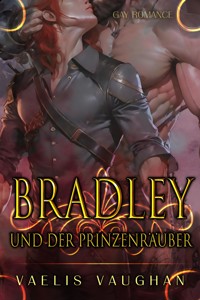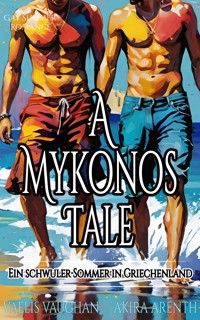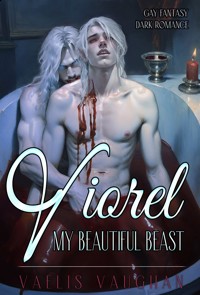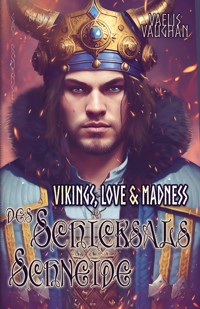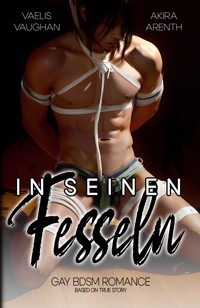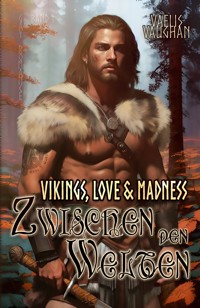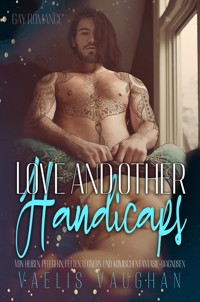2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
"Ein Herzenswunsch zu Weihnachten" Gay Christmas Romance / Schwule Liebesgeschichte Print 208 Seiten inkl. 4 Illustrationen Man sieht es Forstwirt Hudson nicht an, aber trotz seiner beeindruckenden Statur, dem prächtigen Bartwuchs und seinem kernigen Auftreten ist er ein ziemlich schüchterner Kerl. Gerne hätte er einen festen Freund oder wenigstens einen netten Kumpel, mit dem er mal eine gepflegte Runde UNO zocken kann, doch leider ist er in Bezug auf zwischenmenschliche Kontakte ein absoluter Klappspaten. Am letzten Arbeitstag vor Weihnachten wünschen ihm seine Angestellten noch nicht mal ein frohes Fest, sondern verkrümeln sich nach Schichtende, ohne ein Wort zu sagen, was Hudson einen echten Stich versetzt. So fährt er unbewünscht nach Hause, und kaum sitzt er allein in seiner abgelegenen Hütte, lässt er heimlich ein kleines Tränchen über die bärtige Wange kullern. Nur eins! Denn Männer heulen nicht und eins ist keins! Zumindest denkt er das. Er kann ja nicht ahnen, dass er nur wegen diesem winzigen Tröpfchen von einer handgroßen Welle glitzernden Glücks überschwemmt wird, und zwar in Gestalt eines übereifrigen, weihnachtlichen Glücksfees, der ihm um jeden Preis seinen Herzenswunsch erfüllen will. Blöd nur, dass Hudson nichts von Almosen hält, erst recht nicht von magischen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Ein Herzenswunsch
zu Weihnachten
Gay Winter Romance
Klappentext
Man sieht es Forstwirt Hudson nicht an, aber trotz seiner beeindruckenden Statur, dem prächtigen Bartwuchs und seinem kernigen Auftreten ist er ein ziemlich schüchterner Kerl. Gerne hätte er einen festen Freund oder wenigstens einen netten Kumpel, mit dem er mal eine gepflegte Runde UNO zocken kann, doch leider ist er in Bezug auf zwischenmenschliche Kontakte ein absoluter Klappspaten. Am letzten Arbeitstag vor Weihnachten wünschen ihm seine Angestellten noch nicht mal ein frohes Fest, sondern verkrümeln sich nach Schichtende, ohne ein Wort zu sagen, was Hudson einen echten Stich versetzt. So fährt er unbewünscht nach Hause, und kaum sitzt er allein in seiner abgelegenen Hütte, lässt er heimlich ein kleines Tränchen über die bärtige Wange kullern. Nur eins! Denn Männer heulen nicht und eins ist keins! Zumindest denkt er das. Er kann ja nicht ahnen, dass er nur wegen diesem winzigen Tröpfchen von einer handgroßen Welle glitzernden Glücks überschwemmt wird, und zwar in Gestalt eines übereifrigen, weihnachtlichen Glücksfees, der ihm um jeden Preis seinen Herzenswunsch erfüllen will. Blöd nur, dass Hudson nichts von Almosen hält, erst recht nicht von magischen ...
Kapitel 1 - Aus der Träne eines Einsiedlers
Als meine Motorsäge das Wurzelwerk vom Stamm der Tanne trennt, kommt mir ein Gedanke.
›Wie Schneeflocken wirbeln die Holzspäne durch die Luft, der Wald wird erfüllt von Tannenbaumduft.‹
Zum ersten Mal an diesem Tag heben sich meine Mundwinkel gen Ohrschützer. Ich bin nicht besonders gut im Reimeschmieden, aber wenn mir mal einer einfällt, freue ich mich darüber.
Über hundert Jahre stand dieser Baum in unserem Wald, doch Sturm Seymour konnte er nicht mehr trotzen. Die Tanne, die vermutlich sogar mein Großvater gepflanzt hat, wurde entwurzelt. Nun muss sie in die weitere Verwertung, für die ich sie vorbereite.
»Ey voll stabil, Chef!«, ruft unser Azubi beeindruckt, als ich den von den Wurzeln befreiten, mächtigen Stamm zur Seite rolle.
»Na ja, eher das Gegenteil davon«, widerspreche ich und drücke ihm meine große hundertzwanzig Zentimeter lange Marken-Kettensäge in die Hand, die er mit seinen dünnen Ärmchen kaum halten kann. Sein Jugendslang ist gewöhnungsbedürftig und so richtig was mit ihm anfangen kann ich auch noch nicht, trotzdem ist Miles ein netter Junge. Zarte neunzehn Jahre alt, wohnt bei Mutti, vertrödelt seine Freizeit mit Freunden, Kiffen, Zocken und Alkohol. Ein klassischer Fall von gut erzogen, aber beschissen dressiert. »Hier, pack die beiseite und gib mir die Fünfundvierziger zum Entasten.«
»Jupp.« Er tut, was ich sage, und ich lege los, während er zuschaut, so wie immer.
Nach dem Entfernen der ersten Äste und dem Abplatzen von Rindenteilen bestätigt sich leider auch mein anfänglicher Verdacht und ich stelle die Säge wieder ab. »Scheiße«, murmle ich und schaue auf. »Miles, sieh mal hier, das – ey!« Zum gefühlt tausendsten Mal an diesem Tag fummelt der Bengel an seinem Smartphone rum! »Kannst du das Ding mal in der Hose lassen und dich konzentrieren?«
»Höhö ... das hat meine Freundin auch immer gesagt, meinte aber nich` mein Handy«, albert er herum, bleibt jedoch nach wie vor mit dem Blick auf dem Display kleben. »Muss nur noch schnell meine Freundschaftsanfragen durchschauen, Moment.«
Erbost motze ich ihn an: »Ich schick dir auch gleich eine Freundschaftsanfrage ... mit meiner Schuhsohle! Steck das verdammte Ding weg, aber pronto!«
»Jaaaa Chef«, reagiert er endlich, grinst mich mit einem frechen Blick unter seinen kurzen, blonden Locken an, die auch außerhalb des orangefarbenen Plastikhelms herumkringeln, und lässt sein Mobiltelefon in der Gesäßtasche verschwinden. »So, schon weg.«
»Gut! Und lass es da!«, ermahne ich ihn noch einmal mit Nachdruck. Manchmal hab ich das Gefühl, dass unsere Azubis nur deshalb so frech zu mir sind, weil ich mit meinen fünfunddreißig Jahren näher an ihnen dran bin als die meisten unserer Kollegen, die großteils auf die sechzig zugehen. Vielleicht hat er auch bemerkt, dass ich seine provokante Art manchmal ganz niedlich finde ... aber dass ich schwul bin, weiß er sicher nicht! Niemand aus meinem Bekanntenkreis weiß davon und meine Familie auch nicht.
»Los, komm her«, fordere ich schließlich und winke ihn zu mir rüber. »Schau dir den Stamm an und sag mir, warum der nur noch für den Kamin gut ist.«
Miles zieht die Nase hoch und schlurft auf meine Seite, um die Tanne zu begutachten. Die vielen kleinen Löcher im gesamten Stamm sind jetzt nicht mehr zu übersehen.
»Weil er Borkenkäfer hat?«, konstatiert er und schaut mich mit seinen großen braunen Augen fragend an.
»Ganz genau.« Ich klopfe ihm auf die Schulter. »Und warum müssen wir Bäume, die von diesem Käfer betroffen sind, aus dem Wald entfernen?«
Miles überlegt, obwohl es ja im Grunde offensichtlich ist, aber leider ist er nicht die hellste Kerze auf der Torte. »Weil ähm ... weil die sich sonst ausbreiten und das Holz durch die Viecher wertlos wird?«
»Mensch, schon wieder richtig! Da kann ich dir ja heute ein Bienchen ins Muttiheft kleben!« Erneut beklopfe ich ihn und er grinst schief. »In diesem Fall hat uns der Sturm etwas Arbeit abgenommen, aber wir müssen unbedingt auch noch die anderen umgestürzten Bäume checken und alles rausholen, was befallen ist. Sonst haben wir kommenden Frühling eine Invasion!«
Miles nickt und ich nehme erneut die Säge in die Hand. »Ich entaste den hier gleich komplett. Hol du schon mal das Markierspray und schau, ob du weitere Bäume mit Befall findest! Wenn ja, markierst du sie mit einem großen X, okay?!«
»Mach ich, Chefchen.«
Verdutzt sehe ich ihm einen Moment hinterher.
›Hat der gerade ernsthaft Chefchen zu mir gesagt?‹
Was soll`s. Es ist kurz vor Weihnachten, also lass ich es ihm durchgehen, schüttle nur den Kopf und fahre mit meiner Arbeit fort.
Ich heiße übrigens Hudson Bradley und bin Forstwirt in vierter Generation, hier im schönen Quèbec, in Kanada. Nachdem mein Vater, Owen Bradley, vor zwei Jahren einen schweren Schlaganfall erlitt und kurze Zeit später verstarb, machte ich, früher als geplant, meinen Meister und übernahm die Leitung des gesamten Familienbetriebes. Viele der Männer, die bei uns angestellt sind, kennen mich seit dem Kindergarden[Fußnote 1]. Schon als Pimpf begleitete ich meinem Dad in den Wald, wollte immer bei ihm sein und bewunderte seine Arbeit. Er kannte alle Pflanzen- und Tierarten in unserer Region, wusste, wie man sie schützt, und hatte die Stärke eines Bären. Er war mein Held und ich wollte stets so werden wie er.
Ich strecke mich einen Moment und schalte die Säge aus, um mir den Schweiß abzuwischen, der mir trotz der Kälte von der Stirn rinnt. Dabei höre ich seltsam blecherne Geräusche, schaue mich um und entdecke Miles, der ja die Bäume markieren sollte. Der Knallkopp versucht tatsächlich, sich zwischen zwei Fichten zu verstecken, was mit seiner leuchtend orangefarbenen Schutzkleidung ein ziemlich fruchtloses Unterfangen ist. Und als ich erkenne, was er da treibt, würde ich ihm am liebsten einen Kiefernzapfen an die plastikbehelmte Birne werfen!
»Miles!!!«, brülle ich wütend zu ihm rüber. »Was machst du da schon wieder mit deinem verdammten Handy?«
»Nur `n bisschen im Egoshooter looten«, flachst er und singt fast schon amüsiert: »Messer rein, Gedärme raus ...«
»Alter!« Ich platze gleich! »Pack es weg und mach deine verdammte Arbeit oder ich schmeiß dich raus!«
Miles glotzt mich an wie ein verschrecktes Reh. »Sie würden mich echt einen Tag vor Weihnachten feuern?«
Ich brülle zurück: »Ja, würde und werde ich, wenn ich dich auch nur noch einmal mit diesem dämlichen Scheißteil erwische!«
»Okay, okay, ich pack es weg, Mister Scrooge.«
Hab ich erwähnt, dass ich den Bengel manchmal erwürgen möchte? Aber zumindest steckt er sein Handy jetzt in die innen liegende Reißverschlusstasche seiner Arbeitsjacke, also scheint er es nicht gleich wieder rausholen zu wollen.
Auch ich nehme abermals grummelnd meine Arbeit auf und frage mich, ob er diesen Mangel an Respekt vielleicht von den anderen Angestellten übernommen hat. Einige der Kollegen haben mich ausgebildet, was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, warum ich von ihnen jetzt, trotz meiner Größe und meinem selbstsicheren Auftreten, nicht wirklich ernst genommen werde. Für sie bin ich noch immer der kleine Hudsi, der mit Latzhose und Rotzfahne auf die Bäume geklettert ist, und das kriegen sicher auch die Azubis mit, die glauben, sich mir gegenüber dann ebenfalls alles rausnehmen zu dürfen.
Egal. Ich muss mich ranhalten, wenn ich heute noch was reißen will. Also los!
***
Es dauert eine Weile, bis ich die gesamte Tanne entastet habe und damit beginnen kann, sie auf meterlange Stücke zu schneiden. Dabei ärgere ich mich über jedes einzelne Käferloch, das ich freilege. Jahrelang hatten wir schon mit Rotfäule zu kämpfen. Wenn die einen Stamm befallen hat, ist er auch vor der üblichen Umtriebszeit[Fußnote 2] reif für die Säge. Andernfalls breitet sich der Pilz über die Wurzeln aus und macht immer größere Teile des Holzes wertlos, genau wie die Borkenkäfer.
Besonders fachkundige Forstwirte, wie mein Vater einer war, erkennen diese weit verbreitete Erkrankung bereits an einer Auswölbung im bodennahen Bereich eines Stammes, aber dafür muss man wirklich viel Erfahrung und ein geschultes Auge haben. Nach seinem Schlaganfall konnte mein Dad einen Baum nicht mal mehr von einem Laternenmast unterscheiden.
Es geschah hier im Wald, mitten bei der Arbeit, während ich, weiter unten im Forst, mit einem damaligen Azubi über Hockeyspieler diskutierte. Zwei Stunden später fand ich ihn und rief sofort den Notarzt. Doch selbst nach vier Monaten im Krankenhaus, einer Operation und vollgepumpt mit Medikamenten war er immer noch unfähig, alleine zu laufen, zu essen, selbstständig aufs Klo zu gehen oder auch nur einen einfachen, zusammenhängenden Satz zu sprechen. Schließlich verstarb er. Einfach so. Die Ärzte sagten, er hätte aufgegeben.
Mir kommen bis heute die Tränen, wenn ich daran denke, und ja, ich fühle mich schuldig. Wäre ich bei ihm geblieben und hätte sofort reagiert, als er umkippte, hätte seine Hirnblutung vielleicht weniger verheerenden Schaden angerichtet. Mit dieser Schuld werde ich nun bis zu meinem Lebensende klarkommen müssen.
Gerade jetzt, zu dieser kalten Jahreszeit, war mein Vater am liebsten im Wald. Man mag es kaum glauben, aber die Herbst- und Wintermonate sind für einen Forstwirt die arbeitsintensivste Zeit, denn zu unserem Beruf gehört nicht nur die Entfernung absterbender und umgefallener Bäume, sondern auch die Verkehrssicherung entlang der Wege. Wenn es schneit, gibt es ganz besonders häufig Probleme, für deren Beseitigung wir zuständig sind.
Manchmal sind mein Dad und ich mitten in der Nacht gerufen worden. Völlig verpennt kutschten wir dann, jeder einen großen Thermobecher mit starkem Kaffee in der Hand, gemeinsam durch die Gegend, den Anhänger beladen mit einem Bagger samt Greifer. Wir redeten zwar nie viel miteinander, aber trotzdem schweißten uns diese Einsätze als Vater und Sohn zusammen. Wir waren ein eingespieltes Team, jeder Handgriff saß und wir konnten uns immer aufeinander verlassen. Zumindest bis zu diesem einen, verhängnisvollen Tag.
Plötzlich klopft mir jemand auf meine Schulter. Erschrocken zucke ich zusammen und schalte die Säge aus.
»Mann, Miles! Wie oft hab ich dir schon gesagt, dass man sich einem Arbeiter, der mit laufender Motorsäge hantiert, niemals von hinten nähern darf!? Ich hätte dich zweiteilen können, wäre ich abgerutscht!«
»Sie rutschen doch nie ab, Chef«, sagt er vertrauensselig und grinst mich so rammdösig an, dass ich mich unweigerlich frage, ob er wieder heimlich gekifft hat. Nicht mal mehr seinen Helm hat er auf, aber die Erklärung dafür liefert er mir, bevor ich fragen muss. »Wollt nur wissen, ob ich jetzt auch Feierabend machen kann? Die anderen sind schon weg, aber die meinten, ich soll mich bei Ihnen abmelden.«
»Wie, die sind schon weg?« Fassungslos schaue ich durch die Bäume und tatsächlich ist keiner unserer Angestellten mehr zu sehen.
»Ist halb vier, Chef. Die Sonne geht gleich unter.« Miles schiebt die Unterlippe vor und schwenkt mit dem Kopf, weshalb die Bommel seiner Mütze von der einen zur anderen Seite fällt. »Die haben gerufen, aber na ja, Sie haben`s wohl nicht gehört und Sie wissen ja, wie das mit der Annäherungsregel ist, wenn ein Arbeiter eine Motorsäge in der Hand hat.« Er grinst schon wieder, als müsse ich jetzt stolz darauf sein, dass er sich eine Minute lang gemerkt hat, was ich ihm seit zwei Monaten einzubläuen versuche.
»Sich gut sichtbar von vorne zu nähern, wäre aber auch eine Option«, erinnere ich ihn, ziehe den linken Arbeitshandschuh aus und schaue auf meine Uhr. »Na schön.« Seufzend nicke ich. »Dann fahr eben heim. Wir sehen uns nach den Feiertagen.«
»Jo, bis denn. Wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest!«
»Danke. Dir auch.«
Er nickt mir zu, dreht sich um und verschwindet.
Einen Moment schaue ich ihm noch hinterher, beobachte, wie er beschwingt den Hügel hinunterläuft, um unten, auf dem breiten Waldweg, in seine kaputte, alte Schlurre einzusteigen. Knatternd fährt er davon und nur wenige Sekunden später ist es gespenstisch still im Wald.
›Unglaublich.‹
Ich kann immer noch nicht fassen, dass mir keiner der anderen auf Wiedersehen gesagt, geschweige denn schöne Feiertage gewünscht hat!
›Einfach so wortlos abzuhauen, hätten die sich bei meinem Vater niemals getraut, das steht mal fest! ‹
Und das, nachdem ich allen bereits morgen freigegeben habe! Einen Moment überlege ich noch, ob ich allein weitermache, aber das wäre gegen die Vorschriften und außerdem wird es tatsächlich langsam dunkel. Zudem haben die anderen auch den Rückeschlepper mitgenommen, also bleibt mir gar keine Wahl, als die vorbereiteten Stücke liegen zu lassen.
»Die haben mir doch absichtlich nicht Bescheid gesagt«, grummle ich vor mich hin und räume wütend mein Zeug zusammen. Klar, vermutlich wollten sie alle überpünktlich Feierabend machen und haben gesehen, dass ich noch die Tanne wegbringen will. Und damit sie nicht in die Verlegenheit kommen, zehn Minuten länger zu arbeiten, haben sie sich alle klammheimlich aus dem Staub gemacht.
Als ich meinen Rucksack nehme, beginnt es auch noch zu schneien, weshalb ich den Kopf in den Nacken lege und einen leisen Fluch gen Himmel schicke.
»Ernsthaft? Ausgerechnet jetzt?«
Weiße Weihnachten. Für viele ein Wunsch, für mich ein Albtraum. Nicht nur wegen der zu erwartenden nächtlichen Einsätze, sondern auch, weil ich über endlos lange und schmale Waldwege nach Hause fahren muss, die nie beräumt werden.
Frustriert bringe ich all meine Sachen hinunter zu meinem Land Rover Defender, den ich liebevoll Bürsti nenne, weil ich mit seiner Hilfe regelmäßig den Forst durchbürste. Sobald ich alles verstaut habe, lehne ich mich noch einmal an seine Tür und schaue in unseren immer dunkler werdenden Wald hinein, der mit jeder weiteren weißen Flocke, die auf ihm liegenbleibt, märchenhafter aussieht. Die Abendröte schimmert durch die Äste, lässt den Schnee glitzern, der so langsam eine geschlossene Decke bildet, und ich spüre, wie sich mein Groll legt.
Nein, eigentlich kann ich mich nicht beschweren.
Ich liebe den Wald und auch meine Arbeit, selbst wenn diese sehr gefährlich sein kann. Außerdem bin ich gerne im Freien, aber sobald ich irgendwem erzähle, was ich beruflich mache, werde ich eher belächelt. Die meisten Menschen haben eine völlig falsche Vorstellung von dem, was wir tun. Ob ich ein richtigerFörster bin, ist oft die erste Frage, die ich zu hören kriege. Meist will mein Gegenüber anschließend wissen, wie viele Jagdhunde ich habe und ob ich denn auch in einem hübschen grünen Gehröckchen samt Hut und Flinte herumlaufe.
Meine Reaktion auf diese dämlichen Fragen ist stets dieselbe: »Nein! Null! Nein! Aber ich hab `ne fette Kettensägensammlung, auf die selbst Leatherface[Fußnote 3] neidisch wäre!«
Leider führen derartige Antworten meist dazu, dass ich alleine nach Hause gehe.
Im 17. Jahrhundert hießen wir noch Heidereiter, was ich besonders elegant finde, aber den Ausdruck kennt heute keine Sau mehr. Vermutlich würden die meisten Typen in einer Gay-Bar auch eher an irgendwas Sexuelles denken, wenn ich von Reiten spreche. Was soll`s. Jetzt gerade bin ich ein schwuler Forstwirt, dem mitten im Wald der Arsch abfriert, also schwinge ich mich in meine Karre und starte den Motor.
***
Es dauert nicht lange, bis ich mein kleines Heim erreiche, die ehemalige Forsthütte meines Vaters, die er zeitweise bewohnte, um sich die tägliche Fahrerei zu sparen. Meine Mutter lebt noch immer in unserem Haupthaus, dem Forsthof, zusammen mit ihrem neuen Partner sowie meiner älteren Schwester Abigail samt ihrem Ehegatten Nathan und ihrer gemeinsamen Tochter Isla. Meine Schwester und meine Mutter arbeiten beide in der Verwaltung unseres Familienbetriebes, daher telefonieren wir viel, sehen uns aber selten.
Ich parke mein Fahrzeug an der Seite der Hütte unter dem Carport. Kaum sind die Reifen zum Stehen gekommen, höre ich auch schon das aufgeregte Maunzen meines norwegischen Waldkaters Mister Hamilton, der trotz eines fehlenden Hinterbeines wie ein Irrer durch den Schnee geprescht kommt. Als ich die Fahrertür öffne, springt er mir auf den Schoß, stellt seine kalten, nassen Pfoten auf meine Brust und quäkt mich voll.
»Meeeow! Meow, meow, meow, meeeow!«
»Ja, ich weiß, dass es schneit«, antworte ich amüsiert und kraule ihn, um ihn zu beruhigen. Er liebt Schnee und dreht jedes Mal völlig durch, sobald die ersten Flocken fallen. »Komm, ich geb dir jetzt erst mal Hapsipapsi.«
»Meow!?«
»Ja, mit Fisch.«
Ich weiß, dass es albern ist, aber ich tue gerne so, als würde ich ihn verstehen. Außerdem ist er ein äußerst mitteilsames Katzentier, weshalb ich das Gefühl habe, dass es ihm Spaß macht, wenn ich mich mit ihm unterhalte.
Zuerst schalte ich das Stromaggregat ein, sperre anschließend die Tür auf und lasse Mister Hamilton schon mal in die Hütte, obwohl der genauso gut durch seine Katzenklappe hätte gehen können. Der nur noch geringfügige Temperaturunterschied zwischen den Innenräumen und draußen erinnert mich daran, dass ich dringend Brennholz für den Kamin benötige.
»Ach Mann! Ich muss erst mal Holz machen. Bin gleich da, Hami.« Schon irgendwie peinlich, dass ich es trotz meines Berufes nicht geschafft habe, genug Holzscheite für den privaten Gebrauch vorzubereiten. Na ja, zumindest hab ich noch einige ausrangierte Baumabschnitte und Übungsbretter der Azubis vom letzten Jahr unter dem Carport liegen, die ich schnell zerkleinern kann. Ich verlasse also wieder die Hütte, schnappe mir ein paar davon sowie eine der Kettensägen und bringe alles zu meinem kniehohen Hackklotz, in den ich eine Kerbe gesägt habe, damit mir die Stücke nicht wegrollen. Dort stelle ich noch einen Korb als Sammelbehälter daneben und lege los.
›Morgen um diese Zeit sitze ich wahrscheinlich schon mit den anderen zusammen und muss das familiäre Weihnachtsessen über mich ergehen lassen‹, wird mir bei meiner Arbeit bewusst und ich spüre, wie sich bei dem Gedanken mein Hals verengt.
Gewöhnlich feiert man Weihnachten bei uns erst am 25. Dezember, dem Christmas Day, der auch als offizieller Feiertag gilt. Es ist einer der wenigen Tage im Jahr, an dem fast alle Geschäfte geschlossen sind. Die Geschenke liegen am Morgen unter dem Weihnachtsbaum, die Kinder sind den ganzen Tag über beschäftigt und die Erwachsenen können sich in Ruhe um das Essen kümmern. Am Nachmittag gibt es dann auch das traditionelle Festmahl: Truthahn mit Kartoffelbrei und Preiselbeersoße. Dazu wird der Rest der Familie eingeladen.
Meine Mutter besteht jedoch seit dem Tod meines Vaters darauf, dass ich bereits am Vorabend zu ihnen komme und dort übernachte, damit wir alle zusammen die Bescherung machen können. Ihr dämlicher Freund ist auch dabei, genauso wie meine Schwester Abigail, Nathan und Isla. Sie alle feiern Weihnachten, als wäre nichts passiert, tun einfach so, als seien wir eine große, glückliche Familie. Aber das sind wir nicht. Nicht mehr.
Mit dem Freund meiner Mum verstehe ich mich überhaupt nicht und kann auch absolut nicht nachvollziehen, was sie an ihm findet. Er ist das komplette Gegenteil meines Vaters ... und mir, denn ich bin ja inzwischen praktisch sein Abbild, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass ich eben nicht auf Frauen stehe. Doch davon abgesehen wurden wir uns besonders in den letzten Jahren immer ähnlicher: ruhige, große, kräftige Kerle mit Bart und einem Hang fürs Grobe.
Wilson Marsh hingegen, Mums Neuer, ist ein Waschlappen, wie er im Buche steht. Allein der Name sagt doch wohl alles! Darüber hinaus wiegt der Typ kaum mehr als meine Mutter und die geht mir gerade mal bis zu den Nippeln! Wenn ich dem eine Kettensäge in die Hand drücke, fängt er wahrscheinlich an zu heulen und bricht zusammen. Er ist Steuerberater von Beruf, unserSteuerberater, wohlbemerkt, und das seit fünfzehn Jahren, was den makaberen Verdacht nahelegt, dass er meiner Mum bereits Avancen gemacht hat, als mein Vater noch lebte. Keine vier Monate nach Dads Tod stand er jedenfalls bei ihr auf der Matte, als hätte er nur darauf gewartet, dass der Platz an ihrer Seite frei wird. Ich mag durchaus voreingenommen sein, aber ich hasse ihn dennoch und wünsche ihm eine stets leere Papierrolle auf dem Klo seiner Kanzlei!
Abigails Göttergatte ist halbwegs okay: bodenständig, leicht untersetzt und familiär, genau wie sie. Er ist ein eher schweigsamer Typ, arbeitet bei der Bahn, schlurft von einem Abteil ins andere und kontrolliert Fahrkarten, aber zumindest hat er mit Kraftsport angefangen, seit ihn meine Schwester beim Armdrücken besiegt hat.
›Ich sollte einfach nicht hingehen‹, kommt mir in den Sinn. ›Was soll ich auch da? An den Gesprächen beteilige ich mich eh nicht mehr. Und außerdem, wenn ich erst mal zwei, drei Gläser Eggnog[Fußnote 4] intus habe, muss ich die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht auf Innentaschenbügler Wilson losgehe und ihm seinen hochkarätigen Feinrippschlüpper über die Birne ziehe.‹
Ich bin ihm einmal auf dem großen Forstklo begegnet, in dem es noch Pissoirs gibt, seitdem weiß ich leider, dass er die Dinger trägt.
›Oder ich saufe bis zur Besinnungslosigkeit, damit ich von all dem heiligen Brimborium nichts mehr mitkriege!‹
Wenn ich noch dazu den Weihnachtsbaum bereiere, bin ich meiner Mum vielleicht so peinlich, dass sie mich nächstes Jahr gar nicht erst einlädt. Dann brauche ich auch keine Sorge mehr wegen der ganzen blöden Fragen zu haben, wann ich denn endlich mal jemanden mitbringe und ob ich nicht inzwischen ein liebes Mädel kennengelernt hätte. Abigail hat mich sogar schon gefragt, ob ich asexuell bin. Nachdem ich dies verneinte und vorschob, einfach nur keine Zeit zum Ausgehen zu haben, folgte eine Flut an nett gemeinten Tipps: Wie man sich ein Online-Dating-Profil anlegt, welches die besten Plattformen sind und wie man darüber schnell jemanden kennenlernen kann. Als ich ihr sagte, dass ich für eine Freundin gerade weder Nerven noch Zeit habe, sah sie mich an, als wär ich ein Alien, und meine Mutter bemitleidet mich ständig, weil ich alleine lebe, das nervt mindestens genauso.
Früher war sie stolz auf mich. Genau wie Dad. Ich war immer sein Vorzeigesohn, der in seine Fußstapfen tritt. Ein Baum wie er, ausdauernd und stark ... Heute bin ich nur noch der grummelige Sonderling der Familie, mit dem keiner mehr etwas anfangen kann, und das, obwohl sie nicht mal wissen, dass ich auf Kerle stehe.
»Meeeeeow!« Hamilton schiebt den Kopf durch die Katzenklappe und motzt mich an, also reiße ich mich aus meinen Gedanken.
»Ja, ich komme doch schon!« Ich packe die Säge wieder ins Auto und nehme den vollen Holzkorb. Mit dem Ellenbogen öffne ich die Tür, schalte das Licht an und wuchte den schweren Weidenkorb ins Haus.