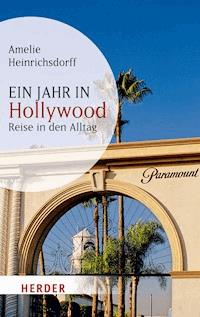
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
Im Traum und im Kino bin ich schon oft in Hollywood gewesen: mit George Clooney im offenen Wagen den Sunset Boulevard entlanggefahren, mit Julia Roberts und einem Cafe Latte in der Hand lässig auf Palmen-umsäumten Avenues spaziert, an Malibus Stränden mit einem David-Hasselhoff-Doppelgänger in die Fluten gesprungen, um schließlich Hand in Hand mit Brad Pitt den Sonnenuntergang vom Mulholland Drive aus zu bewundern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amelie Heinrichsdorff
Ein Jahr in Hollywood
Reise in den Alltag
Impressum
Originalausgabe
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2010
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80260-7
ISBN (Buch): 978-3-451-06193-6
Inhalt
August California Here I Come
September Down on Sunset Boulevard
October There Are No Coincidences
November America’s Finest City
December Seasons in the Sun
January It Never Rains in Southern California
February Hollywood, Land of Dreams
March The Best Things in Life Are Free
April Reality Check
May Ain’t No Mountain High Enough
June Behind the Scenes
July Keep on Dreamin’
Nachwort und Dank
August California Here I Come
Im Traum und im Kino bin ich schon oft in Hollywood gewesen: mit George Clooney im offenen Wagen den Sunset Boulevard entlanggefahren, mit Julia Roberts und einem Caffè Latte in der Hand lässig auf palmenumsäumten Avenuen spaziert, an Malibus Stränden mit einem David-Hasselhoff-Doppelgänger in die Fluten gesprungen, um schließlich Hand in Hand mit Brad Pitt den Sonnenuntergang vom Mulholland Drive aus zu bewundern. Das ganze Jahr über bin ich braun gebrannt, im Kleiderschrank hängen nur Sommerkleider, den Rest kaufe ich am Rodeo Drive. Tagsüber liege ich am Pool, türkis und cool wie auf den Bildern von Edward Hopper, und abends bin ich verabredet mit einem Filmproduzenten, der natürlich gerade mich schon immer gesucht hat für seine nächste Hauptrolle. Denn ich sei schließlich etwas ganz Besonderes, wird er mir versichern. So dachte ich mir das zu Schulzeiten.
Inzwischen – als aufgeklärt-kritische Kulturwissenschaftlerin – hatte ich mich zwar von den Jungmädchenträumen weitgehend distanziert, der Glanz von Hollywood behielt jedoch seine Anziehungskraft für mich: Die Verheißung dieses Stadtteils von Los Angeles, der Mythos der Filmwelt vom Schwarz-Weiß-Streifen bis zum modernen Märchen à la „Pretty Woman“, die Bilder in den bunten Gazetten von Promis, Partys und Palmen lockten mich noch immer.
Ich wollte dorthin, wollte mit eigenen Augen sehen, wie es hinter den Filmkulissen aussah. Darum hatte ich mich auch für das Forschungsstipendium an der Universität in Los Angeles beworben, um mit Anfang dreißig endlich wirklich nach Hollywood zu kommen. Dass es geklappt hat, war in der Tat etwas ganz Besonderes, und ein Jahr lang würde ich nun dort arbeiten, leben und vielleicht sogar entdeckt werden, wofür auch immer. Auf alle Fälle wollte ich einmal dem nasskalten deutschen Herbstwetter entgehen und den manchmal sehr strengen Wintern.
„Früher waren solche Abschiede für immer“, meinte Onkel Heiner am Berliner Flughafen, als ich mit zwei großen Reisekoffern nach LAX (Los Angeles International Airport) via Frankfurt eincheckte.
Stimmt. Da fuhr man auch noch mit dem Schiff über den Großen Teich und wanderte aus, rettete sich jenseits des Atlantiks in die Freiheit oder in Sicherheit. Ich hingegen wollte schon im Dezember einmal wiederkommen, um zu Hause weiße, deutsche Weihnachten zu feiern. Darauf wieder zurück in die Sonne, um meine Recherchen über die deutschen Exilanten in Hollywood weiterzuverfolgen. Ausgestattet mit einem bescheidenen Forschungsstipendium für ein Jahr an der Universität von Kalifornien in Los Angeles, wollte ich sehen, was und vor allem wer noch übrig war von den deutschen Exil-Autoren um Brecht, Mann und Feuchtwanger, die auf der Flucht vor den Nationalsozialisten über Umwege zuletzt in Hollywood ankamen.
„Grüße Tante Gerda von uns, auch von Omi!“, rief meine Mutter mir noch hinterher. Dann verschwanden meine Lieben aus meinem Blickwinkel, und ich ging durch den Sicherheitscheck. Das könnten zwölf phantastische Monate werden, hoffte ich, eine einmalige Chance. Das leicht mulmige Gefühl wegen des langen Fluges und die Ungewissheit, wie mein Leben in Kalifornien sein würde, verdrängte ich erst einmal. Noch war ich ja in Deutschland. Wir landeten in Frankfurt am Main und hatten dort vier Stunden Aufenthalt. Hier wollte ich einen Bekannten treffen, der nach zwei Jahren in New York inzwischen bei einer großen Bank arbeitete. Er hatte als Schüler ein Austauschjahr in Südkalifornien absolviert und wollte mir noch ein paar wichtige Tipps mitgeben. Hansi erwartete mich in der Lobby eines Flughafenhotels. Wir bestellten uns gleich etwas zu essen und quatschten munter drauflos.
Sein erster Tipp: Auf dem Weg in die USA sollte man seine Uhr auf die lokale Zeit umstellen, um sich so bereits an die neue Zeitzone zu gewöhnen.
„Also jetzt!“, ermahnte er mich. „Und gar nicht erst groß umrechnen, wie spät es denn jetzt wohl in Deutschland ist. Das hat mir immer geholfen, ich hatte fast nie Probleme mit der Zeitumstellung.“
Das klang vernünftig, sofort stellte ich meine Armbanduhr neun Stunden zurück auf US-Westküstenzeit.
„Und im Flieger am besten keinen Alkohol trinken, aber viel Wasser. Und versuch dir aus der Business Class eine Schlafmaske und Ohrenstöpsel zu organisieren, damit du ein wenig relaxen kannst.“
Auch das merkte ich mir, Hansi war schließlich Investmentbanker und viel auf Reisen. Wir redeten dann noch stundenlang über alles Mögliche, was man in Kalifornien so tun kann, so dass ich mich nun richtig freute und ungeduldig auf meine Uhr blickte. Und noch zweimal hinguckte, rechnete und einen Riesenschreck bekam.
„Wie spät ist es jetzt – nicht in LA, in Frankfurt?!“
„Hm, lass mal schnell sehen. Kurz nach halb vier“, antwortete er.
„O nein, mein Flug sollte um drei losgehen, das gibt es doch nicht!!!“
Hansi zuckte verlegen mit den Schultern.
„Danke für den Tipp mit der Zeitumstellung, hat ja super geklappt!“
„Sorry“, murmelte er.
Ich sammelte panikartig mein Handgepäck zusammen und rannte los, wieder rüber zum Flughafen, hastete durch die langen Gänge, rempelte rücksichtslos die anderen Passagiere an, kam außer Atem zur Passkontrolle, zeigte mein Ticket und meinen Reisepass vor. Und erreichte als Letzte das Gate – über die Lautsprecher wurde schon mein Name ausgerufen. Auf Hansi war ich noch sauer, als ich mich mit Schweiß auf der Stirn und einem tiefen Seufzer in meinen Flugzeugsitz sinken ließ.
Nachdem ich reichlich Wasser getrunken und mich etwas entspannt hatte, dachte ich an die vielen erfolgreichen Deutschen lange vor mir in Hollywood: Billy Wilder (na gut, der war eigentlich Österreicher), Fritz Lang und natürlich Marlene Dietrich. Dass es Bertolt Brecht dort nie gefallen hat, war mir egal. Ich würde jede Minute genießen.
Endlich war es so weit, wir befanden uns im Sinkflug. Und plötzlich hatte ich Angst vor der eigenen Courage, schließlich könnte ich auch hoffnungslos scheitern wie Alfred Döblin und Heinrich Mann. Oder wie die Handvoll lebender deutscher Schauspieler, die auch dem Ruf Hollywoods gefolgt waren und dann reumütig wieder zum deutschen, weichgezeichneten TV-Movie zurückgekehrt sind, Hollywood im Nachhinein verfluchend. Den anderen Österreicher, den sie hier nur Arnie nennen, ausgenommen. Wobei ich ja dort als Kulturwissenschaftlerin arbeiten wollte und der Film nur Forschungsgegenstand war. Beruhigender Gedanke.
Besagte Tante Gerda würde mich in Los Angeles vom Flughafen abholen. Sie war meine erste Anlaufstation in der südkalifornischen Metropole. Rund 18 Millionen Menschen leben im Großraum Los Angeles, der dreimal so groß ist wie meine Heimat, das Ruhrgebiet. Bei ihr konnte ich erst einmal bleiben, bis ich mir eine eigene Wohnung gesucht hatte. Sie war eine Freundin meiner Großmutter, eine Nenntante, die in den Vierzigern mit dem UFA-Filmballett via Kanada in die USA ausgewandert war.
Jetzt lebte sie als einziges ehemaliges „Scala-Girl“ in Los Angeles und arbeitete hin und wieder als Ballettlehrerin, um ihre knappe Rente aufzubessern. Seit sie in Amerika wohnte, nannte sie sich „Monica“. „Goerda“ fand sie auf Englisch zu hässlich. Sie wollte sich wohl in Amerika neu erfinden. Dabei kam sie uns gern in der alten Heimat besuchen; sie hatte meiner Großmutter auch geholfen, als mein Großvater sehr krank war. Und ihr starker deutscher Akzent im Englischen passte viel mehr zu „Goerda“ als zu Monica, auch nach über fünfzig Jahren in Kalifornien. Das sagte ich ihr aber lieber nicht. Für mich jedenfalls blieb sie Tante Gerda, was sie mir nachsah.
Nach zwölf unbequemen Flugstunden blickte ich von meinem Fensterplatz aus ängstlich-gespannt auf mein neues Zuhause hinunter, die unendlichen graugelben Häuserreihen, bis zum Horizont. „Downtown LA“ sah von oben aus wie eine Handvoll Zahnstocher in einem riesigen Betonmeer. Wie sollte man sich da jemals zurechtfinden? Auch das berühmte Freeway-System von Los Angeles1 war kaum zu erkennen – die zwölf- bis sechzehnspurigen Autobahnen waren lediglich scharfe Einschnitte in der endlosen, flachen Häuserlandschaft, von Grünflächen keine Spur. Dann flog der Pilot eine Schleife, und wir waren plötzlich an der Küste. Der Pazifik flimmerte dunkelblau, der Strand lag lang und leer da, bis auf ein paar Industrieanlagen. Der Himmel strahlte blassblau, und ein bräunlicher, dünner Film zog über das Meer – der Smog. Wie ich bald erfuhr, war er früher viel dichter. Und da stand sie hinter dem Geländer, Tante Gerda, unter den hundert anderen Abholern am Flughafen, als ich übermüdet endlich ans Tageslicht gelangte. Etwas nervös hatte mich die gestrenge Passkontrolle durch José Ramirez hinterlassen, der selbst gerade erst in den USA angekommen zu sein schien.
Sie strahlte mich an, hatte eine riesige Sonnenbrille und einen großen, altmodischen Sonnenhut auf, dazu trug sie Turnschuhe und ein schickes pinkfarbenes Shirt, passend zum Lippenstift. Die grauen Löckchen lugten keck unter dem Hut hervor. Sie drückte mich kurz.
„Hallo Schätzchen“, sagte sie und drängte sofort zum Ausgang. „Das Parken hier am Flughafen ist so teuer, und wir müssen uns beeilen, auf den Freeway zu kommen, bevor die Rushhour so richtig losgeht.“
Nach dem gleißenden Sonnenlicht und der staubig-trockenen Hitze draußen war das Parkhaus eine Erholung für die Augen und angenehm kühl. Es dauerte eine Weile, dann fand Tante Gerda ihr Auto wieder, ein etwas heruntergekommener Pontiac aus den späten Sechzigerjahren, der vorne noch eine durchgehende Sitzbank hatte und ein seltsam stumpfes Blau außen. Das Nummernschild war so alt wie das Auto, schwarz mit gelben Lettern, die nachfolgenden Modelle waren blau, und die neuen „California licence plates“ sind alle weiß, gerne auch mit Zeichnungen von Sonne, Palmen und Strand. Für die personalisierten Nummernschilder, die Namen wie „Big Boss“ oder „Moviestar“ anzeigen, muss man mehr bezahlen. Sie heißen „Vanity Plates“, zeugen sie doch von der Eitelkeit oder auch dem Wunschdenken der Autobesitzer. Tante Gerda und ihr Pontiac gehörten deutlich zu den uneitlen, alteingesessenen Angelenos, wie die Bewohner von Los Angeles sich nennen.
„Den Wagen habe ich neu streichen lassen“, erklärte Tante Gerda stolz das merkwürdige Blau.
„Nimm dir ein paar von den roten Weintrauben, das sind kalifornische.“ Sie hielt mir ein Tupperschälchen hin.
Dann manövrierte sie den großen Wagen etwas ruckartig auf die Flughafenstraße, und ich sah die ersten Palmen und die grünen Autobahnschilder: „405 North – San Diego Freeway“, von dort danach auf den „10 East – Santa Monica Freeway“. „I made it“, ich war tatsächlich in Kalifornien.
Aber die knappe Stunde Fahrt, in der ich versuchte, das erträumte Los Angeles zu finden, war eher ernüchternd: nichts als Autobahnen – und was für welche. Nicht nur waren sie endlos breit, auch stapelten sie sich an Knotenpunkten zu einem scheinbar wilden, furchterregenden Betongebilde über-, unter- und nebeneinander. Entlang den Autobahnen sah ich eigentlich nur schäbige Hallen und Gebäude mit verblassten Neonreklamen.
Tante Gerda lenkte den großen Wagen bedächtig vom Freeway herunter. Wir kamen an einer Kreuzung zu stehen. Ein paar seltsame Gestalten in bunten Hemden lungerten dort herum, mit einem Handwagen standen sie am Straßenrand. Ich wunderte mich ein wenig, sah dann, dass sie Tante Gerda kurz zunickten, sich an ihrem Handwagen zu schaffen machten, und dann bewegte sich der eine mit einem großen Sack über der Schulter auf unser Auto zu. Ich rutschte instinktiv die Sitzbank entlang, bis fast auf Tante Gerdas Schoß. Die hingegen kurbelte die Fensterscheibe herunter, wedelte mit drei Ein-Dollar-Scheinen, woraufhin der große Sack durch das offene Fenster sanft auf die Rückbank verfrachtet wurde. Das Geld behielt der junge Mann – Tante Gerda rief ihm gut gelaunt „Gracias“ hinterher, dann wurde die Ampel grün und wir fuhren gemütlich weiter.
Das Ganze passierte ziemlich schnell innerhalb einer Ampelphase. Ich drehte mich um und erkannte, dass der große Sack mit köstlich duftenden, noch sonnenwarmen Orangen gefüllt war – drehte mich zurück zu Tante Gerda, die schmunzelnd sagte: „Für meinen und deinen frisch gepressten Orangensaft morgens! Die Jungs kenne ich schon lange, die sind sehr nett, und das ist doch praktisch: So muss ich den schweren Sack nicht selbst ins Auto laden und kann die Früchte dann immer wieder einzeln hochtragen. Die Orangen kommen aus Mexiko und liegen mit drei Dollar für knappe zwanzig Kilo deutlich unter dem Großhandelspreis.“
Wir fuhren nach Hollywood, dem wohl berühmtesten Stadtteil von Los Angeles, genauer gesagt zum Los Feliz Boulevard. Dort wohnte Tante Gerda in einem kleinen Zwei-Zimmer-Apartment. Im spanisch anmutenden Innenhof des Apartment-Komplexes plätscherte ein Springbrunnen, und die Bougainvillea-Pflanzen rankten sich dunkelrosa an der Hauswand empor. Ein wenig wie in der Fernsehserie „Melrose Place“, die mein pubertäres Bild vom Leben in Hollywood geprägt hat, nur ohne Pool. Ich war wieder zufrieden, so hatte ich es mir vorgestellt.
Am nächsten Morgen war ich trotz aller Vorkehrungen wegen des Jetlags schon früh wach und zog mir gleich die Joggingschuhe an, Leggins und ein warmes Sweatshirt über das ärmellose Top. Auch bei strahlendem Wetter kann es frühmorgens noch sehr kühl in der Stadt sein – Wüstenklima, wie mir erklärt wurde: morgens sehr kalt, tagsüber sehr heiß, abends wieder empfindlich kalt. Im Sommer ist das weniger extrem, aber noch spürbar; und je weiter man sich der Wüste nähert, sprich: nach Osten fährt, Richtung Palm Springs, desto mehr erlebt man das Wüstenklima.
Am Strand von LA kommt noch die Meeresbrise hinzu und die so genannte „marine layer“, die Schicht feuchtkalter Luft vom Pazifik. Die legt sich jeweils zur Dämmerung wie ein Schleier über die Stadt und sorgt dafür, dass die küstennahen Stadtteile wie Santa Monica, Venice Beach und daran angrenzend Westwood, Brentwood und Bel Air wie auch die höher gelegenen Ortschaften Malibu und Pacific Palisades eigentlich nie zu heiß sind.
Ich fühlte mich sehr sportlich und irgendwie sehr „LA“ in meinem neuen Jogging-Outfit, denn bekanntermaßen gaben die Menschen in Hollywood viel auf ihr Äußeres und taten auch einiges dafür. So wollte ich also den Pfad hoch zum Griffith-Observatorium im nahe gelegenen gleichnamigen Park erklimmen, als kleinen Morgenspaziergang, um meine neue Umgebung zu erkunden.
Parks, so wie man sie in Europa kennt, kann man in LA nicht erwarten. Da hatte Tante Gerda mich schon vorgewarnt. Der Griffith Park ist eigentlich eine Wildnis, staubig und dreckig. Es gibt eine schlecht asphaltierte Straße für die Parkangestellten und ansonsten ein paar Trampelpfade. Die Vegetation besteht aus trockenem Gestrüpp, Senfgras und einigen Hagebuttenbüschen, ein paar Bäume sind in den tieferen Schluchten zu finden. Dennoch ist er der größte innerstädtische Park der USA und bietet herrliche Aussichtspunkte auf die scheinbare Unendlichkeit der Stadt.
Trotz der frühen Stunde – es war kurz vor sechs – waren bereits viele Angelenos unterwegs: Jogger, Walker, Leute mit Hunden an der Leine und mit Helmen auf Mountainbikes. Jeder grüßte freundlich, alle sahen nett und entspannt aus, selbst die Hunde waren ausnahmslos brav und vertrugen sich offenbar. Aus deutschen Großstädten kannte ich das gar nicht. Auch wurden klaglos sämtliche Geschäfte, welche die Hunde verrichteten, von den Besitzern in braunen Plastiktüten aufgehoben, was ich vorbildlich fand. Leider will man bisher in Deutschland diesem Vorbild nicht nacheifern. In Malibu findet man auch großzügige schöne Hundestrände, welche die Hundebesitzer ebenfalls sauber hinterlassen.
Ich stieg inmitten der Einheimischen tapfer bergan, der Weg führte lang und steil nach oben, und mir ging langsam die Puste aus. Die Angelenos waren da trainierter und kamen anders als ich kaum ins Schwitzen, was mir ein wenig peinlich war. Daran muss ich noch arbeiten, nahm ich mir vor. Mit letzter Kraft und großer Überwindung schaffte ich es bis auf die Aussichtsplattform mit der berühmten Sternwarte. Eine Plakette zeigte an, dass hier Natalie Wood und James Dean „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ (Rebel Without a Cause) gedreht haben.
Vorsichtig ging ich zum Rand der Plattform und wurde mit einem phantastischen Panorama belohnt: zur Rechten die Santa Monica Mountains, die sich bis zum dunkelblau funkelnden Meer hinzogen, die Skyline von Downtown unmittelbar vor mir, links dahinter die sanften Hügel der San Gabriel Mountains. Nur auf die Rückseite der Stadt, auf das San Fernando Valley, kann man von hier aus nicht sehen. „The Valley“ nennen es die versnobten Bewohner der Westside naserümpfend. Es liegt jenseits der Santa Monica Mountains, welche die Stadt teilen und die auch der legendäre Hollywood-Schriftzug am Mount Lee schmückt. Von Nahem ist das Hollywood Sign viel kleiner und schäbiger, als man es sich vorgestellt hat; diese Art von Desillusionierung sollte mir in Hollywood noch öfter widerfahren.
„Es gibt keinen schöneren Ort auf der Welt, wenn die Sicht klar ist, oder?“, meinte ein einheimischer Wanderer, der wie ich den Blick genoss.
Und nach einer kurzen Pause: „Und woher kommst du?“
„Aus Deutschland – ist es so offensichtlich?“, stotterte ich verlegen. Nun, beruhigte er mich, ich hätte recht lange dort gestanden und geguckt, das täten die meisten Frühsportler hier nicht.
Und er?
„Ich bin Autor und arbeite von zu Hause aus.“
Was er denn so schreibe? Zeitungsartikel, Romane?
Er grinste mich mit makellosen Zähnen an: „Nein, Drehbücher für Kinofilme.“ Natürlich, ich war schließlich in Hollywood.
Nachdem ich den Hügel – genau genommen sogar den „Mount Hollywood“, wie der mit 1625 Fuß höchste Gipfel Hollywoods im Griffith Park heißt – wieder hinuntergeklettert war, kaufte ich in einem netten kleinen Café in französischem Stil auf der Hillhurst Avenue monstergroße Croissants für Tante Gerda und mich zum Frühstück und eine „Los Angeles Times“ (hier kurz „LA Times“ genannt), vor allem wegen des großes Anzeigenmarkts. Schließlich musste ich mich auf die Suche nach einer Bleibe und einem Auto machen, denn zu Fuß würde ich es in dieser Stadt keinesfalls schaffen. Fahrräder werden hier nur zum Sport benutzt und sind nicht ernsthaft als Fortbewegungsmittel anerkannt. Zuverlässige und gut vernetzte öffentliche Verkehrsmittel gibt es leider nicht.
September Down on Sunset Boulevard
„Es ist alles wunderbar hier, Tante Gerda lässt auch grüßen. Ich wohne noch bei ihr, gucke mich mal an der Uni nach einer Studenten-WG um. Alles andere scheint sehr teuer“, erzählte ich meiner Mutter am Telefon. Das Studienjahr an der Universität, der University of California, Los Angeles, die hier alle nur abgekürzt „UCLA“ nannten, sollte demnächst losgehen. Jetzt würden viele ihre Wohnungsangebote an die Schwarzen Bretter pinnen, wurde mir gesagt. Tante Gerda setzte mich also am Campus ab, an der Hilgard Avenue Ecke Sunset Boulevard.
Der Campus der UCLA liegt in Westwood, jenem gediegenen, grünen Stadtteil von Los Angeles, den schon Thomas Mann während seines kalifornischen Exils sehr liebte und wo er regelmäßig zum Friseur ging. In seinem Tagebuch vermerkte er dann immer: „nach Westwood zum Haareschneiden“. Der Komponist Arnold Schönberg unterrichtete hier Studenten in moderner Musik. Die nach ihm benannte Schoenberg Hall ist zwar nicht das schönste, gehört aber zu den bekannteren Gebäuden der Uni. Westwood ist übrigens auch eine der teuersten Wohngegenden von Los Angeles, so wie die bekannteren Viertel Beverly Hills und Bel Air.
An meinem ersten Uni-Tag ging ich durch den Murphy Sculpture Garden auf dem nördlichen Campus, wo unter Jacaranda- und Eukalyptusbäumen über siebzig Bronzen und Skulpturen von Künstlern wie Jean Arp, Henri Matisse und Henry Moore verteilt sind. Ein Rodin-Torso ist auch dabei und zwei Büsten von Anna Mahler, der Tochter von Alma Mahler-Werfel und dem Komponisten Gustav Mahler. Als Alma mit Franz Werfel im kalifornischen Exil war, hat die Femme fatale die Emigranten-Zirkel aufgemischt.
Eine solch beeindruckende Sammlung auf einem Universitätscampus für jeden zugänglich auszustellen zeugte von der südkalifornischen Lässigkeit, die ich noch sehr zu schätzen lernen sollte. Ich verließ den Skulpturenpark mit dem Vorsatz, hier öfters hinzugehen und meine Lunch-Breaks auf einer der vielen Bänke zu zelebrieren.
Von dort fand ich leicht die Royce Hall, um mich bei dem Professor vorzustellen, der mein Stipendium betreuen sollte: ein emigrierter Ungar, der als Historiker auf dem Gebiet „Exilstudien“ forschte. Professor Lucian Marquis war ein kleiner, fast zierlicher Mann mit dunklen, klugen Augen und gewellten schwarzen Haaren mit erstaunlich wenigen grauen Strähnen, der mich auf Deutsch begrüßte.
„Guten Tag, mein Frollein, schoahn, Sie kennensulörnen.“
Unter seiner Anleitung durfte ich im historischen Archiv der Universität den Nachlass der deutschen Autorin Victoria Wolff untersuchen, die vor den Nazis nach Los Angeles geflohen und hier geblieben war. Victoria Wolff gehörte zu den weniger bekannten und daher auch vergessenen deutschen Exil-Schriftstellerinnen. Vom literarischen Genre her war sie ihrer Mit-Exilantin, der Belletristin Vicki Baum, zuzuordnen. Gleichzeitig war Wolff eine der wenigen, die in Hollywood Erfolg hatten und den nicht einfachen Wechsel von der deutschen Romanschriftstellerin zur amerikanischen Drehbuchautorin schafften.
Meine Aufgabe für das kommende akademische Jahr war es, sie und ihr Werk wieder sichtbar zu machen, beide im wahrsten Sinne des Wortes ans Licht zu bringen. Das bedeutete das Durchforsten und Auswerten von fünfzehn bisher ungeöffneten Holzkisten an Material, von denen keiner genau wusste, was drin war.
Die Bibliothek mit diesen „Special Collections“ befand sich in einem kleinen Gebäude auf dem nördlichen Teil des Campus und war, verglichen mit der grünen Wiese vor der Tür, auf der die fröhlichen kalifornischen Studenten in bunten T-Shirts, löchrigen Jeans und Baseballkappen herumliefen, ein fast feierlicher Ort. Ich musste mich anmelden und erhielt ein paar weiße Handschuhe. Damit durfte ich vorsichtig den Deckel der ersten Kiste des gesamten Nachlasses von „Claudia Martell“ (Wolffs amerikanischer Künstlername) öffnen und ihren Inhalt untersuchen.
In der Mittagspause sah ich mir die ehrwürdige Royce Hall genau an. Sie ist das Wahrzeichen der Universität und eine bekannte Filmkulisse, eine rote Backsteinkathedrale mit zwei Türmen und einem herrlichen Balkon. Von dort kann man die gegenüberliegende Powell Library und den übrigen Campus überblicken. Hier sind unter anderem die Historiker und Literaturwissenschaftler untergebracht sowie ein Theater, das nicht nur Studenten, sondern auch viele Bewohner der Westside von Los Angeles regelmäßig besuchen. Am dortigen Schwarzen Brett fand ich mehrere Wohnungs- und WG-Angebote, die ich gleich abklappern wollte. Außerdem hingen da einige interessante Job-Offerten, wie „Filmproduktion sucht Voice Coach für deutschen Akzent“ oder „Übersetzer für deutsch-englische Videoskripte gesucht“. Ich schrieb mir auch diese Nummern auf, aus Neugier. Man konnte ja nie wissen, wozu es gut war.
Das erste Apartment war erstaunlicherweise fußläufig vom Campus aus erreichbar. Allerdings musste ich den ganzen Campus durchqueren bis zu seiner westlichen Begrenzung, der Veteran Avenue, die den Sunset und den Wilshire Boulevard verbindet. Sie ist benannt nach dem Gemeindezentrum und dem Friedhof für Kriegsveteranen, der sich auf der anderen Straßenseite erstreckt. Eine ungeheure Masse dieser immer gleichen weißen Grabsteine zieht sich da über mehrere Quadratkilometer mitten in der Stadt. Auf den Grabsteinen stehen nur die nötigsten Angaben – Name, Rang, Geburts- und Todesdatum des Soldaten. Anders als auf europäischen Friedhöfen gibt es nur einige Bäume am äußeren Ende der Fläche und keine Blumen, nur die einzelnen Gräber auf einer sanft gewellten, grünen Wiese. So wenig idyllisch er auf den ersten Blick scheint, so wenig ruhig ist er auch. Denn er liegt in unmittelbarer Nähe der viel genutzten Autobahnabfahrt vom Freeway 405 auf den Wilshire Boulevard.
In östlicher Richtung liegt das Westwood Village mit zahllosen Studentenkneipen, Restaurants und Klamottenläden. Ein weiterer kleiner Friedhof liegt versteckt auf der Südseite des Wilshire Boulevards, komplett von Büro-Hochhäusern eingeschlossen. Hier liegt Marilyn Monroe begraben: ein unscheinbares Fach in einer Wand mit lauter Urnen, lediglich eine Rose verweist auf die berühmte Bewohnerin. Friseursalons gab es auch einige (den von Thomas Mann habe ich leider nicht mehr ausfindig machen können) sowie Nagel- und Schönheitsstudios. Ich wurde bald Stammkundin bei Farah, einer Exil-Perserin, die regelmäßig zu den Oscars die französische Schauspielerin Juliette Binoche schminkte.
Das Haus, in dem sich die annoncierte Zwei-Zimmer-Wohnung befand, sah kleiner und schäbiger aus, als ich es gern gehabt hätte, war ansatzweise im mexikanischen Stil gehalten mit einem Rundbogen über der Eingangstür und einem Balkon im ersten Stock. Der Garten war ungepflegt, der weiße Anstrich vom Haus blätterte ab und wirkte eher grau.
Es öffnete eine Frau, die ich auf mein Alter schätzte, mit einem Kind auf dem Arm und einem weiteren am Rockzipfel. Die Frau trug unverkennbar eine Perücke, darüber ein Kopftuch, lange Ärmel und einen Rock bis zum Boden – tapfer, bei den rund 30 Grad trockener Hitze. Sie bat mich zögernd ins Haus, und ich durfte mich auf das Brokatsofa setzen, welches komplett von einem durchsichtigen Plastiküberzug geschützt war. Das Apartment sei noch zu haben, und sie wolle es mir gleich zeigen.
Vorab stellte sie sonderliche Bedingungen: Die Miete sei im Voraus und in bar zu bezahlen, und von Freitagabend bis Sonntag früh seien sie und ihre Familie bitte nicht von den Mietern anzusprechen, sie heiligten den Sabbat.
Okay. „Und wenn das Klo zum Sabbat verstopft ist, dann muss man warten?“, erkundigte ich mich vorsichtig nach dem Ernstfall.
„Ja“, lautete die knappe Antwort.
Dann gingen wir nach draußen und über eine kleine Außentreppe zur oberen Etage hinauf, die durch eine wacklige Holztür in der Häuserwand erreichbar war. In dem „Two-Bedroom-One-Bath-Apartment“ gab es zwar einigermaßen viel Platz, wobei der total verfilzte, hochflorige Teppich, der überall lag, die Wände emporzuwachsen schien. Er war von einem moosigen Grün und gab der Wohnung den Anschein einer feuchten Höhle. Irgendwie roch es auch wie beim Löwen. Der PVC-Boden in der Küche und in dem winzigen Bad wellte sich fröhlich, alle Fenster waren mit Farbe zugekleistert und ließen sich bis auf Weiteres nicht öffnen. Die muffige Bruchbude sollte dafür aber 1450 Dollar im Monat kosten – die Lage nahe am Campus rechtfertige den Preis, so die Vermieterin. Als ich mich in der Küche umdrehte, knirschte es unter meinem Fuß: Rattenköttel. Die Tiere kämen hin und wieder vom Veteranenfriedhof herüber. Angewidert und enttäuscht trat ich den Rückzug an. Nein, danke. Dann bleibe ich doch lieber bei Tante Gerda auf dem Klappbett.
Die zweite Wohnung, die ich mir angucken wollte, lag in West Hollywood, unmittelbar am Sunset Strip, einem Abschnitt des Sunset Boulevards, der eine beliebte Vergnügungsmeile (genauer gesagt anderthalb Meilen, also ungefähr zwei Kilometer lang) ist, mit Restaurants, Bars und Cafés, Shops und vor allem auch Clubs und Musikläden wie dem „Rainbow Room“ und dem „House of Blues“. Das fand ich schon einmal sehr positiv, denn das Nachtleben in Hollywood wollte ich natürlich kennenlernen.
Tante Gerda lieh mir ihren Pontiac, und ich bog vom Sunset Boulevard links in die Harper Street ein. Die vierstellige Hausnummer gehörte zu einem strahlend weißen Gebäudekomplex mit Tiefgarage und roten Terrakotta-Fliesen im Eingangsbereich. Ein großer Brunnen, der auch als Pool durchgehen konnte, dominierte den Innenhof und die ringsherum angeordneten vier Wohnungsetagen. Auch hier wie an vielen Orten in der Stadt gab es herrliche Bougainvilleen und andere exotische Pflanzen, die die Fontäne umgaben.
Apartment No. 31 lag im dritten Stock, ich klopfte an.
Meine zukünftige Mitbewohnerin war ein rehäugiges, leicht magersüchtiges Mädchen mit einer unreinen Haut (schade, sonst hätte sie als Doppelgängerin der Schauspielerin Winona Ryder durchgehen können, dachte ich). Sie hieß Malia Doman. „Like Maria, just with an ‚l‘“, wie sie erklärte.
Sie kam aus Nordkalifornien, aus der Gegend südlich von San Francisco, studierte auch an der UCLA und jobbte nebenbei als Model. Wir waren uns sympathisch und schnell einig: Ich wollte das Zimmer nehmen, es hatte sogar ein daran anschließendes eigenes, sauberes Bad und einen neuen hellgrauen Teppich. Die Miete war auch in Ordnung, da wir sie uns teilten.
Wir stießen mit zwei riesigen Kaffeetassen auf unsere neue Hausgemeinschaft an: „Du bist die Zehnte, die sich die Wohnung anguckt. Und die Einzige, die normal ist. Vielleicht waren die anderen alle einfach nur zu jung. Ich selbst bin ja auch schon älter im Vergleich zu den übrigen Studenten in meinem Jahrgang, weil ich jetzt erst wieder eingestiegen bin und nur noch nebenbei arbeite“, sagte Malia.
„Das nehme ich mal als Kompliment: ‚Normal‘ zu sein ist in Hollywood vielleicht was Besonderes“, meinte ich und hatte doch schon wieder Zweifel. Andererseits war die Wohnung toll, die Lage und das Gebäude gefielen mir – da würde ich es auch mit einem magersüchtigen Ex-Model aushalten. Es war ja schließlich nicht für immer.
Eine schicke Wohnung in Hollywood hatte ich also, nun brauchte ich noch ein paar Möbel und dringend ein Auto. Für die Möbel gab mir Tante Gerda den Rat, das Wochenende abzuwarten und auf die vielen „Garage Sales“ zu gehen, die mit Pappschildern an den Straßenecken angezeigt wurden.
„So habe ich auch angefangen, Kindchen. Ich kam ja mit nichts hier an, dreimal sind wir ausgebombt worden in Berlin. Also, die Leute stellen samstags einfach Dinge, die sie nicht mehr brauchen, in ihre Vorgärten oder Garagen und verkaufen sie wie auf dem Flohmarkt. Du musst auf die Pappschilder achten und kannst wahre Schmuckstücke finden. Und geh ruhig erst mal in die vornehmen Gegenden!“
Das Gute an amerikanischen Wohnungen ist, dass man keinen Kleiderschrank aufzustellen braucht, denn die Schlafzimmer haben alle so genannte „Walk-in-Closets“, eingebaute Schränke, mit einer Kleiderstange und ein paar Fächern. Auch mein Zimmer bei Malia hatte einen solchen begehbaren Schrank. Ich brauchte nur noch ein Bett, einen Schreibtisch mit Stuhl und eine Lampe. Das gemeinsame Wohnzimmer hatte Malia bereits eingerichtet, nicht ganz nach meinem Geschmack: zu viele Wandteppiche mit Indianer-Motiven. Und überall standen Räucherstäbchen herum. Aber ein Fernseher war da und eine gemütliche Couch, das sollte reichen.
Um hier einziehen zu können, brauchte ich, wie gesagt, unbedingt ein Auto. Denn ich musste ja zum UCLA-Campus kommen, einkaufen gehen und wollte schließlich hin und wieder an den Strand. Beim Autokauf half das Schwarze Brett an der Uni leider wenig. Und die Anzeigen in der „LA Times“ mit ihren seltsamen Abkürzungen verstand ich irgendwie alle nicht. Da würde ich bestimmt danebengreifen und eine lahme Ente kaufen, die ständig zusammenbrach.
In einer Stadt wie Los Angeles war ein zuverlässiges Fahrzeug lebensnotwendig. Liegen zu bleiben war gefährlich, wie mich alle warnten, auch wenn ich nicht unbedingt die Gang-Gegenden auf meiner Uni-Route hatte. Die lagen eher im Südosten der Stadt. „South Central LA“ hieß die Gegend, und davon hielt man sich am besten fern, vor allem, wenn man sich nicht auskannte.
Wieder wusste Tante Gerda Rat: „Ruf doch mal beim deutschen Generalkonsulat an. Die sind immer sehr nett und hilfsbereit.“
Und siehe da, der Vizekonsul beendete gerade seine Amtszeit in Kalifornien und verkaufte seinen Wagen und den seiner Frau – ein braver deutscher Golf, das hörte sich zwar nicht nach dem American Dream an, aber nach einem verlässlichen Auto. Frau Konsul ließ mich Probe fahren, und ich schrieb ihr einen Scheck aus.





























