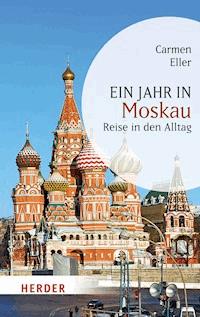
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
Kaum betrat ich die Metrostation, war es mit der Ruhe vorbei. In der Moskauer Unterwelt wie überhaupt im russischen Leben galt ein ehernes Gesetz: Der Stärkste gewinnt! Zur Rushhour herrschte in dieser Elfmillionenstadt real existierender Sozialdarwinismus. Einem Menschen, der es wagte, die Station ohne Ticket zu betreten, schlugen zu einem schrillen Warnsignal zwei Metallschranken auf die Schenkel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carmen Eller
Ein Jahr in Moskau
Reise in den Alltag
Impressum
Originalausgabe
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2010
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80262-1
ISBN (Buch): 978-3-451-06135-6
Für meine Mutter,
die mich die Welt entdecken ließ
in Liebe
Inhalt
September
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
The more you love a memory,the stronger and stranger it becomes.
VLADIMIR NABOKOV
September Nach einer turbulenten Taxifahrt lande ich in einer verwandelten Stadt, fürchte mich vor meinem dritten Mitbewohner und treffe den russischen Harry Potter
Über Moskau leuchteten Sterne aus Glas. Rot wie Rubine saßen sie auf den Türmen des Kreml. Dafür fehlten die Gestirne am nächtlichen Himmel. Selbst der Mond war hinter dem Erlöserturm verschwunden. Als sich um Mitternacht die Zeiger auf seinem Zifferblatt trafen, läuteten die Glocken.
Ungläubig blickte ich auf die märchenhaft bunte Basiliuskathedrale. Ein Milizionär zog wenige Meter davor an seiner Zigarette. Die Spitze glimmte wie ein verlöschender Himmelskörper. In der Ferne, vor dem angestrahlten Kaufhaus GUM, sah ich die schwarze Silhouette eines eng umschlungenen Liebespaars. „Träumst du?“, hörte ich eine Männerstimme hinter mir. Ich drehte mich um und sah Wladimir winken.
„Kak dela? Na, wie geht es dir?“, fragte mein künftiger Mitbewohner und kam näher. „Choroscho“, sagte ich, „gut“, aber das traf es nicht. Eigentlich kam ich mir vor wie neu geboren. Doch zu diesem Satz reichte mein Russisch noch nicht aus. Wie Gagarin, den die Sowjets einst in den Weltraum schossen, fühlte ich mich aus meiner gewohnten Umlaufbahn katapultiert. Auf dem weiten, fast menschenleeren Roten Platz stand ich jetzt wie auf einem fremden Planeten. Hier sollte mein neues Leben beginnen.
Wladimir kannte ich gerade einen halben Tag. Am Flughafen Domodedowo hatte der junge Mann in Jeans und Lederjacke das Schild mit meinem Namen hochgehalten. Die Beschreibung passte: schwarze Haare, dunkle Augen, braunes Shirt. Ganz Gentleman, nahm er mir den übergewichtigen Koffer ab und zog ihn ins Freie. Vor den Schwingtüren des aeroport schien die Sonne. Keine Wolke zog über den Moskauer Himmel, aber um mich herum war alles in Bewegung. Beine, Koffer, Räder. Russische Wortfetzen flogen durch die Luft, Kinder weinten, Autos hupten. Von allen Seiten schwirrten Männer wie Moskitos um uns herum: „Taxi! Taxi! Nedorogo. Nicht teuer.“ „Dawai, komm! Unser Fahrer wartet schon.“ Wladimir schleuste mich durch die Menge und wuchtete meinen Koffer in einen silbernen Schiguli. „Sag mal, hast du Steine eingepackt?“ „Nein, aber die gesammelten Werke von Dostojewski“, scherzte ich. Tatsächlich hatte ich für lange Winterabende russische Romane im Gepäck.
Wladimir und ich hatten kaum auf der Rückbank Platz genommen, da gab unser Fahrer, ein dicker Russe mit Schildmütze und Schnurrbart, auch schon Gas. Über vierspurige Ausfallstraßen rasten wir ins Zentrum. Seit einem vor Jahren glimpflich verlaufenen Autounfall hatte ich als Beifahrerin schwache Nerven. Unser Taxist, der bei über 140 Sachen und regem Spurwechsel ohne Blinker auskam, strapazierte sie gewaltig. Am Fenster flog Moskau vorbei. Autohäuser, Shopping-Malls und Wohnsilos, die wie gigantische Bienenwaben in den Himmel ragten. „Bist du zum ersten Mal in der Stadt?“, wollte Wladimir wissen. In gebrochenem Russisch erzählte ich ihm von meinem Schüleraustausch in den frühen Neunzigern. Von meinen Gasteltern, deren Herzlichkeit mich jedes Heimweh vergessen ließen. Von meiner Gastschwester Sweta, die schon mit 14 keine Lust mehr auf einen Beruf hatte und deshalb auf einen tüchtigen Gatten hoffte. Leider war unser Kontakt abgebrochen. Keine Seltenheit in einer Zeit ohne E-Mails, aber mit unzuverlässigen Postboten.
„Wie lange bleibst du diesmal?“ Wladimir sah mich erwartungsvoll an. „Erst mal nur ein Jahr. Als Redakteurin bei der Moskauer Deutschen Zeitung.“ Ich beschrieb ihm das Journalistenprogramm des Instituts für Auslandsbeziehungen, das mich nach Russland entsandt hatte.
Wladimir stammte aus der Kleinstadt Rjasan, rund zweihundert Kilometer von Moskau entfernt. In die Hauptstadt hatte ihn sein Studium geführt. Als Verkaufsleiter einer Firma kümmerte er sich um die Ausfuhr von russischem Schnittholz nach Europa. Gleichzeitig schrieb er an einer Doktorarbeit in Germanistik. Wladimir ergründete darin Besonderheiten argumentativer Strukturen in deutschsprachigen wissenschaftlichen Abhandlungen, was hoffentlich spannender war, als es klang. Doch er meinte ganz unsentimental: „Wahrscheinlich bleibe ich am Ende in der freien Wirtschaft. Als Uniprofessor erhältst du hier einen Hungerlohn.“ Das also hatte sich nicht verändert seit meiner ersten Russlandreise. Lehrer und Ärzte zählten schon damals zu den Geringverdienern.
Unser Taxifahrer drehte am Radio, und ich hörte die ersten russischen Nachrichten. Weil Wladimir weitersprach, verstand ich bis auf die Wettervorhersage nur Putin. Immer wieder Putin. Wir sausten durch graue Wohnviertel mit bunten Reklametafeln, und ich war von Minute zu Minute gespannter auf mein neues Zuhause. Irgendwann bogen wir in eine schmale Seitenstraße mit kleinen Lebensmittelläden.
Der Taxifahrer blinkte links und wir rumpelten einen unebenen Weg entlang, den hohe Bäume säumten. Vor einem unscheinbaren Plattenbau bremste er und rief „Stschastliwo!“, als wir ausstiegen. „Stschastliwo!“, wiederholte Wladimir. Für Moskauer war das russische Wort für „glücklich“ ein üblicher Abschiedsgruß, für mich ein Grund zum Staunen.
An meinem neuen Haus hingen rostige Balkone wie Überbleibsel von anno dazumal. So hatte ich russische Wohnviertel in Erinnerung. Andere Aspekte des Alltags schien ich völlig verdrängt zu haben. Sonst hätte ich wohl nicht gleich einen Kulturschock erlebt, als ich das Treppenhaus sah. Vielmehr roch. Eine Mischung aus nassem Hund, Urin und Holzkohle lag in der Luft. Ich rümpfte die Nase, aber hielt meinen Mund. Schließlich wollte ich Wladimir nicht beleidigen, er konnte ja nichts für den Gestank. Erst viel später sollte ich beobachten, wie er zustande kam.
Wladimir hievte mein Kofferungetüm über hohe graue Stufen in den vierten Stock. Ich dachte wieder an meinen spindeldürren Gastvater vom Schüleraustausch, der trotz dicker Schweißperlen auf der Stirn immer darauf bestanden hatte, alle Koffer ganz alleine zu schleppen.
Im Flur roch es nach gebratenen Kartoffeln. Wladimir zog den Koffer über einen braunen Teppich, vorbei an Telefontisch und Garderobe. „Wo ist die Toilette?“, fragte ich und verschwand in einem winzigen Raum, auf dessen Boden ein aufgeschlagenes Computermagazin lag.
Mein neues Zimmer stammte aus einer vergangenen Zeit. In einem schweren braunen Eichenschrank staubten dickleibige Bücher vor sich hin. Ein zartrosa Blumenmeer ergoss sich über die Tapete. Welcher Mensch hatte dazu nur ein düsteres Stillleben mit Gebetbuch und tropfender Kerze gehängt? Das Beste aber war ein rotbrauner Teppich, der sich über die ganze Wand spannte. Darunter stand ein Wahrzeichen russischer Wohnkultur: der Diwan. Rot wie die Flagge der Sowjetunion. Gegenüber reihten sich hinter einer Glasvitrine Modelle von Satelliten und falsche Kristallgläser aneinander. Darüber kreiste ein Sputnik um einen Plastikglobus. War mein Vorgänger etwa Kosmonaut gewesen? „Der Vater des Vermieters arbeitete als Raumfahrttechniker“, erriet Wladimir meine Gedanken. „Aber jetzt stelle ich dir Alexej vor.“
Mein zweiter Mitbewohner stand mit Shorts und freiem Oberkörper vor einer Pfanne. Auf einem Backblech brutzelte Alexejs Auflauf, ein etwas liebloses Gemisch aus Pilzen, Kartoffeln und Suppengrün. Vier dazugelegte Würste versetzten mein Vegetarierherz in Aufregung. „Priwet, Carmen, hallo.“ Der halbnackte Koch reichte mir seine rechte Hand, mit der linken stach er eine Gabel ins Gericht. „Sadis, setz dich.“ Ich ließ mich auf einem der Holzhocker nieder und sah mich um. Die Küche war nicht viel größer als eine Besenkammer. Über blau-weiße Kacheln schipperten Segelboote. Folklorefiguren mit kugelrunden Bäuchen tanzten auf Holzbrettchen über der Spüle.
Mein Blick schweifte über die Mikrowelle zum Fernseher, und in diesem Moment sah ich ihn. Den dritten im Bunde, den Mitbewohner, den mir alle Beteiligten bisher verschwiegen hatten. Unverwechselbare Kennzeichen: graue Haare, schwarze Knopfaugen, vier Beine – dazu ein bleistiftlanger Schwanz. Eine Ratte! Ihr Käfig stand auf der lautlos flimmernden Mattscheibe. Ohne Interesse für seine Umwelt zu zeigen, knabberte das Vieh an einer Banane. „Das ist Ben“, sagte Alexej, und Wladimir grinste. „Du magst doch Tiere, oder?“ Jetzt grinste Wladimir noch breiter, öffnete eine Wodkaflasche und hob sein Glas. Statt ehrlich zu antworten, stieß ich mit ihm an. „Auf dich!“, riefen die Männer im Chor. „Dobro poschalowat w Moskwu! Willkommen in Moskau!“
Wir aßen, wir tranken und wieder dachte ich an meine alte Gastfamilie. Ihr Russland ging damals durch meinen Magen und es war Liebe auf den ersten Biss. Trotzdem freute sich Maxim, Swetas kleiner Bruder und damit das Nesthäkchen der Familie, immer noch am meisten über McDonald’s-Kost. Mit der Perestrojka war auch der Big Mac nach Moskau gekommen. Noch immer sah ich die strahlenden Augen des Sechsjährigen vor mir, als er Coca-Cola durch den Strohhalm zog. Meine Gastmutter inszenierte im Esszimmer täglich „Tischlein deck dich“, und ich musste spachteln, bis jede Schüssel leer war und mein Bauch so voll, als hätte ich Rotkäppchen mitsamt dem Wolf verschlungen. Doch frische Früchte waren Luxus. Niemals hätte man damals eine Ratte auf ein Stück Banane losgelassen.
Auch Alexej wollte wissen, was mich nach Moskau führte, erzählte aber selbst sichtlich ungern von seinem Job. „Ich mache PR in einer Künstleragentur“ war alles, was ich dazu von ihm hörte. „Wie weit ist es eigentlich von hier zum Roten Platz?“, warf ich nach dem zweiten Wodka in die Runde, wohl wissend, dass ich heute nicht einschlafen könnte, ohne ihn gesehen zu haben. „Nedaleko, nicht weit. Eine halbe Stunde mit der Metro.“ Wladimir lächelte. „Du bist wohl noch nicht müde?“ Nein. Nervös? Ja. Leicht beschwipst? Vielleicht. Aber müde? Eine Viertelstunde später saß ich mit meinen Jungs in der Metro.
Statt abgegriffener Münzen öffneten uns jetzt Magnetkarten den Weg in die Unterwelt. Sonst aber war alles so, wie ich es in Erinnerung hatte. Endlose Rolltreppen, die doppelt so schnell wie zu Hause liefen. Palastartige Stationen mit Kronleuchtern und Skulpturen russischer Revolutionäre. Bunte Mosaike mit Lenins Konterfei. Ein sowjetisches Disneyland, dessen Pracht mich wieder staunen ließ, als sähe ich alles zum ersten Mal.
Leider strahlte der Glanz der Metro nicht ab auf das menschliche Gemüt. Die Moskauer, die sich mit uns in weichen Kunstledersesseln zum Takt der Räder schütteln ließen, hatten ernste und müde Gesichter. In einer Ecke krümmte sich eine faltige Frau mit zerschlissenem Schuhwerk. An jeder Station sagte eine freundliche Stimme: „Vergessen Sie beim Aussteigen Ihre Sachen nicht.“ Aber das rauschte an mir vorbei, wie ich überhaupt kaum etwas von dem verstand, was sich Alexej und Wladimir in schnellem Pingpong-Russisch erzählten. Umgeben von kyrillischen Buchstaben, dösenden Russen und gleichmäßigem U-Bahn-Rattern gab ich es auf, ihrem Gespräch folgen zu wollen.
Von der Station Ploschtschad Revoluziji sah man bereits auf den Roten Platz. Weil er leicht anstieg, erhoben sich in der Ferne die verspielten Kuppeln der Basiliuskathedrale mit jedem Schritt ein Stück mehr aus dem Kopfsteinpflaster. Ausgerechnet Zar Iwan der Schreckliche hatte diese architektonische Schönheit in Auftrag gegeben. Erst jetzt, als ich direkt vor ihr stand, war ich wirklich in Moskau angekommen.
An keinem Ort waren die Kontraste der Stadt schärfer als auf dem Roten Platz. Gegenüber dem Lenin-Mausoleum, einem Sinnbild des Kommunismus, lockte mit dem Kaufhaus GUM ein turbokapitalistischer Konsumtempel. Bei meinem ersten Besuch in Moskau stand ich zwei Stunden in der Schlange, um einen Blick auf Lenins Leiche zu werfen. Sprechen war streng verboten, und so drehte ich zusammen mit russischen und deutschen Schülern eine schweigende Runde in dem finsteren Raum. In Anzug und Krawatte lag der beleuchtete Lenin wie Schneewittchen im gläsernen Sarg.
„Na, was sagst du?“, riss mich Wladimir aus meinen Gedanken. „Wunderbar.“ In diesem Moment erschien es mir wirklich wie ein Wunder, nach zwei Stunden Flug aus Berlin, nach Taxifahrt und Metrorattern, nach Wodka und der ernüchternden Erkenntnis, die Wohnung künftig mit einer Ratte teilen zu müssen, wieder auf diesem weltberühmten Pflaster zu stehen.
Nein, es war nicht der Wodka, der mich in eine so euphorische Stimmung brachte, es war dieser schwindelerregend schöne Platz, den ich in Zukunft immer wieder betreten sollte, wenn meine Welt aus den Fugen geraten war oder Melancholie mich ergriff. In meinem Kopf spielte der alte Beatles-Hit: „Been away so long I hardly knew the place, gee, it’s good to be back home. Leave it til tomorrow to unpack my case, honey disconnect the phone. I’m back in the USSR.“ Na ja, die Sowjetunion war zum Glück schon Geschichte, auch wenn, wie ich später erfuhr, manche Russen das bis heute nicht glauben wollen.
Die ersten Tage vergingen wie im Traum. Erst wenn ich Wladimir und Alexej im Nebenzimmer auf Russisch sprechen hörte und einen verschlafenen Blick aus meiner Plattenbaufestung wagte, wusste ich es wieder ganz sicher: Vor der Tür wartete mein Abenteuer Moskau. Vor allem aber auch mein Job als Journalistin.
Am Morgen meines ersten Arbeitstages schaffte ich es kaum, richtig zu frühstücken. Was nicht nur an meiner Aufregung lag. Während ich Milch in meine Cornflakes goss, wühlte mein müffelnder Mitbewohner mit seinen langen Krallen in der Käfigstreu. Meine zweibeinigen WG-Genossen schliefen noch. Zu meinem Erstaunen teilten sie nicht nur ein Zimmer, sondern auch das Bett. Inwieweit dies ihr privater Spaß oder doch eher eine Sparmaßnahme war, musste ich noch herausfinden.
Auf dem Weg zur Arbeit passierte ich erneut unsere vier stinkenden Stockwerke. Unangenehme Gerüche, so merkte ich schnell, gehörten zu Moskau wie hupende Blechlawinen. Vor der Tür aber war die Luft klar. Hinter einer frühmorgendlichen Wolkendecke blinzelte die Sonne hervor. Nur ganz wenig, als ob sie noch entscheiden müsste, ob sie sich wirklich in die Welt wagen wollte. Auf dem Spielplatz gegenüber half eine junge Mutter ihrem kleinen Mädchen auf die Schaukel. Mein Weg zur Metro führte mich an kleinen Kiosken vorbei, vor denen Männer Zigaretten pafften. Verwahrloste Gestalten bettelten sie um ein paar Rubel an.
Kaum betrat ich die Metrostation, war es mit der Ruhe vorbei. In der Moskauer Unterwelt wie überhaupt im russischen Leben galt ein ehernes Gesetz: Der Stärkste gewinnt! Zur Rushhour herrschte in dieser Elfmillionenstadt real existierender Sozialdarwinismus. Einem Menschen, der sich ohne Ticket durch die Sperre wagte, schlugen zu einem schrillen Warnsignal zwei Metallschranken auf die Schenkel. Dahinter geriet ich in einen Strudel aus Jacken, Taschen, Armen und Beinen.
Als sich die Türen des anfahrenden Zuges öffneten, ergoss sich ein Strom von Menschen in die bereits wartende Masse. Man musste nicht viel von Algebra verstehen, um zu wissen, dass so etwas nicht gut gehen konnte. Alle auf einmal stürzten, nein stießen sich in die Waggons. Ellbogen drängten mich zur Seite. Kurz: Der Zug fuhr ohne mich. Zu meinem Glück ging die Metro im Minutentakt. Beim zweiten Versuch stand ich vorne dabei und versuchte nicht länger, höflich zu sein. Geschafft.
Bevor ich mich darüber freuen konnte, rammte mir ein Mann von hinten seinen Aktenkoffer in die Kniekehlen. Glatzen und gefärbte Haare drückten sich in mein Gesicht. Die Dame vor mir hatte ihre Hochfrisur mit Spray fixiert, dessen beißender Geruch mir nun in die Nase stieg. Schweiß vermengte sich auf engstem Raum mit Zigarettenrauch, Hundehaaren und Parfüm. Ich kam ins Schwitzen. Wie musste sich erst ein klaustrophobisch veranlagter Mensch hier fühlen? Wer an dieser Krankheit litt, lebte bestimmt nicht in Moskau, dachte ich. Oder die morgendliche Metrofahrt wirkte als Schocktherapie so gut, dass der Geheilte fortan lieber andere Neurosen entwickelte. Etwa die Angst vor leeren Plätzen. Die gab es in Moskau nämlich nie.
Warum verbargen sich die Menschen, die in diesem Moloch zuhause waren, hinter einer Maske der Gleichgültigkeit? Warum verwandelten sie sich in andere Wesen, sobald sie die eigenen vier Wände verließen? Arbeiteten auch Alexej und Wladimir mit Ellbogen, wenn sie alleine unterwegs waren? Es gab noch viel zu lernen.
Als Redakteurin der Moskauer Deutschen Zeitung verantwortete ich das Feuilleton und die Rubrik Fotoreportage. Sobald ich mit dem Journalismus auf Russisch begann, merkte ich, dass es zunächst vor allem darauf ankam, nicht sofort an ihm zu verzweifeln. Die Anrufer in unserer Redaktion sprachen dreimal so schnell wie die Menschen auf meinen Lern-CDs. Es plagten sie auch ganz andere Probleme.
Fragen, auf die ich bestens vorbereitet gewesen wäre – wie „Könnten Sie mir sagen, wann der nächste Zug nach St. Petersburg fährt?“ oder „Was kostet bei Ihnen das Doppelzimmer mit Frühstück?“ –, stellten sie natürlich nie. Stattdessen wollten sie wissen, wie sie ein Zeitungsabo bestellen oder kündigen konnten, und vermieden dabei sorgsam jede mir bekannte Vokabel. Mehr als einmal reichte ich den Hörer unter einem Vorwand an einen meiner vier Kollegen weiter.
Auch mein Redaktionscomputer sprach ausschließlich Russisch. Jede Seite Pressemitteilung kostete mich eine Stunde, und selbst danach hatte ich nicht jeden Satz verstanden. Nur Langenscheidt war es zu verdanken, dass ich mit Kamera und Aufnahmegerät doch zur richtigen Zeit am richtigen Ort erschien. Weil ich Wichtiges von Unwichtigem erst nach mehrmaligem Anhören trennen konnte, nahm ich in Pressekonferenzen auch die langweiligsten Statements auf Band auf – um später über der Fülle des Materials fast den Mut zu verlieren.
Hatte ich damals nicht mit meiner russischen Gastschwester Sweta recht flüssig über Schulsorgen und Schwärmereien diskutiert? Irgendwo in meinem Hirn musste es all die Vokabeln noch geben, aber sie hatten sich verdammt gut versteckt.
„Mann, ist Russisch anstrengend!“, klagte ich meinem Kollegen Christian eines Tages mein Leid. Wir saßen in der Redaktionskantine bei einer ucha – russischer Fischsuppe. Wie meine anderen deutschsprachigen Kollegen telefonierte er längst mühelos mit den Russen. „Sei froh, dass du immerhin gute Grundlagen hast“, ermutigte er mich. „Als ich hier ankam, sprach ich so gut wie kein Wort.“ Was kaum zu glauben war, wenn man sein Russisch hörte.
Christian, ein Schweizer, war bereits ein Jahr vor mir zur Moskauer Deutschen Zeitung gekommen. Neben Russisch sprach er fließend Französisch und Spanisch. „Ich habe mal ein halbes Jahr in Madrid an der Universidad Complutense Politik studiert und bin früher gerne zum Surfen nach Tarifa gegangen“, erzählte er mir. „Wirklich? Ich habe auch ein halbes Jahr in Madrid gelebt und dort Literatur studiert.“ Irgendwie freute ich mich über diese Gemeinsamkeit. Vielleicht würden wir uns ja auch außerhalb der Arbeit gut verstehen.
Eine Weile löffelten wir schweigend unsere Suppe. „Mit dem Russisch ging es uns allen so. Mach dir da nicht zu viele Gedanken.“ Christian sah mich aufmunternd an. „Wsjo budjet choroscho.“ Das hatte ich verstanden. Alles wird gut.
Mein erster Artikel führte mich zu einem Mann, der mit Helden aus der Sowjetunion im neuen Russland Karriere machte: Kinderbuchautor Wladimir Postnikow. „Strastwujte. Guten Tag und hereinspaziert!“ Als die Tür zu seiner Moskauer Wohnung aufflog, erinnerte mich der Mann dahinter mit seinen millimeterkurzen Haaren, dem schwarzen T-Shirt und dem ovalen Gesicht an einen Pantomimen.
Einige Tage zuvor hatte ich ihn auf der Moskauer Buchmesse erlebt. Zwar trug er jetzt nicht mehr den Zylinder, seine Augen aber funkelten noch genauso frech. Eilig reichte er mir bunte Hausschlappen und bat mich in die Küche. Während ich mein Aufnahmegerät vorbereitete, setzte er Tee auf und verschwand dann ins Nebenzimmer.
Das Band lief jetzt, aber wo war mein Gesprächspartner? „Gospodin Postnikow?“, rief ich leise, aber erhielt keine Antwort. „Ta-taaa!“ Erschreckt fuhr ich herum. Postnikow stand mit einer Handpuppe im Türrahmen und sagte mit Piepsstimme: „Darf ich vorstellen? Ich heiße Karandasch.“ Das fing ja gut an.
Durch Vorrecherchen wusste ich, dass karandasch Bleistift hieß und eine Kinderbuchfigur war, die sein berühmter Vater, der Schriftsteller Jurij Druschkow, erfunden hatte. Tatsächlich saß der Puppe, die mit ihrem seidig gelben Kleidchen und den feuerroten Wuschelhaaren wie ein russischer Pumuckl aussah, ein kurzer dicker Stift als Nase im Gesicht.
Auf eine freche Show musste eine freche Frage folgen. „Warum haben Sie zunächst die Buchhelden Ihres Vaters übernommen, statt eigene zu schaffen?“ „Neue Helden werden kaum populär, es sei denn, man veranstaltet eine große Werbekampagne“, sagte Postnikow nun wieder mit tiefer Stimme und zog sich den russischen Pumuckl von der Hand. „Früher war es so: Wenn man schrieb, wie man musste, war man prominent und reich. Mein Vater zum Beispiel hatte in der Sowjetunion einen Freund, der in seinen Büchern die ganze Zeit nur von Pionieren erzählte. Er hatte viel Kohle, eine große Wohnung in Moskau und war ständig auf Kur.“
Inzwischen kochte das Teewasser. Postnikow schenkte uns ein und erzählte weiter: „Nach der Perestrojka wurde keines seiner Bücher neu aufgelegt. So ging es den meisten Schriftstellern, die in der Sowjetunion berühmt waren. Heute wiederum zählt nicht, wie ein Buch geschrieben ist, sondern wie viel Werbung dafür gemacht wird.“
Postnikow war ein Schriftsteller, der die Gesetze des Marktes genau zu kennen glaubte und bereit war, ihnen zu folgen. „Der erfolgreichste Autor ist ein Mensch, in dem sich die Talente eines Poeten und eines Geschäftsmannes vereinen“, meinte er. „Wenn man berühmt werden will, gibt es zwei Möglichkeiten: zwanzig Jahre Öffentlichkeitsarbeit leisten oder ,Harry Potter‘ schreiben.“
Wie weit Postnikow zu gehen bereit war, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, bewies sein jüngstes Werk „Der Junge Harry und sein Hund Potter“. „Wenn ich den Jungen Wassja genannt hätte und den Hund Tusik, wäre dieses Buch doch uninteressant für die Medien.“ Postnikow lächelte schlitzohrig und zeigte mir das Werk, auf dessen Einband eine zwinkernde Eule zu sehen war. Ganz schön pfiffig, dachte ich. Mit dem echten Harry Potter habe sein Buch inhaltlich aber nichts zu tun, versicherte er mir. Eine Zauberschule käme bei ihm allerdings auch vor.
Postnikow senkte jetzt seine Stimme, als sei er ein Märchenerzähler, der zur spannendsten Stelle kommt: „Alle Figuren in dem Buch sind Tiere, bis auf den Jungen Harry. Eines Tages klingelt es an der Tür und vor ihm steht Potter, ein sprechender Hund.“
Sein Geschäftssinn überraschte mich. Er war so ganz anders als die meisten Russen, die ich bei meiner ersten Moskaureise kennengelernt hatte. Ein Phänomen des neuen Russland. Mehrere Tassen Tee später zeigte sich: Postnikow lag nicht nur der Markt am Herzen, er hatte auch eine Mission. Er wollte russische Kinderbücher wieder bekannter machen. „In jedem Land gibt es doch einen Helden, auf den die ganze Nation stolz ist, zum Beispiel Winnie the Pooh in England, Pinocchio in Italien oder Karlsson in Schweden. In Moskau hängen jede Menge Plakate mit Harry Potter, aber viele russische Kinder kennen Tscheburaschka überhaupt nicht mehr.“ Ich war vor Kurzem durch Zufall auf die Figur gestoßen. Im Büro unseres Layouters saß ein braunes Plüschtier mit Segelohren und knallorangem Plastikgesicht. Eine bizarre Kreuzung aus Teddybär, Monchichi und Teletubby. „Was ist denn das?“, entfuhr es mir eines Tages, und die Antwort des Layouters klang fast beleidigt. „Eto Tscheburaschka!“
Die Helden der Vergangenheit waren wieder im Kommen. In Gesprächen mit jungen Leuten merkte ich: US-amerikanische Filmstars taugten nicht mehr als Vorbilder, russische Role-Models mussten her. Das neu erwachte nationale Selbstbewusstsein, das mich bei meinem Gespräch mit Postnikow überrascht hatte, begegnete mir fortan immer wieder, und das nicht nur in den Menschen. Moskau selbst strahlte wie eine Metropole, die nach entbehrungsreichen Jahren lernt, zu genießen. Und doch steckte die Stadt voller Widersprüche. Hinter grandiosen Palästen lauerten graue Plattenbauten. Futuristische Architektur schoss neben klassizistischen Bauwerken in die Höhe. Es gab MTV und Sushi-Bars, aber am internationalen Bahnschalter sprach man noch immer kein Englisch.
In den nächsten Tagen und Wochen begab ich mich auf ausgedehnte Streifzüge. Immer wieder fuhr ich ins Herz der Stadt, spazierte die Kremlmauer entlang und bewunderte die Standfestigkeit der Wachsoldaten am Grab des unbekannten Soldaten. Ich lief die prächtige Einkaufsmeile Twerskaja hinauf und hinunter und erfreute mich an der goldenen Kuppel der Christi-Erlöser-Kathedrale. Stalin hatte sie sprengen lassen und Jelzin richtete sie bis zum Jahr 2000 wieder auf. Trotzdem konnte man sie leicht für ein Relikt aus der Zarenzeit halten.
Das Kaufhaus GUM am Roten Platz glitzerte wie Münchner Boutiquen in der Maximilianstraße. Im Schaufenster lagen Kleider von Chanel, Krawatten von Armani oder bester Schweizer Käse. Luxus ohne Grenzen, aber wer konnte sich ihn leisten?
Auf den breiten Boulevards verdeckten riesige Werbeplakate mit verführerisch gekleideten Frauen und frisch rasierten Schönlingen ganze Häuser. Auf dem Platz zwischen den heiligen Hallen der russischen Macht, Duma und Kreml, entdeckte ich eine Rolex-Reklame, die sich über mehr als hundert Meter erstreckte. In unserer Feuilleton-Glosse mit dem treffenden Namen „Planet Moskau“ teilte ich meine Eindrücke mit den Lesern.
„Mein“ Moskau hatte ein neues Gesicht. Ich betrachtete es immer wieder mit großen Augen und fuhr dann zurück in meine kleine WG. Als ich eines Abends die Wohnung betrat, produzierte Alexej gerade einen Remix auf seinem Laptop, während Wladimir in der Küche zwischen einer Putin-Rede und Popmusik hin- und herzappte. Zum ersten Mal versuchte ich mich an unserer halbautomatischen Waschmaschine. „Solche stehen noch in vielen Moskauer Haushalten“, klärte mich Wladimir in seinem fast akzentfreien Deutsch auf.
Drei Schritte führten zum Erfolg beziehungsweise zu sauberen Kleidern: Klappe auf, Wäsche rein, Wasser marsch! Das mit dem Duschschlauch eingeführte Nass ergoss sich später als schmutzige Brühe in die Badewanne. Damit das Waschen trotzdem noch Spaß machte, hatte Alexej Aufkleber mit Wodkawerbung im Bad verteilt. In der Küche nagte Ben, die Ratte, sorglos an einem Apfel. Ihm war offensichtlich alles egal, solange nur genug in seinem Magen landete. „Beeeeen away so long, I hardly kneeew the place“, summte ich vor mich hin. Niemand störte sich an unserer wilden Geräuschkulisse aus elektronischer Musik, russischen Nachrichten und halbautomatischer Waschmaschine. Irgendwie klang es fast besser als der Beatles-Song.
Oktober Ein Russe legt in seinem Wohnzimmer Feuer, ich mache einen kulinarischen Ausflug in die Sowjetunion und erlebe die Liebe auf den ersten Löffel
Eines wurde mir in meiner russischen Wahlheimat sehr schnell bewusst: Um den Alltag in Moskau gut zu überstehen, brauchte ich viel Geduld und noch mehr Humor. Die Stadt hielt nahezu täglich Überraschungen für mich bereit. Das ging schon am Morgen los – mit einer kopflosen Verkäuferin.
Auf dem Weg zur Redaktion, die im fünften Stock des Deutsch-Russischen Hauses angesiedelt war, hielt ich an der nach einem sowjetischen Heerführer benannten Metrostation Frunsenskaja an einem wohnwagenähnlichen Gefährt. Darin gab es neben allerhand Milchprodukten wie Kefir und Käse besagte kopflose Verkäuferin.
Fast jeden Morgen erstand ich bei ihr einen Joghurtdrink. Ihr Gesicht sah ich nie. Womöglich war sie furchtbar entstellt oder hatte einen Schnurrbart. Ich hörte immer nur ihre Stimme, die „sluschaju“ sagte, „ich höre“. Das traf es genau, denn sehen konnte auch sie mich nicht. Das einzige Sichtfenster, durch das ich meine zwanzig Rubel reichte, befand sich auf der Höhe meiner Brust.
Allmorgendlich zog die Frau den Joghurtdrink mit geübtem Griff aus einem hinter ihr stehenden Pappkarton. Wie das Kaninchen aus dem Hut, dachte ich. Eine Zirkusnummer. Dem Milchwagen fehlte nur noch der Marktschreier: „Meine Damen und Herren, treten Sie näher und staunen Sie. Hier bedient nicht die Dame ohne Unterleib, nein, hier bedient die Dame ohne Kopf.“
Diese Episode war kein Einzelfall. Es gab in dieser Stadt unzählige Methoden, die Kommunikation zwischen Kunde und Verkäufer zu unterbinden. Die Variante „Ich sehe nicht, ich höre nur“ wurde nur noch gesteigert durch „Ich sehe, aber höre nicht“ im Trolleybus.
Ich wollte vom Fahrer wissen, ob er bis zu meiner Station Bagrationowskaja fuhr. Der Mann saß in einer orangefarbenen Signaljacke am Steuer, wie sie in Deutschland Straßenarbeiter und Müllmänner tragen. In seiner Fahrerkabine bewegte er die Lippen lautlos wie ein Goldfisch im Glas. Die einzige Öffnung, durch die Rubel, Fahrscheine und Schallwellen passieren konnten, befand sich, und das übertraf noch den Milchwagen, auf der Höhe meines Bauches.
Ich beugte mich also nach unten und sprach meine Frage dort hinein. Dazu musste ich eine Pose einnehmen, die aussah wie Aerobic für Anfänger. Der Busfahrer sah mich verständnislos an. Als er mir schließlich antwortete, klang seine Stimme so dumpf, als spräche er zu mir aus einem anderen Universum. „Njet“, das verstand ich. Die restlichen Worte blieben an der Scheibe hängen. Ein Schild, wie ich es aus Deutschland kannte – „Bitte sprechen Sie nicht mit dem Fahrer“ –, hätte man hier um den Zusatz erweitern können: „Er hört Sie sowieso nicht.“
Noch leichter missglückte die Kommunikation am Telefon. Wenn ich etwa in unserer WG den Hörer abnahm, dann rauschte und knackte und tutete es gelegentlich, als würde gerade Kontakt zu einer fernen Galaxie hergestellt – dabei ging es doch nur um Germanija. Besonders aufregend war so ein Gespräch, wenn ich unfreiwillig zum Spion wurde. Mehr als einmal saß mir das Leben der anderen in der Ohrmuschel. Dazu hörte ich starkes Rauschen, tiefe Stimmen und Kurzwellen-Gedudel.
Die Russen aber schienen das Telefon zu lieben – das war mir schon bei meinem ersten Besuch in Moskau aufgefallen. Im Hause meiner Gasteltern war der Fernsprecher so etwas wie ein Familienmitglied, das schon vor dem Frühstück und noch lange nach Mitternacht Zuwendung und insbesondere Zusprache erfuhr. Es hing direkt über dem Esstisch in der Küche, und sein schriller Ton konnte Tote, aber nicht den schlafenden Vater auf der Couch wecken.
Die Mitglieder meiner Gastfamilie waren die liebsten Menschen auf der Welt, aber am Telefon hatten sie den Charme von Henkern. Offensichtlich gehörte ein schroffer Stil am Telefon in Russland zum guten Ton. Erst nachdem der Hörer wieder auf der Gabel saß, verwandelte sich die Mutter zurück in die fürsorgliche Gastgeberin und tischte mit freundlichem Lächeln den Tee auf.
Ein bisschen Mut erforderte es deshalb schon vom neu zugezogenen Ausländer, sein Anliegen – auf Russisch! – zu formulieren, wenn die Person am anderen Ende der Leitung sich nicht vorstellte, sondern nur ein kühles „Aallo!“ in die Muschel bellte. Auch ich gewöhnte es mir schnell ab, am Telefon meinen Namen zu nennen. Es musste ja nicht jeder gleich beim ersten Wort wissen, dass ich Ausländerin war. Außerdem galt der schöne Satz „When in Rome, do as the Romans do“ auch für Moskau.
Alles in meiner neuen Stadt schien mindestens zwei Nummern zu groß. Die endlosen Boulevards, die man nur unterirdisch gefahrlos überqueren konnte. Der Betondschungel, der elf Millionen Moskauer fast verschwinden ließ. Wie Mäuse in ihren Schächten bewegten sich die Menschen durch die labyrinthischen Gänge der Metro. Mich erschlug aber nicht nur die Größe der Stadt. Auch ihr Tempo. Ihre Dynamik. Ihre Atemlosigkeit. Der Planet Moskau schien sich schneller zu drehen als der Rest der mir bekannten Welt.
Jeden Tag galt es, einen Wettkampf zu bestehen. Um den Einstieg in den Metrowagen. Um einen Sitzplatz. Um den rechtzeitigen Ausstieg. In Moskau machte schon der Morgen müde. In den Nächten aber feierte sich die russische Hauptstadt, als würde die Sonne nie mehr aufgehen.





























