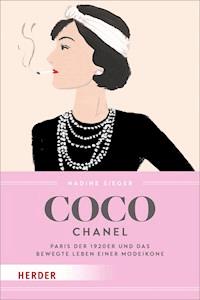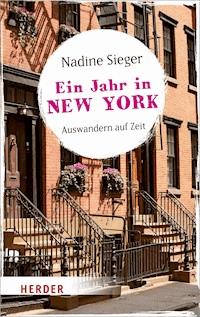
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es war wie im Film, als würde sie sich in den Kulissen von »Der unsichtbare Dritte« bewegen - mit einem Unterschied: Alles war echt. Penetrante Hupkonzerte und unablässig drängende Menschenmassen, die erste Wohnung in Harlem als gefühlte einzige Weiße, die ungewohnte Dating-Kultur, »new friends« und das kollektive Truthahn-Essen an Thanksgiving - ein Jahr in New York!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nadine Sieger
Ein Jahr in New York
Auswandern auf Zeit
Impressum
Titel der Originalausgabe: Ein Jahr in New York
Auswandern auf Zeit
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © Rovenko Photo – shutterstock
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-81148-7
ISBN (Buch): 978-3-451-06914-7
Inhalt
Prolog
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Für Kevin, mein Zuhause in New York
Prolog
EIN JAHR. Ich war mir anfangs ganz sicher, ich bleibe höchstens ein Jahr. Das erschien mir damals wie eine halbe Ewigkeit. Aber nach zwölf aufregenden, bereichernden und berauschenden Monaten war sehr schnell klar: Ich muss unbedingt bleiben. Denn es gab noch so unglaublich viel zu entdecken und erleben. Diese Entdeckungsreise hält bis heute an. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Denn auch einige Jahre und sieben Apartments später schafft New York es immer wieder, zu überraschen, begeistern und inspirieren. Die Stadt verändert sich ständig, aber bleibt sich dabei konsequent treu. Deshalb haben all diese viel zitierten Liebeserklärungen von legendären Schriftstellern wie E.B. White, Dorothy Parker und Tom Wolfe auch Jahrzehnte später kein bisschen an Relevanz eingebüßt. „Es gibt dir immer ein bisschen mehr, als du erhofft hast. Das ist das Besondere an New York“ – das gilt heute wie damals.
Zugegeben, selbst seit meiner Ankunft ist schon so manches Stück geliebtes New York verschwunden. Leider. Aber: So war es schon immer, und so wird es immer sein. Denn die Stadt macht unbeirrt Platz für Neues. Sich darüber zu beschweren gehört zur Lieblingsbeschäftigung jedes New Yorkers. Und man darf sich keine Illusionen machen, wie bei jeder großen Liebe schleicht sich auch hier irgendwann der eine oder andere Reibungspunkt ein. Die Stadt kann launisch sein. Sie kann unbarmherzig an den Nerven zehren, mit dem stetigen Lärmpegel und den konstant steigenden Mietpreisen zum Beispiel. Und das gnadenlose Tempo und Pendeln zwischen Extremen ist anstrengend, gleichzeitig aber Teil der Anziehungskraft. Reibung erzeugt schließlich Wärme. Nirgendwo sonst auf der Welt findet man auf so engem Raum so viel Talent, Vielfalt, Möglichkeiten und kreatives Potenzial. Nirgendwo sonst kann man sich so wunderbar in den Tiefen der Straßenschluchten verlieren und sich gleichzeitig so gut aufgehoben fühlen. Jedes dieser vielen ganz unterschiedlichen Stadtviertel ist wie ein individueller Kosmos, der eigene Kiez dagegen ein winziges Dorf.
Bewegende Begegnungen, inspirierende Erlebnisse und dieses ewige Glücksversprechen liegen in New York förmlich in der Luft. Man muss nur die Witterung aufnehmen und sich dann darauf einlassen. Das gilt für Besucher und Bewohner gleichermaßen. Deshalb werde ich auch nach Jahren statt von Alltagsroutine noch regelmäßig von regelrechten Glücksgefühlen erfasst. So stand ich kürzlich das erste Mal inmitten einer Horde Touristen im 100. Stock auf der Aussichtsplattform des über 540 Meter hohen neuen World Trade Centers und war beim 360-Grad-Anblick der Stadt mindestens genauso überwältigt wie jeder Neuankömmling. Auch als mich eine Presseeinladung auf die Dachterrasse eines wohlhabenden Beauty-Moguls an die Nobelmeile der Fifth Avenue führte, verschlug mir sowohl das Central-Park-Panorama als auch die museumsreife Picasso-Sammlung im Penthouse umgehend die Sprache. Und jeden Sonntag überkommt mich ganz banal beim Joggen an der frisch renovierten East-River-Promenade immer wieder aufs Neue eine Ganzkörpergänsehaut, wenn in der Ferne die Freiheitsstatue am Horizont auftaucht. Der Faszination New Yorks kann sich einfach niemand entziehen, egal ob man hier schon seit Jahren lebt oder gerade erst gelandet ist. Deshalb: Ganz viel Spaß, und lassen Sie sich treiben!
Oktober
WIE IM FILM. Ich stand in der New Yorker Bahnhofshalle Grand Central und musste es mir immer wieder selbst bestätigen. Ich fühlte mich wie im Film. Gerade eben war ich durch das reale Filmset von Kinohits wie „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ („Vergiss mein nicht!“) und den Klassiker „North by Northwest“ („Der unsichtbare Dritte“) gelaufen. Durch das glamouröse Beaux-Arts-Gebäude mit der haushohen Kuppel und dem 1912 irrtümlich spiegelverkehrt aufgemalten Himmelsgewölbe. Hier ergriff Jim Carrey Kate Winslets Hand, und Cary Grant floh vor seinen potentiellen Mördern. Während ich noch damit beschäftigt war, mental weitere Kinohits mit dem Tatort New York aufzulisten, spülte der Strom von Menschen mich und meine zwei Koffer durch das Hauptportal hinaus auf den breiten Gehweg. Hätte ich jemals zuvor New York besucht, wäre ich vermutlich besser vorbereitet gewesen. Stattdessen war ich einfach nur überwältigt. Schwärme gelber Taxen. Penetrante Sirenen- und Hupkonzerte. Menschen aller Nationalitäten. Wow, dort drüben ragte sogar die elegante Silberspitze des Chrysler Buildings über die Häuserzeilen hinweg. Absolute Reizüberflutung. Eine Dynamik, die ich so geballt noch nirgends zuvor erlebt hatte. Der Effekt wurde deutlich durch meine eigene Müdigkeit verstärkt. Seit etwa 15 Stunden war ich nun schon unterwegs, war in aller Herrgottsfrühe aufgestanden, um von Hamburg über Paris nach New York zu fliegen. Ich war physisch erschöpft und gleichzeitig völlig aufgekratzt. Ich dachte darüber nach, wie schade es ist, dass man solche Augenblicke nur ein einziges Mal zum allerersten Mal erlebt. Alles war klarer, lauter, größer und intensiver. Meine Synapsen liefen auf Hochtouren. Ein undefinierbares Glücksgefühl durchflutete mich. Ich musste grinsen, als hätte ich einen leichten Schwips, und war so ziemlich die einzige Person, die einfach nur bewegungslos auf dem Bürgersteig stand. Damit hatte ich mich auf den ersten Blick als New-York-Novize geoutet. Wer orientierungslos auf den Gehwegen stand, war im Weg. So wie ich, angewurzelt auf dem Bürgersteig. Die New Yorker navigierten zielstrebig um mich herum, wichen mir aus. Als Tourist gerade so geduldet, aber eindeutig ein Fremdkörper. Ich war ein staunendes Hindernis und schaute mit offenem Mund nach oben, nach rechts, nach links und wieder geradeaus. Jeder Blick fing etwas Neues ein. 125 000 Fahrgäste werden hier täglich durch die Stationen des historischen Bahnhofes geschleust, der mit seinen 44 Bahnsteigen angeblich der größte der Welt ist. Ein ziemlich wildes Treiben. Dabei fing alles so überschaubar an.
John F. Kennedy International Airport. Ich hatte einen riesigen modernen Metropolenflughafen erwartet und sah mich schon mit meinem Gepäck durch das hektische An- und Abreise-Chaos irren. Stattdessen verbrachte ich die erste Stunde in New York mit Warten. Wir Ausländer standen in einer müden, langen Schlange vor der Einwanderungsbehörde eines kleinen miefigen Terminals mit schäbigen Teppichen und Mobiliar aus einem anderen Jahrzehnt. Die Fragen der Einreiseerklärung mussten wir schon im Flugzeug beantworten. Eine konsequente Reihe Neins. Kriminelle Vergangenheit? Nein. Verbindungen zu Terrororganisationen? Nein. Ansteckende Viruskrankheiten? Nein. Ein einziges Ja hätte mich ganz offensichtlich umgehend in die Heimat zurückkatapultiert. In meinem Reisepass klebte ein frisch ausgestelltes Journalistenvisum. Gültig für die nächsten fünf Jahre. Es gab also keinen einzigen Grund, mir die Einreise in die USA zu verwehren. Trotzdem war ich nervös, als ich endlich an der Reihe war. Ich hatte schon zu viele Horrorgeschichten über die Willkür der Beamten der Einwanderungsbehörde gehört, die Touristen, Schiedsrichtern gleich, regelmäßig die Rote Karte zeigten. Insbesondere seit George W. Bush nach dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September das „Department of Homeland Security“ zum Heimatlandschutz vor Terroristen gründete, das seit 2003 auch für Immigration und Grenzschutz zuständig ist. Wer Pech hat, wird gleich mit dem nächsten Flieger wieder nachhause befördert. Und das ist nicht selten von der Laune des jeweiligen Officers abhängig. Mein zuständiger Beamter winkte mich mit seiner linken Hand hektisch zu sich und gab mir zu verstehen, dass er keine Zeit mit mir verschwenden wollte. Das war mir nur recht. Die gut sichtbar positionierte Handwaffe an der rechten Gürtelseite ließ keinen Zweifel an seiner Autorität. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, prasselten seine Fragen wie aus einer Maschinenpistole auf mich nieder. Ungeduldig wedelte er mit meinem Reisepass und kaute dabei gelangweilt sein Kaugummi. „Könnten Sie die letzte Frage bitte wiederholen“, fragte ich eingeschüchtert. Dass ich ganz offensichtlich weder amerikanische Staatsbürgerin noch jemals Gast in diesem Land war, schien er mit Genugtuung zu ignorieren und sprach fast noch undeutlicher, als er die Frage noch mal stellte. Ah, meine Fingerabdrücke, ja richtig, natürlich, wegen der Sicherheit. „Bitte noch mal, und vorher den Finger auf dem Pad befeuchten, der ist viel zu trocken“, zischte er mich an. Also noch mal ein fester Druck links, danach der Zeigefinger rechts. Ein übermüdetes Lächeln in die winzige Kamera, und ich war drin. Sicher gespeichert im Computersystem der amerikanischen Einwanderungsbehörde und erleichtert eingereist in das Land der unbegrenzten Möglichkeit. Bei der Reisepass-Übergabe presste er sich noch ein „Have a nice stay“ durch die kaum geöffneten Lippen. Ja, einen schönen Aufenthalt, genau das wünschte ich mir auch. In der Empfangshalle erwartete uns Neuankömmlinge ein Schwarm Limousinenfahrer. Bewaffnet mit handbeschrifteten Pappschildern starrten sie erwartungsvoll in jedes Gesicht, in der Hoffnung den erwarteten Fahrgast schnellstmöglich in Manhattan abzuliefern. Auf mich wartete niemand. Über acht Millionen Menschen in dieser Stadt und alles Fremde.
„Hi, ich bin Bob. Schön dich kennenzulernen“, stellte sich mein Nachbar im Bus vor, noch bevor ich auf meinem Platz saß. Natürlich ohne Nachnamen. In diesem Land, in dem die Sprache nur „du“ und kein „Sie“ kennt, wurde auf überflüssige Förmlichkeit offensichtlich verzichtet. Bob war etwa fünfzig. Ein attraktiver Mann in einem dunklen Anzug und leicht grauem Haar, irgendwie kreativ. Oder bildete ich mir das nur ein, weil ich zwangsläufig jeden New Yorker für ein kreatives Genie hielt? Nett und wahnsinnig höflich war er ohne Zweifel. Ich fühlte mich gleich ein bisschen weniger allein in dieser großen Stadt, die mein neues Zuhause werden sollte. Als ich ihm erzählte, dass ich das allererste Mal hier bin, war er fast so aufgeregt wie ich. „That is so exciting“, sagte er immer wieder und erzählte, dass er schon seit über zwanzig Jahren in New York lebt und für immer hier bleiben wolle. „New Yorker ist man nicht aus Zufall, sondern aus Leidenschaft“, unterstrich er seine Entscheidung. An New York gebunden, ganz ohne Fesseln. Er hörte mir mit größtem Interesse zu und ignorierte ganz offensichtlich meine holprige Aussprache. Unter keinen Umständen würde sich ein Amerikaner anmerken lassen, dass er gerade mit einem nach Worten und grammatikalisch korrekten Sätzen ringendem Ausländer kommunizierte. Jeder Fehler wird galant ignoriert und auf jeden noch so kurzen Schlagabtausch folgt meistens ein überschwängliches Kompliment. Fast so, als wäre man adoptierter Muttersprachler. Auch wenn sich der deutsche Akzent meist schon beim ersten Satz ins Ohr bohrt. Denn das Zungenbrecher-„th“, das uns meistens nur als scharfes „ß“ durch die Zähne rutscht, entlarvt die Deutschen sofort. Stichwort „Happy Börssssday“. Amerikaner musste man regelrecht anflehen, auf immer wiederkehrende Fehler hinzuweisen. Und davon gab es bei mir einige. „Den zweiwöchigen Sprachkurs in der School of English in Hamburg hätte ich mir wirklich sparen können“, erzählte ich Bob frustriert, als ich ihm im Bus einen vorstammelte. „Ihr Deutschen wollt immer perfekt sein. Hauptsache, das Vokabular reicht für ganze Sätze“, entgegnete Bob ermutigend.
Mein erstes englisches Gespräch außerhalb eines Klassenzimmers erforderte so viel Konzentration, dass Bob mich daran erinnern musste, zwischendurch auch mal aus dem Fenster zu schauen. „Genau hier habe ich auch nach so vielen Jahren noch immer eine Gänsehaut!“, rief er feierlich, als am Horizont plötzlich die Silhouette der Wolkenkratzer auftauchte. Wie oft hatte ich diese legendäre Linie schon gesehen. Auf Postkarten, im Fernsehen, in Zeitschriften, aber noch nie live. Augenblicklich überfiel auch mich eine Gänsehaut, die anhielt, bis der Bus am Grand Central stoppte. Statt sich einfach zu verabschieden, wuchtete Bob meine zwei schweren Taschen aus dem Kofferraum und trug sie mir in die Bahnhofshalle. „Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit und hoffe, du wirst New York lieben“, sagte er zum Abschied und klang fast ein bisschen besorgt, dass ich von seiner geliebten Stadt nicht genauso begeistert sein könnte wie er. Er lachte mir aufmunternd zu, drehte sich um, und im nächsten Moment hatte ihn die Millionenmetropole schon verschluckt.
Da stand ich also verloren und überwältigt an der Bushaltestelle und schlug mein kleines Notizbuch auf: Madison Avenue, meine neue Adresse. Art-déco-Prunkbauten. Edle Designerboutiquen. Elegant geföhnte Damen in Chanel-Kostümchen. All das ging mir durch den Kopf, als ich vor einem Monat in meiner Hamburger Altbauwohnung saß und mir von der deutschen Immobilienmaklerin Petra aus New York ein Apartment andrehen ließ. Madison Avenue – einer der wenigen New Yorker Straßennamen, unter denen ich glaubte, mir etwas vorstellen zu können. Ich sah mich im Geiste schon auf dem Weg in mein neues Apartment durch die blitzblanke Lobby laufen. Vorbei am höflich grüßenden Doorman in seiner bordeauxroten Uniform. „Möblierte Wohnung mit Holzfußboden, Küche und Badezimmer mit Wanne auf der Madison Avenue. Perfekte Lage. U-Bahn-Linien rechts und links. Man ist im Nu überall“, versprach Petra. „Und in der Gegend möchte man wirklich wohnen?“, fragte ich noch mal unwissend nach. „Glaub mir, eine eigene Wohnung auf der Madison Avenue für tausend Dollar ist ein echter Glücksfall“, wich sie meiner Frage geschickt aus. Aus sechstausend Kilometer Entfernung in einer fremden Stadt eine Wohnung mieten? War das eine gute Idee? Und tausend Dollar für ein winziges Apartment war aus der Perspektive meiner hundert Quadratmeter großen, 700 Euro günstigen Altbauwohnung in St. Pauli nicht gerade ein Schnäppchen. Aber hatte ich eine andere Wahl? Weder hatte ich Freunde mit ausziehbaren Schlafsofas noch das Budget für ein Hotel. Außerdem war die Aussicht, gleich nach Ankunft in meine eigene Wohnung fahren zu können, sehr verlockend. Auch der Luxus, sich keinen Wer-putzt-das-Badezimmer-WG-Debatten aussetzen zu müssen, schien das Risiko wert.
Ich starrte aus dem Fenster. Am Grand Central war ich direkt an der Madison Avenue in den Bus gestiegen, der gen Norden direkt bis vor meine neue Haustür fuhr. Anfangs sah es haargenau so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Vorbei am Armani Shop, dem Carlyle Hotel und dem Whitney Museum, einem Bauhaus-Meisterwerk von Marcel Breuer. Kurz darauf ließ der Bus langsam und bei jedem Stopp laut schniefend die 80. Straße hinter sich, und allmählich verändert sich das Bild. Die schicken Läden waren plötzlich verschwunden, auch die charmanten französischen Bistros. An deren Stelle traten Fast-Food-Imbisse und Häuser, die eher nach sozialem Wohnungsbau als nach Prestige-Architektur aussahen. Die in Ralph Lauren gekleideten Katalogmütter und mit Balenciaga-Handtaschen bewaffneten Damen waren mittlerweile ausgestiegen. In der 125. Straße angekommen, schaute ich mich um. Ja, tatsächlich, ich war die einzige hellhäutige Person im Bus. Und damit das erste Mal in meinem Leben in der ethnischen Minderheit. Willkommen in Harlem.
Vor der Tür wartete schon meine Immobilienmaklerin Petra. Ich hatte alles auf sie gesetzt und fühlte mich betrogen, noch bevor ich die Wohnung betreten hatte. Aber ich war zu erschöpft, die Zertrümmerung meiner naiven Illusionen zu thematisieren. Die unerwartete Identitätswandlung der Madison Avenue erinnerte mich an all die Warnungen, auf die ich in meinem Reiseführer zum Stadtteil Harlem gestoßen war. Bis dato hatte ich diese einfach ignoriert. „Laufen Sie nach Einbruch der Dunkelheit auf keinen Fall ohne Begleitung durch Harlem“, stand da zum Beispiel. Ich hoffte noch immer, dass sich solche Vorsichtsmaßnahmen als längst überholt herausstellen sollten. Schließlich war das gefährliche New York der Achtziger, dank Ex-Bürgermeister Rudolph Giuliani, längst Vergangenheit. Hatte er nicht radikal aufgeräumt im düsteren Moloch New York und die Stadt von Übel und Kriminalität befreit – war das nicht lange überall Schlagzeile? Hatte ich nicht kürzlich sogar noch gelesen, dass New York die sicherste Großstadt der Staaten sei? Oder? Es wartete sicherlich kein Taxifahrer dieser Stadt mehr vor der Haustür, bis das Licht in der Wohnung des ausgestiegenen Fahrgastes anging, nur um sicherzustellen, dass dieser die zehn Meter zum eigenen Apartment überlebt hatte. Das war früher tatsächlich der Fall. Gruselgeschichten wie diese geben die alteingesessenen New Yorker immer wieder gerne genüsslich zum Besten. Worauf in den meisten Fällen ein Schwall wehmütiger, romantisch eingefärbter Erinnerungen folgte, die damit endeten, dass New York beschuldigt wurde, nicht mehr das zu sein, was es mal war. Es ist die Rede vom Verfall des Mythos New York. „Ja, die Stadt hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Die Wirtschaft boomt wie lange nicht. Aber wie überall auf Kosten von Kreativität und der multikulturellen Vielfalt, die von Kommerz und Geldgier vertrieben und zerstört werden“, hatte Bob mir schon im Bus vorgehalten, „Junge Kreative und Immigranten aus der ganzen Welt, die diese Stadt zu dem machen, was sie ist, und sie jahrzehntelang vorantrieben, können sich mittlerweile weder die Mieten, noch die Umsetzung ihrer Ideen und Träume leisten.“ Stattdessen wimmelt es von Investmentbankern und Immobilienmaklern, die über ehemalige Künstlerviertel wie SoHo und die Lower East Side herfallen. SoHo steht für „South of Houston“ und ist mittlerweile eher eine edle Shoppingmeile für Touristen als die Stätte kreativer Kopfgeburten. „Die Gentrification macht sich wie ein Virus in der ganzen Stadt breit. Nachbarschaft für Nachbarschaft. Das Meatpacking District ist ein Paradebeispiel“, seufzte Bob und machte mich gleich am ersten Tag mit dem Wort bekannt, das für die geldgesteuerte Transformation der Viertel stand. Im Meatpacking District, südwestlich von der 9th Avenue, Ecke 14. Straße wurden vor wenigen Jahren noch Schweine und Rinder in alten Industriehallen geschlachtet und gelagert. Wo kürzlich noch Blut durch die Straßenrinnen lief, stöckeln mittlerweile teuer gekleidete Damen mit Föhnfrisuren in High Heels über das Kopfsteinpflaster. Auf dem Weg zu edlen Boutiquen von Diane von Furstenberg, Apple und Vitra. Noch vor 20 Jahren verdienten hier Prostituierte und Transvestiten ihr Geld. Substantieller Broterwerb wurde von nächtlicher Unterhaltung auf teurem Niveau ersetzt. In den vielen schnieken Clubs ist man schon am Eingang zwanzig Dollar los. Und es macht den Eindruck, als wenn hier jeden Monat ein neues Lokal eröffnete, das dann umgehend von Celebrities wie Lindsay Lohan heimgesucht wird. Mittendrin ragt das moderne, kürzlich erbaute Gansevoort Hotel wie ein Fremdkörper über die alten Lagerhallen und Loftgebäude hinweg. Dessen Rooftop-Bar bietet zwar einen spektakulären Blick über den Hudson River, aber nur Auserwählten: Wer als Mann kurze Hosen trägt, hat sich disqualifiziert und wird gar nicht erst hochgelassen. Diskutieren zwecklos.
Glaubte ich meiner Maklerin Petra, würde mein neues Zuhause Harlem in Kürze zum nächsten Meatpacking District mutieren. „Harlem ist ganz sicher die nächste ‚Up and Coming Neighborhood‘“, behauptete sie, „H&M hat eine Filiale eröffnet, und auch Starbucks. Und direkt hier um die Ecke in der 125. Straße ist auch Ex-President Clinton vor kurzem in sein neues Office gezogen.“ Petra hatte meine Enttäuschung also bemerkt und versuchte, mir meine neue Nachbarschaft schmackhaft zu machen. Vergebens. Ein zweites Mal würde ich mich nicht um den Finger wickeln lassen. Sicher, auch hier gab es einiges zu entdecken. Das legendäre Apollo Theater zum Beispiel, das ich am darauf folgenden Mittwoch besuchte. „Ein absolutes Must“, wie mir Petra vorab deutlich machte. Einmal die Woche findet hier die „Amateur Night“ statt, in der sich Gospelsänger aus der Provinz auf die Bühne wagen in der Hoffnung, entdeckt zu werden. Und das schon seit über siebzig Jahren. Angeblich haben hier Jazz- und Soulgrößen wie Ella Fitzgerald und James Brown ihre Karriere begonnen. Ich musste mich drei Mal umsetzen, weil an den ersten mir zugewiesenen Sitzen mit den abgewetzten Polstern jedes Mal eine Armlehne fehlte. Die glorreichen Zeiten verlangten nach einer Renovierung, die kurz nach meinem Besuch stattfand. Das Publikum war trotz allem kaum zu bremsen und tobte bei jeder Vorführung. Oder buhte gnadenlos, bis ein Clown die geknickten Sänger von der Bühne zerrte. Darüber war ich ziemlich erschrocken, aber das radikale „Top or Flop“-Talente-Ausfiltern war anscheinend Tradition.
Meine Wohnung selbst war akzeptabel. Nicht überwältigend. Aber das hatte ich für tausend Dollar in New York auch nicht erwartet. Zweiter Stock, Altbau, Holzfußboden, etwa 25 Quadratmeter. Eigentlich alles so, wie Petra versprochen hatte. Die Küche lag direkt im Eingangsbereich. Das Badezimmer war okay, auch wenn die von Petra angepriesene Wanne nicht gerade zu Schaumbädern verführte. Im Wohnzimmer prunkte eine geschmacklose Esstisch-Garnitur, daneben ein belangloses Sofa, vor dem ein monströses Fernsehgerät stand. Es gab zwar keinen Doorman, aber dafür dudelte in dem menschenleeren Flur ein Radio 24 Stunden am Tag. Warum, konnte mir niemand sagen. Harlem Renaissance hin oder her, ich fühlte mich, auch ohne zu wissen, wo ich eigentlich war, am Ende der Insel. Und die war 13,4Meilen lang. Von wegen mittendrin. Downtown war mindestens 15 U-Bahn-Stopps entfernt. Und dort war das New York, für das ich Hamburg verlassen hatte.
Nah war nur der Central Park. 15 Blöcke entfernt, zwölf Minuten zu Fuß. Und hier wurde die Abgeschiedenheit zum Vorteil. Während halb Manhattan am Wochenende von der Südstirn, der Ost- und der Westflanke in den Park strömte, war man hier oben in Harlem im Norden fast allein. Ohne direkten Kontakt mit den 25 Millionen Besuchern, die jährlich auf der Suche nach Erholung und frischer Luft in den Park pilgern, war der urbane Naturersatz fast glaubhaft. Die grüne Lunge New Yorks, 1857 künstlich angelegt, vier Kilometer lang und 800 Meter schmal, ist fast doppelt so groß wie Monaco. Gebaut wurde diese Metropolen-Oase, weil die vom Großstadtleben, dem Lärm und Gedränge erschöpften New Yorker schon vor 150 Jahren großen Bedarf an Erholung hatten. Man erhoffte sich damals, mit einer grünen Zuflucht soziale Unruhen zu verhindern, und realisierte das Millionenprojekt trotz der damaligen Wirtschaftskrise. Arm und Reich sollten sich hier nebeneinander entspannen. Das scheiterte anfangs, denn die arme Bevölkerung konnte sich den Penny für die Busfahrt nicht leisten. Damals lag der Park weit oberhalb des Stadtzentrums, war von Brachland umgeben und nicht so einfach zu erreichen. Mittlerweile ist die Stadt längst über den Central Park hinausgewachsen, und der Park ist tatsächlich „central“. Gar nicht auszudenken, was wäre, wenn es diese Idylle mit den Seen, Wegen, Wiesen, Wäldchen, Sport- und Spielplätzen, dem Zoo, der Eislaufbahn im Winter, dem Pool im Sommer und dem alljährlichen Kulturangebot an Opern, Konzerten und Theaterstücken nicht gäbe.
Es war noch früher Sonntagvormittag. Die Sonne strahlte wie jeden Tag vom blauen Himmel. Der Herbst hatte schon begonnen, aber es lag noch so eine Ahnung von Sommer in der Luft. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, Starbucks zu meiden. Aber ich war in Harlem und hatte keine andere Wahl. Ein nettes Café hatte sich trotz der Prophezeiung meiner Maklerin Petra leider bisher noch nicht in meine Nachbarschaft verirrt. „Latte, Venti, ja, ganz normale Milch, bitte.“ Um mich herum flogen komplizierte Bestellungen durch den Raum. Mit Sojamilch, aber ohne Schaum, dafür ein Spritzer Karamell, ach ja: entkoffeiniert, bitte. Hier standen offensichtlich massenerprobte Profis an der Espressomaschine. Geduldig und flink setzten sie jeden Extrawunsch in die Tat um. 220 Filialen bevölkern mittlerweile Manhattan, und vor jeder einzelnen Kasse wartet zu allen Tages- und Nachtzeiten eine lange Schlange koffeinhungriger Menschen. Diese Kaffeeketten-Epidemie war mir persönlich eher unsympathisch. Aber in New York ist die Starbucks-Dichte ziemlich praktisch, wie ich feststellte, als ich das erste Mal eine öffentliche Toilette suchte und nur hier fündig wurde. Ich spazierte also mit meinem Starbucks-Wappen-Pappbecher zum Central Park. Vor mir lag eine bunte Baumlandschaft, die in den schönsten Herbsttönen leuchtete. Ein Farbenmeer aus gelben, roten, braunen und teilweise noch grünen Blättern. Irgendwann wurde mir diese schöne, aber menschenleere Stille im Norden des Parks zu einsam. Mir selbst Gesellschaft zu leisten, das hatte ich den letzten Tagen zur Genüge getan. Mir war nach Menschen zumute. Ich lief also immer weiter Richtung Süden. Dort fand ich das, was sich die Visionäre und Erbauer des Parks damals gewünscht hatten: den New Yorker „Melting Pot“. Menschen aus über 200 Ländern, die mehr als 170 Sprachen sprechen. Die unterschiedlichsten Ethnien, Kulturen, Lebenseinstellungen, Denkweisen und Steuerklassen. Eine Metapher, mit der der russisch-jüdische Autor Israel Zangwill 1908 mit seinem gleichnamigen Theaterstück das erste Mal New York beschrieb und die noch heute greift. Nach einer Stunde war ich so ziemlich jedem Klischee-New-Yorker dieser Stadt begegnet. Ich bestaunte die vielen Dog-Walker, die zum Teil acht Leinen in einer Hand jonglierten, an denen acht ganz unterschiedliche Hunderassen hingen. Groß, klein, dürr, dick, niedlich, hässlich. Wie ferngesteuert ging dieses Menschen-Hunde-Gespann seines Weges. Wie war das nur möglich? Beruhigungsmittel? Keiner tanzte aus der Reihe oder hob unangemeldet sein Bein. „Oh, ich wusste gar nicht, dass du einen Hund hast“, überhörte ich ein Gespräch hinter mir. Ich drehte mich um und sah einen jungen Typ, der eine kleine veredelte Ameise wie eine lebende Handtasche auf dem Arm trug und darauf sagte: „Ja, er verlässt nur sehr ungern das Haus, deshalb gehe ich so gut wie nie mit ihm spazieren.“ Sein Gegenüber nickte verständnisvoll.
Ich überquerte die einzig große Straße im Park, die sich von Süden nach Norden quer durch das Grün schlängelt. Unter der Woche war dies eine beliebte Abkürzung für Taxi- und Autofahrer. An Samstagen, Sonntagen und unter der Woche ab 19 Uhr wird die Straße für Autos gesperrt, aber der Verkehr verdichtet sich: Rollerblader, Jogger, Radrennfahrer und Kutschen verwandeln die Straße in einen pulsierenden Parcours. Auf der Wiese gegenüber trainierten Väter in ihren Elite-College-T-Shirts eifrig mit ihren Söhnen Baseball. Eine in rote Trikots gekleidete Gruppe Jugendlicher feuerte schreiend den jeweiligen Schläger ihres Teams an. Auf etlichen Spielplätzen kreischten Kinder. Die Mütter waren auf den Bänken angeregt ins Gespräch vertieft. Wie ich später feststellte, bot sich genau auf diesen Spielplätzen unter der Woche ein ganz anderes Bild. Von Eltern war an diesen Tagen keine Spur, stattdessen klopften dunkelhaarige Nannys den Sand von den Hosen blonder Kinder, die ganz offensichtlich nicht ihre eigenen waren.
Die Szenerie war interessanter als Fernsehgucken. Überall ragten die oberen Etagen der in der Ferne stehenden Hochhäuser über die Baumwipfel hinweg und rahmten den Central Park am Horizont wie ein Gemälde ein. „In welchem Haus wohnt wohl Woody Allen? Und Mia Farrow, lebt die tatsächlich direkt gegenüber?“, dachte ich. Gerne hätte ich jetzt auf einen mentalen Auslöser gedrückt, um diese Szene für immer festzuhalten. Und dann – ich traute meinen Augen kaum. War er es wirklich? Bob? Mein erster Amerikaner, Bob aus dem Bus? Etwas zu laut schrie ich quer über die Wiese: „Bob!“, als hätte ich einen alten, jahrelang vermissten Freund wiedergefunden. So kam es mir in diesem Augenblick allerdings auch vor. Er drehte sich um und strahlte mich an. Tatsächlich, er war es. „Na, das gibt es ja gar nicht, the little German girl“, sagte er, und ich hoffte sehr, dass seine Freude so ernst gemeint war wie meine. Ansonsten hätte mich meine losgelöste Wiedersehenseuphorie ziemlich blamiert.
Damals wurde mir das erste Mal klar, wie klein diese Stadt mit ihren 26 Quadratmeilen trotz der mythischen Größe sein kann. Zufallsbegegnungen dieser Art häuften sich von Monat zu Monat. Das lag natürlich auch daran, dass sich mein eigener Lebensradius reduzierte, je besser ich die Stadt kennenlernte. Wenn man erst mal weiß, wo’s einem am besten gefällt, stellt sich ein gewisser Lokalpatriotismus ein, und plötzlich findet man sich selten in einer anderen Nachbarschaft als der eigenen wieder. Aber davon war ich in meinem ersten Monat noch weit entfernt. Erst mal musste mein Arbeitsleben beginnen und damit die Routine. Meine drei arbeitslosen Sightseeing-Wochen waren vorbei, und der erste Arbeitstag stand bevor.
Das Büro lag in Midtown, in einem der Rockefeller-Center-Gebäude. Und ausnahmsweise hatte Petra mal Recht. Der Weg zur Arbeit dauerte tatsächlich nur 25 Minuten. Von Tür zu Tür. In Midtown wird eigentlich nur gearbeitet, alles ist auf Business- und Bürobedürfnisse ausgerichtet. Ganz nebenbei werden Horden von Touristen durch die Hochhausschluchten geschleust. Ich glaube, genau so hatte ich mir New York aus der Ferne vorgestellt. Mittelpunkt sind die neunzehn Rockefeller-Art-déco-Bauten, die in den Dreißigerjahren von der gleichnamigen Familie errichtet wurden. Die waren Anfang des letzten Jahrhunderts eine der reichsten Familien Amerikas, die einen Großteil ihres Vermögens dem Ölgeschäft zu verdanken hatten. Die Rockefellers schufen hier schon vor vielen Jahrzehnten eine Infrastruktur, die es den fleißigen Menschen in Anzügen ermöglicht, ihre Arbeitszeit zu maximieren. Unter den Gebäuden erstreckt sich ein ausgeklügeltes Passagen-Netz, ein kleines, unterirdisches, kommerzielles Versorgungsdorf, das man nicht zu verlassen bräuchte. Eine Post, Banken, ein Schuster, Sandwich-Theken, Starbucksfilialen, ein Friseur, eine Drogerie, ein Blumenladen. Hier hatte man alles, außer Tageslicht. Selbst die U-Bahn-Stationen befanden sich direkt unter den hohen Officetürmen. Emsigen Ameisen gleich strömten die Büromenschen wie auf vormarkierten Wegen aus der U-Bahn über den Bahnsteig, die Treppe hoch, durch die Lobby und verschwanden in den Aufzügen. Ich musste in der eleganten Lobby mit den goldverputzten Wänden erst mal kurz innehalten und mich aus diesem eifrigen Menschenstrom befreien. Ich beobachtete, wie die Leute mit ihren Gebäudeausweisen die kleinen Sperrschranken passierten, um zu den Aufzügen zu gelangen, und fühlte mich wie in einem Hochsicherheitstrakt. Zwei Minuten später stand ich suchend im Aufzug und konnte den Knopf für die 26. Etage nicht finden. Dort sollte mein Büro sein. War ich im falschen Gebäude, oder hatte ich die Adresse falsch notiert? „Nein, nein, Sie sind nicht falsch, die Aufzüge auf dieser Seite halten nur bis zum 15. Stock, mit denen auf der anderen Seite können Sie zu allen Etagen oberhalb des 15.