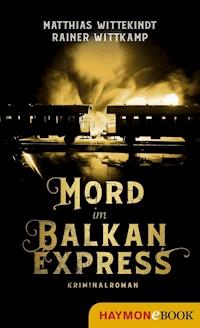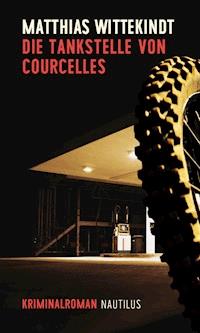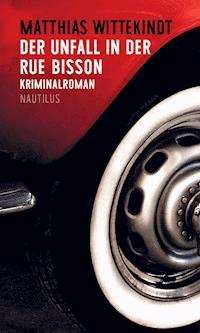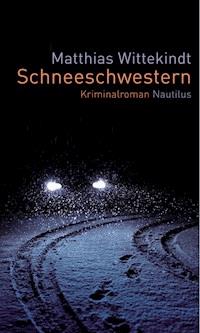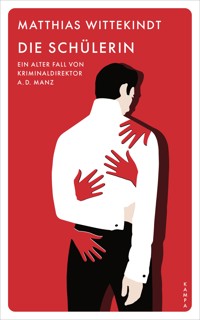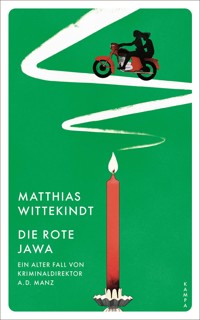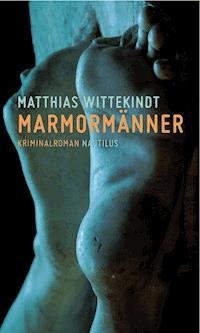Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Bauge, eine kleine französische Hafenstadt in der Bretagne, im November. Der Küste vorgelagert wird gerade ein großes Strömungskraftwerk gebaut, die Arbeiter kommen fast alle aus China und sind in einem Lager quasi kaserniert. Als man Leichenteile findet und eine Frau im Park überfallen wird, fällt der Verdacht schnell auf die Fremden. Sergeant Ohayon, zur Verstärkung aus Fleurville beordert, muss sich mit den Geheimnissen und Allianzen in dieser kleinen Stadt auseinandersetzen: Die unerklärlichen Ereignisse häufen sich. Ganz in der Nähe der Stelle, an der die Frau überfallen wurde, wird ein Mädchen überfahren, der Fahrer ist flüchtig. Aber warum geriet sie überhaupt mitten in der Nacht an dieser gefährlichen Stelle auf die Straße? War sie vor etwas auf der Flucht? Zwischendurch lässt Wittekindt den Leser dem wahren Mörder über die Schulter schauen. Nur, für welche Taten ist dieser Mörder wirklich verantwortlich? Der neue Band mit dem dicken, ständig unterschätzten Ohayon fesselt durch die Figuren und die schwebende Stimmung - ein Roman wie ein französischer Film!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Wittekindt
EIN LICHT IM ZIMMER
Kriminalroman
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg
Schützenstraße 49 a · D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 2014
Originalveröffentlichung · Erstausgabe Oktober 2014
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
1. Auflage
Print ISBN 978-3-89401-795-8
E-Book ePub ISBN 978-3-86438-161-4
Inhalt
Prolog
Dienstag
Mittwoch
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Montag
Samstag
Was Silvia Courbet am meisten an ihrer Tochter aufregte, war der Hals.
Ein paar Monate, nachdem Eva zwölf geworden war, hatte das angefangen. Dieses Verlängern des Halses, die stolze Art, wie Eva ihr Kinn hob und den Unterkiefer vorschob, wenn sie mit ihrer Mutter sprach. Obwohl also genau genommen das Kinn verantwortlich war, richtete sich der Zorn ihrer Mutter gegen den Hals.
Da Eva nicht verstand, was an ihrem Hals falsch war, sah sie sich den ihrer Mutter genauer an. Als sie begriff, was damit nicht in Ordnung war, begann sie sich für ihren eigenen Körper zu interessieren. Für ihre Haut, ihre Augen, ihre Haare.
»Ich hasse dich!«
»Ich dich auch!«
Evas Geburt war eine Quälerei gewesen, weil sie falsch herum lag. Obwohl die Ärzte der Schwangeren erklärt hatten, dass eine Steißlage für das Kind mit Gefahren verbunden wäre, ging Silvia Courbet das Risiko ein und hielt die Schmerzen bei der Geburt aus. Warum sie sich nicht zu einem Kaiserschnitt überreden ließ, konnte sie später nicht erklären. Nun, das Kind war gesund zur Welt gekommen, und so spielte ihre eigenwillige Entscheidung keine Rolle mehr. Als ihr Mann sie ein paar Monate später fragte, ob kosmetische Gründe eine Rolle gespielt hätten, erklärte sie ihm, sie hätte gewusst, dass alles gutgehen würde.
Eigentlich hatte sie kein Kind gewollt.
Richard hatte es dann aber doch geschafft, seine Frau zu überreden, und nach der Geburt änderte sich Silvias Einstellung. Wenn Richard abends nach Hause kam, erzählte sie ihm als Erstes, was ihre Tochter Neues entdeckt hatte.
»Eva hat wieder vor dem Spiegel gestanden.«
Das waren besondere Momente. Eva war mit ihren zwölf Monaten noch unsicher auf den Beinen. Meistens zog sie sich vor dem Spiegel hoch, sah sich mit großen Augen selbst an und versuchte dann, nach ihrem Spiegelbild zu greifen. Natürlich konnte sie es nicht fassen. Manchmal fand sie das amüsant. Dann lachte sie und stampfte vor Freude mit dem Fuß auf. Das Anstarren ihres Gesichts endete stets damit, dass sie ihren Mund öffnete, ihn gegen den Spiegel presste und so eine ganze Weile verharrte.
Silvia wurde während dieser Spiegelphase richtig kindersüchtig. Sie hätte gerne noch eins bekommen. Aber das wurde nichts mehr.
Auch Richard war begeistert von seiner Tochter. »Hast du mal auf ihre Augen geachtet? Man sieht richtig, wie ihr Verstand arbeitet.«
Richard stand immer auf Evas Seite. Vor allem, als sie älter wurde. Vielleicht weil er spürte, dass seine Frau anfing, eifersüchtig zu werden. Aber war sie wirklich eifersüchtig? Auf ein Kind? Möglicherweise war er ein bisschen zu begeistert von seiner Tochter, und vielleicht nervte das seine Frau. Es ließ sich später gar nicht mehr sagen, wer damit angefangen hatte. Richard meinte, Silvia wäre zu kritisch ihrer Tochter gegenüber, und vermutete, er hatte mit einem Freund darüber gesprochen, dass es vielleicht mit der schmerzhaften Geburt zu tun hatte. Beiden Männern war natürlich klar, dass sie es stark übertrieben mit ihren Deutungen.
Wie auch immer. Richard Courbet nahm sich ab Evas elftem Lebensjahr viel Zeit für seine Tochter. Sie machten Ausflüge, fuhren zum Einkaufen in die Stadt. Eva bekam ständig kleine Geschenke von ihrem Vater. Silvia und ihre Freundin Catherine hatten inzwischen eine Galerie in London übernommen, und so war Silvia die Woche über weg. Richard Courbet machte bei Renault Karriere. Zuhause war alles gut organisiert, Eva kam mit ihrer Tagesmutter bestens zurecht. Sie wurde früh selbstständig, hielt sich an Vereinbarungen und kümmerte sich sogar eine Weile um das Pony einer Freundin, die es – Evas Worte – vernachlässigte. In dieser Phase ihres Lebens hingen viele Poster von Ponys und Pferden in ihrem Zimmer.
Aber natürlich war nicht alles gut und in Ordnung mit ihr, sonst wäre sie ja kein Kind gewesen. Es gab da einen hässlichen Zwischenfall. Die Besitzerin des Reiterhofs rief an einem Samstagnachmittag um kurz nach vier bei Silvia an.
»Sie müssen Ihre Tochter abholen.«
»Ist ihr etwas passiert?«
»Sofort.«
»Was ist denn los, ist Eva vom Pferd gestürzt?«
Eva hatte angeblich ein Pony geschlagen. Ein schwarzes, ziemlich dominantes Pony, das September hieß.
»Meine Tochter soll ein Pony geschlagen haben?«
»Nicht nur ein bisschen, glauben Sie mir, Madame, nicht nur ein bisschen.«
Es blieb das einzige Mal, dass so etwas vorkam, und Eva hatte den Vorfall ja auch erklärt: »September hat den Kleinen immer alles weggefressen und sie gebissen!« Zwei Wochen später durfte sie wieder auf den Hof und entschuldigte sich für das, was sie getan hatte.
Nach einigen Umzügen, die mit Richards Beruf zusammenhingen, landete die Familie in Bauge, einem Städtchen mit knapp 14000 Einwohnern – direkt an der Atlantikküste. Der Ort war ideal für die Familie. Silvia konnte mit der Fähre nach England übersetzen und war in vier Stunden in ihrer Galerie. Richard hatte es auch nicht weit zur Arbeit. Renault hatte in der Nähe von Bauge ein neues Werk errichtet, in dem Lichtmaschinen und modernste Hybridmotoren gefertigt wurden. Eva war inzwischen vierzehn. Sie zogen in eine Villa auf den Klippen von Roche, einem Vorort von Bauge. Der Ausblick aus dem Wohnzimmer war atemberaubend.
Zur Zeit des Umzugs hatte Eva noch ganz lange, glatte Haare und einen schnurgeraden Pony. Kurz darauf trug sie ihr Haar schulterlang und leicht gewellt. Die Pferdebilder hatten den Umzug nach Bauge zwar noch mitgemacht, aber … Eva hängte sie nicht wieder auf.
Eva kam in ihre Experimentierphase. Es fing damit an, dass sie immer mehr Zeit im Badezimmer verbrachte. Anfangs waren zwei Freundinnen in Evas Badezimmersessions mit einbezogen. Es war immer das Gleiche. Erst wurde eine Farbe ausgesucht, dann gingen die drei ins Badezimmer, und nach einer halben Stunde kam eins der Mädchen heulend wieder heraus, während die beiden anderen hinterherliefen und entweder lachten oder beteuerten, dass es doch gut aussähe oder beides zusammen.
Es wurde immer wilder. Blond, schwarz, blond mit Strähnchen, rot, Kastanie. Rotorange, dann wieder blond. Zuletzt blond. Alle drei. Gewellt. Alle drei. Und ein Piercing. Unterlippe. Aber nur eins.
»Muss das sein, Eva? Was, wenn sich das entzündet?«
Dazu verschiedene Hosen. Jeans, Leggins, Stoffhosen. Dann Röcke. Verschiedene Längen.
»Nein! Hast du dich mal im Spiegel gesehen?«
Die drei pushten sich total hoch.
Eva wusste inzwischen, dass »weiblich« für die Mädchen ihrer Klasse etwas anderes bedeutete als für sie. Zum Beispiel Träume. Gut oder schlecht über andere reden, Freundschaften, Liebe, Bücher lesen. Französisch war Evas zweitbestes Fach, sie las ziemlich viel. In Mathe war sie noch besser, da war sie die Nummer eins. Aber dann ließ sie in Mathe nach. Das hatte nichts damit zu tun, dass sie zu viel Zeit damit verbracht hätte, sich zu stylen, es lag daran, dass sie noch besser in Französisch werden musste, und das wiederum hing damit zusammen, dass sie unbedingt Mitglied im BUCHCLUB werden wollte. Vom BUCHCLUB hatte Eva immer nur gehört. Sie wusste weder, wo er war noch was dessen Mitglieder eigentlich machten. Lesen möglicherweise.
Niemand in ihrer Schule – in der es nur Mädchen gab, was Vor- und Nachteile hatte –, niemand dort wusste Näheres über den BUCHCLUB. Trotzdem hielt sich die Behauptung, dass es ihn gab. Dort Mitglied zu sein, bedeutete so etwas wie die Aufnahme in eine Geheimgesellschaft, da waren sich alle einig. Dabei zu sein, würde für Eva vor allem bedeuten, dass sie aus der Mittelmäßigkeit herauskam. Eva empfand ihre Umgebung von einem bestimmten Zeitpunkt an nämlich als durchschnittlich und langweilig. Nachdem sie erkannt hatte, dass ihre Familie nicht schlecht, sondern einfach nur bedeutungslos war, hörte sie auf, sich mit ihrer Mutter zu streiten. Es waren ja auch gar keine richtigen Streits gewesen, eben nur diese kleinen Zankereien. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter wurde besser, Evas Vater dagegen verlor an Bedeutung. Nein, das trifft es nicht. Das Verhältnis zwischen Eva und ihrem Vater wurde regelrecht problematisch. Woran das lag? Wahrscheinlich daran, dass sich Eva immer öfter mit Jungen traf. Väter sind manchmal furchtbar ängstlich mit ihren Töchtern.
Alle, die sich auskannten, hatten Eva gesagt, dass niemand einfach so Mitglied im BUCHCLUB wurde, indem er zum Beispiel irgendwo hinging und sich bewarb. Das wäre ja auch gar nicht möglich gewesen, da niemand wusste, wo der BUCHCLUB überhaupt war. Nein, man wurde von denen selbst aufgefordert. Die Mitglieder des BUCHCLUBS, so hieß es, würden schon wissen, wen sie bei sich haben wollten und wen nicht. Zwei Monate vor ihrem 15. Geburtstag hatte Eva ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Sie war die Beste in Französisch und durfte in der Aula eine Kurzgeschichte vortragen, die sie geschrieben hatte. »Schön und klug«, stand in der Gazette de Bauge, dazu ein Foto von ihr, und natürlich ihre Geschichte. Trotz dieses Erfolgs geschah nichts. Niemand meldete sich, niemand forderte sie auf, sich an einen geheimen Ort zu begeben. Zuerst war Eva enttäuscht, dann begann sie an der Existenz des BUCHCLUBS zu zweifeln, und der Traum löste sich auf. Als sie nach ein paar Wochen noch mal daran dachte, kam es ihr vor, als läge das alles schon sehr weit zurück.
Aber so viel Zeit war gar nicht vergangen.
Sechs Wochen nach ihrem Vortrag in der Aula war sie auf einer Party von Sarah. Eva hatte den ganzen Abend getanzt, denn das war immer noch die beste Möglichkeit, sich die Jungen vom Hals zu halten. Und sie hatte getrunken. So bekam sie erst gar nicht mit, was Sarahs kleine Schwester von ihr wollte.
»Hier!« Die Kleine war auf die Tanzfläche gekommen und zog Eva am Ellenbogen. »Hier!«
»Was denn?«
»Für dich, das hat einer abgegeben, du sollst rauskommen.«
Eva nahm die Karte, die das Mädchen ihr hinhielt und las. BUCHCLUB. In Großbuchstaben mit Bleistift auf ein Pappkärtchen geschrieben.
»Was ist das?«, wollte das Mädchen wissen.
»Nichts«, sagte Eva und ging hoch. Sie sah auf ihr Handy. Genau Mitternacht. Draußen würde es kalt sein, sie zog ihre Jacke an. Sie tat das nicht gerne, wenn es um wichtige Begegnungen ging, weil sie meinte, die Jacke mache sie hässlich. Eva überlegte kurz, ob sie Sarah holen sollte, schließlich unternahmen sie seit einiger Zeit fast alles zusammen, und Eva wusste, dass ihre Freundin auch in den BUCHCLUB wollte. Aber dann dachte sie, dass es sicher einen Grund gab, warum man sie gefragt hatte und nicht Sarah. Also verließ sie das Haus, ohne ihr was zu sagen. Das könnte sie ja auch später noch machen.
Draußen war niemand. Aber das hatte nichts zu bedeuten, denn der Garten von Sarahs Eltern war zur Straße hin durch eine hohe Hecke abgegrenzt. Es war viel wärmer als noch vor ein paar Stunden. Und es roch nach Rauch. Die verbrennen bestimmt wieder Seetang, dachte sie. Aber nachts …? Sie vergaß den Geruch, ärgerte sich noch mal über ihre hässliche Jacke und ging zur Straße.
Das Auto und der Junge waren nicht zu übersehen. Der Wagen stand auf der anderen Seite direkt unter einer Laterne. Es war ein altes amerikanisches Auto mit einem auffällig verchromten Kühlergrill, auf den ein galoppierendes Pferd aufgelötet war. Schick, dachte sie, bestimmt teuer, wahrscheinlich von den Eltern. Der Junge saß auf dem Heck des Wagens. Eva schätzte ihn auf achtzehn. Er wirkte lässig und gleichzeitig wie aus einer anderen Zeit. Sie musste an ein Bild denken, das ihre Mutter ihr neulich im Internet gezeigt hatte. »Den fand deine Großmutter toll«, hatte sie gesagt. Eva wusste, dass der Junge, den ihre Großmutter damals angehimmelt hatte, bei einem Autounfall gestorben war und dass er in Hollywood Filme gedreht hatte. Ja … Irgendwie sah der Junge auf dem Heck des amerikanischen Schlittens ein bisschen so aus.
»Hast du mir die Karte geschickt?«
Keine Antwort, er machte sich nicht mal die Mühe, sich zu ihr umzudrehen.
»Was willst du?«
»Ich dachte, dass wir ein bisschen in der Gegend rumfahren.« Er sah sie immer noch nicht an, und dass er seine Stimme verstellte, hätte jeder Idiot gemerkt.
»Ich kenne dich gar nicht.«
»Aber ich kenne dich. Ich habe deine Geschichte in der Zeitung gelesen.«
»Auf welche Schule gehst du?«
»Crombourg, so wie alle Jungen. Also, kommst du mit?«
»Ganz bestimmt nicht. Autos machen nichts mit mir.« Das hatte sie gut gesagt, fand sie. Sie knöpfte ihre Jacke auf und stellte sich anders hin.
»Du willst doch Mitglied im BUCHCLUB werden, oder?«
»Wer sagt das?«
»Soll ich wegfahren?«
Warum ging sie nicht wieder rein? Ihr Vater hatte ihr doch so oft geraten, mit fremden Männern vorsichtig zu sein. Nun, die Warnungen ihres Vaters waren hier gar nicht nötig. Sie wäre sowieso nicht eingestiegen. Nicht zu einem, der aussah wie aus einer anderen Zeit. Kein Junge, den sie kannte, hätte so eine Lederjacke getragen und so hoch sitzende Jeans.
»Du willst doch, also komm«, sagte er ruhig. Er sah nicht nur merkwürdig altmodisch aus, er hatte auch eine Art zu reden, die total peinlich war.
»Du kommst mit deinem Auto und meinst, es reicht, wenn du ein Wort auf eine Karte schreibst?«
Er antwortete nicht, sondern sah runter zum Meer. Eva konnte ihn jetzt im Profil sehen. Sein Körper schien gut trainiert zu sein. Na und? Sie kannte mindestens zwei Jungen, die genauso gut aussahen, und beide hatten sich ihr schon an die Fersen geheftet.
»Du meinst also, du bist was Besonderes?«, fragte sie, um ihn ein bisschen herauszufordern. Er ging auch darauf nicht ein. Sie fand ihn inzwischen nur noch affig. Wahrscheinlich hatte er von irgendwem gehört, dass sie unbedingt in den BUCHCLUB wollte. Aber von wem? Und woher wusste er, dass sie heute Abend hier war? Sie fing an, ihn, sein Auto, sein ganzes Getue unter Anmache und auch ein bisschen unter gefährlich einzuordnen. Doch obwohl sie ihn innerlich abgehakt hatte, sah sie immer noch zu ihm rüber. Irgendwas an seinem Aussehen stimmte nicht. War er traurig? Was zog sie an? Vielleicht doch sein Aussehen? Die Art, wie er da auf dem Heck des Wagens saß?
»Na los, in einer Stunde bist du zurück.«
Er rutschte vom Heck und ging um den Wagen herum zur Beifahrertür. Das Licht der Laterne schien ihm ins Gesicht, und das Erste, was Eva auffiel, waren seine Augenbrauen. Die waren falsch. Als hätte er sie mit Teer oder tonnenweise Mascara vollgeschmiert. Dann sah sie etwas, das noch unpassender war. Er war ein Krüppel. Sein rechtes Knie knickte bei jedem Schritt nach innen weg, und sein rechter Schuh war ein Klumpen. Warum hatte er, obwohl er ein Krüppel war, so viel Selbstbewusstsein? Er beugte sich ungelenk vor, ließ die Beifahrertür aufschwingen und wies dann mit der offenen linken Hand auf den Sitz. Ein Clown mit geteerten Augenbrauen und einem Klumpfuß, dachte sie. Dass sie mit so einem weder mitfahren wollte noch sollte, war ihr natürlich klar. Aber sein Bein, die Tatsache, dass er irgendwie zwei Wesen in einem vereinte, brachte ihr Warnsystem durcheinander. Mehr noch, es öffnete ihr eine Tür in eine helle, andere Welt. So empfand sie, sie hätte es nicht erklären können. Sie hatte auf einmal das sichere Gefühl, dass er sie gar nicht persönlich meinte, dass es hier nicht um blöde Anmache ging. Nein, er sprach etwas viel Allgemeineres an mit seiner Einladung. Und so trat sie, ohne noch etwas zu denken, aus sich heraus. Sie verließ ihren Körper und ging auf die weit geöffnete Tür zu. Während sie das tat, wurde sie mit jedem Schritt mutiger. Sie hatte immer darauf gehofft, dass etwas Großartiges passieren würde. Jetzt war es soweit.
Als das Bein gefunden wurde, gab es kein Entsetzen, kein Kotzen und kein Geschrei. Obwohl der Geruch unerträglich war. Kein Geschrei, weil das Mädchen, das das Bein in einem Müllsack neben den Containern entdeckte, erst vier Jahre alt war. Ihre Mutter hatte sie Monique genannt, weil die Mutter ihres Mannes so hieß. Ein versöhnliches Angebot, das nichts gebracht hatte. Die kleine Monique sagte aus, sie hätte noch eine Weile nach anderen Teilen der Puppe gesucht, aber nichts gefunden. Ein Misserfolg, der sie beschäftigte. Sie sagte weiter aus, das Bein hätte gestunken.
»Weil es schmutzig war!«
»Hast du dich erschrocken?«, fragte eine sehr alte Frau, von der Monique wusste, dass ihr die Schule gehörte, in der ihr Kindergarten war.
»Jemand muss das Bein waschen.«
»Das geht nicht.«
»Warum?«
»Wir wissen ja noch gar nicht, wem es gehört.«
Monique zeigte aus dem Fenster. »Da hinten, im Schaufenster von Façon, stehen solche Puppen. Die müsst ihr mal fragen. Da kaufen wir oft ein. Das hier, was ich anhabe, das haben wir da gekauft. Und wenn man was findet, bekommt man eine Belohnung!«
Monique erwies sich als hartnäckig, was die Belohnung anging. Später, als immer mehr Polizisten und viele andere da waren, verwandelte sich ihre Verärgerung in Freude darüber, dass sich so viele Menschen für sie und ihre Geschichte interessierten.
»Meine Oma hat gesagt, wenn man was findet, das keinem gehört, darf man es behalten.«
»Vielleicht gehört die Puppe ja jemandem.«
»Ich will die Puppe nicht haben. Weil niemand sie gewaschen hat, und weil sie stinkt. Aber kriege ich denn eine Belohnung?«
»Hm … Vielleicht hat jemand das Bein versteckt, um jemand anderen zu ärgern, und es ist dabei schmutzig geworden. So was kann passieren, wenn man nicht aufpasst.«
»Wie heißt du?«
»Nora.«
»Und warum hast du eine Pistole?«
Weshalb zwischen dem Fund und der Benachrichtigung der Polizei über eine Stunde verging, konnte später nicht mehr geklärt werden. Keiner dieser verzögernden Aspekte hing, nach Einschätzung von Gendarmin Nora Rose, mit dem Versuch einer Vertuschung oder Irreführung zusammen. Man hatte sich um das Kind gekümmert, das zunächst komische Sachen gesagt hatte. Und zwar erst, als die Erzieherin gefragt hatte, was Monique denn die ganze Zeit mit ihrer Freundin zu besprechen hätte.
»Sie hat von einer Puppe gesprochen, und ich dachte, sie meint eine Puppe.«
Die Erzieherin war noch immer ganz durcheinander. »Erst als ich Monique das dritte Mal fragte und sie sagte, es gehe um das Bein einer sehr großen Puppe, und dass das Bein stinkt … erst da, verstehen sie? Ich habe nicht gleich an die Polizei gedacht, sondern mich um das Kind gekümmert und die Eltern benachrichtigt.«
»Sie haben vollkommen richtig gehandelt.«
»Das Bein hätte gestunken, hat sie gesagt, und es wäre zu groß gewesen.«
»Sie ist erst vier.«
»Sonst hätte sie es womöglich mit in die Klasse gebracht.«
»Dazu ist es ja zum Glück nicht gekommen.«
Das Bein wurde sofort zur Untersuchung gebracht. Rousseau fuhr mit. Noch während er unterwegs war, verfasste Nora einen längeren Bericht, der im Wesentlichen die Zeugenaussagen wiedergab. Die Spurensicherung erledigte wie immer ein Team der Police Nationale aus Villons, denn es gab keine solche Abteilung in Bauge.
Zum Nachdenken kamen Nora Rose und Gendarm Philippe Rousseau erst am nächsten Tag.
»Wie sieht’s aus, Rousseau? Schon eine Theorie?«
»Na ja …« Gendarm Rousseau hatte die Angewohnheit zu nicken, wenn er eine Theorie entwickelte. Er nickte auch bei anderen Gelegenheiten. Und immer mit ernstem Gesicht. Gendarm Rousseau war verheiratet und hatte Kinder – zwei Jungen, und beide waren gut in der Schule, worauf er sehr stolz war.
»Also? Was denkst du, Rousseau? Oder überlegst du noch?«
»Was soll ich sagen, Nora … Ich denke, der ist einfach da hin. Wahrscheinlich in der Nacht. Und hat das Bein neben die Container gestellt.«
»Und warum genau da hin? Neben einer Schule mit Kindergarten.«
»Vielleicht wohnt er irgendwo in der Nähe. Oder es liegt an den Büschen, die den Container abdecken. Oder daran, dass man mit dem Auto gut rankommt. Ja, ich denke, er ist rumgefahren, bis er eine geeignete Stelle gefunden hat.«
»Das Bein muss höllisch gestunken haben.«
»Das hatte er ja wohl im Kofferraum, oder?«
»Das heißt, er musste anhalten, aussteigen, den Kofferraum öffnen …«
»Vielleicht war’s nicht das erste Mal.« Gendarm Rousseau nickte eine Weile, ohne zu sprechen. Er mochte es, wenn klare Schlüsse gezogen wurden.
Die Leichenschau, wenn man bei einem Bein von so einer sprechen kann, fand nicht in Bauge statt, da es dort auch keinen Gerichtsmediziner gab. Die Arbeit übernahm Dr. Poisson, ein älterer Pathologe. Gendarm Rousseau fuhr sogar noch mal hin. Er war neu in Bauge und hatte gemeint, er müsse ermitteln. Nora hatte ihm erklärt, dass die Police Nationale in Villons den Fall übernommen hätte. Das wäre immer so bei schweren Delikten.
Dr. Poisson – auffällig seine dicken Brillengläser und die Angewohnheit, die Augen zusammenzukneifen – erklärte Rousseau, es handele sich um das Bein einer Frau, Anfang dreißig.
»Die Frau ist seit mindestens zwei Wochen tot. Das Bein hat außerdem längere Zeit im Wasser gelegen. Salzwasser.«
»Salzwasser?«, fragte Rousseau.
»Kein Meerwasser. Salzlauge. Vielleicht in einer Badewanne.«
»Könnte man feststellen, ob das Bein, bevor es in die Salzlauge gelegt wurde … ob es da im Meer gewesen ist?«
»Sie meinen, die Salzlauge sollte das Meerwasser übertünchen?«
»War nur ein Gedanke.«
»Warum so kompliziert? Ich meine, wenn das Bein schon im Meer war … warum es dann wieder rausholen?«
»War nur ein Gedanke«, wiederholte Rousseau.
»Es macht empirisch wenig Sinn, mit abwegigen Möglichkeiten zu beginnen. Vielleicht können Sie mir da zustimmen. Warum sind Sie überhaupt hier?«
»Weil das Bein in Bauge gefunden wurde.«
»Der Fall liegt jetzt bei uns. Kommissar Bary hat bereits alles Nötige veranlasst.«
»Verstehe. Ich melde mich, wenn wir weitere … wenn wir noch was finden.«
Rousseau fand nichts, und er wurde auch noch mal deutlich darauf hingewiesen, dass der Fall in Villons bearbeitet werde. Irgendwann hatte er das begriffen. Er war neu und musste noch lernen, seinen Eifer zu dämpfen. So lief das eben in Bauge.
Kommissar Bary und seine Leute fanden noch einiges im Laufe der nächsten Monate. Allerdings nicht in Bauge, sondern in den Wäldern bei Villons. Drei Frauenleichen, und bei einer fehlte ein Bein. Die Leichen konnten drei vermissten Frauen zugeordnet werden, in deren Wohnungen Blut und Hinweise auf einen Raubüberfall gefunden worden waren. Alle Opfer waren mit einem Hammer erschlagen worden, bei allen fand sich die DNA desselben Täters. Kommissar Bary entschloss sich nach einigen Diskussionen, in der Zeitung bekanntzugeben, dass die Frauen in ihren Wohnungen getötet worden waren. Wo genau in der Wohnung das geschehen war, wurde nicht mitgeteilt. Es war die Gazette de Villons, die auf das Wort Hammermörder kam. Die Bezeichnung war nicht sehr originell – es wurde auch in der Nähe von Marseille ein »Hammermörder« gesucht, und in der Gegend um Avignon ebenfalls. Der Redakteur war eben darin geschult, prägnante Begriffe zu benutzen, und »Hammermörder« brachte die äußeren Umstände der drei Morde seiner Meinung nach auf den Punkt.
Die kleine Monique übrigens nahm, nach Auskunft einer hinzugezogenen Schulpsychologin, keinen seelischen Schaden. Das hing damit zusammen, so die Erklärung, dass die Direktorin, Moniques Kindergärtnerin und auch Gendarmin Rose schnell reagiert und Monique in dem Glauben gelassen hatten, sie habe das Bein einer Puppe gefunden. Monique bekam, nachdem sie tagelang gequengelt hatte, von der Direktorin eine hübsche Puppe geschenkt, die sie Monique nannte. Diese Puppe zerstörte sie auf der Fahrt nach Hause, was sie offenbar beruhigte, denn sie fragte danach nie wieder nach der großen Puppe.
Irgendwann war dann wieder alles so, wie es sein sollte. Ruhig. Und Gendarm Rousseau bekam sein übertriebenes Bedürfnis, etwas zu unternehmen, in den Griff. Es passierte nichts Schlimmes mehr. Abgesehen natürlich von den tragischen Ereignissen im Herbst und im Winter, die längst Routine waren. Alte Leute, die bei Ebbe zu weit rausgingen und deren Leichen sie dann mit schöner Regelmäßigkeit am nächsten oder übernächsten Tag zwischen den Klippen von Colline fanden.
Die Geschichten mit den ertrunkenen Rentnern stimmten Gendarm Rousseau immer sehr nachdenklich. Da hatten zwei Menschen ihr Leben gemeistert, vielleicht Kinder aufgezogen, fürs Alter vorgesorgt, sich fit gehalten und dann … starben sie trotzdem. Nur weil sie die Zeit nicht beachtet und die Tücke der Flut unterschätzt hatten. Für Gendarm Rousseau waren diese tragischen Unfälle ein Sinnbild für das unberechenbare Spiel des Schicksals, das stets über allem schwebte, was Menschen wollten und planten.
Zwei Jahre nach dem Bein kamen die Knochen. Was zunächst ganz vernünftig klingt, obwohl … Wie irgendwelche Ereignisse ihren Anfang genommen haben und was aus was folgt, darüber lässt sich natürlich endlos spekulieren. Rousseau, wie gesagt, dachte dabei an Schicksal. Aber hätte man die Vorboten der Katastrophe, die dann über den Ort hereinbrach und dem Namen Bauge für lange Zeit einen schlechten Klang in ganz Frankreich verlieh … hätte man das nicht doch messen oder voraussehen können? Theoretisch ja. Anfang November hatte sich die Strömung vor der Küste verändert. Das hatte zur Folge, dass etwas angespült wurde.
»Was war das für ein Knochen?«, fragte Nora.
»Wahrscheinlich eine Rippe. Schrecklich, oder?«
»Wann hast du die gefunden?«
»Heute Morgen, um kurz nach sieben.«
Gendarmin Nora Rose und Miriam Marchand waren beide fünfzig Jahre alt. Sie kannten sich noch aus dem Kindergarten. Demselben übrigens, in dem auch Monique spielte und lernte. Miriam betrieb eine Pension mit Bar und Terrasse, so wie es schon ihre Eltern getan hatten. Allerdings hatte sie vor zwei Jahren alles von Grund auf renovieren lassen. Sie hätte es sonst nicht mehr ausgehalten. Sie hatte sogar mit dem Gedanken gespielt, sich das Leben zu nehmen.
»Hat er wieder eine getötet?«, fragte Miriam und presste die Lippen aufeinander.
»Wen meinst du mit ›er‹?«
»Na, den Hammermörder.«
»Um die Frage zu beantworten, wäre der Schädel nützlich.«
Miriam senkte den Kopf wie jemand, der etwas falsch gemacht hat, und schwieg eine Weile.
Der Fundort war längst abgesperrt. Nora und Gendarm Rousseau waren in Brest gewesen, als Miriam auf der Gendarmerie angerufen hatte. Gendarmin Florence Marin hatte sofort die Spurensicherung in Villons informiert. Die waren also zuerst da gewesen und hatten bereits alles abgesperrt. Hinter der Absperrung hatten sich viele Menschen versammelt, und die sahen sehr ernst aus.
Es wehte ein scharfer Wind, Nora Rose hatte die Kapuze ihres Anoraks hochgeklappt. Sie überlegte, wie viel Zeit ihnen die Flut noch lassen würde. Gendarm Rousseau stand neben ihr und fror. Nora hatte ihm schon hundertmal gesagt, dass er einen Anorak und Stiefel im Wagen deponieren solle. Ein Stück weit draußen sah sie David Leroy und noch weiter hinten zwei andere Männer von der Spurensicherung.
»Soll ich dir erzählen, wie ich die Rippe gefunden habe und wo?«, fragte Miriam.
»Fang an.«
»Die lagen ungefähr da vorne. Also zuerst lagen sie da, dann natürlich nicht mehr.«
»Warum dann nicht mehr?«
»Na, ich war doch mit dem Hund spazieren, der hat sie gefunden. Geschnappt und sofort los. Mein letzter hätte das nicht gemacht, der hat aufs Wort gehört. Aber der neue hat was Wildes in sich, verstehst du, das kriegt man nicht raus.«
»Weiter, und nicht zu viel über den Hund.«
»Doch, der ist wichtig. Er wollte die Rippe nämlich nicht hergeben, ich musste bis fast zu den Klippen von Roche hinter ihm her. Bis zum Bunker von den Deutschen. Aber am Anfang lagen sie da vorne. Die habe ich dann den Männern gegeben, die hier abgesperrt haben, und die haben sie hinten in ihr Auto gelegt, in eine silberne Box. Ich hatte die Rippe natürlich angefasst, weil, sonst hätte der Hund sie nicht hergegeben. Das war vielleicht was. Ich, der Hund und …«
»Ich sehe es genau vor mir.«
»Glaubst du, dass das Überreste von einer Frau sind? Hat er eine Neue getötet?«
»Bei uns wird niemand vermisst.«
»Aber in Villons läuft einer rum, der tötet.«
»Seit zwei Jahren nicht mehr.«
»Vielleicht hat er jetzt wieder eine ermordet und sie dann hierher gebracht.«
»Hm.«
»Vielleicht hatte er sie beschwert und draußen über Bord geworfen. Ich hab hier noch nie so was gefunden, der Hund auch nicht, und der findet alles.«
»Ist ein Jagdhund, nicht wahr?«
»Den Wal hatte er schon im Haus gerochen.«
»Delfin!« Nora hatte damals die Bergung und den Abtransport überwacht.
»Obwohl nein, das war noch unser alter Hund. Das war ja in der Zeit, als es mit Jean zu Ende ging. Er hat noch den Wintergarten gebaut und dann … das Herz. Ich war damals so verzweifelt, dass ich überhaupt nicht mehr schlafen konnte. Immer musste ich aufstehen. Der Hund war auch ganz verrückt, die spüren das ja. Zwei Jahre ist Jean jetzt tot, und … Der Hund ist dann ja auch bald gestorben. Er ist seinem Herrchen gefolgt.«
»Ich muss los, Miriam. Die Flut.«
»Da, wo das Fähnchen steckt, lag die Rippe. Das wolltest du doch wissen.«
Der Weg zu David Leroy war nicht weit, aber anstrengend. Nachdem Gendarm Rousseau am Rand des Wassers einen falschen Schritt gemacht hatte, befahl Nora ihm, am Ufer zu warten. Wenn ihre Chefin, Nicole Giry, nicht da war, übernahm Nora automatisch das Kommando.
Ihre Stiefel sanken in den weichen Sand ein. Den Kopf hielt sie bei ihrem Marsch gesenkt, die Augen leicht zusammengekniffen.
»Hi, David!«
»Nora!« David Leroy musste schreien, um gegen den Wind anzukommen: »Zieh deine Kapuze zu, sonst kriegst du eine Mittelohr …!«
»Habt ihr noch was gefunden?«
»Rippen und Wirbelknochen!«
Auch David war damals in Noras Kindergartengruppe gewesen. Er hatte sich vorhin kurz mit Miriam unterhalten. Die hatte sich gefreut, ihn nach so langer Zeit wiederzusehen, und ihm von ihrem Hund, einem Wal und ihrem verstorbenen Mann erzählt. Er hatte sie wegen der auflaufenden Flut unterbrochen.
»Und? Sind die von einem Menschen?«
»Von der Größe her, würde ich sagen, Schwein.«
»Schwein. Ihr müsst aufhören.«
»Die Flut kommt erst in einer halben Stunde.«
»Die kommt aber nicht gleichmäßig. Ihr werdet eingeschlossen. Nach zwei Minuten könnt ihr euch nicht mehr bewegen, nach fünf Minuten …«
David funkte seine Männer an und befahl ihnen, aufzuhören und zum Wagen zu gehen. Dann stapften er und Nora zurück Richtung Strand. Als sie dort ankamen, schloss sich ihnen Gendarm Rousseau an. Inzwischen standen fast hundert Neugierige hinter den Absperrbändern. Die meisten schwiegen. Und so sahen sie gar nicht wie Neugierige aus. Man wäre eher auf den Gedanken gekommen, sie würden den Strand bewachen.
Die anderen Männer von der Spurensicherung kamen, sie trugen eine Kiste aus Aluminium.
»Sieht schwer aus.«
»Ist auch ’ne Menge drin. Rippen und Teile von einer oder von mehreren Wirbelsäulen. Da kommt in den nächsten Tagen sicher noch mehr.«
»Schwein«, erklärte einer der Männer.
»So was«, sagte Nora, und warf Rousseau einen kurzen Blick zu, aber der war im Moment nicht in Stimmung, einen Kommentar abzugeben.
»Hier …« Einer der Männer öffnete die Kiste und holte eine Rippe raus. »An den meisten ist noch Fleisch dran. Die Knochen lagen nicht lange im Wasser. Theoretisch könnte man die noch auskochen.«
»Hat aber niemand vor, oder?«
»Wir werden die in Villons gleich mal in unsere Fleischerei bringen.«
Gendarm Rousseau wirkte irritiert, Nora verstand: »Du meinst, das Fleisch ist mit einem Messer ausgelöst worden?«
»Würde sagen, das sind Küchenabfälle. Mal sehen, was unser Fleischer meint.«
Nora Rose zog ihre Handschuhe aus und ging auf die Schaulustigen zu. Sie sagte ihnen, dass es nichts zu sehen gäbe, und bewirkte nichts damit. Nachdem David ihr erklärt hatte, dass es am Strand mit Sicherheit keine Spuren gäbe, die schützenswert waren, verzichtete Nora darauf, die Schaulustigen noch mal zu ermahnen.
Zurück auf der Gendarmerie, befahl sie Rousseau, sich unter die Dusche zu stellen. Als er damit fertig war, erklärte er freimütig: »Ich bin echt ein Idiot.«
Nora ging nicht darauf ein. »Hoffentlich regen sich die Leute nicht auf und schieben es den Chinesen in die Schuhe.« Sie brachte damit etwas ins Spiel, das die Bewohner von Bauge noch mehr beschäftigte als der Hammermörder. Die Chinesen bauten nämlich vor der Küste ein Gezeitenkraftwerk und das …
»Bedroht unsere Existenz!«
Im Zusammenhang mit dieser Bedrohung kamen regelmäßig zwei weitere Worte ins Spiel: Tourismus und Austernbänke.
»Pass auf, Rousseau. Morgen früh fährst du als Erstes an den Strand, wenn die Ebbe einsetzt, nimmst dir einen Müllsack und sammelst alles ein.«
»Die Chinesen …«, sagte Rousseau und ließ den Gedanken so stehen.
»Vierhundert Arbeiter. Die haben da sicher eine Großküche.«
»Miriam vorhin wieder mit ihrem Hammermörder! Das lässt die Leute nicht los. Warum haben die in Villons den eigentlich nie gefasst?«
»Weggezogen, Gefängnis, gestorben, du kennst das doch.«
»Was meinst du? Kommt die Giry noch mal wieder? Sie liegt schon seit zehn Tagen in der Klinik.«
Genau eine Woche später – Nicole Giry war noch nicht zurück – rief Miriam Marchand wieder an.
»Dieselbe wie letztes Mal?«
»Selbe Stelle. Wieder Rippen.«
Nora und Rousseau verbrachten zwei Stunden damit, Knochen einzusammeln.
Als sie zurück waren, hatte Nora eine Idee. »Heute ist wieder Montag. Offenbar passiert das wöchentlich. Ich ruf mal im Lager an.«
»Bei den Chinesen? Dürfen wir das?«
»Wir sind die Polizei, oder?«
»Ja, aber das sind Chinesen. Vielleicht gilt ihr Lager als chinesisches Territorium.«
»Das meinst du nicht ernst, oder?«
Nachdem Nora mit der Leiterin der Großküche, Zoé Turner, telefoniert hatte, gab sie Rousseau einen Zettel. »Hier. Die Küchenabfälle werden immer am Samstag von dieser Firma abgeholt. Fahr hin und lass dir zeigen, ob die die Sachen richtig entsorgen. Da muss es ja Rechnungen geben oder Lieferscheine.«
Es kam nichts raus bei Rousseaus Recherche. Er hatte sich Papiere zeigen lassen und die schienen in Ordnung zu sein.
Nora legte sich trotzdem am Samstagabend auf die Lauer. Die Arbeit war so eingeteilt, dass sie meistens die Nachtschichten hatte. Sie war kinderlos, und Rousseau hatte ja seine zwei klugen Jungen.
Nora saß also in ihrem Auto und beobachtete sechs Stunden lang das Meer. Zwei-, dreimal spannte sie sich an, aber es waren immer nur Fischkutter, die mit normaler Geschwindigkeit vorbeifuhren. Wahrscheinlich, dachte sie, war ihre Aktion sinnlos. Worauf wartete sie überhaupt? Ihr Vater besaß einen Kutter, und sie hatte die Vorstellung gehabt, dass das Schiff, von dem aus die Tierreste ins Meer geworfen wurden, zu diesem Zweck stoppen würde. Um die lange Wartezeit durchzuhalten, nahm sie ein Buch mit, in dem es um künstlich gezeugte Zwillinge ging. Um vier Uhr morgens sah sie, eigentlich nur aus Langeweile, für einen Moment von ihrem Buch auf.
Der Kutter dümpelte nicht mal dreihundert Meter vor der Küste herum und wurde gerade entladen.
Nora notierte die Uhrzeit und das Datum: 28. November. Eine Viertelstunde später setzte sich der Kutter wieder in Bewegung. Zu dem Zeitpunkt wusste sie bereits, wem er gehörte. Es gab in Bauge nur noch sechs Kutter.
Die Festnahme war kein Problem, und der Besitzer und Kapitän, Paul Chervel, war geständig. Er hatte seinen Auftrag von der Firma bekommen, die die Küchenabfälle und auch noch einigen anderen Sondermüll von den Chinesen übernahm. Zu seiner Entschuldigung meinte er, dass die Strömung sich geändert haben müsse, was bestimmt an dem neuen Kraftwerk läge, das die Chinesen bauten. Der Fall war geklärt, Paul Chervel verlor sein Kapitänspatent.
Die Bestrafung eines Einheimischen hatte Folgen, die niemand hätte voraussehen können. Obwohl … vielleicht hatte man die Stimmung in der Stadt nicht ernst genug genommen. Dort wurden der Bau des Kraftwerks und die damit verbundenen Störungen längst als existenziell bedrohlich angesehen. Bereits bei der Einrichtung der Großbaustelle hatte es Ärger gegeben, die riesigen Tieflader hatten ausgerechnet während der Hochsaison so viel Sand und Staub aufgewirbelt, dass die Caféterrassen zeitweilig nicht mehr benutzbar waren. Davon abgesehen …
»Die Austernbänke werden versanden und die Touristen …!«
Immer wieder die gleichen Sätze. Die Leute verstanden nicht, warum das Kraftwerk von einem chinesischen Konsortium gebaut wurde und nicht von französischen Firmen. Die Gazette de Bauge wies darauf hin, dass es eine internationale Ausschreibung gegeben hatte und das günstigste Angebot eben von den Chinesen gekommen war. Es war in diesen Artikeln auch von dem Wunsch die Rede, sich von russischen Gaslieferungen unabhängig zu machen.
Die Artikel von Chefredakteur Pascal Meur waren europäisch gedacht, sie waren verständlich und informativ, aber … Wen interessiert das, wenn es um die eigene Existenz geht? Wenn man sich wehren will – wehren muss! –, sucht man sich einen greifbaren Gegner. So erklärte zum Beispiel der Bäckermeister der traditionsreichsten Boulangerie von Bauge einer Kundin:
»Das mit dem Hammermörder hat angefangen, als die Chinesen kamen. Und die benutzen Hämmer auf ihrer Baustelle. Das ist doch kein Zufall!« Während er das sagte, hielt er eine Tüte mit Baisers in der Hand und machte sehr exaltierte Bewegungen, um seine Behauptungen zu unterstreichen. Der Bäcker geriet in Rage, hielt ihr eine richtige Rede. Die Kundin gab ihm mit einem stetigen Nicken in allem Recht und behielt dabei die Tüte mit den Baisers im Auge, die ihr schließlich mit einer energischen Bewegung auf den Glastresen gelegt wurde. In einer Fleischerei spielten sich ähnliche Szenen ab. Da war es noch bedrohlicher, weil der Fleischermeister bei seiner Rede keine Tüte mit Baisers in der Hand hielt. Irgendwas war außer Kontrolle geraten. Bauge hatte plötzlich etwas von einem Bienenstock, vor dem ein chinesischer Bär aufgetaucht war. Und das war kein Pandabär.
Es war eins zum anderen gekommen, und niemand auf der Gendarmerie hatte darauf geachtet, was die Leute so redeten, wie sie sich in ihre Abneigung gegen das Großprojekt reinsteigerten. Und jetzt entsorgten die Chinesen auch noch ihre Abfälle vor der Küste. Die Bucht von Bauge ein chinesischer Mülleimer? Das brachte das Fass zum Überlaufen.
Die Stimmung kochte innerhalb von Stunden hoch, und es kam zu einer heftigen Schlägerei im Cash, dem einzigen Lokal, das die chinesischen Ingenieure und Arbeiter besuchten. Auch von dieser Schlägerei bekam die Gendarmerie nichts mit, und zum Glück stellte später nie jemand die Frage, warum das so war. Jedenfalls waren Nora, Rousseau und Florence vollkommen überrascht, als das Lager der Chinesen gegen 22 Uhr von etwa dreißig Leuten angegriffen wurde. Kurze Zeit später waren dreihundert am Bauzaun. Die kamen zwar nicht rein, da der Zaun für die unorganisierten Bürger von Bauge ein unüberwindliches Hindernis darstellte, aber als die Verstärkung aus Villons eintraf, war bereits viel kaputt gegangen. Es waren Steine und improvisierte Molotowcocktails geflogen. Zwei Chinesen hatten ein bisschen gebrannt, und zwei Jugendliche hatten das mit ihren Handys aufgenommen. Diese Aufnahmen machten im Netz die Runde, weckten großes Interesse.
Bereits am nächsten Morgen meldeten vier überregionale Zeitungen, Bauge sei fremdenfeindlich, man würde dort Ausländer anzünden. Unterstützung bekam die Stadt aus dem Dunstkreis des Front National, der zwei Veranstaltungen in Bauge organisierte. Auch das wurde so dargestellt, als hätte man mit denen zu tun.
Am Morgen nach dem Angriff herrschte großes Durcheinander auf der Gendarmerie. Ein Journalist der Gazette de Bauge hielt sich in den Räumen auf und verfolgte die Vernehmungen. Aber sie mussten ja nicht nur mit den Randalierern fertigwerden, die sie in der Nacht vorläufig festgenommen hatten. Da waren auch noch die Leute, die Hinweise darauf hatten, dass die Chinesen noch ganz andere Ordnungswidrigkeiten begangen hatten, als Küchenabfälle vor der Küste zu entsorgen. Von diesen Zeugen wurde immer wieder zu Protokoll gegeben, dass es auf der Baustelle Arbeitsunfälle gegeben hätte, dass es da unmenschlich zuginge.
Was war das? Eine Verstrickung unglücklicher Umstände? Unfähigkeit? Rousseau machte an diesem Vormittag einen Fehler, der eigentlich keiner war. Bis jetzt war das doch immer richtig gewesen. Dass die Gendarmerie in Bauge auf gutem Fuß mit der lokalen Presse stand. Und die Frau? Die war doch vorher nie als Denunziantin oder Wichtigtuerin in Erscheinung getreten. Eine ganz normale Frau war das, hübsch sah sie aus. Vielleicht hatte Rousseau sich deshalb zu lange mit ihr unterhalten. So lange, bis das einem Journalisten der Gazette de Bauge auffiel. Und so wurde aus einer Mücke ein Elefant. Und zwar ein ganz dicker mit langen Stoßzähnen und einem riesigen Rüssel. Denn wenn eine Aussage einmal aufgenommen, wenn der Vorgang offiziell ist, dann kann man nicht mehr so ohne weiteres zurück. Was gesagt ist, ist gesagt. Vor allem dann, wenn man auch noch so leichtsinnig war, einem von der Gazette de Bauge zu erlauben, dabei zu sein. Aber es war ja auch viel los an dem Morgen! Verdammt! Menschen sind doch keine Maschinen!
So ergab sich ein Bild, das etwas Chaotisches hatte und doch wieder normal war. Alltag auf einer Gendarmerie nach einem besonderen Ereignis. Die Sekretärin der noch immer abwesenden Kommissarin kochte ununterbrochen Kaffee.
Zunächst wurde die Frau, die nervös auf einem Stuhl wartete, fast zwei Stunden lang übersehen. Sie war ein paarmal rausgegangen, um zu rauchen. Das Schicksal hätte es ja auch gut meinen können, und sie hätte sich während einer dieser Rauchpausen entschließen können, nach Hause zu gehen. Sie war zweimal kurz davor, dann aber doch zurückgekehrt.
Die Frau trug Jeans, einen schwarzen Pullover und eine rote Daunenjacke mit einem Besatz aus synthetischem Fell am Kragen. Als Rousseau sie endlich zu sich bat, wirkte sie ängstlich.
»Setzen Sie sich, was kann ich für Sie tun?«
Sie zögerte, war sich auf einmal unsicher. »Ich wollte fragen …« Sie zögerte erneut, Rousseau blieb geduldig. »Was wollten Sie fragen?«
Sie sah sich kurz um, als dürfe niemand sie hören. »Woran würde man einen Mörder erkennen? Was wäre typisch für so einen?«
»Entschuldigen Sie, Madame, aber erstens habe ich, wie Sie sehen, im Moment keine Zeit für solche allgemeinen Fragen, und zweitens, wenn wir das wüssten … Sie verstehen? Sind Sie denn einem Mörder begegnet?«
»Nein, ich wollte nur wissen …«
»War das alles?«
Sie schluckte. Rousseau sah, dass sie sich eindeutig zurechtgemacht hatte für ihren Gang zur Polizei. Sie war dezent geschminkt, ihre Fingernägel waren frisch lackiert. Sie roch allerdings nach Zigaretten, und so was war für ihn immer ein dicker Minuspunkt.
»Haben Sie noch Fragen, Madame? Wenn nicht, dann …«
»Ich würde gerne wissen, ob sich das mit dem Chinesen bestätigt hat.«
»Was hat sich bestätigt?«
»Dass es einer von den Chinesen ist. Der damals die Frauen in Villons ermordet hat.«
Rousseau blieb ruhig. »Das ist eine der vielen Spuren, denen in Villons nachgegangen wird.«
»Ich frage, weil die Morde doch damals genau in dem Moment angefangen haben, als die Chinesen hierher kamen.«
»Sie haben dann aber auch wieder aufgehört, Madame, schon vor zwei Jahren. Und die Chinesen sind immer noch hier.«
»Vielleicht ist der Mörder zurück nach China.«
»Sie gucken viel Fernsehen, nicht wahr?«
Das hatte er nett gesagt, sogar gelächelt dabei. Sie war inzwischen nicht mehr nervös, eher neugierig. Rousseau bemerkte erst jetzt, dass der Mann von der Gazette de Bauge ihnen zuhörte.
»Können Sie bitte da hinten hingehen, das ist eine polizeiliche Vernehmung. Danke.«
Im gleichen Moment wurde es bei den Leuten, die sie in der Nacht vorläufig festgenommen hatten, unruhig. Die Frau schien das nicht zu stören. Sie sah Rousseau an, sie war ganz bei der Sache. Rousseau fragte: »Hat Sie denn ein Chinese angegriffen oder belästigt?«
Sie kniff die Lippen zusammen, sah ihn mit ihren großen Augen an. Sie kam aber nicht dazu, etwas zu sagen. Die Vernehmung wurde unterbrochen, weil ein Mann versuchte abzuhauen, mit den Worten …
»Ich gehe jetzt, das ist mir zu dumm!«
Es dauerte eine Weile, bis Florence und Nora den Randalierer unter Kontrolle hatten. Rousseau ging ebenfalls hin, und es gelang ihm, unter Androhung schwerer Strafen, drei andere Männer davon abzuhalten, dem Mann zu helfen. Das war ihm hochpeinlich, da er die Leute kannte. Der Bäcker, bei dem er morgens seine Brötchen holte, zwei Besitzer kleiner Pensionen, ganz normale Leute … Und jetzt musste er so auftreten, sie mit Strafe bedrohen. Dabei verstand er sie doch. Keiner mochte die Chinesen.
Als Rousseau zu der Frau zurückkehrte, war sie in ein intensives Gespräch mit dem Journalisten der Gazette de Bauge verwickelt. Die Frau wirkte irritiert, als Rousseau den Mann rausschmiss. Angeblich hatte sie angenommen, der Reporter gehöre zur Polizei.
»Also, wo waren wir stehengeblieben?«
»Sie haben mich gefragt, ob ich von einem Chinesen angegriffen wurde.«
»Ist das passiert?«
»Gibt es denn eine Belohnung?«
»Wenn Sie eine Falschaussage machen, wird das Konsequenzen haben. Sie sitzen jetzt seit zehn Minuten hier. Das ist eine Gendarmerie, kein Club für Erörterungen. Wurden Sie angegriffen oder nicht?«
»In der Rue Jean Morel«, sagte sie schnell, »letzte Nacht. Mit einem Hammer.«
»Der Hammermörder hat Sie in der Rue Jean Morel angegriffen? In aller Öffentlichkeit?«
»Nein, nicht in der Rue Jean Morel.«
»Moment, das geht jetzt ein bisschen zu sehr durcheinander.«
Rousseau war erleichtert. Eine Aussage, die den Hammermörder betraf. Für den waren sie nicht zuständig. Sollten die aus Villons sich mit ihr rumärgern. Er rief an und hatte Glück. Zwei von den dortigen Sergeanten waren gerade in der Nähe.
»Ja, eine Frau, die sagt, sie sei vom Hammermörder angegriffen worden. – Ja, sie sitzt vor mir. Ihr kommt bitte so schnell ihr könnt, hier ist viel los.«
Rousseau zog sich Block und Stift heran und bat die Sekretärin, Christine Clery, ihm einen Kaffee zu bringen.
»Also, wie heißen Sie?«
»Judith Jambet.«
»Und wo wohnen Sie?«
Die Frage gefiel ihr nicht. Rousseau musste sie ganz schön unter Druck setzen, ehe sie sich überwand und die geforderten Angaben machte.
»Also, wann wurden Sie angegriffen?«, fragte Rousseau.
»Gestern Nacht. Ich hab was abgekriegt. An der Schulter. Aber das war nicht auf der Straße, das haben Sie falsch verstanden, das war im Park. Er hat mich im Park angegriffen.«
Christine Clery kam, brachte Rousseau seinen Kaffee, blieb neben ihm stehen.
»Danke. Wo im Park wurden Sie angegriffen?«
Sie überlegte lange.
»Wo war das, Madame! Wenn Sie mir hier eine Geschichte erzählen …«
»Auf dem Steg, der über den Canal de la Malmaison führt. Ich konnte nicht weg, weil der Steg so schmal ist und ein Geländer hat. Also habe ich mich geduckt und weggedreht. Deshalb hat er mich nicht richtig erwischt, sondern nur an der Schulter. Dann bin ich gelaufen, so schnell ich konnte. Aber was ich nicht verstehe … In der Zeitung stand doch immer, dass er die Frauen in ihren Wohnungen ermordet hat.«
Da hatte sie recht. Die Leichen waren zwar im Wald gefunden worden, aber in den Wohnungen der Opfer hatte es eindeutige Hinweise darauf gegeben, dass die Opfer dort angegriffen und getötet worden waren.
»Sie haben die Sache verfolgt«, sagte Rousseau, »das mit dem Hammermörder interessiert Sie.«
Christine Clery hatte sich ein Urteil über die Zeugin gebildet und ging.
»Ja, weil man im Fernsehen doch immer sieht, wie es ist. Dass Serienmörder es immer gleich machen. Aber manchmal ändern sie auch ihre Methode, weil sie inzwischen noch verrückter geworden sind.«
»Wo kamen Sie denn überhaupt her? Weshalb waren Sie nachts im Park?«
»Ich kam aus dem Cash, ich wollte zum Bus.«
»Können Sie den Angreifer beschreiben?«
»Ich glaube, das war ein … Asiate.«
»Ein Asiate. Meinen Sie damit einen Chinesen?«
»Wenn es ein Chinese war, wenn Sie den schnappen, an wen geht dann eigentlich die Belohnung?«
An diesem Punkt wurde die Vernehmung endlich unterbrochen, da die beiden Männer aus Villons kamen. Sie nahmen Judith Jambet mit, um sie noch mal gründlich zu vernehmen. Was ihr überhaupt nicht gefiel.
Am nächsten Tag kam dann der Schlag, und Rousseau wurde von Nora scharf zurechtgewiesen. In der Gazette de Bauge erschien ein langer Artikel, in dem der Überfall auf Judith Jambet beschrieben wurde. Sie wäre gerannt und hätte es tatsächlich geschafft, die Rue Jean Morel zu erreichen. Aber dort war niemand. Also war sie runter zum Hafen gelaufen und unterwegs war ihr ein Mann begegnet … und so weiter. Man konnte richtig Angst kriegen. Gleichzeitig fiel die nicht ganz neue Vermutung, dass der Hammermörder einer von den Chinesen war, auf fruchtbaren Boden.
Nora begriff als Erste, dass sie ein ernsthaftes Problem hatten. Wenn irgendwer herausfand, dass sich die verantwortliche Leiterin der Gendarmerie während all dieser Zwischenfälle auf einer psychiatrischen Station aufgehalten hatte, würde das nicht nur für die Giry Folgen haben, sondern auch für den Ruf der Gendarmerie. Sie hatten das eindeutig zu lässig gehandhabt und die Wut der Bevölkerung unterschätzt. Was kaum verwunderlich war, denn sie waren ja selbst gegen das Kraftwerk. Nora verstand vor allem nicht, warum das Ding nicht wenigstens von französischen Firmen gebaut wurde. Dann hätte es mehr Kontakte zur Bevölkerung gegeben und alles hätte sich nicht so beschissen entwickelt. Sie waren nicht fremdenfeindlich. So einen Schwachsinn schrieben nur Leute, die nicht von hier kamen. Das mit dem Kraftwerk war bestimmt in Paris am grünen Tisch entschieden worden, da war Nora sich sicher. Und wahrscheinlich nur deshalb, weil die Deutschen inzwischen wie die Verrückten in ihre Windkraftwerke investierten. Seit wann ließ sich denn Frankreich von den Deutschen diktieren, was zu tun war? In Paris interessierte sich niemand für ihre Austern und Sommergäste. Noras Vater war ja selbst betroffen, auch er hatte Austern da draußen. »Scheiß Chinesen«, hatte er ein paarmal gesagt, und sie hatte ihm Recht gegeben. So war eben die Stimmung, sie verstand die Leute total.
Aber jetzt ging es erst mal um Schadensbegrenzung. Nora fuhr also in die Klinik und besprach sich mit ihrer Chefin. Leider war Nicole Giry nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Immerhin rief sie ihren Vater an. Und der war in der Lage, Dinge zu regeln.
Dienstag
Bertrand Giry hatte eine Weile überlegt, wie er das Problem seiner Tochter in den Griff bekäme, ohne dass jemand davon erfuhr. Er musste vorsichtig sein, schließlich hatte er einen Namen, der etwas galt, und seine Tochter trug denselben. Er brauchte jemanden, der in der Lage war, die Probleme in Bauge zu lösen, jemanden, der seine Tochter decken würde, ohne es an die große Glocke zu hängen. Nachdem er eine Weile nachgedacht hatte, wusste er, an wen er sich wenden würde. Er rief Roland Colbert in Fleurville an.
»Monsieur Giry? Ich spreche mit Bertrand Giry?«
Roland Colbert hatte schon mit Bertrand Giry zu tun gehabt, denn Giry war einer seiner Ausbilder gewesen. Fachbereich forensische Psychologie. Sie waren ein paarmal aneinandergeraten, was daran lag, dass Bertrand Giry dazu neigte, die Fälle von seiner psychologischen Warte aus zu sehen, während Roland Colbert eher ein Organisator war, der auf Fakten baute.
»Sie sind der typische Fall eines Funktionärs, eines Mannes, der an ein Regime glauben würde!« Zu Aussagen dieser Art hatte Bertrand Giry sich damals hinreißen lassen.
Roland spürte, wie sich sein Körper anspannte.
»Womit kann ich Ihnen helfen, Monsieur Giry?«
»Es geht um meine Tochter Nicole. Sie leitet seit einem Jahr die Gendarmerie in Bauge. Meiner Tochter geht es nicht gut. Das Wetter. Bauge war die falsche Wahl.«
»Das tut mir leid.«
»Warum ich Sie anrufe, ist Folgendes …« Er erklärte alles, ließ es ein bisschen wie den Schlag des Schicksals aussehen. »… die brauchen Unterstützung, es darf zu keinen weiteren Übergriffen auf das chinesische Lager kommen! Es wäre nur übergangsweise, so lange, bis die Stelle meiner Tochter neu besetzt ist.«
»Wird sie denn nicht zurückkehren?«
»Ich werde mich darum bemühen, dass sie in einer angenehmeren Umgebung eine neue Aufgabe erhält.«
»Wieder in leitender Stellung?«
»Das ist für diese Sache vollkommen unwichtig.«
Bertrand Giry hätte das mit der Unwichtigkeit nicht betonen müssen, Roland Colbert war bereits klar gewesen, dass es genau darum ging. Dass Nicole Giry sauber aus der Sache rauskommen musste, weil sie den Namen ihres Vaters trug.
»Ich möchte nicht, dass ihr Weggang damit in Verbindung gebracht wird, dass sie ihre Arbeit nicht anständig erledigt hat.«
»Und da wenden Sie sich an mich? Wir sind nicht gerade Freunde.«
»Nein.«
»Also, warum ich? Weil ich in der Provinz sitze? Weil ich es nicht rumerzählen kann?«
»Offen gesagt, ja. Und weil ich Sie für jemanden halte, der mein Problem versteht. Es geht nicht nur um meine Tochter. Es geht um die Institution.«
Roland Colbert schwieg. Er war noch immer nicht so ganz dahintergekommen, was Bertrand Giry sich von ihm versprach. Rief man denn jemanden an, der einem feindlich gesinnt war, wenn man ein so prekäres Problem hatte? Aber Giry war ja Psychologe, er würde schon seine Gründe haben.
»Kann ich auf Sie zählen?«
Roland Colbert hätte abgelehnt. Aber Bertrand Giry war ein einflussreicher Mann, der nützlich sein konnte. Nicht ihm direkt, aber einem seiner Mitarbeiter. Und mit dem hatte er Pläne. Es ging dabei letztlich um seine eigenen Karriereziele. Nachdem er das alles kurz durchdacht hatte, beschloss Roland Colbert, ihm zu helfen.
»Jemanden zu schicken, wird nicht ganz einfach sein.«
»Darum kümmere ich mich. Haben Sie denn einen? Wenn Sie jemanden schicken, dann sollte er natürlich gut sein, aber er sollte vor allem eine gewisse Ruhe ausstrahlen.«
»Ja, ich denke, da habe ich genau den Richtigen. Aber ich hätte auch eine Bitte an Sie.«
»Natürlich.«
»Der Mann, den ich nach Bauge schicke, ist vor zweieinhalb Jahren zum Brigadier ernannt worden …«
»Nein, das geht nicht. Für die Leitung einer Gendarmerie brauchen wir jemanden mit einem höheren Rang.«
»Genau darüber sollten wir sprechen. Der Mann, an den ich denke, hat vor einiger Zeit eine Fortbildung an der Offiziersschule Melun abgeschlossen. Er hat alle Prüfungen bestanden, er hat Erfahrung … Es stünde ihm zu, Lieutenant zu werden. Aber wir warten auf die entsprechenden Urkunden.«
»Wo ist das Problem?«
»Er ist erst seit zweieinhalb Jahren Brigadier. Normalerweise …«
»Erst zweieinhalb Jahre Brigadier?«, unterbrach ihn Giry, »wer hat den überhaupt zu den Prüfungen zugelassen?«
»Er wäre genau der Richtige. Der Mann denkt weder strategisch, noch ist er an Politik interessiert. Er wird sich keine Gedanken darüber machen, dass er in Bauge letztlich nur ihre Tochter aus der Schusslinie bringen soll. Kurz, er ist ein in jeder Hinsicht zuverlässiger Mensch. Und ein guter Ermittler.«
»Er soll nichts ermitteln, sondern rein formell eine Stelle besetzen und da Ruhe reinbringen. Gut, ich … werde ein paar Leute anrufen. Lieutenant, das müsste gehen.«
»Man sollte ihm den Weg nicht verbauen. So wie man ihrer Tochter den Weg nicht verbauen sollte, nur weil sie an einem Ort eingesetzt wurde, der … zu schwierig war für sie.«
»Sie sind ein Arschloch«, sagte Bertrand Giry, seine Stimme klang nach einer reinen Feststellung.
»Sie auch«, sagte Roland, ebenfalls ganz neutral. »Wir kriegen das schon hin. Ich brauche natürlich eine Zusammenfassung der Vorkommnisse in Bauge.«
»Selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.«
»Ich Ihnen auch, Monsieur Giry.«
Nachdem Roland Colbert aufgelegt hatte, wusste er, dass er einen großen Schritt weiter war, was seine Pläne für die Zukunft anging. Er dachte an seine Frau Julie und an seine Tochter Sina, die seit zwei Jahren in Paris studierte. Er rechnete damit, sie noch ein paar Jahre unterstützen zu müssen. Der sonderbare Einfall von Bertrand Giry hatte ihm in die Hände gespielt. Wegen der Liebe zu seiner Frau und seiner Stadt war Roland in Fleurville geblieben. In der tiefsten Provinz. Daran war nichts mehr zu ändern. Aber Fleurville entwickelte sich, gewann an Bedeutung. Und vor zwei Wochen hatte Bürgermeister René Plutard ihn zu sich gerufen, um ihm ein verlockendes Angebot zu machen. »Du solltest dich mehr in der Politik engagieren, Roland«, hatte er gesagt und war dann konkret geworden: »Du wirst natürlich jemanden finden müssen, der dich hin und wieder vertritt, was die Leitung der Gendarmerie angeht. Eine politische Karriere frisst viel Zeit.« Kommissar Roland Colbert lächelte. Sein Plan hatte heute einen ordentlichen Schub bekommen. Niemand in Fleurville hätte auch nur einen Cent darauf gewettet, dass Brigadier Ohayon noch Karriere machen würde. Aber er musste diese Karriere machen. Es passte einfach zu viel zu gut zusammen.
Mittwoch
Ärgerlich so was. Und dabei war es ihm bisher gar nicht aufgefallen. Das war das Peinlichste daran.
Ohayon sah an sich herab und spielte ein bisschen damit herum. Dann ging er ins Schlafzimmer und stellte sich vor den Kleiderschrank. Esche, hellgrau gebeizt, großer Spiegel. Er rief, erklärte seiner Frau, was für ein Problem er gerade hatte, sah dann wieder an sich herab und spielte wieder damit herum.