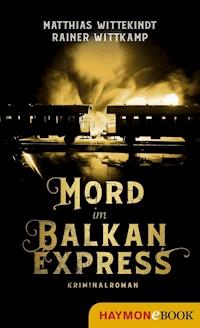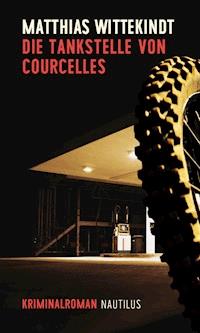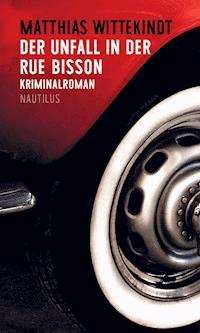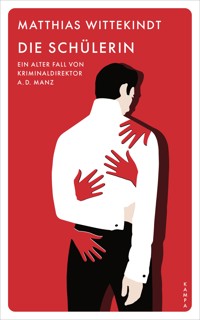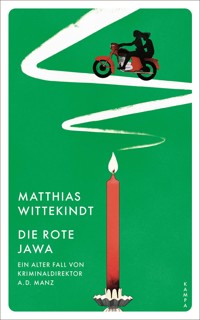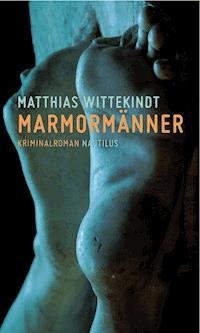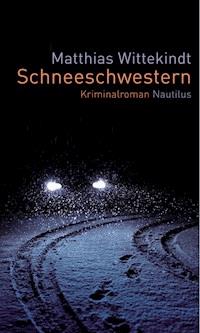
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Matthias Wittekindt erzählt in seiner sehr eigenen Sprache eine Kriminalgeschichte aus der deutsch-französischen Grenzregion. Das Polizeiteam muss den Mord an der sechzehnjährigen Geneviève aufklären. Der Leser ist gleichzeitig dem Mörder auf der Spur und erlebt hautnah, was geschieht, wenn das fein austarierte Zusammenspiel zwischen Vernunft und Trieb auseinanderbricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Wald von Fleurville wird die sechzehnjährige Geneviève tot aufgefunden. Sie war mit drei betrunkenen Jungs zum Knutschen in den Wald gefahren, einer von ihnen gilt als gewaltbereit. Die Lokalzeitung bekommt einen anonymen Hinweis auf einen Sexualstraftäter aus Deutschland. An Verdächtigen herrscht kein Mangel. Doch dann tauchen immer mehr Ungereimtheiten auf: Woher wusste der anonyme Anrufer so unmittelbar nach dem Mord von der Tat? Und welche Rolle spielt der »König«?
Ein Roman über das, was geschieht, wenn das fein austarierte Zusammenspiel zwischen Vernunft und Trieb auseinanderbricht.
Matthias Wittekindt wurde 1958 in Bonn geboren. Nach dem Studium der Architektur und Religionsphilosophie arbeitete er in Berlin und London als Architekt. Es folgten einige Jahre als Theaterregisseur. Seit 2000 ist er als freier Autor tätig, schreibt u. a. Radio-Tatorte für den NDR. Für seine Hörspiele, Fernsehdokumentationen und Theaterstücke wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 2004 erschien sein Roman »Sog« (Eichborn Berlin). Wittekindt hat eine Tochter und lebt in Berlin.
Matthias Wittekindt
SCHNEESCHWESTERN
Kriminalroman
Edition Nautilus
Verlag Lutz Schulenburg
Schützenstraße 49 a
D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© Edition Nautilus 2011
Originalveröffentlichung
Erstausgabe August 2011
Umschlaggestaltung:
Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
Autorenfoto Seite 2:
Thorsten Wittekindt
Druck und Bindung:
Fuldaer Verlagsanstalt
1. Auflage
Print · ISBN 978-3-89401-743-9
eBook · ISBN 978-3-86438-047-1 (ePub)
ISBN 978-3-86438-048-8 (PDF)
Die Dunkelheit, die sie umfing, war nicht körperlos oder passiv. Es war eine greifbare Dunkelheit. Gleichzeitig war es ruhig geworden. Sie spürte keine Schmerzen mehr und hatte aufgehört, sich zu wehren. Dann umfing sie etwas, das trotz der Greifbarkeit schon kein Zustand mehr war. Die Endlichkeit kam in Wellen, wurde umfassender. Sie fühlte sich aufgehoben und hatte das Gefühl, ihr Kopf würde in den Nacken sinken. Vielleicht tanzte sie auf den Wellen. Lag auf dem Rücken und tanzte. Ihre Beine hatten aufgehört zu zappeln, und es dauerte nicht lange. Das war das Gnädige an diesem Übergang. Denn als die dritte Welle sie anhob, war sie bereits tot.
Freitag
Mord ist eine schreckliche Sache. Zerkochte Spaghetti übrigens auch. Zum Glück kennt Kommissar Roland Colbert sich aus. Er nimmt also den Topf rechtzeitig von der Platte und gießt die Spaghetti in ein Plastiksieb. Ja, nein! Er gießt sie nicht in das Sieb, er schlägt sie hinein. Er nimmt den Topf mit beiden Händen, schwenkt ihn hoch, bis über den Kopf, dreht ihn und haut ihn mitsamt dem Gewurschtel aufs Sieb. Es knallt, es spritzt, eine Ecke des weißen Spaghettidurchschlags springt ab, hopst über den Boden, bleibt vor einer Fußleiste liegen.
Sie sehen auf. Beide.
Während die Spaghetti sich ängstlich beeilen abzutropfen, dreht Roland Colbert seinen Kopf.
Er sieht die Frauen.
Zwei sind es. Seine Nachbarin Juliet, und die ist mehr als seine Nachbarin, seit drei Jahren, und neben ihr, auf der gemütlichen Holzbank, seine Tochter, Sina, aus einer Verbindung lange vor Juliet.
Bis eben, bis zu dem Knall, haben sich Sina und Juliet sehr lebhaft, sehr bei sich, über Barcelona unterhalten, über die geplante Reise zu dritt.
Das mit dem Urlaub war Sinas Idee. Roland hat zwar schon seinen Urlaub eingereicht und die Reise gebucht, aber … Er kann es nicht lassen.
»Und du bist dir sicher, Sina, dass Barcelona richtig ist, im Winter?«
»Ja! Viel besser als der Harz! Vor allem wo sowieso keiner von uns Ski läuft. Und außerdem, Katrin war schon in Barcelona! Und die sagt: Super!«
»Wer ist Katrin?«
»Die Dicke. Du nennst sie immer die Dicke.«
»Hab ich ›Dicke‹ gesagt? Das glaub ich nicht.«
»Katrin sagt, dass Barcelona unglaublich toll ist im Winter, weil man dann auch mal echte Spanier trifft, und Juliet findet Barcelona auch besser als Harz. Sag doch mal!«
»Ich finde Barcelona auch besser als Harz.«
Roland nickt. »Das heißt also, ich soll mich mal erkundigen, was so was kostet.«
Juliet erschrickt. »Ich denke, du hast längst gebucht? Wir hatten doch alles besprochen! Wenn du jetzt noch nicht gebucht hast …«
Ein Triumph. Juliets Gesicht! Da ist schon eine gehörige Portion Ernst in ihrem Entsetzen. Sina sieht noch besser aus mit ihrem offenen Mund. Er kann seinen betont nachdenklichen Gesichtsausdruck nicht länger kontrollieren. Der Mund zuckt. Die Augen fangen fast an zu tränen. In einem Verhör wäre ihm so etwas natürlich niemals passiert.
Juliet kapiert, Sina versteht überhaupt nichts. »Was heißt das jetzt? Er hat nicht gebucht oder wie?«
Roland dreht sich zurück zum Herd und beginnt, in der Spaghettisoße zu rühren. Juliet sieht Sina so lange und so betont traurig an, bis die endlich versteht. »Und ihr findet das witzig, ja?«
Eine Familie beim Abendessen.
Die Spaghettisoße blubbert, das Kind wird gequält, die Stiefmutter ist entzückt. Noch normaler und irdischer kann das Leben kaum sein.
Mord. Jemand hat Todesangst. Damit zu beginnen. Sich diese Situation in Ruhe und ohne Ausflucht vor Augen zu führen.
Sie haben übrigens vor zwei Wochen die Küche renoviert. Alles rausgeräumt, die Tapeten runter, eine neue Farbe. Sina hat die Farbe ausgesucht. Man darf in dieser Renovierungsaktion ruhig etwas Bedeutendes sehen. Es geht um mehr als um die Veränderung und Auffrischung von Farbe. Roland Colbert denkt nämlich in letzter Zeit viel über seine Familie nach. Vielleicht, weil Sina jetzt sechzehn ist und in ein paar Jahren auszieht.
Sinas leibliche Mutter heißt übrigens Marie. Sie war fünf Jahre älter als Roland und verdiente ziemlich viel Geld bei einer großen Unternehmensberatung. Eine finanzielle Basis hätte es also gegeben. Aber er und Marie waren eigentlich gar nicht mehr zusammen, als Sina entstand und … ein Kind? Mit vierundzwanzig? Nein! Er wollte es nach Paris schaffen, auf eins der großen Kommissariate. Sechzehn Jahre ist das jetzt her.
Die Aufklärung eines Mordes kostet Zeit, wird schnell zu einem routinemäßigen Vorgang. Natürlich ist Distanz nötig. Der Tod. Alles Getue, alles Reden ist Distanz, was das angeht.
Das übrigens verband alle Frauen, mit denen Roland je zusammen war. Dass sie gesellschaftlich über ihm standen. Ungewöhnlich, denn die wenigsten Frauen orientieren sich nach unten, und die wenigsten Männer halten es aus, wenn ihre Frau erfolgreicher ist. Dass dieses Gefälle für Roland Colbert nie ein Problem war, lag an dem einfachen Umstand, dass er sich bei der Wahl seiner Frauen von ganz einfachen und gradlinigen Impulsen leiten ließ, also von dem, was er als Gefühl bezeichnete. Sehr bodenständig! Diese Worte hatten einige seiner Partnerinnen benutzt. Und offenbar ging ein Reiz davon aus.
Die Aufgaben der Ermittlung werden immer auf ein Team verteilt. Als könnten die Beteiligten das nicht alleine aushalten, diese erregenden Zustände der Jagd. Es scheint sogar so zu sein: Obwohl die Aufklärung eines Mordes doch eigentlich spannend ist, gibt es, selbst bei jungen Ermittlern, einen Drang, der zurück zum Normalen will. Das zeigt sich zum Beispiel darin, wie oft die Wichtigkeit eines ausgeglichenen Privatlebens betont wird. Dass es dabei meist viel langsamer zugeht und oft ohne rechte Zuspitzung, wird akzeptiert. Ohne familiären Rückhalt, das sagt jede Statistik, besteht in diesem Beruf ganz klar die Gefahr, Alkoholiker zu werden.
Marie hatte also ein Kind bekommen. Und dann stand auf einmal alles auf dem Kopf. Sie veränderte sich so grundlegend, wie niemand es hätte voraussehen können. Auf einmal verließ die vorher so umtriebige Karrierefrau kaum noch das Haus. Bei fast jeder anderen Frau hätte man gesagt: »Na ja, sie kümmert sich um ihr Kind!« Aber bei Marie hatte sich eindeutig etwas ganz und gar Falsches in Gang gesetzt. Die Art, wie sie mit Sina umging, sie gegen alles abschloss, machte Roland Colbert Angst. Andererseits hatte er keine Erfahrung mit solchen Situationen, denn Sina war ja sein erstes Kind. Über ein Jahr ging das so.
Er war inzwischen der hoffnungsvollste Sergeant in Fleurville, bereitete sich auf seinen Sprung nach Paris vor. Er galt als zuverlässig und hatte bewiesen, dass er ein Team führen konnte. Es war seine große Zeit.
Aber dann war etwas passiert mit Marie. Sie fühlte sich krank. Und tatsächlich bekam sie Hautausschläge am ganzen Körper. Es folgte eine Odyssee, die bei normalen Ärzten begann, Ärzten, die nichts fanden, und bei einem »Berater« endete, der endlich den Zusammenhang begriff. Die Ausschläge und Maries Gefühl, durch und durch krank zu sein, hatten etwas mit ihrem Stiefvater zu tun, damit, dass ihr echter Vater sie so früh verlassen hatte. Für sie, so der Befund, war Mutterschaft ohne vorherige Aufarbeitung das Falscheste, was sie hatte tun können. In Europa, das war klar, würde man sie mit Medikamenten vollstopfen oder sie mit unangemessenen Therapien noch tiefer hinabziehen. Mit Therapie allein, so die Lehre des Beraters, der lange in Amerika gewesen war, mit Therapie allein war es hier nicht getan. »Der Mensch ist nicht nur Psyche. Ernährung dient nicht nur der Sättigung.« Der Berater wusste, wovon er sprach, und Marie hatte Geld. Und Angst. Eine gehörige Portion Angst. Und so verließ sie die Familie und ging nach Kalifornien, um sich mit Hilfe einer Ernährungsumstellung, ganzheitlicher Methodik und regelmäßigen Zahlungen in Ordnung zu bringen. In den ersten Jahren schrieb sie noch ein paar Briefe, erklärte, dass sie Fortschritte mache, und bat Roland inständig, ihre Tochter nach Kalifornien zu schicken. Offenbar hatte Marie es in Amerika beruflich inzwischen noch viel weiter gebracht als damals in Frankreich und war wieder im beratenden Gewerbe tätig. Ganzheitliche Heilmethoden sind alles andere als dummes Zeug, und Sinas Mutter ist der beste Beweis dafür. Marie wird in Amerika reich und ausgeglichen, indem sie anderen Menschen hilft. Und zwar in Fragen, die einst ihre eigene Krankheit waren.
Du willst Sina? Roland Colbert erwies sich auch in dieser Frage als bodenständig. Er dachte nicht im Traum daran, seine Tochter wegzugeben. Und zwar einfach, weil sie zu ihm gehörte und nicht zu ihrer … Er benutzte schreckliche Worte. Es dauerte Jahre, bis er milder wurde und sich vorstellen konnte, dass Marie wirklich gelitten hatte. Er wusste inzwischen aus beruflicher Erfahrung, zu was Menschen sich verleiten ließen, wenn sie Angst hatten. Für Marie wäre es vermutlich besser gewesen, einfach Karriere zu machen und auf ein Kind zu verzichten.
Sina allein großzuziehen, war natürlich schwierig. Und er hätte es wahrscheinlich auch gar nicht geschafft, wenn seine Mutter ihm nicht geholfen hätte. Es hatte da Szenen gegeben! Er und seine Mutter am Wickeltisch, er und seine Mutter vor dem Regal mit der Babynahrung. Er hatte viel gelernt, und seine Mutter war noch mal jung geworden.
Es geschah übrigens genau in dieser Zeit an der Wickelkommode, dass Roland seinen ersten Mordfall bekam. Einer Lehrerin war der Hals durchgeschnitten worden. Aber Sina hatte Windpocken, und er konnte tagelang nicht von zu Hause weg. Er und Sergeant Ohayon hatten den Fall trotzdem gelöst, wobei Ohayon auf eine Weise über sich hinausgewachsen war, die Roland ihm niemals zugetraut hätte. Während dieses Falls mit der Lehrerin hatte sich zwischen ihm und Ohayon eine Art Freundschaft gebildet, ein großes Vertrauen, das allerdings nur während der Arbeitszeit bestand. In ihrer Freizeit trafen sie sich nie.
Zwei Dinge waren in sechzehn Jahren Dienst nie geschehen: Sie hatten sich nie mit quietschenden Reifen quer vor ein Fluchtfahrzeug gestellt, und Roland Colbert hatte noch nie eine Tür eingetreten. Überhaupt herrschte in Fleurville selten Eile. »Ein Kommissar rennt nicht!«, hatte Roland einmal gesagt. Und Sergeant Ohayon hatte ihm recht gegeben.
Seine Karriere? Er hatte es nie nach Paris geschafft, war in Fleurville hängen geblieben. Viehdiebstähle, Einbruchserien, Autohehler. Ganz selten so was Großes wie Mord. Dann war er Chef der Polizeistation von Fleurville geworden. Vor vier Jahren hatte er ein Reihenhaus gekauft, für sich und Sina. In Saint Mouron wohnte er jetzt, dreißig Kilometer westlich von Fleurville. Weiter war er nicht gekommen. Aber so lernte er immerhin Juliet kennen. Einfach, weil sie … seine Nachbarin war, weil sie gut aussah, kultiviert und … Nein, so einfach war es dann doch nicht.
Natürlich! Die Gründe, warum ihn bestimmte Frauen anzogen … der Beginn, der kraftvolle Startimpuls, war noch immer der Gleiche. Und noch immer nannte er dieses unbedingte Wollen Gefühl. Aber bei Juliet war dann mehr daraus geworden. Das hing damit zusammen, dass Juliet ihm unerklärlich blieb, dass sie ihm widerstand und sich nie ganz zu erkennen gab. Auch nach drei Jahren wusste er längst nicht alles über sie. Juliet hatte ihn also ordentlich durchgemischt, alles noch mal neu justiert. Zum Beispiel existierte Paris auf einmal nicht mehr. War von der Landkarte verschwunden, gewissermaßen. Ja, so was kommt vor! Ein Mann lernt eine Frau kennen, und eine Stadt verschwindet. Spurlos.
Und Mord? Diese unglaubliche Zuspitzung? Die großen Momente plötzlicher Eingebung, die zur Lösung führen? Ja, natürlich! Auch das war vorgekommen. Drei Mal in sechzehn Jahren Dienst.
So ging er also ruhig auf die vierzig zu. Aber noch nicht ganz ruhig! Denn er ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass Juliet Kinder haben will. Siebenunddreißig ist sie jetzt. Und weil sie und Sina sich so gut verstehen, weil er sich ausgerechnet bei Juliet, einer Frau, die doch so unvorhersehbar ist, weil er sich ausgerechnet bei ihr sicher ist, dass sie nicht durchdrehen wird, fand er neuerdings, dass seine Familie noch wachsen könnte.
Dass seit einigen Tagen nichts mehr so ist, wie er meint, kann er nicht wissen.
Juliet hat sich bis jetzt noch nicht dazu durchringen können, mit ihm darüber zu sprechen. Einfach, weil sie selbst nicht weiß, was das mit ihr macht. Seit zwölf Jahren arbeitet sie jetzt in einem Schulbuchverlag. Auch sie ist sich sicher, inzwischen eine feste Position erreicht zu haben. Doch letzte Woche hat der Chef ihres Verlags, Monsieur Chevrier, sie in sein Büro bestellt.
»Juliet, ich habe dich zu mir gebeten, weil ich es für geboten halte …« Monsieur Chevrier spricht so. Er mag das, dieses Förmliche. Er trägt gerne dunkelblaue Anzüge und sein Haar wird grau und licht. Leider. Dabei war er als Student angeblich recht ansehnlich. »… weil ich es für geboten halte, dich von Veränderungen so frühzeitig in Kenntnis zu setzen, dass du dich darauf einstellen kannst. Du arbeitest jetzt seit zwölf Jahren für uns«, da war Juliet schon schlecht geworden, »und wir waren immer mit dir zufrieden. Ich glaube, du weißt das.« Monsieur Chevrier machte eine Pause, sie schwieg. »Aber wie du weißt, werden sich bei uns einige Dinge ändern müssen. Das elektronische Buch wird sich jetzt wohl doch durchsetzen und … Kurz, wir stehen vor größeren Umstrukturierungen und vielen damit verbundenen Unwägbarkeiten.« Sie senkte den Kopf und konzentrierte sich vollständig auf das Muster des Teppichs. »Deshalb schon jetzt diese Vorankündigung. Ich ziehe in Erwägung, dass du ab März nächsten Jahres die Leitung der Abteilung übernimmst, in der du zur Zeit arbeitest. Das bedeutet mehr Einkommen, erheblich mehr Entscheidungsfreiheit … Aber auch ein Mehr an zeitlichem Aufwand. Es ist bis jetzt nur eine Überlegung. Ich wollte dich trotzdem rechtzeitig in Kenntnis setzen. Ich hoffe, du freust dich.«
Und wie sie sich gefreut hat! Ihr Kopf brauste förmlich! Natürlich würde sie das Angebot annehmen! Darauf hatte sie doch zwölf Jahre hingearbeitet! Sie wäre Monsieur Chevrier am liebsten um den Hals gefallen. Im letzten Moment siegte dann aber doch ihre professionelle Seite. Es war ja bis jetzt nur eine Überlegung, und so eine Reaktion wäre da sicher unangemessen gewesen. Obwohl Monsieur Chevrier, so wie sie ihn kannte, einen weiblichen Gefühlsausbruch, vor allem wenn er auf Dankbarkeit beruhte, sicher zu schätzen gewusst hätte.
Roland Colbert gießt gerade seine Spaghettisoße in die Schüssel, als Sina eine Frage stellt, die ihn freut.
»Ich hab doch in Barcelona mein eigenes Zimmer, oder? Ich meine, kann ich auch mal später kommen?«
Dass Sina daran denkt, später ins Hotel zu kommen, ist ein gutes Zeichen. Roland Colbert findet nämlich, dass seine Tochter viel zu sehr auf ihn und Juliet fixiert ist. Die ist immerhin sechzehn! Seiner Meinung nach müsste Sina jetzt, an einem Freitagabend, eigentlich in der Disco sein. Sina müsste überhaupt einiges anders machen. Sie sollte mal zum Friseur! Und warum sie immer in Jeans und langweiligen Turnschuhen rumläuft, versteht er auch nicht so ganz. Aber es sind wohl nicht alle Mädchen gleich. Oder die Zeiten haben sich geändert. Vielleicht stehen die Jungs von heute ja auf Mädchen ohne besonderen Haarschnitt, die in alten Jeans rumlaufen. Möglich ist das. Obwohl er es sich eigentlich nicht vorstellen kann.
Mord, Vergewaltigung, organisierte Kriminalität, Roland Colbert ist ein ganz normaler Mann. Einer, der gerne in der Küche steht und für seine Frauen kocht. Am Abend, nach den Verbrechen des Tages. Während sie sich über Barcelona unterhalten, über Gaudi, über Kleist, über kleinere Konsumartikel, die noch zu erwerben sind oder gerade erworben wurden, oder über sich selbst, über Fragen, welche die Existenz an sich betreffen, oder Vorgänge, die im Werden sind, deren möglichen Ausgang sie ausloten in einem längeren Dafür und Dawider. So sollte es immer sein. Roland Colbert braucht das. Das Familiäre.
Roland möchte noch ein Kind, Juliet steht davor, Karriere zu machen. Und Sina macht sich überhaupt keine Gedanken über Karriere oder Familie. Sie hat einfach nur das Gefühl, sich in einem reißenden Fluss zu befinden, weil gerade so unglaublich viel Wichtiges passiert in ihrem Leben.
Geneviève Mortier findet auch, dass viel passiert, und sie möchte natürlich auch nicht so sein wie alle anderen. Da geht also ganz schön was um in ihrem Kopf, als sie das Haus ihrer Mutter verlässt. Bevor sie in die Disco kann, muss sie vor allem erst mal mit Kristina reden, ihrer besten Freundin. Es ist einfach irrsinnig viel passiert in letzter Zeit. Geneviève weiß ja, wie das ist, wenn man hundert Sachen gleichzeitig im Kopf hat. Da können einem die merkwürdigsten Sachen zustoßen. Zum Beispiel ist sie neulich gegen einen Lichtmast gelaufen, obwohl sie ihn eigentlich hätte sehen müssen. Weil er unübersehbar mitten auf dem Bürgersteig steht und weil sie seit Jahren jeden Tag an ihm vorbeigeht. Zum Glück sind es vom Haus bis zur Bushaltestelle nur hundert Meter, und so kommt sie heil an, obwohl sie auf nichts achtet. Und weil sie auf nichts achtet, sieht sie natürlich auch nicht, dass auf der anderen Seite der Straße ein Auto steht und dass im Auto ein Mann sitzt.
Aber selbst wenn sie ihn gesehen hätte. Was hätte sie denn schon gedacht? Vielleicht: Was glotzt du? Findest du mich geil oder was? Und genau das ist nicht der Fall. Der Mann findet sie nicht geil. Nicht im Moment. Er denkt längst an etwas anderes. Er hat eine Vorstellung von Orten, von Fahrstrecken, von Entfernungen ganz allgemein. Er ist nicht geil, er entwirft einen Plan.
Der Bus ist mal wieder zu spät, und Geneviève friert. Irgendwie sind kurze Röcke idiotisch. Andererseits liebt sie ihren silbernen Rock. Vor allem kommt er gut an! Letztes Mal haben mindestens vier Jungen gesagt, dass sie richtig glitzert, wenn sie tanzt. Wie ein Stern! Und dann, ganz zum Schluss, kam Max und sagte, dass sie richtig glitzert, wenn sie tanzt, und dass er an einen Stern denken musste. Max sagt oder tut nie etwas, was die anderen vor ihm nicht schon gesagt oder getan haben. Das einzig Besondere an ihm ist seine extreme Schüchternheit. Dafür reißt er dann umso mehr die Klappe auf, wenn er mit den Jungs zusammen ist. Typisch! Aber eigentlich will Max was ganz Festes und für immer.
Leider hat Geneviève was gegen alles Feste und für immer. Im Gegenteil! Sie hofft, dass nachher im Chaise Longue Jungs da sind, die sie noch nicht kennt. Jungs, die besonders sind. Und wo sie schon beim Fantasieren ist, fragt sie sich, ob heute Nacht endlich mal was Extremes passiert. Seit sie nämlich weiß, dass sie diese Wirkung auf männliche Wesen hat, sind ihr einige ziemlich schräge Gedanken gekommen. Zum Beispiel, ob es was bringt, wenn sie mal mit einem älteren Mann zusammen wäre. Einem, der schon zwanzig ist oder einundzwanzig.
Der Mann im Auto beobachtet sie noch immer. Das ist kein Zufall. Es liegt daran, dass sie erst sechzehn ist. Es liegt auch daran, dass er sich sehr genau vorstellt, was sie anhat, unter ihrem Mantel. Es liegt an seiner Fantasie mehr als an ihr. Seine Fantasie ist sehr stark entwickelt. So gesehen ist auch er aufgeregt. Allerdings wird seine Aufregung immer wieder von einem Gefühl gestört, das ihn verengt und ihm Angst macht. Er weiß nämlich, dass seine Erregung nicht in Ordnung ist. Nicht bei sechzehnjährigen Mädchen. Und dieses Dilemma hatte bereits Auswirkungen auf seine Ehe gehabt.
Oh Gott ja …!
Wie schrecklich das früher war! Wenn er mit seiner Frau und seiner Tochter beim Frühstück saß, da war er immer so stumm. So geistesabwesend, hatte seine Frau ihm vorgeworfen und gemeint, er würde sich langweilen mit ihr und seiner Tochter. Inzwischen ist das alles in Ordnung. Seit er sein Leben sauber in zwei Welten geteilt hat, kann er sich wieder normal mit seiner Frau und seiner Tochter unterhalten. Er ist sogar einfühlsam und hat die Gabe, alle zum Lachen zu bringen. Zum Beispiel, indem er alltäglichen Worten eine originelle doppelte Bedeutung gibt. Oder in großen Zusammenhängen auf Nebensächlichkeiten hinweist, die alle verblüffen.
Er hat sich also im Griff und ist die meiste Zeit ganz normal. Das ist wichtig. Wie hätte er sonst weiter arbeiten können, wo er bei seiner Arbeit so viel mit Mädchen zu tun hat?
So kann man sagen, dass er eigentlich ein ganz normaler Mensch ist. Man schätzt ihn. Seine Kollegen wissen, dass er schon einigen auf die Sprünge geholfen hat. Gerade auch Mädchen, die ohne ihn nie ihren Abschluss geschafft hätten. Mädchen, die er motiviert hat. Es ist also auch für andere gut, dass er endlich wieder stabil ist. Vor vier Jahren hätten sie ihn fast erwischt. Und nachdem die Hunde ihm schon so nah waren, dass er ihren Atem hören und riechen konnte, wusste er, dass es lebenswichtig für ihn war, sich zu kontrollieren. Am Ende war es ein Gedanke, der ihn erlöste: Wem tut schon weh, was ich denke? Ich darf nur nie wieder aus dem Auto aussteigen.
Das Kommissariat von Fleurville ist ein dreigeschossiger Betonklotz, und Sergeant Ohayon ist zum Nachtdienst eingeteilt. Genau wie Resnais. Conrey darf meistens nach Hause gehen. Er wohnt nur drei Straßen weiter, und wenn sie ihn brauchen … Conrey kann sich unglaublich schnell anziehen und ist dann in null Komma nichts da. Er vergisst nur manchmal, seinen Reißverschluss zuzumachen. Gut. Sergeant Ohayon: Sergeant Ohayon ist 1 Meter 61 klein. Dick ist er außerdem. Auch sein Gesicht ist dick, und der breite Schnauzbart macht es nicht besser. Ohayon raucht, trinkt gerne Cognac und hat das Pech, dass er riecht. Nicht alle Männer, die rauchen und Schnaps trinken, riechen. Nicht mit achtunddreißig. Ohayon hat es nicht schwer mit den Frauen. Er hat keine. Sie finden ihn abstoßend. Ohayon sieht das aber nicht ein. Ohayon döst gerne. Ohayon schläft gerne. Ohayon hat keinerlei Ehrgeiz. Manche zweifeln an seiner Auffassungsgabe. Deshalb ist er nach fünfzehn Jahren noch immer Sergeant, was einer Degradierung gleichkommt.
Aber im Moment fühlt Sergeant Ohayon sich eigentlich ganz wohl. Er richtet sich ein, auf seinem Sessel. Es ist nichts los am Abend des 3. November. Minus sechs Grad haben sie im Radio gesagt, vielleicht wird es schneien. Bis vor zehn Minuten hat sich Ohayon mit Resnais über amerikanische Autos unterhalten. Ohayon fährt nämlich einen Achtzylinder Chevrolet Camaro von 1969. 5,7 Liter V8-Motor mit 300 PS. Resnais ist der einzige, der sich noch nie über Ohayons Auto lustig gemacht hat. Inzwischen sitzt Resnais in der Telefonzentrale, und Ohayon hat seine Schlafstellung eingenommen. Ohayon kann sehr gut im Sitzen schlafen. Er rutscht nie weg, weil er von den Armlehnen seines Stuhls gehalten wird.
Der Mann im Auto hat Glück. Geneviève nimmt den Bus. Wenn die Mädchen zu Fuß gehen, ist es schwierig, ihnen mit dem Auto zu folgen. Es fällt auf. Als ob ich ein Bulle wäre, der jemanden observiert! Seine Verfolgungsfahrten sind fast schon Routine.
Dann passiert etwas Unvorhergesehenes.
Geneviève verlässt den Bus, geht ein paar Meter und betritt ein Haus. Der Mann hält schräg vor dem Haus. Dass Geneviève nicht in die Discothek gefahren ist, weicht vom Üblichen ab. Letzten Freitag und Samstag hatte sie ihren Weg nicht unterbrochen. Der Mann lehnt sich zurück und spreizt die Schenkel. Gehst deine eigenen Wege …! Dass Geneviève sich nicht nach Plan verhält, erhöht die Spannung. Der Mann sieht kurz auf die Uhr neben dem Tacho. Es ist genau 21 Uhr.
Um 23 Uhr kommt das Mädchen wieder raus. Sie ist allein, und das ist erfreulich. Die Kleine ist offenbar ganz gut organisiert, denn schon nach zwei Minuten kommt der Bus. Der Mann überholt und fährt zum Chaise Longue. Es macht ihm Spaß, die Mädchen kurz freizulassen. Er findet einen Parkplatz an der Ecke einer Seitenstraße. Von hier aus hat er den Eingang der Discothek im Blick, ohne dass ihn jemand sehen kann.
Der Mann schaut auf die Uhr. Es ist 23 Uhr 15. Er hat jetzt sicher eine Weile Zeit. Vor eins kommen sie nie raus. Wieder spreizt er die Beine. Er ist sich seiner Sache so sicher, dass er sich sogar erlaubt, die Augen zu schließen.
Es gibt Dinge, die sich einbürgern in Beziehungen, und manche davon sind ganz sinnvoll. Juliet ist nach dem Essen in ihre Wohnung gegangen. Sie macht das jeden Abend, damit Roland eine Stunde mit seiner Tochter allein sein kann. Manchmal passiert in dieser Stunde nichts, manchmal unterhalten sie sich. Wie das eben so ist, bei Menschen, die sich gut kennen.
Roland Colbert bleibt sitzen, sieht seiner Tochter zu, wie sie das Geschirr in die Maschine räumt und die Anrichte abwischt. Es ist schwer herauszufinden, was in einem Menschen vorgeht, während er wischt. Selbst für einen Kommissar. Manchmal verraten sich Menschen durch ihre Bewegungen. Sina verrät nichts. Sie wischt. Danach sagt sie, dass sie kurz in ihr Zimmer geht, um ein Buch zu holen. Vielleicht eine Liebesgeschichte?
»Bin gleich zurück!«
Er ist zufrieden. Vor allem, weil Sina ihn das vorhin gefragt hat: Ob sie in Barcelona ein eigenes Zimmer hat und später kommen darf! Anlass zur Hoffnung, dass sie kein Kind mehr sein will … Aber Mädchen in dem Alter entwickeln sich ja auch. Manche fangen mit dreizehn an, manche eben erst mit sechzehn. Wenn sie schon länger wegbleiben will, dann geht sie bestimmt bald zum Friseur und zieht sich mal richtig an. Ja, jetzt geht das los mit den Jungs … Roland Colbert ist stolz. Er möchte stolz sein auf seine Tochter. Und dazu gehört eben auch, dass er will, dass sie gut aussieht. Dann hängen hier lauter verliebte männliche Teenager rum … Ja. Seine Tochter ist auf dem richtigen Weg.
»Pass auf!« Sina blättert in einem Buch, findet die Stelle. »Das hat Heinrich von Kleist über das Bild Der Mönch am Meer geschrieben: ›Zu dem Bild gehört, dass man hingegangen sein muss, dass man alles zum Leben vermisst und die Stimme des Lebens dennoch im Rauschen der Flut vernimmt.‹«
Kommissar Roland Colbert blickt ohne Bewegung. Alles zum Leben vermisst … Roland Colbert ist Fachmann für kriminelle Motive, kein Kunstkenner. Er kann diese Sätze nur so interpretieren, wie ein Kommissar sie interpretiert: Etwas ist passiert. Oder etwas wird bald passieren.
Sina erzählt ihrem Vater, wie Heinrich von Kleist gelebt hat. Zuletzt spricht sie über seinen Selbstmord. »Er hat sich zusammen mit seiner Freundin erschossen!« Offenbar hat sie sich da sehr genau hineingedacht. Kann über diesen Selbstmord reden wie nur eine Sechzehnjährige darüber reden kann. Voller Verständnis. »Ich geh auf mein Zimmer und lese noch, ja?« Sina umarmt ihn mit einer so einleuchtenden Vertrautheit, dass er sich nicht wehren kann, und geht mit ihrem Buch nach oben.
Alles zum Leben vermisst …
Roland Colbert steht auf, öffnet eine Flasche Rotwein, trinkt schnell. Selbstmord!
Er füllt das Glas nach. Balanciert es zur Couch. Irgendwas ist doch los!
Roland Colbert denkt: Irgendwas ist doch los! Er meint aber das Gegenteil. Etwas war nicht los. Mit Sina! Während die anderen Mädchen nämlich ihre ganze Energie darauf verwendeten, sich in attraktive junge Frauen zu verwandeln, trifft sich seine Tochter mit einer dicklichen Freundin und einem anderen unscheinbaren Wesen, vermutlich einem Jungen, und liest Gedichte.
Die müsste chaotischer sein, mit mir kämpfen!
Vor zwei Wochen hatte er Sina vorgeschlagen, zu einem Friseur ihrer Wahl zu gehen und dann ein paar schicke Sachen zu kaufen. Damit die Jungs mal sehen, wie schön du bist! Sina hatte sofort angefangen zu weinen und war auf ihr Zimmer gegangen. Von diesem Zwischenfall hatte er Juliet erzählt, woraufhin die mit der Hand eine Bewegung vor ihrem Gesicht machte, die bedeutete, dass er nichts von Frauen und noch weniger von sechzehnjährigen Mädchen verstand.
Was ist denn an meinem Wunsch so verrückt? Sina soll sich doch nur mal schön machen, so wie die anderen!
Roland Colbert hört, wie die Wohnungstür aufgeschlossen wird. Juliet kehrt zurück. Sie kommt ins Wohnzimmer, bleibt im Raum stehen. Macht nichts.
Roland Colbert sieht sie eine Weile an, steht auf, geht zu ihr. Kurz darauf ist er sich sicher, dass er doch etwas von Frauen versteht.
Geneviève tanzt. Geneviève glitzert. Geneviève fällt einigen Jungen auf.
Thomas, Philippe und Max zum Beispiel, die am Rand der Tanzfläche stehen und seit einer Stunde Wodka-Zitrone trinken.
Max ist so gut drauf, dass er mit einem einzigen Wort auskommt. Dafür singt er das Wort im Takt der Musik.
»Wodka!«
Es wird noch besser. Thomas bringt Nachschub.
»Jetzt nehmt mir doch mal die Gläser ab! Und du, Max, hör auf, so blöde zu singen! Ja? Hörst du mal auf, bitte!«
Es sind große Gläser. Man kann im Chaise Longue so viel trinken, wie man will.
»Worauf trinken wir?«, fragt Thomas.
»Fotzen«, sagt Max mutig.
»Fotzen schlachten«, sagt Philippe.
Sergeant Ohayon sitzt so bequem, dass das Bequeme Teil seines Traums wird. Er träumt nämlich davon, dass er in seinem Auto sitzt, weit zurückgelehnt, vollkommen entspannt. In seinem Traum kommen lauter junge Frauen vor, die alle was von ihm wollen. Das ist schön. Ganz allmählich verwandelt sich der Traum. Es werden immer mehr Frauen. Und irgendwann wird es dann so anstrengend, dass er aufwacht.
Da! Der Mann im Auto öffnet die Augen. Er sieht sofort auf die Uhr. Viertel nach eins. Das heißt, er hat fast zwei Stunden geschlafen. Das ist ihm noch nie passiert, dass er während einer Observation eingeschlafen ist. Vielleicht die Kälte. Es ist eisig im Auto, er sieht nichts. Der Mann kratzt ein kleines Loch ins Eis und guckt zum Eingang des Chaise Longue. Ist sie schon weg? Der Mann ist sich jetzt sicher. Es liegt an der Kälte, dass er so lange geschlafen hat. Sein Körper ist ganz steif. Hätte glatt erfrieren können … Er weiß, was das bedeutet. Er muss abbrechen. Er kann nicht länger hier in der Kälte sitzen. Scheiße! Morgen gleich noch mal auszurücken ist gegen die Regeln. Er observiert nie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Das könnte auffallen. Ja, und Sonntag kommt seine Frau zurück, dann ist es erst mal vorbei mit den Observationen. Als er gerade den Motor anlassen will, sieht er, wie einige Jugendliche das Chaise Longue verlassen. Und sie ist dabei. Außerdem ein paar Jungen. Es versetzt ihm immer einen kleinen Stich, wenn die Mädchen mit Jungen aus dem Chaise Longue kommen. Aber andererseits ist das auch gut. Wenn sie mit den Jungs irgendwo hinfährt, besteht keine Gefahr. Er wird ihr folgen, er wird viel erleben. In seiner Fantasie. Wenn er Glück hat, fahren sie zum Feensee. Da fahren die Jungs doch immer mit ihnen hin! Bestimmt kann er sie dort beobachten. Glück gehabt! Der Abend ist doch noch nicht gelaufen. Und das Beste daran ist, dass die Kleine im Glitzermini ein paar Jungen dabei hat. Sie ist also sicher vor ihm. Er wird den Wagen nicht verlassen, sondern nur observieren.
Sexuelles Interesse zu wecken kann sehr schwer sein, unmöglich sogar, kann aber auch sehr leicht sein. Jedenfalls sieht Philippe gut aus, und Geneviève will ja, dass heute Abend was Besonderes passiert. Sie spielt also mit, ignoriert, dass die Jungs total betrunken sind, lässt sich ein paar Drinks spendieren und zieht dann mit ihnen los. Angst hat sie keine. Außerdem ist sie ja nicht allein.
Max fährt den Wagen, was Geneviève nicht gut findet. Der ist doch niemals achtzehn! Er wirkt so klein hinter dem Steuer! Das kann aber auch am Auto liegen. Sie sitzen in einem riesigen Schlitten, einem goldenen Opel Admiral aus den siebziger Jahren. Max hat Schwierigkeiten mit der Lenkradschaltung. Und auch mit dem großen Lenkrad. Kristina sitzt neben ihm und sagt nichts. Keiner beachtet Kristina. In ihrer grauen Jeans, ihrem schwarzen Parka sieht sie aus wie ein Junge. Geneviève in ihrem silbernen Minirock sitzt hinten, zwischen Thomas und Philippe. Philippe schiebt seine Hand zwischen ihre Schenkel, und Geneviève presst sie zusammen. Sie findet das eklig und hat gleichzeitig das Gefühl, alles falsch zu machen. Warum fängt sie jetzt an zu zicken? Vielleicht hat sie einfach zu wenig getrunken! Thomas gibt ihr also die Flasche, und Geneviève trinkt. Dann hält Philippe sie fest, und Thomas kippt die Flasche so weit hoch, dass sie immer weiter trinken muss. Der Schnaps tut ihr weh im Hals, sie muss husten. Es läuft ihr die Wangen runter und in ihren Ausschnitt. Die Jungs lassen sie frei, und für einen Moment glaubt Geneviève, dass sie kotzen muss.
Dann sieht sie den Wald.
Er liegt wie eine dunkle Kuppe einen Kilometer vor ihnen. Und auf den Wald zu führt die Straße, und die ist weiß überhaucht und glitzert wie in einem Märchen.
Der Parkplatz am Feensee.
Max bringt den Wagen zum Stehen. Die Jungen steigen aus. Als Geneviève aussteigt, passiert etwas mit ihr.
Sauerstoff.
Es gibt eine kleine Verwirrung, ein Taumeln aller. Max und Thomas kotzen sofort.
Philippe will. Geneviève will nicht. Philippe brüllt rum. Kristina verteidigt Geneviève nicht.
Es passiert sehr viel gleichzeitig. Bewegungen. Drehungen. Stürze. Mädchen werden angefasst. Reißen sich los. Dann eine kleine Lücke.
Geneviève blickt nach oben. Sieht den Mond. Sie läuft los. Minus sechs Grad. Ein Glitzermini.
Es hat angefangen zu schneien. Nur einige Flocken. Der Mann fährt langsam am Parkplatz vorbei. Er blickt kurz zu dem Opel Admiral hinüber, fährt ein Stück weiter und hält hinter den Bäumen. Es war genau der richtige Moment. Der Mann hat gesehen, wie sein Mädchen sich von den Jungs losgerissen hat und in den Wald gerannt ist.
Die läuft zur Hexe!
Der Mann im Wagen wartet. Er gibt ihr einen Vorsprung und berechnet in aller Ruhe den Weg, den sie wahrscheinlich nehmen wird. Er muss sich nicht beeilen, er kennt einen alten Forstweg, der direkt an die Lichtung führt. Er lächelt. Der alte Knutschweg! Das Lächeln hält noch eine Weile an. Er ist zufrieden. Die Tatsache, dass einer der Jungen sein Mädchen angefasst hat, dass sie sich losgemacht hat, dass sie den Jungen angebrüllt hat, das alles hat den Mann erregt. Der Mann kennt die Gegend am Feensee, den Wald von Fleurville. Er hat hier schon oft observiert. Wege und Abkürzungen zu berechnen lenkt ihn von seiner Erregung ab. Beruhigt ihn. Er muss sich ablenken. Er darf seine Erregung genießen, aber er darf nicht die Kontrolle verlieren. Er darf unter keinen Umständen aussteigen. Die Erinnerungen an den alten Knutschweg entführen ihn eine Weile aus der Realität. Er war als Jugendlicher oft da. Mit verschiedenen Mädchen, die er in der Disco aufgerissen hatte. Er war ganz gut dabei. Es war immer sehr aufregend. Fast so aufregend wie heute.
Geneviève läuft durch den Wald. Nach hundert Metern kommt sie an den See. Der Feensee dampft, wie er das im Winter immer tut. Geneviève dringt in den Nebel ein. Als sie den Nebel wieder verlässt, hat sie den See halb umrundet und die anderen und das Auto weit hinter sich gelassen. Der Hochsitz! Da geht’s rein. Wieder dringt sie in den Wald ein. Sie kennt den Weg zum Haus der Hexe. Sie war schon da. Als die Kaninchen Junge hatten.
Zehn Minuten später betritt sie die Lichtung. Am Rand der Lichtung bleibt sie stehen. Sie hat alles vergessen. Die Jungs, den Ekel, die Kälte … Ihr Hals brennt immer noch, aber das Hexenhaus macht ihr so wenig Angst wie die Nacht. Dann hat sie plötzlich ein schlechtes Gewissen. Sie ist weggelaufen und hat nur an sich gedacht.
Eine Haarsträhne kitzelt Geneviève an der Wange. Im Hexenhaus brennt kein Licht, die Haare bewegen sich wieder, kitzeln wieder, und Geneviève ist auf einmal klar, dass nicht alles in den Gedichten der Schule Kitsch ist, denn der Mond ist tatsächlich silbern. Der Schnee, der sich über dem Dach in Wirbeln dreht, auch. Alles ist silbern heute Nacht. Und Silber ist zur Zeit Genevièves Lieblingsfarbe. Plötzlich meint sie, dass sie etwas gesehen hat. Eine Gestalt, eine Bewegung. Rechts. Hundert Meter entfernt, schräg rechts am Waldrand, auf der anderen Seite der Lichtung. Sie strengt sich an, erkennt aber nichts. Trotzdem ist es mit der Leichtigkeit erst mal vorbei. Ist das Philippe? Philippe hat versucht, ihr zwischen die Beine zu grabschen. Das ist bestimmt nicht das Besondere, auf das sie gehofft hat. Die Frage ist jetzt, ob überhaupt je was Besonderes passieren wird. Vielleicht ist sie nicht gut genug dafür, dass mit ihr etwas Besonderes passiert. Oder sie wünscht es sich zu doll. Das hat sie nämlich herausgefunden. Wenn sie ein Bild malt, ist es immer gefährlich, wenn sie etwas Besonderes will. Die besonderen Sachen passieren einfach so. Mittendrin. Woher das wohl kommt? Dass sie manchmal etwas malt, das besser ist als anderes? Und so hat sie Philippe und die Tatsache, dass sich am Waldrand etwas bewegt hat, schon wieder vergessen und fragt sich stattdessen, wie man wohl einen silbernen Mond malen könnte, ohne Silber zu nehmen, und dann fragt sie sich, ob Silber überhaupt eine Farbe ist, und dann, ob Kupfer und Gold Farben sind, und dann knackt hinter ihr ein Zweig, und Geneviève dreht sich um, und ein Gefühl unbändigen Glücks durchfährt sie.
Damit hatte er nicht gerechnet. Schlaglöcher! Sein Wagen hat sich festgefahren. Er traut sich nicht, zu viel Lärm zu machen. Er überlegt, ob er abbrechen und zurückfahren soll. Er vergisst die Zeit. Schließlich macht er noch einen Versuch. Schwung – und zurück. Schwung – und zurück. Er schafft es, den Wagen freizubekommen. Er fährt noch dreihundert Meter durch den Wald. Der Waldweg endet vor einer Stange. Er wusste, dass der Weg hier endet. Er kennt sich aus. Bis zur Lichtung ist es nicht weit, aber er muss das letzte Stück gehen. Von hier aus wird er nichts sehen.
Der Mann steigt aus.
Reglos am Rand der Lichtung. Er stiert zum Hexenhaus hinüber. Er scannt die Lichtung ab. Wo ist sie? Drüben der Waldrand liegt im Schatten. Schatten des Mondlichts. Ist sie da im Schatten? Sie müsste doch längst hier sein. Oder ist sie ins Haus gegangen? Hat sie sich bei der Hexe verkrochen? Nein! Die haben doch alle Angst vor der Hexe. Oder stimmt was nicht mit der Zeit? Hat er zu lange gewartet? Der Zwischenfall im Wald. Er sieht auf die Uhr. Schon zwanzig vor drei! Die Aufregung. Er hat sich verschätzt. Du hast dir viel zu viel Zeit gelassen! Zu viele Träume! Er wartet trotzdem noch eine Weile. Er steht da und guckt hoch zum Dach des Hexenhauses. Ist da was auf dem Dach? Der Mann tritt ein Stück vor. Auf die Lichtung. Leichtsinn! Er sieht nichts. Das ist auch egal. Der Mann ist nicht mehr interessiert an Beobachtungen. Er wartet. Es hat inzwischen angefangen zu schneien. Er fängt an zu frieren. Er wird ungeduldig. Er wird sogar wütend. Auf sie. Die ihn warten lässt. Auf sich selbst. Dann will er es wissen. Eine starke Kraft. Er gibt die Deckung endgültig auf. Hoffentlich schläft die Hexe! Na ja, kein Licht. Die schläft. Er geht auf das Haus zu. Vielleicht ist die Kleine auf der anderen Seite. Ihm ist nämlich eingefallen, dass dort ein Schuppen steht. Der Schuppen! Der Gedanke an den Schuppen. Es wäre nur logisch, wenn sie dort wäre. Schutz sucht. Als er das Haus umrundet hat und den Schuppen sieht, geschieht etwas mit ihm, das so stark ist, dass er sich völlig darin verliert. Dieses Zusammenziehen der ganzen Existenz zum Sexuellen, die unendliche Befreiung, das plötzliche Niederbrechen aller selbst auferlegten Tabus ist so berauschend, so mächtig und lebenskräftig, dass sich der Verstand ausschaltet.
Er will töten.
Es ist ein Rausch. Er verliert den Sinn für das, was wirklich ist und was nicht.
Es vergeht Zeit. Er wird nie sagen können, wie viel Zeit verging. Aber es ist Zeit vergangen. Während er ununterbrochen die Tat begeht, die er begehen muss.
Plötzlich ist er wieder in der Welt. Er sieht sie. Im Schnee. Blut.
Blut, mit dem er auf einmal nichts mehr zu tun haben will. Er lehnt das Blut ab. Ja, er lehnt das Blut kategorisch ab! Er lehnt auch das tote Mädchen ab. Er meint, dass hier etwas mit Ursache und Wirkung nicht stimmt. Das, was er sieht, kann und darf nicht stimmen.
Er wird für kurze Zeit verrückt. Wirklich verrückt.
Nicht nur in dem Sinne, dass er die Kontrolle verliert. Die Ausschaltung des Verstandes ist so gründlich, dass er später Lücken haben wird, regelrechte Gedächtnislücken. Er wird sich nie vollständig daran erinnern können, was genau passiert ist.
Erster Tag der Ermittlungen – Samstag
Sergeant Ohayon sitzt noch immer in seinem Sessel und schläft. Resnais muss ihn also erst wecken, und Ohayon braucht etwas, bis er begreift, worum es geht.
»Eine Madame Darlan! Jetzt wach schon auf! Madame Darlan! Hey! Die hat angerufen! Gerade eben.«
»Scheiße, wie spät ist es?«
»Zehn nach fünf. Sie sagt, da liegt ein totes Mädchen in ihrem Garten.«
»Die Hexe hat angerufen und …? Nee, oder?«
»Doch! Du musst hinfahren, Ohayon! Sofort!« Resnais erklärt noch, Madame Darlan sei vielleicht betrunken gewesen. »Die hat so merkwürdig abgehoben gesprochen. Und zwischendurch auch deutsch.«
Ohayon ahnt, was Resnais meint. Marie Darlan war früher Deutschlehrerin in Fleurville. Wenn Resnais glaubt, dass sie abgehoben spricht, muss das also nicht am Alkohol liegen. Es kann auch Ausdruck ihrer Bildung sein. »Ruf Conrey an. Der soll sich sofort anziehen.«
»Alles klar, Ohayon.«
Wenn sie nachts rausmüssen. Vor allem wenn es kalt ist. Wenn es zu einer Leiche geht. Dann ist das immer auch eine Geschichte vom Pissen.
Pissen, Tod und Architektur.
Der lange Gang oben. Das Treppenhaus. Der lange Gang unten.
Die Erschließungswege der Polizeistation von Fleurville sind ein Paradebeispiel für schlechte Architektur. Immerhin gibt es oben am Treppenhaus eine Toilette. Riecht man schon fünf Meter vorher! Ohayon betritt als Lebender in der ganzen Banalität seines Daseins die Toilette, zieht den Duft durch die Nase ein, riecht, dass Leben ein stetiger Wandel und dass dieser Ort ein Mahnmal der Endlichkeit ist. Dann verschwindet dieser Gedanke. Er denkt an die Kantine im Keller. Freut sich auf sein Mittagessen.
Ein paar Schritte. Ein paar einfache Handlungen.
Ohayon steht jetzt vor einer gekachelten Wand und ist ganz bei sich. Eine Weile denkt er an nichts. Ein neuer Gedanke reift zu einer Schlussfolgerung: Conrey braucht noch, bis er angezogen ist, da kann ich in Ruhe pissen.
Dann vernebelt sich auch dieser Gedanke in großer Seligkeit.
Oh nein! Das hier ist kein Spaß. Zu pissen ist wichtig, wenn’s rausgeht, in die Kälte. An solchen Erfahrungswerten sieht man, dass Ohayon kein Frischling mehr ist. Die Frischlinge müssen alle irgendwann hintern Baum.
Als Sergeant Ohayon drei Minuten später unten durch den gläsernen Vorbau des Kommissariats geht, sieht er, dass der Gummibaum wieder ein Blatt abgeworfen hat. Er nimmt es zur Kenntnis. Der Gummibaum stirbt seit fünfzehn Jahren. Er war jedenfalls schon da, als Ohayon hier anfing. Und er sah damals nicht anders aus als heute … meint Ohayon. Aber da widersprechen ihm die Älteren und behaupten, der Gummibaum hätte sehr wohl seine guten Zeiten gehabt. Dass er Blätter abwirft, ist immerhin eine Art Lebenszeichen … meint Ohayon.
Als er aus dem Glaskasten nach draußen sieht, flucht er. Es liegen zwanzig Zentimeter Schnee, der Himmel ist bedeckt, und die Flocken fallen so dicht, dass man keine dreißig Meter weit sehen kann. Bei so einem Wetter ist ein amerikanischer Riesenschlitten mit Heckantrieb nicht gerade ideal. Conrey kommt dazu, er ist noch nicht richtig wach. Sie fahren los.
»Hast du Roland Bescheid gesagt?«
»Was denkst du denn, Conrey? Natürlich habe ich Bescheid gesagt!«
»Und Grenier? Kommt die auch?«
»Die kommt auch.«
»Schön. Und wenn das jetzt gar nichts ist?«
»Dann waren wir alle umsonst im Kalten. Deine Hose ist noch auf.«
»Danke.«
»Roland wird sicher eine Weile brauchen bei dem Wetter. Wir werden also die Ersten sein.«
»Boah, ich bin noch ganz steif.«
»Kein Schweinkram jetzt.«
Conrey sieht Ohayon an. Sie sind nicht unbedingt Freunde. Und Conrey findet Ohayons Bemerkungen selten witzig.
Der Mann aus dem Auto steht in einem Raum aus Glas. Er guckt, als wüsste er nicht, wo er ist.
Dabei hat er doch schon einige durch und durch vernünftige Dinge gemacht. Er hat zum Beispiel das Licht angeschaltet und seine Orchideen gegossen. Ja, das ist absolut vernünftig: etwas zu tun, das alltäglich ist und doch seine ganze Konzentration erfordert.
Eine Weile glaubt er, er könnte es schaffen. Dann muss er sich doch setzen.
Warum, verdammt?
Er war ausgestiegen. Warum?
Ja, er hat angefangen zu weinen. Er sitzt auf seinem Stuhl und weint unermesslich. Er bekommt fast keine Luft mehr, Schleim läuft ihm aus Nase und Mund. Und wieder dieser Reflex. Diese Selbstbeschuldigung. Das stand doch unverrückbar fest! Dass ich nicht aussteigen darf! Er darf die Mädchen verfolgen, aber er darf nicht aussteigen. Er hat es trotzdem getan. Von da an erinnert er sich eigentlich an gar nichts mehr. Das ist auch gut, er will es gar nicht wissen. Was bringt das auch, wenn er sich vor sich selbst ekelt. Nein, mit Tränen und Rotz ist ihm nicht geholfen. Er braucht jetzt seinen Verstand. Die Funktion seines Verstandes ist überlebensnotwendig. An ein winziges Detail nämlich erinnert er sich. Im Haus war plötzlich das Licht angegangen. Nur an das. Nur an das Licht erinnert er sich. Ob es vor oder nach seiner säuischen Tat angegangen war, weiß er nicht. Wenn die Hexe mich gesehen hat! Das war kein Gedanke. Das war Angst in ihrer reinsten Form. Gott, wenn die Hexe mich gesehen hat!
Es war doch sicher hell gewesen auf der Lichtung. Hat da nicht auch Schnee gelegen? Er versucht sich zu erinnern. Wie weggeblasen. Alles wie weggeblasen. Außer diesem kurzen Moment, als im Haus Licht angegangen war. Auf diesen Moment, dieses Bild konzentriert er sich, ist schnell gewiss. Ja, es hat Schnee gelegen. Nicht viel, aber genug, um alles sichtbar zu machen. Vollmond. Der Mond war noch gut zu sehen gewesen, hinter den dünnen Wirbeln aus feinstem Schnee.
Die Hexe kann mich gesehen haben. Die Angst muss weg, er kann so nicht denken. Vielleicht ist sie sich nicht sicher. Was sieht man auf einer Lichtung, die weiß bezuckert ist? Einen Schatten? Mehr? Charakteristische Bewegungen? Vielleicht ist sie sich nicht sicher.
Der Mann guckt nach draußen. Es schneit. Und inzwischen sind es schon lange keine feinen, silbernen Flocken mehr. Der Schnee ist ihm vielleicht zum Verhängnis geworden. Gleichzeitig ist er seine Chance. Der Schnee tilgt alle Spuren. Aber nicht die im Gedächtnis der Hexe! Die Angst kommt zurück. Er muss jetzt irgendwas machen. Und dann fällt es ihm ein. Sein Plan! Natürlich! Er hatte doch einen Plan für den Notfall. Sie hat vielleicht nur eine Gestalt gesehen, ist sich nicht sicher! Ja. Er muss anrufen. Sofort. Aber nicht von hier. Er verlässt das Gewächshaus und geht zu seinem Auto. Er muss den Notfallplan ausführen, darf nur daran denken. Sonst kommt die Angst zurück.
Er weiß es natürlich nicht. Aber die Angst, gesehen worden zu sein, erkannt, erwischt und sichtbar gemacht zu werden, diese Angst ist, so schrecklich sie auch sein mag, nichts anderes als Schutz. Genau wie die Auslöschung der Erinnerung. Schutz davor, darüber nachzudenken, was er getan hat. Und diesen Schutz wird er jetzt verstärken. Das ist der Zweck des Notfallplans. Das mehr als alles andere.
Der Ton löst keine Träume aus. Roland Colbert reagiert absolut vernünftig auf das Klingeln des Telefons. Er zieht sein Bein vorsichtig zwischen Juliets Schenkeln raus, dreht sich um und nimmt den Hörer ab, ohne etwas vom Nachttisch zu schmeißen. Er spricht leise, aber so klar, als wäre es zwölf Uhr mittags.
»Kommissar Colbert.«
»Hier Ohayon! Du musst sofort kommen. Im Wald bei Fleurville wurde ein totes Mädchen gefunden! Ich mach mich auf den Weg, Conrey nehme ich mit. Am besten, du fährst von Fleurville her ran. Den Parkplatz kennst du?«
»Ja.«
»Du gehst gerade in den Wald, bis zum Feensee, gehst um den See. Kennst du den See?«
»Ja.«
»Pass auf, dass du nicht irgendwo einbrichst … Es schneit hier ziemlich, und man sieht nicht genau, wo die Gräben sind, ja? Also hältst du am besten genug Abstand, besser etwas mehr als …«
»Ich gehe um den See, und dann?«
»Auf der anderen Seite ist ein Hochsitz, da gehst du wieder in den Wald. Da ist ein Haus, ich … Du wirst das Licht sehen. Mein Licht.«
»Ich werde dein Licht sehen.«
»Aber beeil dich! Hier schneit alles ein!«
Juliet murmelt etwas, als er aufsteht. In den ersten Monaten hat sie ihn im Halbschlaf manchmal Jean genannt. Sie war der Meinung, dass er wie Jean Reno aussähe, der Schauspieler. Blödsinn!
Roland Colbert ist mindestens zwanzig Zentimeter größer, hat mehr Haare. Vielleicht das Gesicht. Die Augen. Aber auch da beschränkt sich die Ähnlichkeit auf den Blick. Kuhäugig! Das hat Juliet wohl gemeint. Man könnte natürlich auch von einem melancholischen Blick sprechen. Nur, was manche für Melancholie halten, entspringt bei ihm einer zur Ruhe gemäßigten Haltung. Es bringt nichts, aufgeregt oder genial zu sein. Es ist auch kein Vorzug, depressiv zu sein oder aggressiv. Roland Colbert ist seit achtzehn Jahren bei der Polizei. Es ist ein Beruf, kein psychotischer Zustand.
In jedem Fall erst mal auf die Toilette! Gestern hatten wir minus fünf Grad. Roland Colbert duscht kalt, zieht eine lange Unterhose an, ein Unterhemd mit halben Ärmeln, das bis zum Hals schließt. Danach die Thermostrümpfe, Hose, Hemd, Pullover. Lieber zu warm als zu kalt! Schal, Mantel, Mütze.
Zuletzt denkt er an Ohayon, schnappt sich eine Einkaufstüte, steckt etwas hinein.
Die Straße. Weiß. Sein BMW. Schwarz. Noch immer eine kleine Freude, der Anblick. Roland Colbert steigt ein, startet den Motor, schaltet das Licht ein.
Blau. Die Tachobeleuchtung ist blau. Roland Colbert achtet nicht darauf. Es geht jetzt um Wichtigeres.
Du musst das machen! Du musst!
Er hält vor dem Bahnhof. Die Telefonzelle gehört zu seinem Plan für den Notfall. Es ist niemand zu sehen. Das Allerschlimmste ist vorbei. Er registriert die Umgebung, zieht Schlussfolgerungen, die seiner Sicherheit dienen. Er muss sich retten. Sofort. Du musst! Ja, er muss den Mut aufbringen. Telefonieren. Das Telefonat ist Bestandteil des Notfallplans. Davon wird nicht abgerückt, das wird nicht infrage gestellt.
Hauptsache, es nimmt keiner ab!
Er steigt also aus. Geht zur Telefonzelle. Ruft an.
Es kommt alles anders. Aber er reagiert gut. Er denkt sogar daran, seine Stimme zu verstellen. Aber es ist schiefgegangen. Keine Frage.
Es war kein Anrufbeantworter, sondern ein Mensch. Jemand war ans Telefon gegangen. Dabei hatte er das doch gecheckt! Ein paar Mal angerufen. Zu verschiedenen Zeiten. Immer gleich aufgelegt. Um zwanzig nach fünf hatte nie jemand abgenommen. Heute hat jemand abgenommen. Aber er hat durchgehalten. Es ist alles in Ordnung, fahr nach Hause! Bleib ruhig.
Der erste, der wichtigste Schritt ist geschafft. Er ist raus aus der unmittelbaren Bedrohung. Und die war von ihm selbst ausgegangen. Jetzt liegt das Schwierigste hinter ihm. Er hat es geschafft, seine Angst zu transferieren. Er denkt nicht darüber nach, was er getan hat, er plant, wie er es schafft, dass sie ihn nicht erwischen. Die Angst, erwischt zu werden, die kann er notfalls aushalten.
Es schneit keine dicken Flocken, sondern mitteldicke. Und sie fallen auch nicht von oben, sie bewegen sich schräg. Dichtes Schneetreiben. Der Wind hat zugenommen. Sergeant Ohayon steht im Dunkeln neben der Leiche und versucht, sich warmzuhalten.
Wenigstens hab ich die Taschenlampe!
Bis eben war Grenier von der Spurensicherung da. Grenier hat, wie immer, präzise gearbeitet. Diesmal musste es offenbar schnell gehen.
»Warum so schnell, Grenier? Weil es so kalt ist oder warum?«
Sie hatte ihm nicht geantwortet.
Ohayon guckt ihr gerne zu. Sieht gut aus, wenn jeder Griff sitzt. Ihre Arbeit erinnert Ohayon an die eines Archäologen. Mit dem Unterschied, dass es heute schnell gehen musste. Grenier hatte nur kleine Löcher gegraben, die Tiefe des Schnees ausgemessen, den Kopf des Opfers vorsichtig angehoben, sich die Stelle angesehen, auf der er lag. Das Gleiche mit dem Arm. Grenier hat viel aufgeschrieben. Vor allem Zahlen. Zuletzt hatte sie alles im Umkreis von zwei Metern untersucht. Ohayon war interessiert. »Ist da was? Du siehst was, oder?«
Grenier antwortete ihm nicht. Sie arbeitete.
Ihr war die Unregelmäßigkeit sofort aufgefallen. Sie hatte kurz im Schnee gestochert, den Gegenstand entdeckt, ein Fähnchen in den Schnee gesteckt. Sergeant Conrey kam dazu, Ohayon fragte: »Und? Hat die Hexe was gesagt?«
»Ja. Dass sie das Mädchen angeblich kennt. Sie will aber nur mit dem Kommissar sprechen.«
»Aha.«
Grenier unterbrach die Männer und erklärte ihnen, was sie nicht tun sollten. »Also, Jungs. Wir wissen nicht, was unter dem Schnee ist! Verstanden?«
»Ja, Grenier.«
»Conrey?«
Conrey nickte knapp, Ohayon erklärte: »Wir sollen nicht rumlaufen.«
»Du hast verstanden?«
»Ja, Grenier. Ich bin seit fünfzehn Jahren dabei. Ich laufe nicht rum. Conrey auch nicht.«
Dann war Grenier mit ihrem Rucksack Richtung Wald gelaufen. Am Waldrand war sie noch einmal stehen geblieben, hatte die Fäuste geballt und ihre Arme zum Himmel geschleudert. Grenier hatte den Himmel angebrüllt. Ohayon und Conrey hatten zum Himmel hinaufgesehen und beide etwas gesagt. Danach war Grenier im Wald verschwunden und Conrey ging ins Haus zu Madame Darlan.
Es gibt nichts Schlimmeres als eine Leiche im Freien! Da bricht garantiert ein Unwetter los! Das hatte Grenier mal gesagt. Und sie hatte bei jeder Leiche, die sie im Freien fanden, recht behalten. Nur war es diesmal kein Unwetter, sondern Schnee.
Der fällt leise. Schräg. Schnell und in Massen.
Als Roland Colbert zwanzig Minuten später den Parkplatz am Feensee erreicht, wäre es beinahe passiert. Die Scheibenwischer seines BMW schaffen es nicht mehr, und er sieht kaum noch was durch den festgefrorenen Schneepapp.
Gott! Erst im letzten Moment sieht er das Licht. Er bremst. Kommt noch zum Stehen. Was?
Er springt raus. Er hat sie gesehen. Im letzten Moment. Das Licht. Dann gebremst. Dann raus. So war es.
Das Mädchen krabbelt auf dem Boden rum. Er will zu ihr laufen, bleibt nach drei Schritten stehen.
Was er sieht, passt nicht. Dieses Mädchen ist kein Mädchen, und sie ist auch nicht in Not. Würde sie sonst ein Maßband ausgerollt haben und etwas auf einem Block notieren? Die Frau, die kein Mädchen ist, richtet sich auf, macht heftige Bewegungen mit der Hand. »Fahr deine Kiste weg, Roland! Da! Fahr da hin!«
»Grenier?«
»Fahr deine Kiste da weg! Du musst da rein in den Wald. Sie liegt auf der anderen Seite vom See! Oben auf der Lichtung beim Haus von Madame Darlan, kennst du das Haus?« Roland Colbert kennt das Haus. »Beeil dich! Sonst siehst du gar nichts mehr!«
Roland Colbert setzt seinen Wagen ein Stück zurück. Der Wagen sackt hinten ab.
Scheiße! Mit diesem Wagen wird er hier nicht mehr wegkommen. Er steigt aus, nimmt eine Taschenlampe und die Plastiktüte für Ohayon vom Beifahrersitz. Bleibt dann einen Moment neben dem Wagen stehen.
Er friert, aber das ist in Ordnung.
Er musste sehen, ob das Mädchen noch da lag. Es war seine berufliche Pflicht, das zu überprüfen. Er musste sich vergewissern. Er war von der deutschen Seite gekommen. Vorsichtshalber. Er hat die Lichtung umrundet, bis er zu der Stelle kam. Er hat eine Frau von der Polizei beobachtet, die etwas im Schnee untersuchte. Das Mädchen lag also noch da. Neben der Frau stand ein kleiner, dicker Mann und stellte ihr Fragen. Dann war ein zweiter Mann gekommen, und die Frau hat den beiden etwas erklärt. Plötzlich war die Frau in den Wald gelaufen. Direkt auf ihn zu. Er war geflüchtet, quer durch den Wald, bis fast runter zum See. Er hat gewartet. Lange.
Jetzt hat er keine Angst mehr. Für Angst ist es viel zu kalt. Also traut er sich endlich zurück in den Wald. Ihm bleibt auch gar nichts anderes übrig. Gehen oder erfrieren. Er wird hochgehen, bis an den Rand der Lichtung, dann die Lichtung umrunden, bis auf die andere Seite, wo er seinen Wagen versteckt hat. Auf einmal hört er Hunde. Er läuft weg, duckt sich hinter einem Stamm. Wartet. Die Hunde kommen nicht näher. Er will gerade wieder aufstehen, als er hört, dass jemand kommt. Er bleibt also hinter dem Baumstamm hocken. Lange wird er es nicht mehr aushalten in der Kälte.
Nachdem Roland Colbert den See umrundet hat, dringt er wieder in den Wald ein. Er nimmt dabei nicht denselben Weg wie Geneviève. Er nimmt einen schlechteren Weg. Einen, der durchs Unterholz führt. Dann hört er Hunde und dann …
Da ist jemand.
Er schaltet die Taschenlampe aus. Lauscht. Dreht sich. Lauscht. Nur die Hunde. Sehr weit entfernt.
Aber da ist jemand!
Hat er etwas gesehen? Nein. Hat er etwas gehört? Nein.
Es dauert einen Moment. Jetzt weiß er es. Er hat etwas gerochen. Er versucht, den Vorgang zu wiederholen. Riecht. Nichts. Geht ein Stück zurück. Schnüffelt. Nichts. Er versucht sich an den Geruch zu erinnern. Schwierig.
Parfüm. Das ist sicher. Parfüm eines Mannes? Einer Frau? Eher ein Mann.
Roland Colbert ist besorgt. Das Drehen. Die Orientierung. Die Batterien der Taschenlampe gehen in der Kälte zugrunde.
Da! Kommissar Colbert sieht einen gebündelten Lichtstrahl, der durch den Wald fingert. Er geht auf den Ursprung des wandernden Lichtstrahls zu, strauchelt, fängt sich ab. Endlich wird er vom Licht erwischt.
»Roland!«
Er sieht nichts außer Licht.
»Ohayon, verdammt! Nimm die Lampe runter.«
»Hier! Hier bin ich! Hier, Roland, hier!«
»Hör auf, mich anzuleuchten!«
Ohayon senkt den Lichtstrahl. Roland Colbert richtet sich auf und betritt die Lichtung.
»Hier! Hier liegt sie.«
Roland Colbert geht zu Ohayon, ignoriert die Leiche. Es ist keine Leiche, es ist ein weißer Hügel.
»Wo steht denn dein Auto? Da war keins auf dem Parkplatz.«