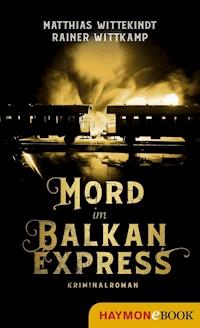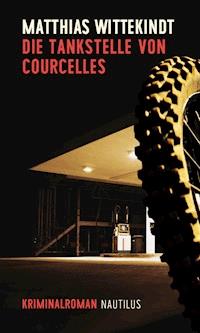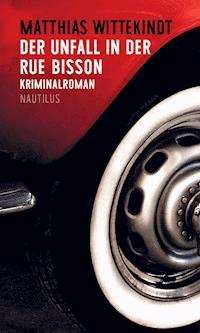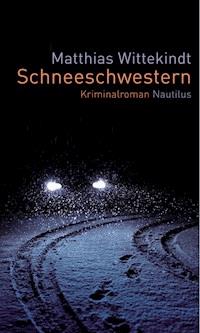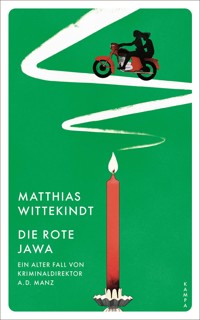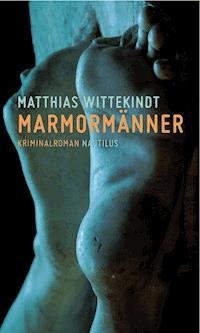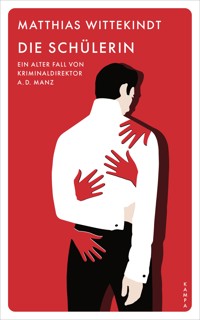
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Red Eye
- Sprache: Deutsch
»Ihr müsst miteinander reden«, fordert Christine, und Manz weiß: Seine Frau hat recht. Seit Julias Scheidung ist die Stimmung zwischen ihm und seiner jüngsten Tochter eisig. Dabei eifert Julia ihrem Vater beruflich nach: Als Anwältin ist auch sie täglich mit Verbrechen befasst. Um die Wogen zu glätten, erkundigt sich Manz nach Julias Arbeit und stellt fest: Mit ihrer aktuellen Klientin hatte er selbst schon zu tun, in den siebziger Jahren in Berlin. Damals hat diese Sabine Schöffling im Fall eines ermordeten Fünfzehnjährigen eine zweifelhafte Rolle gespielt. Soll Manz seine Tochter warnen? Doch Ratschläge will Julia sicher nicht von ihrem Vater - schon seine Kommentare zur Erziehung von Enkelin Emma sind ihr lästig. Bei Manz selbst setzt die ganze Sache Erinnerungen in Gang: an den Fall, der sich im Umfeld der reformpädagogischen Elisabeth-Rotten-Schule ereignete, an sein damaliges Leben, als Christine gerade mit Julia schwanger war, und an seine eigene Kindheit im Berlin der Nachkriegszeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Wittekindt
Die Schülerin
Ein alter Fall von Kriminaldirektor a. D. Manz
Kampa
I
Die schreckliche Ente
Schwarz. Drall. Schimmernd. Feucht, aber nicht nass in der Furche.
Nun kommt die Hand. Ein prächtiges Exemplar! Ein bisschen Bohren, ein bisschen Hebeln und Ziehen, schon ist es geschafft.
Da bist du ja.
Die kommt natürlich sofort aufs Küchenhandtuch.
Der nächste Einstich. Tief, aber nicht endlos tief. Nicht wuchtig und roh. Nicht, wie ein übermütiger Junge es vielleicht machen würde. Die nächste Furche tut sich auf. Wieder greift die Hand in die Tiefe. Tastet. Bohrt ein wenig. Hebelt. Zieht.
Prächtig.
Auch die kommt aufs Küchenhandtuch.
Es ist ein routinierter, fast schon mechanischer Vorgang. Und doch macht sich bei jedem Sieg ein kleines Glücksgefühl breit.
So geht es eine ganze Weile. Achtundzwanzig Mal, um genau zu sein. Sooft eben ein Mann seines Alters es noch am Stück schafft. Als Manz sich schließlich aufrichtet, spürt er seinen Rücken. Zum Glück ist es längst nicht mehr so schlimm wie noch vor ein paar Monaten. Da hatte sein Arzt ihm dringlich zu einem operativen Eingriff geraten, und der Gedanke, dass Teile seines Körpers ersetzt werden mussten, kratzte doch spürbar an Manz’ Selbstwertgefühl.
Den Tiefpunkt hatte er Anfang März durchlitten.
»Es fängt schon wieder an«, hatte er damals zu seiner Frau Christine gesagt. »Ich komm nicht mehr runter.«
Am schlimmsten war es immer am Sonntag nach dem Mittagessen.
»Ich komme und komme und komme einfach nicht mehr runter. Ich leg mich hin. Schrecklich, dass einem das Alter so die Lust auf alles verdirbt.«
»Du genießt es aber auch ein bisschen, oder?«, hatte Christine gefragt. Sie hatte ihn dabei nicht mal angesehen und in aller Seelenruhe ihr Messer aufs Fleisch gesetzt.
Am Ende war glücklicherweise keine Operation nötig. Christine war der emotional deutlich gestörte Zustand, die bis in den intimen Bereich wirkende Ermattung und Lustlosigkeit ihres Mannes irgendwann so auf die Nerven gegangen, dass sie sich mit einer Kollegin besprach.
»Er kommt nicht mehr runter.«
»Oh.«
Die Kollegin, die gar nicht mal eine enge Freundin war, riet Christine, und sie war sich ihrer Sache ganz sicher: »Ab zur Krankengymnastik, er muss beweglich werden! Durchlässig. Mehr ist es in der Regel gar nicht bei Männern in dem Alter. Sie müssen wieder durchlässig werden. Und natürlich beweglich.«
»Sagtest du schon.«
»Auf keinen Fall eine verfrühte Operation. Hast du nicht erzählt, dein Mann würde rudern?«
»Viermal die Woche.«
»Und da tut ihm der Rücken weh?«
»Beim Rudern nicht, sagt er.«
»Dann muss auch nichts operiert werden. Eine gute Krankengymnastin kriegt das hin.«
Und so war es gemacht worden. Eigentlich keine große Sache.
»Au, aua! Aufhören! Sie machen mich kaputt!«
»Mal ganz ruhig, Herr Manz. Und bitte genauso atmen, wie ich sagte.«
»Gott!«
»Hören Sie mir zu, Herr Manz?«
»Ja, verdammt!«
»Einatmen. Halten. Ausatmen. Und nicht gleich rumschimpfen, wenn es mal zeckt. Immer aktiv in den Schmerz reingehen. Sind wir so weit?«
»Gott!«
Der Anfang war ein bisschen schwierig gewesen, aber es hatte sich gelohnt. So steht Manz jetzt, gerade mal sieben Monate später, in seinem Garten und erntet Schwarzwurzeln. Eine Arbeit, bei der man sich bücken muss.
Nun, das ist kein Problem mehr für ihn, denn die Krankengymnastin … Eine phantastische Frau, ohne sie, ihr Einfühlungsvermögen, ihre enormen Kenntnisse … Diese phantastische Krankengymnastin hat Manz nicht nur geheilt, sondern ihm auch einiges beigebracht.
Wie man vernünftig geht, vernünftig steht. Wie man sich richtig bückt. Wie man dabei die Knie beugt, welche Muskeln man einsetzt, wenn man etwas Schweres hebt. Und vor allem, wie man richtig sitzt.
»Ich sagte gerade, ich sagte nicht Militär.«
Anfangs hat er auf einem großen türkisfarbenen Ball geübt.
Schwarzwurzeln.
Dieses Wort ist für Manz fast schon zu einem Synonym geworden, für Heilung.
Noch während er schmerzgeplagt und geschwächt war, fing das an. Nach Schwarzwurzeln stand ihm plötzlich der Sinn. Denn Schwarzwurzeln hatte er seinerzeit mit Leidenschaft in der Polizeikantine gegessen. Damals noch in Berlin, in der Karl-Marx-Straße, Direktion 5. Vierzig Jahre ist das jetzt her.
Das Gesicht, der Körper, ja sogar die Körperhaltung der Frau an der Essensausgabe war in seinem überreizten Geist aufgestiegen. Sie hatte ihm oft eine halbe Kelle extra gegeben.
»Noch einen Schlag helle Soße?«
»Gerne.«
»Zwiebeln?«
»Auch.«
Um seine neu erwachte Lust auf Schwarzwurzeln im Herbst selbst stillen zu können, hat Manz mithilfe seiner Ruderfreunde, Wolfgang, Henning und Theo, die die schweren Arbeiten übernahmen, noch im März dreihundert Quadratmeter hinten in seinem Garten umgegraben und dort Schwarzwurzeln ausgesät. Dazu kamen dann noch Salat, Rüben, Kohlrabi.
»Und meine Astern?«, hatte Christine gefragt, als die Männer begannen zu graben.
Richtig Lust bekommen auf einmal auf gute Ernährung.
Wer im Frühjahr sät, kann im Herbst ernten. Und Manz muss ernten, weil … Er will heute etwas Besonderes kochen. Seine jüngste Tochter, Julia, hat sich angekündigt. Mit Emma. Richtig. Zusammen mit Emma, seinem Lieblingsenkelkind.
Aber noch kocht er nicht, noch sticht Manz seinen Spaten mit Bedacht in die Erde, hebelt die von Feuchtigkeit gesättigte Erdmasse vorsichtig auf. Es ist acht Uhr morgens, das Gras ist vom Tau ganz nass, die Elbe dampft seit Tagen.
Fast möchte man meinen, der Fluss würde kochen und … Ha! Die weißen Teufelchen werden sich zeigen.
Als Manz vier Dutzend Schwarzwurzeln ausgegraben und auf seinem Küchenhandtuch abgelegt hat, muss er plötzlich an einen gusseisernen Heizkörper denken.
Leicht gelblich. Wenigstens zehnmal lackiert.
Er versteht nicht, woher das Bild auf einmal kommt, weiß aber, dass der Heizkörper, den er vor seinem inneren Auge sieht, direkt neben seinem Schreibtisch an der Wand hing. Damals in Berlin. In meinem Büro, Direktion 5.
Aber taucht das Bild des gusseisernen Heizkörpers wirklich in diesem Moment zum ersten Mal auf? Beim Anblick von soeben geernteten Schwarzwurzeln auf einem Küchenhandtuch?
Wo sollte da die Verbindung sein?
Manz wird sich später fragen, ob er an den gusseisernen Heizkörper bereits bei der Schwarzwurzelernte dachte oder erst, nachdem mir Julia von ihrer Mandantin und der totgefahrenen Frau auf dem Fahrrad erzählt hat.
Solche Momente, in denen man auf einmal erkennt, wie grundlegend man sich in einer Sache oder dem Verhältnis zu einer Sache getäuscht hat, kennt jeder. Manz war das zum ersten Mal passiert, als er mit seiner Mutter in den Ferien war.
Nordsee. Wie alt war ich da? Sechs? Sieben?
Es war Anfang der fünfziger Jahre noch üblich, Berliner Kinder zusammen mit ihren Müttern ans Meer zu verschicken. Wangerooge. Wegen der Luft. Und damit wir mal was anderes zu sehen bekommen als kaputte Häuser und Straßen. Aber wie kam ich da hin? Aus Pankow? Wann wurde die DDR gegründet? Neunundvierzig, oder? Hat sicher Onkel Jochen organisiert, dass wir da hinkonnten. So wird’s gewesen sein. Onkel Jochen über einen seiner Patienten. Anders gar nicht denkbar.
Ja, und da stand der kleine Manz also am Strand. Ganz friedlich kamen ihm das Meer und die nicht mal kniehohen Wellen vor, die rote, bereits heftig flimmernde Sonne hatte gerade zum ersten Mal das ebenfalls rote Wasser betupft, und … da sah er die Ente. Im Gegenlicht der untergehenden Sonne erkannte er natürlich nur einen Schatten. Den er aber sofort als einen Schwimmring mit Entenkopf identifizierte. Schon halb die Luft raus.
Und diese Ente, die schaukelte nun in den Wellen sanft auf und ab. Immerzu. Sanft auf und ab. Und der kleine Manz wollte unbedingt ran, sie rausholen. Er ging also ins Wasser, während dreißig Meter hinter ihm seine Mutter darauf konzentriert war, die Badesachen einzupacken. Manz konnte damals noch nicht schwimmen, trotzdem wagte er es. Erst bis zum Rand der Badehose, dann Uh! ganz vorsichtig weiter, Tippelschritte mit Sand zwischen den Zehen, bis zum Bauch, dann noch etwas tiefer, schließlich bis an den Brustkorb. Aber er kam nicht ran, an die Ente. Nein. Er kam einfach nicht ran. Zuletzt hatte er gemeint, er könne sie mit seinem Blick lenken, ja fast saugen und dafür sorgen, dass die Aufblasente durch reine Willenskraft näher käme. Es war ein Spiel gewesen. Ein intensives, ein leichtsinniges und … ja, ein bisschen verrückt war es auch. Erstens, sich als Nichtschwimmer so tief reinzutrauen, und zweitens, sich einzubilden, die Ente mit dem Blick kontrollieren zu können. Das ging gut, bis zu dem Moment, da er plötzlich meinte, nicht er würde die Ente ansehen, sondern sie ihn.
Er hatte sich so erschrocken. So erschrocken! War aus dem Wasser gestürmt, das ihm auf einmal feindlich und gefährlich vorkam, und dann gleich hin zu seiner Mutter, die gerade mit ihren Knien unter einem gebeugten Rücken die Luftmatratze leer drückte. Hatte er geschrien? Wohl nicht, denn dann hätte seine Mutter ja reagiert.
»Mutti …!«
»Gott, du bist ja ganz weiß im Gesicht!«
Ihre kräftigen, warmen Arme, sein zarter Körper.
»Na, das wird schon, das wird schon, dir kann doch nichts passieren.«
Er wollte trotzdem nach Hause. Zurück in Sicherheit. Zurück nach Berlin.
Die Sache mit der fragwürdigen Ente hatte Manz nie ganz losgelassen. Dabei fand sich später durchaus eine Erklärung für sein furchtbares Erschrecken. Christine, die sich mit solchen Effekten wie auch mit vielem anderen auskannte, hatte die Aufblasente Jahrzehnte später … eine abendliche Unterhaltung über Erlebnisse in der Kindheit … mit Sachverstand auf einen akademischen Sockel gehoben.
»Die Umkehrung des Blicks, darauf beruht die Urangst im Wald.«
»Ach.«
Sie meinte damit bestimmte, eigentlich unsinnige Momente.
»Zum Beispiel, wenn jemand plötzlich glaubt, die Bäume im Wald hätten so was. Einen Blick. Oder wenn man meint, im Gebüsch wäre etwas, das man nur noch nicht sieht. Etwas mit einem Blick.«
Manz hatte genickt. Einige Opfer, die er seinerzeit beruflich befragte, hatten solche Ahnungen erwähnt. Kurz vor dem Angriff.
Davon abgesehen konnte seine Frau gerne klug reden. Über die Umkehrung des Blicks und so. Er hörte ihr auch zu, aber … Die Ente hat sie ja nicht angesehen! Christine wusste möglicherweise gar nicht, wie sich das anfühlt. Angst. Wirkliche Angst. So eine, die einem die Schlagadern vom Hals her bis in die Ohren hinein anschwellen lässt und den Bauch mit Macht zu den Lungen hochdrückt.
Nun hier, also im Fall der plötzlich in seinem Geist aufgestiegenen gusseisernen Heizung, ist es natürlich nicht so schlimm wie damals mit der Ente. Denn erstens taucht das Bild des Heizkörpers nur für ein paar Sekunden auf, und zweitens ist Manz mit seinen vierundsiebzig Jahren Lebenserfahrung kein Kind mehr.
»Träumst du, Opa? Wir wollten doch los.« Das Fernglas baumelt vor Emmas Bauch, es wirkt riesig.
»Noch mal zur kleinen Insel?«
»Ja!«
Dass seine Enkeltochter zur kleinen Insel will, liegt an einem Buch, das er ihr gerade vorliest.
Der Tag ist ihm kurz vorgekommen. Und das, obwohl sie einiges erlebt haben. Mit Emma auf die kleine Insel zu den Reihern, dann beide einen Nassen geholt im Modder, später im Garten ein Feuer gemacht. Hat mächtig gequalmt. Mittags hat Emma zwei Portionen Schwarzwurzeln gegessen und beim Abendbrot gefragt, ob noch welche da wären.
»Zeit fürs Bett«, hat Julia gesagt. »Deine Augen sind schon ganz rot.«
»Weil es so gequalmt hat, als Opa und ich das Laub verbrannt haben.«
Leider war der Qualm genau zu Wolfgang rübergezogen. Kam dann ja auch gleich an den Zaun.
So wird es Abend, so wird es dunkel und …
Wer jetzt draußen, schön warm eingemummelt, im Garten von Manz und Christine stünde, wer vielleicht den Kopf etwas in den Nacken legte, dem würde es nicht entgehen. Die Nacht, sternklar, der Mond riesig, die Landschaft entfärbt. Eine dünne Dunstfahne über dem Schornstein steigt auf wie ein gekräuselter Faden. Fast möchte man an Nordlichter denken. Die Fenster aber, die Wärme des Lichts, das von innen nach draußen dringt, die beiden Frauen auf dem Sofa hinter dem großen Terrassenfenster … Das sieht so gemütlich aus, da möchte man gleich ans Fenster treten, anklopfen und dabei sein.
Auch oben, in Manz’ altem Arbeitszimmer, brennt Licht. Es wirkt noch wärmer als das unten.
»So, Emma, jetzt haben wir das ganze Kapitel durch, und dir fallen auch schon die Augen zu. Zeit, dass du schläfst.«
»Bauen wir morgen das Floß?«
»Wir gehen erst mal zum Ruderclub und sehen nach, was wir an Material haben.«
»Ist Wolfgang auch da? Trinkt ihr dann wieder Bier? Der ist dein Freund, oder?«
»Ja, Wolfgang kommt aus Berlin, so wie ich.«
Emma bewegt ihre Beine, irgendetwas scheint ihr im Kopf umzugehen.
»Warum heißt Zizzwitz eigentlich Zizzwitz?«
»Das erzähle ich dir ein andermal.«
»Und warum wohnt ihr nicht bei uns in Dresden?«
»Na, so weit ist es ja nicht bis zu uns.«
»Dreizehn Kilometer, wir haben das gemessen.«
»Ich glaube, du solltest jetzt schlafen.«
»Mutti war letzte Woche zweimal in Berlin. Wegen ihrem Prozess.«
»Ah, ja?«
»Warum sagst du das so komisch?«
»Schlaf jetzt, Emma. Wir können morgen weiterreden.«
»Die Tür …!«
»Lass ich ein bisschen offen. Denk an was Schönes, dann schläfst du schnell ein.«
»Warum an was Schönes?«
»Gute Nacht.«
Wie versprochen lässt Manz die Tür zwei Handbreit offen und geht über die schmale Holztreppe nach unten. Schon vor einiger Zeit hat er mit Genugtuung festgestellt, dass er sich dabei nicht mehr am Handlauf festhalten muss.
»So, da bin ich wieder.«
Manz wirft einen Blick auf seinen Besitz und das Erreichte. Berechnet angefallene Kosten. Christine und Julia sitzen gemütlich auf der neuen, von einem italienischen Designer entworfenen IKEA-Couch. Tausendzweihundert Euro. Die Couch ist grau bezogen und hat sehr dünne, leicht nach außen abgewinkelte Beine, wie es vor sechzig Jahren schon mal Mode war. Die große, bis zum Boden hinabreichende Panoramascheibe zum Garten hin wurde letzte Woche professionell gereinigt. Siebzig Euro, nie wieder. Draußen im Garten läuft der beleuchtete Springbrunnen, Algenfilter muss gereinigt werden, und die Birke vor Christines Hortensienhügel ist perfekt angestrahlt. Die Blätter werden bald fallen, ich muss noch die Beete vorne mit Rindenmulch …
»Das hat ja ewig gedauert«, unterbricht Julia seine Gedanken.
»Emma konnte noch nicht einschlafen.«
»Dann hat sie dich reingelegt. Zwanzig Minuten Vorlesen ist unsere Abmachung.«
»Das Kapitel war aber noch nicht zu Ende.«
»Was hast du ihr denn vorgelesen?«
»Na, weiter Robinson Crusoe. Die Geschichte mit dem Floß, wie er alles aus dem Wrack rettet und auf die Insel bringt.«
»In dem Alter ist sie doch noch gar nicht. Vor allem möchte ich dich bitten, dass du die Stelle mit den Menschenfressern auslässt.«
»Natürlich.«
»Ich weiß nicht, ob dir so was auffällt, aber dieses Buch, das ist Rassismus pur.«
»Für Erwachsene wie dich vielleicht. Emma ist sieben.«
»Richtig, sie ist sieben. Und wir haben darauf zu achten, was sie später denkt. Wir machen unsere Kinder zu dem, was sie mal sind.«
»Das glaubst du doch selbst nicht!«
»Der Wein, den Julia mitgebracht hat, ist wirklich gut«, sagt Christine.
»Das ist mein voller Ernst. Zwanzig Minuten. Sie kennt die Regel ganz genau. Und du eigentlich auch.«
»Der Wein, den Julia mitgebracht hat … der ist wirklich gut«, sagt Christine erneut und hebt diesmal, als wäre das dringend geboten, ihr Glas.
»Glaub ich gerne, aber … ich hol mir ein Bier.«
Während der nächsten Stunde breitet Julia noch einmal vor ihnen aus, dass sie inzwischen wieder in ihrem Anwaltsbüro arbeitet … hat sie uns doch letztes Mal schon erzählt … und wie sie alles drum herum organisiert hat. Sie hat sich im Vorjahr von ihrem Mann getrennt.
»Wir kriegen das immer besser hin. Emma ist bis fünf in ihrer Gruppe, und ich habe mir jetzt einen kleinen Mitsubishi …«
Christine ist irgendwann müde geworden und hochgegangen.
Fand das wohl auch ein bisschen langweilig.
So ist das Schlimmste eingetreten. Manz und seine Tochter sitzen plötzlich da wie bestellt und nicht abgeholt. Draußen plätschert der Springbrunnen, die von drei Halogenstrahlern präzis erfasste Birke leuchtet goldgelb, und es steht nicht gut zwischen ihnen.
»Ihr müsst miteinander reden«, hat Christine erst vor ein paar Tagen gefordert. »So geht das nicht weiter.«
»Ach, komm …«
»Doch! Diesmal redest du mit deiner Tochter und entschuldigst dich.«
»Wofür?«
»Das weißt du genau.«
Der Grund für den Zwist? Manz hatte Julias Trennung von ihrem Mann im letzten Jahr nicht gut moderiert.
»Scheidung? Ihr habt eine Tochter! Daran zwischendurch mal gedacht?«
Er hielt die Auflösung der Ehe für verfrüht, und Julia hatte das in den falschen Hals gekriegt.
»Ist das Prinzip bei dir, dass du dich immer auf seine Seite stellst?«, hatte sie zum Beispiel gefragt. Im Januar stritten sie sich teils heftig deswegen. Auch im Februar war es noch zu Gefechten gekommen.
»Du kannst nichts von dem beweisen, was du deinem Mann unterstellst.«
»Warum muss ich denn etwas beweisen?«
»Weil du ihm vorwirfst, für eine Frau aus seinem Büro zu schwärmen, oder was weiß ich, was da angeblich vorgefallen ist.«
»Ach, darum geht es doch gar nicht.«
So hatten sie im Januar, Februar, ja, bis in den März hinein miteinander gestritten. Vielleicht spielten Manz’ Rückenschmerzen eine Rolle. Er hatte seiner Tochter ständig widersprochen, sie ihm ebenfalls. Einmal hatten sie sich angeschrien.
Manz hatte gemeint, die Wogen würden sich sicher irgendwann glätten. Eine hoffnungsvolle Einschätzung, denn Julia hatte ihm im Rahmen dieser Streitereien noch einiges mehr vorzuwerfen. Und Christine war in dieser ganzen vertrackten Angelegenheit wahrlich keine große Hilfe.
»Es klingt wirklich so, als stündest du auf der Seite ihres Mannes.«
»Die ist doch verrückt! Jetzt behauptet sie auch noch, ich hätte sie kaum wahrgenommen, als sie … als Kind. Als Jugendliche.«
»Du hast viel gearbeitet damals.«
»Ach, so ist das? Und warum haben Claudi und Steffi dann keine Probleme?«
»Weil die sich nicht so auf dich beziehen.«
»Und Julia tut das? Den Eindruck habe ich nicht.«
So war das bis in den März hinein gegangen, und im April, Mai und Juni war es auch nicht viel besser geworden.
Der Scheißrücken.
Es war eine Mauer entstanden zwischen ihnen. Weil es, wie Julia wiederholt sagte, so wenig Kontakt gab. Früher. Als sie jung war. Als sie ihren Vater gebraucht hätte.
Wie bestellt und nicht abgeholt. So sitzen sie da.
Die Aussprache! Die Aussprache! Es hilft ja nichts. So kann das nicht weitergehen, also geht er es an.
»Und?«, fragt er, nachdem sie etwa drei, gefühlt dreizehn Minuten stumm dagesessen haben. »Wie läuft’s in deiner Kanzlei?«
»Es ist nicht meine Kanzlei.«
»Wie läuft’s in der Kanzlei, in der du arbeitest?«
»Gut.«
»Schön. Schön, dass es gut läuft. Und woran arbeitest du gerade?«
»Ich arbeite nicht an etwas, sondern für jemanden.«
»Himmel auch! Das ist doch … Muss das denn immer …? Ich bin dein Vater, kein Staatsanwalt oder Richter oder … Herrgott!«
»Versuch doch mal, dich ein bisschen genauer auszudrücken und vernünftige Sätze zu bilden.«
»Himmel! Julia! Das ist kein Verhör! Also, für wen arbeitest du im Moment?«
»Für eine Mandantin.«
»Was wirft man ihr vor?«
»Interessiert dich das überhaupt?«
»Was wirft man ihr vor?«
»Meineid.«
»Im Rahmen einer schweren Straftat?«
»Die Staatsanwaltschaft wirft Frau Schöffling vor, einem Mann, der Fahrerflucht begangen hat, ein falsches Alibi verschafft zu haben.«
Schöffling … War es nicht eher dieser Moment? War nicht erst da das Bild der gusseisernen Heizung in seinem Kopf entstanden?
»Und war das ihr Mann?«
»Wie?«
»Den sie angeblich mit einem falschen Alibi gedeckt hat, war das ihr Mann?«
»Ein Bekannter.«
»Ein schlimmer Unfall?«
»Mit Todesfolge.«
»Frau Schöffling ist wie alt?«
»Siebenundfünfzig.«
»Also kein Fall fürs Jugendgericht.«
Manz hat das schnell und mit konzentriertem Ernst gesagt. Einen kurzen Moment lang ist seine Tochter so irritiert, dass sie versehentlich … lächelt.
Da Manz sich nun ebenfalls über seine letzte Bemerkung amüsiert, ergibt sich ein Bild, das Außenstehende dazu verleiten könnte zu glauben, die beiden würden sich doch gut verstehen, seien sich doch nahe. Verstärkt wird der Eindruck dadurch, dass Vater und Tochter nicht nur die exakt gleichen Augen und den gleichen Blick haben, sondern auch in fast gleicher Haltung dasitzen.
»Schöffling ist ein seltener Name«, sagt Manz. »Aber passend irgendwie, weil …«
»… bei Gericht …«
»… Schöffen …«
»Genau.«
»War nur ein Gedanke.«
»Ja, dachte ich auch gleich, als sie sich vorstellte. Sabine Schöffling. Berlinerin.«
»Das heißt, die Verhandlung …«
»… in Berlin.«
»Kriminalgericht Moabit?«
»Wo sonst?«
»Weißt du, was mir letztes Jahr aufgefallen ist? Ich war doch da, wegen …«
»… die alte Sache, deine Aussage …«
»… genau. Und als ich reinging … Ich war natürlich in meiner Berliner Zeit oft im Kriminalgericht, aber letztes Jahr, da fiel es mir zum ersten Mal richtig auf …«
»… ein irres Treppenhaus.«
»Gigantisch.«
Auf einmal, man kann nicht immer sagen, warum Menschen etwas tun, richtet Julia ihren Oberkörper in einer Weise auf, als hätte sie sich erschrocken. Manz meint, ihr Gesicht hätte sich gerötet. Es sieht aus, als wäre ihr auf einmal heiß geworden. Auch ihm ist heiß. Aber da passiert noch mehr. Bei Manz verbindet sich das Bild seiner Tochter mit einem Namen, Schöffling, einem Wurzelgemüse und einer gusseisernen Heizung. Ja, so ist es. Das erst ist der Moment. Da erst denkt er an den gusseisernen Heizkörper. Oder?
Eine halbe Sekunde dauert das. Nicht mal! Sabine Schöffling. Manz möchte seine Tochter vor ihrer Mandantin warnen. Es ist ein starker, ein sehr unmittelbarer Impuls, und doch tut er es nicht. Ihre Sache, ihr Fall, ihr Leben.
Manz atmet tief durch, sein Blick geht jetzt, an seiner noch immer hoch aufgerichteten Tochter vorbei, in Richtung der Birke.
Er lag auf dem Rücken, Beine parallel, Arme und Hände eng am Körper. Vierzehn, vielleicht fünfzehn Jahre alt. Der Hosenaufschlag flatterte im Wind. Jemand hatte ihn so drapiert.
Und da! Buuum! Es ist dieser Moment. Da geht der mit goldenen Pailletten reichlich bespickte Vorhang auf, die jungen Frauen in ihrer knappen Tracht treten mit devoter Verbeugung zur Seite, und präsentiert wird: Manz’ glorreiche Vergangenheit in all ihrer Pracht.
Frau Bächle hat ein Gespür
Scheiße auch!
Berlin, 78. Manz rieb sich die rechte Gesichtshälfte. Sie kam ihm geschwollen vor, und … spürte er nicht sogar ein leichtes Pochen, war es nicht so, dass er seit einigen Tagen immer häufiger sein rechtes Auge zukniff? Es war kaum auszuhalten.
Und das Mitte Oktober!
Er hatte sich nichts Böses gedacht, als man ihn nach seinem Aufstieg in den Rang eines … in diesen Raum gesteckt hatte. Nicht groß, dafür hell. Und nach vorne raus.
Manz teilte ihn sich seit sechs Monaten mit einem zweiten Mann. Borowski war nicht dick, sondern breit. Er gehörte somit, wenigstens auf den ersten Blick, zum endomorphen Typus, erkennbar an seinen eher kurzen Armen und Beinen, seinem runden Gesicht, einem kurzen Hals und einer glatten, wie es schien, überaus weichen Haut. Dazu kamen noch sehr viele, etwa drahtdicke knallschwarze Haare, die er regelmäßig in eine Fasson schneiden ließ, was ihm im Zusammenspiel mit viel Haarfit einen Seitenscheitel erlaubte. Wie Manz wusste, ging Borowski seit vielen Jahren regelmäßig in ein Sportstudio, um dort gemeinsam mit einer Gruppe Rentner Übungen zu praktizieren, die dem Bodenturnen zuzuschreiben waren.
Obwohl Borowski sich zudem sehr bewusst ernährte und gerne schmal geschnittene Sportjacketts über knackengen Herrenhemden trug, verlor er, so viel er auch turnte, nichts von seiner Breite, die er für Fettleibigkeit hielt. Und das, obwohl sowohl sein Arzt als auch seine Frau ihn regelmäßig darauf hinwiesen, dass es sich um Muskeln handelte, deren Präsenz er mit den Mitteln des Bodenturnens niemals würde reduzieren können. Der Begriff »Schrank« war unter den Kollegen mehrfach gefallen. Was nach Manz’ Meinung eindeutig bewies, dass die meisten Mitarbeiter der Direktion 5 nicht übermäßig einfallsreich waren. Fraglos eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für professionelle Polizeiarbeit.
Für gewöhnlich neigte Borowski nicht zu euphorischen Anfällen, an diesem Morgen jedoch war er überaus munter gestimmt. Wie sich schnell herausstellte, hing Borowskis Freude mit dem Ausgang einer Wahl zusammen. Am Vortag war ein Pole zum Papst bestimmt worden.
Wer oder was kommt auf so eine schwachsinnige Idee?, dachte Manz. Und das nicht zum ersten Mal während der letzten Tage.
Von seinem Schreibtisch aus hatte er einen guten Blick auf die Karl-Marx-Straße, eine der Hauptadern, die Neukölln mit Verkehr versorgten. Die Autos fuhren stop and go, die Bürgersteige waren voller Menschen. Manche Frauen trugen ihr Haar offen, andere benutzten ein Kopftuch.
Die Inhaber der vielen kleinen Läden hatten einen Teil ihrer Waren auf dem Bürgersteig deponiert, und selbst wenn Manz damals von seinem Schreibtisch aus natürlich nur sah, was er sah, so meinte er doch, einen bestimmten Geruch wahrzunehmen. Er hatte, wie das schon seit der Jugend seine Art war, versucht, ihn in einem Satz zu beschreiben, war aber beim innerlichen Formulieren nicht weitergekommen als bis zu einzelnen Worten. Verwirrend. Vielfältig. Gewürzlastig. Zufrieden war er mit diesem Ergebnis nicht.
Wer bitte kommt auf so eine irre Idee?
Seit drei Tagen lief die Heizung auf vollen Touren.
Nicht nur das Reiben seiner rechten Gesichtshälfte wiederholte sich, auch die Gedanken waren immer wieder die gleichen.
»So kann ich nicht arbeiten«, hatte er tags zuvor zu Borowski gesagt. War runtergegangen und hatte eine Rohrzange aus seinem Wagen geholt. Denn auf normalem Wege war die Heizung nicht zu drosseln.
Das mit der Rohrzange funktionierte nicht, also hatte Manz dreimal mit voller Wucht gegen den Heizkörper getreten. Borowski war ruhig sitzen geblieben.
»Das würde ich nicht machen«, hatte er gesagt.
Zu spät. Manz trat gerade das vierte Mal zu. Die Folge war ein stechender Schmerz in seinem dicken Zeh, der wie ein elektrischer Schlag hochschoss bis in seinen Rücken. Ein Schock, gefolgt von einem kleinen Aufschrei.
»Das war abzusehen gewesen«, hatte Borowski gesagt.
Borowski war – da zeigten sich die Kollegen einig – mit seiner stoischen, teils auch besserwisserischen Grundhaltung bisweilen ein bisschen anstrengend und ganz sicher alles andere als eine Stimmungskanone. Trotzdem hatte Manz sofort seinen Namen genannt, als der Erste Kriminalhauptkommissar Behrens ihn fragte, ob er einen bestimmten Wunsch habe, mit wem er gern zusammenarbeiten würde. Die Bächle wäre natürlich noch viel besser, hatte er kurz gedacht, aber der fehlt die Ausbildung, der Rang, das geht nicht.
»Also, wenn mich jemand gefragt hätte …«, sagte Borowski, nachdem Manz seinen großen Zeh auf eventuelle Bruchstellen überprüft hatte, »ich wusste genau, dass du zutreten würdest. Und diese Heizkörper sind alt, die bestehen aus Gusseisen.«
»Aus Gusseisen! Wie präzise du wieder bist.«
»Davon abgesehen finde ich die Temperatur genau richtig.«
»Und ich muss hier raus.«
Manz musste wirklich dringend nach draußen. Ganz nach draußen in die autoaffine, die wohltuende, die würzige Berliner Luft.
Nachdem er sich einigermaßen abgekühlt und beruhigt hatte, war er zum Hausmeister gegangen.
»Ich werde gekocht in meinem Büro. Und die Fenster …«
Natürlich waren sie nicht zu öffnen. Im Raum von Manz und Borowski wurden manchmal Vernehmungen durchgeführt.
»Da kann ich leider nichts machen«, hatte der Hausmeister ihm erklärt.
»Aber irgendwo muss die verdammte Heizung doch abzustellen sein.«
»Das wird zentral geregelt.«
»Und wo ist diese Zentrale?«
»Dafür ist eine Außenabteilung zuständig.«
»Die Zentrale ist eine Außenabteilung?«
»Ich habe da auch schon angerufen, aber wie ich Ihnen gestern bereits sagte …«
»Dann rufen Sie bitte noch mal an. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie hart. Keinen Millimeter nachgeben.«
Der Körper des Hausmeisters hatte sich gestrafft, auch seine Stimme klang ein wenig anders. »Jawohl, wird gemacht.«
Der Hausmeister war Ende fünfzig und gehorchte noch gewissen Reflexen. Er war als junger Mann bei der Wehrmacht gewesen, hatte Berlin verteidigt.
Am nächsten Tag trat Manz nicht gegen den Heizkörper, er verließ einfach sein Büro.
Auf dem Flur kam ihm Frau Bächle von der Annahme entgegen. Sie war dort Chefin von vier weiteren Beamten.
»Was ist los, Manz? Humpelst du?«
»Nein.«
Die Annahme, die offiziell natürlich eine präzisere Bezeichnung hatte, aber so und nie anders genannt wurde, war die Stelle – es handelte sich um eine Art Tresen aus hellem Holz –, an der Bürger vorstellig wurden. Um sich zu beschweren, um Anzeige zu erstatten oder sich beraten zu lassen. Manz kannte Frau Bächle seit Jahren und wusste einiges über ihr Leben.
Sie stammte aus Reutlingen, war aber vor fünf Jahren zu ihrem Freund nach Berlin gezogen. Der hatte eine mittlere Position im Management der Berliner Verkehrsbetriebe inne. Aber das war nicht das Bemerkenswerteste an diesem Mann, der vor zehn Jahren aus Teheran nach Deutschland gekommen war. Nein, wenn man wirklich wissen wollte, was das für ein Mann war, mit dem die Bächle ohne Trauschein zusammenlebte, dann musste man mal in seinem Garten unten in Rudow gewesen sein, dann musste man das Pfeifen gehört haben, das Rasseln und Rattern der Räder.
Offiziell bestand Frau Bächles besondere Qualifikation darin, dass sie nicht nur Deutsch und Englisch, sondern auch Türkisch, ein wenig Italienisch und angeblich sogar Persisch sprach.
»Na, ich finde schon, dass du humpelst.«
»Sonst noch was?«
»Ich wollte gerade zu dir.«
Manz’ rechte Augenbraue hob sich ein wenig. Denn wenn Frau Bächle »wollte gerade zu dir« sagte, war das oft der Beginn einer Ermittlung.
»Bei mir vorne sitzt eine Frau Schöffling, die Angst hat um ihre Tochter.«
»Sie sitzt? Normalerweise stehen die Leute bei dir.«
»Ich habe sie in mein Büro gebracht. Frau Schöffling ist sehr aufgeregt, mich hat sie total kirre gemacht.«
»Eine Deutsche oder …?«
»Ja, eine Deutsche. Du wirst mich nicht brauchen.«
Manz nickte. Ihm war es vor allem beim ersten Gespräch lieber, wenn niemand dabei war. Die Zeugen oder Verdächtigen zeigten sich dann genauer, wie er meinte. Wenn sie also ihre Augen oder den Kopf bewegten, lag es nicht daran, dass da noch jemand war, sondern dass sie einem Impuls folgten, den sie nicht kontrollieren konnten. Bei manchen war das so deutlich, als würden sie ein Schild hochhalten, auf dem stand: Darf ich kurz lügen?
»Wenn du mit der Mutter sprichst …«
»Ich soll nett sein, nicht grob?«
»Sie ist wirklich sehr aufgewühlt, fast schon fiebrig.«
»Kann an der Heizung liegen.«
Er folgte Frau Bächle. Sah, wie sie ging. Sah, wie akkurat sie ihre Füße voreinandersetzte. Sah, dass ihre Schultern sich beim Gehen kein bisschen bewegten. Eine nervöse Mutter? Auf den ersten Blick nichts für ihn, denn offenbar war ja bisher niemand zu Schaden gekommen. Nun … Wenn Frau Bächle zu ihm kam, dann gab es einen Grund. Ihre wirkliche Qualifikation, das waren nach Manz’ Ansicht nicht ihre Sprachkenntnisse. Und sie arbeitete in seinen Augen auch nicht einfach nur an der Annahme, um ein erstes Protokoll zu schreiben, sondern um in Menschen zu lesen. Frau Bächle besaß so etwas wie einen sechsten Sinn. Manz jedenfalls bewunderte ihre Menschenkenntnis und Beobachtungsgabe. Er hatte sich bereits in einigen Fällen bei Kriminalhauptkommissar Rolfes durchsetzen können und erreicht, dass die Bächle ihm inoffiziell zugeteilt wurde. Dass Manz das gelang, verdankte er dem Ersten Kriminalhauptkommissar Behrens, der, wie es unter den Kollegen hieß, Manz in auffälligster Weise protegierte.
»Nur für beratende Gespräche, mehr nicht«, hatte Behrens ihn ermahnt. »Und nur hier im Haus.«
»Natürlich. Frau Bächle ist ja nicht für den Außendienst zuständig.«
»Nicht zuständig und auch nicht ausgebildet.«
Es war dann meist etwas mehr daraus geworden. Manz hatte die Bächle hin und wieder mit zu Zeugen genommen.
»Nur zuhören und einen Eindruck gewinnen, wir reden dann später«, hatte er zu ihr gesagt.
»Ich sitze da und schweige.«
»Ich werde aus dem Zeugen einfach nicht schlau. Du sagst mir dann …«
»Ich sage dir dann.«
So ungefähr hatte sich das abgespielt. Behrens und Rolfes hatten von diesen Eskapaden entweder nichts mitbekommen, oder sie gingen stillschweigend darüber hinweg.
Die Mutter ist ganz durcheinander
Als Manz das Büro von Frau Bächle betrat, saß dort eine Frau, die einen nervösen oder doch wenigstens sehr angespannten Eindruck machte.
»Guten Tag. Meine Kollegin sagte mir, Sie hätten ein Problem?«
»Nicht ich, meine Tochter.«
»Man hat Ihnen bereits etwas zu trinken gebracht, wie ich sehe.«
»Ja, Ihre Kollegin. Ich weiß gar nicht …«
Manz nickte, holte sich den Stuhl, auf dem Frau Bächle für gewöhnlich saß, hinter ihrem Schreibtisch hervor und stellte ihn in zwei Metern Entfernung vor den der Mutter. Dieses Arrangement war nach Manz’ Erfahrung besser für Gespräche geeignet, als wenn er hinter dem Schreibtisch Platz genommen hätte.
»So.« Manz zückte Block und Stift.
»Soll ich erzählen?«
»Bitte.«
»Also, ich habe in den Schulsachen meiner Tochter nachgesehen. Oder nein, ich muss anders … Meine Tochter Sabine war eigentlich immer eine gute Schülerin. Nicht die beste, aber sie kam sehr gut mit. Seit einem halben Jahr, na, vielleicht etwas länger, hat sie nachgelassen. Ich hatte daher seit einiger Zeit den Verdacht, dass sie ihre Hausaufgaben entweder gar nicht macht oder nur so halb, nur so …«
»Hinschlurt.«
»Das wollte ich sagen. Haben Sie Kinder?«
»Zwei Töchter.«
»Dann kennen Sie das ja.«
»Und?«
»Schrecklich. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Mir wurde ganz kalt.«
»Macht sie denn ihre Hausaufgaben?«
»I wo. Aber das war es nicht. Ich habe in einem ihrer Hefte das hier gefunden …«
Die Frau öffnete ihre Handtasche und gab Manz einen Zettel, auf dem stand: DUBISTTOT.
»Das ist nicht die Handschrift Ihrer Tochter, nehme ich an.«
»Nein, das hat wohl irgendwer aus ihrer Klasse geschrieben. Sie wissen vielleicht, dass dort letztes Jahr ein Mädchen verschwunden ist?«
Es war dieser Moment. Manz klappte seinen Notizblock auf und zog die Kappe vom Bleistift. »Auf welche Schule geht Ihre Tochter?«
»Elisabeth-Rotten-Schule. Aber nicht die für Bekloppte in Mariendorf …«
»Die am Körnerpark.«
»Genau.«
»Ihre Tochter heißt …«
»Sabine.«
»Richtig, das sagten Sie.«
Es entstand eine kurze Pause. Die Mutter wirkte irgendwie gereizt. Es sah aus, als würde sie kauen.
»Wie alt?«
»Was denn?«
»Wie alt ist Ihre Tochter?«
»Sechzehn.«
»Also vermutlich mitten in der Pubertät.«
»Ja, aber … ›Du bist tot‹? Das ist doch schon mehr als Pubertät, finden Sie nicht?«
Manz nickte. »Sie sagten eben, an der Schule sei letztes Jahr ein Mädchen verschwunden.«
»Alina.«
»Eine Türkin?«
»Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ihre Eltern aus Syrien stammen.«
»Gibt es irgendwelche Vermutungen, was da passiert sein könnte?«
»Soweit mir zu Ohren gekommen ist, haben sich die Eltern getrennt. Aber das sind nur Geschichten. Und natürlich hat die Polizei nichts unternommen.«
»Ich denke, da täuschen Sie sich, Frau Schöffling. Ich werde mich erkundigen und bin sicher, dass die Kollegen …«
»Was soll das?«, fragte die Mutter nun mit Zorn. »Ich bin nicht wegen irgendeiner Alina hier, sondern wegen dem da!«
Sie zeigte in Richtung des Zettels, den Manz zwischen die Blätter seines Notizblocks geschoben hatte.
»Haben Sie mit Ihrer Tochter darüber gesprochen?«
»Sie behauptet, das hätte ein Junge aus ihrer Parallelklasse geschrieben. Den hat sie wohl kürzlich abblitzen lassen, aber …«
»Ja?«
»Meine Tochter belügt mich ständig, und …«
Frau Schöffling ließ den Satz unvollendet. Da Manz nicht gleich etwas sagte, wurde die Situation zwischen ihnen intensiver. Das Schweigen beider bewirkte mehr, als wenn Manz sich erklärt hätte. Als er schließlich doch etwas sagte, klang es, als spräche er zu sich selbst.
»Schon etwas sonderbar.«
»Das finden Sie auch, oder? Ich meine, man schreibt so was doch nicht nur, weil ein Mädchen nicht will?«
»Das werden wir herausfinden.«
»Sie glauben nicht, das ist nur irgendwas Dummes? Ich meine, vielleicht hat das ja wirklich nur irgendein verliebter Rotzbengel geschrieben.«
Warum plötzlich diese Einschränkung?
»Mag sein, dass es dumm ist«, sagte Manz. »Trotzdem ist das eine schriftliche Drohung.«
»So schlimm sehen Sie das?«
»Sie nicht? Sie sind doch hergekommen deswegen.«
»Schon, aber jetzt, wo Sie es so deutlich sagen …«
»Ich bin kein Jurist, aber in meinen Augen ist das wenigstens Nötigung.«
»Sie werden meine Tochter aber doch nicht gleich befragen deswegen.«
Warum soll ich das nicht tun, wo sie sich doch angeblich Sorgen macht?
»Es ist sicher besser, wenn erst mal Sie selbst mit ihr sprechen«, schlug Manz vor. »Vielleicht finden Sie noch etwas mehr heraus.«
»Ich glaube nicht, dass das funktioniert.«
»Warum?«
»Sabine ist so verschlossen, sie ist richtig gegen mich.«
»Reden Sie trotzdem mit ihr.«
»Ist das Ihre Art, mit so etwas umzugehen? Die Arbeit mir zuzuschanzen?«
»Nein, aber Sie müssen uns helfen. Wenn Sie neue Informationen haben oder es einen anderen Grund gibt, sich Sorgen zu machen, rufen Sie bitte sofort an. Frau Bächle wird Ihnen zwei Telefonnummern geben. Davon abgesehen müssen Sie natürlich erst mal Anzeige erstatten.«
»Ist das denn wirklich nötig? Ich meine, es ist nur ein Zettel.«
»Ohne Anzeige gibt es für uns keine rechtliche Grundlage, etwas zu unternehmen. Ich bräuchte Ihre Telefonnummer.«
Manz notierte die Nummer in seinem Block.
»Gut. Bleiben Sie bitte sitzen, ich schicke Ihnen Frau Bächle rein, damit sie die Anzeige aufnimmt.«
»Was Sie hier mit mir machen, das grenzt auch an Nötigung.«
»Weil ich Sie bitte, Anzeige zu erstatten?«
»Vielleicht will ich das gar nicht.«
Im Vorzimmer zog Manz die Bächle zur Seite.
»Sie soll Anzeige erstatten.«
»Wie schätzt du das ein?«
»Auf mich wirkt sie ziemlich verwirrt.«
»Fand ich auch. Trotzdem …«
»Ein Gefühl?«
»Hm.«
»Sie hat mir erklärt, an der Schule ihrer Tochter sei kürzlich ein Mädchen verschwunden.«
»Alina. Hat sie mir auch gesagt.«
»Gibt es denn eine Vermisstenanzeige?«
»Nein. Ich hab sofort nachgesehen. Da ist nichts. Kann es sein, dass die Mutter …?«
»Du meinst, sie ist verrückt? Na, ich fahr da trotzdem mal hin.«
»Zur Schule? Ist das nicht eher was fürs Jugendamt?«, fragte Frau Bächle.
»Ich ruf gleich mal an und frag Stephan. Gut möglich, dass der was über das Mädchen weiß. Und vielleicht auch …«
»Über die Mutter?«, fragte Frau Bächle.
Manz grinste. Es ging nicht anders. Die Bächle hatte manchmal so eine Art.
»Ich möchte jedenfalls nicht ihre Tochter sein«, fügte sie noch hinzu. »Auf welche Schule geht das Mädchen?«
»Elisabeth-Rotten-Schule«, sagte Manz.
»Oh.«
»Heißt?«
»Ich hab versucht, meinen Sohn da anzumelden. Hat nicht geklappt. Es gibt eine lange Warteliste. Die können sich ihre Schüler aussuchen.«
»Eine Warteliste für eine Schule in Neukölln?«
In diesem Moment ging die Tür zum Büro von Frau Bächle auf.
»Ich werde jetzt gehen.«
»Ich muss noch Ihre Anzeige aufnehmen.«
»Ich werde keine Anzeige erstatten.«
»Wenn Sie jetzt darauf verzichten«, sagte Manz, »dann mache ich einen Vermerk. Sollte Ihrer Tochter etwas zustoßen, dann geht das in den Vorgang ein. Unterlassene Hilfeleistung oder so ähnlich heißt das dann.«
»Kommen Sie«, sagte Frau Bächle und lotste die noch immer erregte Mutter durch die Tür.
Auf dem Weg zurück in sein Büro musste Manz kurz an seine eigene Mutter denken. Die war nie so zappelig und unklar gewesen. Wusste immer, wie wir es machen. Auch wenn’s mal wieder schlecht lief mit dem Geld.
»Na?«, fragte Borowski, als Manz das Büro betrat. »War was?«
»Sieht man mir das an?«
»Schon.«
»Na, die Bächle …«
»Oh«, sagte Borowski und machte Anstalten aufzustehen.
»Bleib sitzen.«
Borowski setzte sich wieder hin.
»Die Bächle hatte nicht mehr als einen merkwürdigen Eindruck.«
Borowski stand erneut auf.
Manz öffnete den schmalen Spind, holte seine schwere Filzjacke und die Stoffmütze raus. »Ruf beim Jugendamt an und frag Stephan nach einer Sabine Schöffling. Geht auf die Elisabeth-Rotten-Schule am Körnerpark. Vielleicht ist da schon mal was vorgefallen. Entweder mit ihr. Oder mit der Schule. Oder mit ihrer Mutter.«
Die Erziehung zur Freiheit
Da Borowski Manz’ Kontakt beim Jugendamt nicht erreichte … »Dachte ich mir schon.« … machte Manz sich … »Nein, bleib hier, ich check das nur kurz. Setz dich, Borowski. Vielleicht kommt was rein wegen des Zauberlehrlings. Nicht, dass dann keiner von uns da ist, und am Ende Borgmann die Lorbeeren erntet.« Nach all dem also machte Manz sich auf den Weg zu Sabine Schöfflings Schule.
Als er das Gebäude sah, als er, den Kopf in den Nacken gelegt, direkt davorstand …
Eine Warteliste? Sieht aus wie tausend andere Schulen.
Der viergeschossige Bau lag direkt am Körnerpark, einer Grünanlage, die man 1916 in einer ehemaligen Kiesgrube angelegt hatte. Das Schulgebäude war, so vermutete Manz, höchstens zehn, fünfzehn Jahre vorher errichtet worden. Es fügte sich, was die Traufhöhe anging, in den Blockrand ein, bestand aus roten Backsteinen und hätte vom ersten Eindruck her auch ein altes Postamt sein können.
Links gab es eine Lücke zum nächsten Haus, da ist dann wohl eine Bombe rein.
Manz betrat das Gebäude nicht von vorne, sondern benutzte die improvisierte Zufahrt links von der Schule, eine Bombe und peng, die zu einem kleinen Parkplatz weiter hinten führte. Da es zum Grundstück der Schule hin einen rostigen Maschendrahtzaun, umwuchert von Knallerbsensträuchern, gab, musste er ganz außenrum und kam zuletzt von hinten auf den auf der Rückseite des Gebäudes gelegenen Schulhof. Dort gab es … nichts eigentlich.
Eine an vielen Stellen geflickte uralte Teerdecke, einige Betonelemente, ein einzelner Baum und am Rand Gestrüpp, mehr war da nicht.
Im Vordergrund des Bildes fiel Manz als Erstes eine Gruppe aus drei Schülern auf, die auf einigen Betonelementen herumlungerten. Der Junge hatte gewellte, fast lockige Haare. Er war, so wie Manz das sah, der klassische Schönling. Auch in seiner Klasse hatte es früher so einen gegeben. Sven. In den waren fast alle irgendwann mal verknallt.
Von den beiden Mädchen war eine blond, die andere schwarzhaarig. Sie saßen links und rechts vom Schönling. Der rekelte sich, trotz der niedrigen Temperatur, auf einem der Klötze, den er wie eine Liege benutzte. Wobei sein Kopf bequem auf dem Oberschenkel der Schwarzhaarigen lag.
Merkwürdig angezogen die drei, dachte Manz. Das Entscheidende war ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgefallen. Dabei war es doch mehr als offensichtlich.
Von hinten zeigte sich das Gebäude gegliederter, als die Straßenansicht vermuten ließ. Es gab zwei eng beieinanderstehende Gebäudeflügel, verbunden durch einen schmalen Querriegel. Fenster, Fenster, Fenster, kaum Zier, wenn man von den beiden hoch aufragenden Giebeln am Ende der Seitenflügel absah.
Die Höhe der untersten Fensterreihe … Einiges an dem Gebäude war, was die Proportionen anging, etwas verquer. Jedenfalls schienen die Räume im Erdgeschoss enorm hoch zu sein. Vielleicht ein ehemaliges Spital. Das war gut möglich, denn in der Nähe des Körnerparks reihte sich, wie Manz wusste, ein Friedhof an den nächsten. War damals noch der Übergang zur Vorstadt. Dahin wurden die Toten geschafft, und da gab es sicher auch Krankenhäuser, die man im Zentrum nicht wünschte.
An der Stirnseite des rechten Seitenflügels war, ganz oben im Dreieck des Giebels, ein großes Fenster in Form einer Rosette eingelassen.
Vermutlich ohne Funktion.
Offenbar war gerade Pause. Die Schülerinnen und Schüler standen in Gruppen zusammen. Niemand schrie rum, niemand rannte.
Manz überquerte den Schulhof, stieg zuletzt drei breite Stufen hoch.
Der Zugang zum Gebäude befand sich in der Mitte des Querriegels. Dort gab es zwei große, voneinander getrennte, blau gestrichene Türen. Ziemlich lädiert und … »Boah!« … schwergängig.
Im Inneren roch es nach Schule, die riechen alle gleich. Zunächst ging Manz ein paar Meter über einen Boden mit einem simplen Mosaik. Vier weitere Stufen waren zu überwinden, dann, frisch gewischtes hellgraues Linoleum, es ist immer das Gleiche, stand er an einer Art Kreuzung.
Von hier zweigten zwei lange Gänge nach links und rechts ab, eine breite Treppe aus hellgrauem Speckstein führte geradeaus nach oben, und, ach!, auf einem schlichten Betonsockel, rechts am Fußpunkt der Treppe, war die Bronzebüste einer gemütlich dreinblickenden Frau um die fünfzig festgeschraubt.