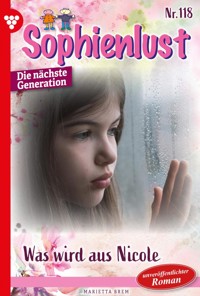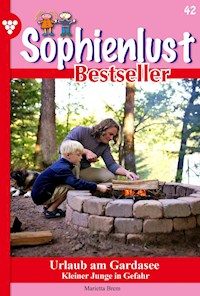Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust Bestseller
- Sprache: Deutsch
Der Sophienlust Bestseller darf als ein Höhepunkt dieser Erfolgsserie angesehen werden. Denise von Schoenecker ist eine Heldinnenfigur, die in diesen schönen Romanen so richtig zum Leben erwacht. Das Kinderheim Sophienlust erfreut sich einer großen Beliebtheit und weist in den verschiedenen Ausgaben der Serie auf einen langen Erfolgsweg zurück. Denise von Schoenecker verwaltet das Erbe ihres Sohnes Nick, dem später einmal, mit Erreichen seiner Volljährigkeit, das Kinderheim Sophienlust gehören wird. »Kaufst du mir ein Eis, Papi?« bettelte Jens Schönleber, ein blonder fünfjähriger Junge. Der Mann, der ihn sorgsam an der Hand führte, lächelte. »Aber nein, Jens. Die Eisdiele hat doch um diese Jahreszeit noch gar nicht geöffnet. Immerhin haben wir erst Februar.« »Och, Papi, wozu sind wir dann überhaupt in die Stadt gegangen, wenn du mir nichts kaufen willst«, nörgelte Jens und zerrte energisch an der Hand seines Vaters. »Ich will nach Hause zu Mami. Sie wartet bestimmt schon.« Frank Schönleber, ein stattlicher Mann Mitte dreißig, lächelte leicht. Trotz seiner fünf Jahre wußte Jens schon, was er wollte und wie er es anstellen mußte, um es auch zu bekommen. In diesem Fall aber half ihm auch sein Starrsinn nichts. Außerdem hatte Gerda ihrem Mann verboten, Jens etwas zum Naschen zu kaufen. Er hatte gerade erst eine Erkältung hinter sich gebracht, und mit seinem Appetit war es auch nicht zum Besten bestellt. »Die Mami wartet nicht. Schließlich hat sie uns beide losgeschickt, daß wir für dich eine lange Hose kaufen, nachdem du die beiden anderen im Kindergarten total zerrissen hast. Und die Sonntagshose ist zu schade zum Spielen.« »Ich will aber keine Hose sondern ein Eis«, beharrte der Junge und stampfte mit dem Fuß auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust Bestseller – 20 –Ein Mädchen namens Biggi
Gibt sie unserem Leben neue Hoffnung?
Marietta Brem
»Kaufst du mir ein Eis, Papi?« bettelte Jens Schönleber, ein blonder fünfjähriger Junge.
Der Mann, der ihn sorgsam an der Hand führte, lächelte. »Aber nein, Jens. Die Eisdiele hat doch um diese Jahreszeit noch gar nicht geöffnet. Immerhin haben wir erst Februar.«
»Och, Papi, wozu sind wir dann überhaupt in die Stadt gegangen, wenn du mir nichts kaufen willst«, nörgelte Jens und zerrte energisch an der Hand seines Vaters. »Ich will nach Hause zu Mami. Sie wartet bestimmt schon.«
Frank Schönleber, ein stattlicher Mann Mitte dreißig, lächelte leicht. Trotz seiner fünf Jahre wußte Jens schon, was er wollte und wie er es anstellen mußte, um es auch zu bekommen.
In diesem Fall aber half ihm auch sein Starrsinn nichts. Außerdem hatte Gerda ihrem Mann verboten, Jens etwas zum Naschen zu kaufen. Er hatte gerade erst eine Erkältung hinter sich gebracht, und mit seinem Appetit war es auch nicht zum Besten bestellt.
»Die Mami wartet nicht. Schließlich hat sie uns beide losgeschickt, daß wir für dich eine lange Hose kaufen, nachdem du die beiden anderen im Kindergarten total zerrissen hast. Und die Sonntagshose ist zu schade zum Spielen.«
»Ich will aber keine Hose sondern ein Eis«, beharrte der Junge und stampfte mit dem Fuß auf. Trotzig blickte er zu seinem Vater auf.
Aber dieser beachtete ihn nicht. Frank ärgerte sich zwar im stillen, aber das sollte Jens natürlich nicht merken, sonst würde er sich bestimmt wieder als Sieger in diesem Kampf fühlen.
»In diesen Laden werden wir jetzt hineingehen«, bestimmte Frank Schönleber und zog seinen Sohn an der Hand in das Haus.
»Ich will aber nicht, Papi, ich will ein Eis.« Jens zerrte und zog, aber der Vater ließ seine Proteste nicht gelten. Er hielt den Jungen fest an der Hand und führte ihn in den Laden.
Endlich hatten sie eine passende Hose gefunden, die der Mann in einer Plastiktüte trug. »Und was machen wir jetzt? Wir sind ziemlich früh fertig. Die Mami rechnet bestimmt um diese Zeit noch nicht mit uns.«
»Jetzt gehen wir in die Eisdiele.«
Jens strahlte über das ganze Gesicht.
»Aber Junge, ich habe dir doch schon gesagt...«
»Ich will aber ein Eis essen. Jetzt war ich die ganze Zeit brav, weil du mir eine Belohnung versprochen hast. Was man verspricht, das muß man auch halten.«
»Aber ich habe nicht gesagt, daß die Belohnung aus einem Eis besteht. Du kannst etwas anderes haben, vielleicht ein Spielzeug, aber kein Eis.«
»Also gut«, fügte sich der hübsche Junge und rümpfte seine Nase, auf der sich unzählige Sommersprossen tummelten. »Immer muß ich das machen, was du sagst. Warum kannst du nicht mal mir folgen?«
Frank Schönleber lachte und schaute stolz und zärtlich auf seinen Sohn. Von der Mutter hatte er die dunklen, fast schwermütigen Augen, über denen die dunklen Brauen einen reizvollen Kontrast zu dem wirren Blondhaar bildeten.
»Bald ist Frühling, dann bekommst du dein Eis, mein Kleiner. So, und jetzt gehen wir über die Straße. Wir werden so tun, als ob du der Vater und ich das Kind sei. Einverstanden?«
Jens war begeistert und reckte seinen Hals, damit er noch ein Stückchen größer wirkte. Er stellte sich an den Straßenrand und schaute zuerst links und dann rechts, wie es sich gehörte. Das hatte er im Kindergarten gelernt, und auch sein Vater übte immer mit ihm, wenn sie gemeinsam in der Stadt waren.
»Es kommt kein Auto, Papi, wir können«, rief Jens und riß sich von der Hand seines Vaters los.
Ehe Frank noch etwas sagen konnte, war der Junge schon losgerannt. »Halt! Jens, bleib stehen! Das Auto!« Der Mann erwachte aus seiner Erstarrung, als er den roten Sportwagen um die Ecke schießen sah. Jetzt rannte auch er los. Aber es war bereits zu spät.
Er hörte noch den dumpfen Aufprall und das Quietschen von Bremsen, dann war alles still, unheimlich still. Es war, als hielte die ganze Welt den Atem an.
»Jens«, flüsterte Frank Schönleber entsetzt, und sein Blick hing verständnislos an der kleinen Gestalt, die leblos vor ihm auf der Straße lag.
»Steh doch auf, Jens. Komm, Junge, laß uns nach Hause gehen, die Mami wartet doch.«
Aber das Kind rührte sich nicht. Seine Augen waren halb geöffnet und aus seinem Mund lief ein dünner Blutfaden.
»Um Himmels willen, der Junge ist ja tot«, hörte er eine weibliche Stimme hinter sich.
Haß stieg in ihm auf. Er drehte sich um. »Mein Sohn ist nicht tot, das sehen Sie doch.« Wie konnte die Frau nur so etwas behaupten?
Nein! Er wußte es besser. Gerade hatte Jens noch gelacht und um ein Eis gebettelt, und jetzt sollte er tot sein? Nein, so ein Quatsch.
»Komm, Jens, steh endlich auf. Du bekommst auch dein Eis«, lockte er verzweifelt und wußte gar nicht mehr, was er redete.
»Der Vater hat den Verstand verloren«, flüsterte die Frau ihrer Freundin zu.
»Nein, das ist nur der Schock«, flüsterte die andere voller Mitleid zurück. »Man müßte dem Mann helfen, aber wie. Der Junge ist tot, das sieht man doch.«
»So ein rücksichtsloser Autofahrer«, schimpfte ein Mann und starrte den kaum Zwanzigjährigen an, der sofort aus seinem Auto gesprungen war und sich neben Jens niedergekniet hatte. Aber auch er sah sofort, daß hier jede Hilfe zu spät kam.
»Ins Gefängnis gehört so einer, jawohl.«
Der junge Mann zitterte am ganzen Körper. Kein Mensch hatte Mitleid mit ihm. »Er... er ist mir ins Auto gelaufen«, versuchte er sich schwach zu verteidigen. Aber niemand hörte ihm zu.
Alle bedauerten den kleinen Jungen und seinen Vater.
Wenige Minuten nach dem Unfall kam schon der Notarztwagen. Jens wurde kurz untersucht und dann vorsichtig auf die Trage gehoben. Im Innern des Sanitätswagens kümmerte sich der Arzt weiter um den Jungen.
»Gehört jemand von Ihnen zu dem Kind?« fragte ein Sanitäter und schaute sich kurz um. Als niemand antwortete, wollte er ebenfalls einsteigen, damit sie ins Krankenhaus fahren konnten.
»Einen Augenblick noch«, meldete sich da eine ältere, mütterlich scheinende Frau, »dieser Mann da war bei dem Kind. Vielleicht ist es der Vater.«
Erst jetzt bemerkte der Sanitäter Frank Schönleber, der wie versteinert dastand und noch immer auf die Stelle starrte, wo gerade eben noch sein Sohn gelegen hatte.
»Der Mann hat einen Schock«, flüsterte er dem Arzt zu, der inzwischen bei Jens Wiederbelebungsversuche unternahm. »Wir müssen ihn mitnehmen.«
Der Mediziner nickte nur, und der Helfer lief rasch auf Frank zu. »Kommen Sie, steigen Sie ein.«
Frank wehrte sich nicht. Er ließ sich schieben wie eine Marionette. In seinem Kopf überschlugen sich die Gedanken, aber er vergaß sie alle wieder.
Erst als der Fahrer das Martinshorn einschaltete, kam er zu sich. »Wie... geht es Jens?« fragte er tonlos und schaute den Arzt flehend an.
Der zuckte die Schultern. »Wir versuchen alles Menschenmögliche«, antwortete er dann leise und wandte sich wieder dem Kind zu. Der Arzt hatte kaum Hoffnung, Jens noch einmal ins Leben zurückholen zu können.
Im Krankenhaus war bereits alles für eine Notoperation vorbereitet. Man hatte die Art der Verletzungen über Funk durchgegeben.
Frank Schönleber wurde in ein kleines Wartezimmer beordert, das einen unpersönlichen Eindruck auf ihn machte. Aber es störte ihn nicht. Er sah nur immer die leblose Gestalt seines Sohnes vor sich, die ganz reglos auf dem kalten Pflaster gelegen hatte.
Unruhig nahm er die Wanderung durch das überheizte Zimmer auf. Seine Hände ballten sich, daß die Knöchel weiß hervortraten. In seinem bleichen Gesicht stand der stumme Vorwurf geschrieben, den er sich machte.
Wenn er besser aufgepaßt hätte, dann wäre das nicht geschehen. Dann würde er mit Jens längst zu Hause sein bei Gerda, die bestimmt schon angstvoll auf ihre Männer wartete.
Mit leerem Blick starrte Frank Schönleber aus dem Fenster. Es hatte angefangen zu schneien, und ein eisiger Wind trieb die Flocken vor sich her. So hatte es auch geschneit, als sie vor fast zwei Monaten Weihnachten gefeiert hatten.
Es war eines der schönsten Feste gewesen, denn die Eltern hatten den größten Wunsch ihres Sohnes erfüllt und ihm einen kleinen Hund geschenkt.
Roxy hatte Jens seinen kleinen Freund genannt und ihn von Stunde an nicht mehr aus den Augen gelassen. Nur mit viel Zureden hatten sie es geschafft, das niedliche Tierchen wenigstens am Abend aus dem Zimmer ihres Sohnes zu verbannen.
Nur mühsam fand Frank Schönleber wieder in die Wirklichkeit zurück. Er stand noch immer am Fenster und starrte hinaus. Es mußte jetzt um die Mittagszeit sein, überlegte er und stellte gleichzeitig fest, wie sinnlos seine Gedanken waren.
Mit den Händen stieß er sich vom Fenstersims ab und nahm gedankenverloren seine Wanderung wieder auf. Warum dauerte es so lange, bis er Nachricht bekam?
Der Mann rieb verzweifelt die Hände aneinander. Die Minuten kamen ihm endlos lang vor, und fast erschien es ihm, als wären bereits Stunden vergangen.
Endlich wurde diskret angeklopft, und gleich darauf öffnete sich die Tür. Ein junger Mann in weißem Mantel kam auf Frank zu. Seine Miene drückte nichts aus, und auch sein Blick war undurchdringlich.
»Herr Schönleber?«
Frank nickte. »Ja?«
»Es... tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen...«
»Muß Jens hierbleiben?« unterbrach Frank Schönleber den Arzt und kam mit erhobenen Händen auf ihn zu.
»Kommen Sie bitte mit in mein Zimmer. Ich werde Ihnen eine Beruhigungsspritze geben.«
Verständnislos schüttelte der Mann den Kopf. »Wozu eine Spritze? Ich... bin in Ordnung«, wehrte er ab, als er neben dem Arzt herging. »Bitte, sagen Sie mir, was mit meinem Sohn ist. Ich muß dann gleich meine Frau anrufen. Sie wird sich bestimmt schon sorgen.«
»Nehmen Sie Platz, Herr Schönleber.« Der junge Arzt sagte das in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Er deutete auf den Stuhl, der ihm am nächsten stand.
»Jetzt möchte ich aber endlich wissen... Ist Jens schwer verletzt?« Zu der Angst, die Frank bis jetzt ausgestanden hatte, kam jetzt auch noch Ärger hinzu, weil der Arzt ihm anscheinend keine richtige Auskunft geben konnte.
»Bitte, Herr Schönleber, Sie müssen jetzt sehr stark sein. Ihr Sohn ist... tot. Wir konnten ihm leider nicht mehr helfen.«
Wie versteinert saß Frank auf seinem Stuhl. In ihm klangen noch die Worte des Arztes nach, aber er konnte ihre Tragweite noch nicht begreifen.
»Möchten Sie nicht doch lieber eine Spritze? Ein Wagen von uns wird Sie dann nach Hause bringen.«
Die mitleidige Stimme des Mannes im weißen Kittel weckte Frank aus seiner Erstarrung. Wie erwachend schaute er auf. »Nein... nein, vielen Dank. Ich... kann auch allein... Bitte, bemühen Sie sich nicht. Tot, sagen Sie? Gerda... Wie soll ich das nur meiner Frau beibringen? Jens ist tot.«
Kopfschüttelnd verließ Frank Schönleber das Zimmer des Arztes. Später hätte er nicht sagen können, wie er nach Hause gekommen war.
*
»So, Biggi, nun haben wir die meisten Sachen eingepackt, die du mitnehmen möchtest, nicht wahr?«
Denise von Schönecker strich dem achtjährigen Mädchen liebevoll über die langen, blonden Locken, die mit einem roten Samtband gebändigt waren. Lustig baumelte der dicke Pferdeschwanz bis über die schmalen Schultern des Mädchens herab.
»Noch nicht ganz, Tante Isi. Felix muß noch mit, und Adolf darf ich auch nicht vergessen.« Biggi krauste die hübsche Stubsnase. Ihre intensiv blauen Augen leuchteten, und ihre hellroten Lippen schienen immer zum Lachen bereit zu sein.
Obwohl Brigitte Hafran erst vor einer Woche ihre Mutter verloren hatte, war sie weder traurig noch verschüchtert. Sophia Hafran hatte nie einen Hehl daraus gemacht, daß ihr das Kind im Wege war, denn der Vater hatte sich rechtzeitig vor der Geburt des Kindes ins Ausland abgesetzt. Alle Versuche, ihn zu finden, um wenigstens Unterhaltszahlungen einklagen zu können, waren fehlgeschlagen.
Also war Sophia Hafran nichts anderes übriggeblieben, als arbeiten zu gehen, damit sie mit ihrem ungeliebten Kind wenigstens hatte leben können.
Tagsüber hatte sie in dem Lager eines großen Supermarktes ausgeholfen, und abends besondere Gäste in einer Nachtbar bedient, das hatte ihr natürlich den Hauptverdienst eingebracht.
Um Biggi hatte sie sich kaum gekümmert, und seltsamerweise war auch die Fürsorge nicht auf diese miserablen Zustände aufmerksam geworden. Wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter, sagt man. Genauso schien es sich bei den Hafrans verhalten zu haben.
»Wer ist Felix und Adolf, wenn ich fragen darf?« Denise unterdrückte ein lautes Lachen. Sie wußte genau, daß sie das Mädchen damit sehr beleidigt hätte.
»Felix ist mein Bär, den ich immer mitnehme, wenn ich schlafen gehen muß, und Adolf ist seine Frau.«
»Aber Adolf ist doch ein Männername«, tat Denise ganz ernsthaft.
»Schon. Aber damals, als ich Adolf den Namen gegeben habe, da konnte ich doch nicht wissen, daß Felix ihn einmal heiraten würde.« Biggi machte ein ernstes Gesicht.
»Dann hole sie schnell, die beiden, damit wir fahren können. Wir haben einen weiten Weg vor uns.«
Ohne noch etwas zu sagen, rannte Biggi davon. Inzwischen schaute sich Denise noch einmal in der Wohnung um. Sie konnte sich gar nicht vorstellen, daß hier bis vor kurzem noch eine Frau und Mutter gelebt hatte.
Warum nur hatte sich Sophia Hafran das Leben genommen? Hatte sie irgendwelche Probleme gehabt, die sie allein nicht mehr hatte lösen können? Hatte sie nicht einmal der Gedanke, daß sie ihr kleines Mädchen unversorgt zurücklassen mußte, von dieser furchtbaren Tat abhalten können? Dann mußte das Problem schon sehr groß gewesen sein.
Die geräumige Wohnküche war nicht sehr gemütlich und auch nicht zweckmäßig eingerichtet. Ein alter Herd, auf dem das Kochen sicher keinen großen Spaß gemacht hatte, stand in der Ecke. Von ihm aus führte ein rostbraunes Ofenrohr zum Kamin.
Denise wunderte sich, daß es solche Öfen, die noch mit Holz und Kohle betrieben wurden, überhaupt noch gab. Im Winter mochte es ja behaglich warm hier sein, aber im Sommer war es sicher kaum auszuhalten vor Hitze.
Das Spülbecken aus graubraunem Speckstein war bestimmt auch schon lange nicht mehr geputzt worden, denn sogar auf dieser unempfindlichen Grundfarbe zeigten sich häßliche Flecken.
Nachdenklich schritt Denise von einem Möbelstück zum anderen, aber sie getraute sich nicht, eines davon anzufassen. Wie konnte man in solch einer Umgebung nur leben?
Gewaltsam mußte sich die Gutsbesitzerin in die Wirklichkeit zurückholen. Diese kleine Wohnung der Selbstmörderin beeindruckte sie auf eine ganz besondere Weise, zeigte sie doch, wie tief ein Mensch sinken konnte, wenn man sich nicht um ihn kümmerte.
Mitleid mit der unbekannten Frau ergriff Denise, aber sie unterdrückte es. Das alles, was Sophia Hafran vielleicht widerfahren war, gab ihr noch lange nicht das Recht, ihr Kind so zu vernachlässigen, daß es nicht einmal Trauer beim Tod der Mutter empfinden konnte.
»Arme Biggi«, murmelte Denise mitleidig. Aber wo steckte das Mädchen überhaupt? Suchend schaute sich die schwarzhaarige Frau um, aber Brigitte war nirgends zu entdecken.
Denise machte sich auf die Suche. Ein Blick auf ihre goldene Armbanduhr, ein Weihnachtsgeschenk ihres Mannes Alexander, sagte ihr, daß es höchste Zeit wurde, wenn sie nicht in die Dunkelheit hineinkommen wollte.
»Wo steckst du denn, Biggi?«
Leise öffnete Denise die Tür zum ehemaligen Kinderzimmer. Verwundert blieb sie stehen.
Brigitte saß auf ihrem Bett und hielt das Bild ihrer Mutter in den Händen. Dabei murmelte sie etwas, das Denise jedoch nicht verstehen konnte.
»Komm, Biggi, wir müssen gehen«, sagte die Frau nach einer Weile sanft.
Das Mädchen hatte sie entdeckt und wollte die Fotografie rasch verstecken.
»Das ist nicht nötig, Kind. Nimm das Bild deiner Mama ruhig mit, dann ist sie immer bei dir.
»Aber... vielleicht will sie gar nicht mit nach Sophienlust?« Brigitte holte zögernd das Bild wieder unter ihrer Zudecke hervor.
»Doch, sie will bestimmt, das kannst du mir glauben. Wir werden das Foto in der Reisetasche verstauen, da kann ihm überhaupt nichts passieren.«
Biggi war erleichtert. Sie hatte lange mit sich gerungen, ob es der Mami wohl recht war, was sie tat, aber wenn Tante Isi es auch sagte, dann mußte es schon richtig sein.
Denise trug den Koffer hinunter und verstaute ihn im Wagen. Skeptisch schaute die schöne Frau zum Himmel hinauf, wo sich dunkle Wolkenberge türmten. Auch das noch! Jetzt würde sie bei Regen fahren müssen, und das gleich mehrere Stunden lang.
Seufzend stieg die Verwalterin von Sophienlust wieder die vielen Stufen bis bis zur Wohnung der Hafrans hinauf.
»Endlich wird hier einmal etwas unternommen. Man konnte es ja schon nicht mehr mit ansehen, was die Frau mit der Kleinen getrieben hat.«
Überrascht schaute Denise in die Richtung, aus der die vorwurfsvolle Frauenstimme gekommen war. Die Tür zur Nachbarwohnung war leise geöffnet worden, gerade einen Spalt breit, daß man die Frau zwar verstehen, ihr Gesicht aber kaum erkennen konnte.
Innerlich ärgerte Denise sich über soviel Herzlosigkeit, aber äußerlich war sie die Ruhe selbst. Da beobachtete ein Mensch jahrelang die Not eines Kindes und fand nicht den Mut, etwas dagegen zu unternehmen. Und wenn andere dann diese Pflicht übernahmen, sparte diese Frau nicht mit ihrem Kommentar, der niemanden half auch niemanden interessierte.
»Mir scheint, Sie konnten es ganz gut mit ansehen, sonst hätten Sie etwas dagegen unternommen«, antwortete Denise gelassen und verschwand in der Wohnung, um Biggi und die Reisetasche abzuholen.
Als sie endlich im Auto saßen und das häßliche alte Mietshaus hinter ihnen lag, atmete Denise erleichtert auf. So schwer hatte sie sich ihre Mission nicht vorgestellt.
Sie hatte beim Verstauen des Gepäcks bemerkt, das überall an den Fenstern Gardinen zur Seite geschoben und neugierige Blicke ihnen zugeworfen worden waren.