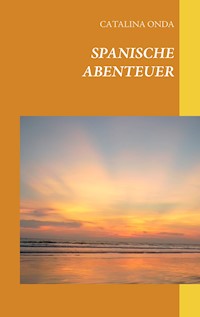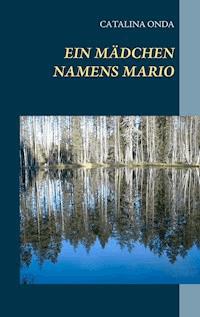
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für ein Kind, das im Österreich der 60er Jahre am Land aufwächst, hat Marion recht ungewöhnliche Wünsche. Zum Beispiel möchte sie später einmal Pilot werden! Auch wenn ihr alle sagen, dass das kein Beruf für Mädchen ist ... Sie möchte ja ohnehin lieber ein Mann werden. Also: zuerst ein Mann und dann Pilot! Mit ihren eigenwilligen Vorstellungen von der Welt und von ihrer Zukunft, eckt sie zumeist an oder erntet Unverständnis. Aber eines Tages lernt sie Julian kennen und gemeinsam erschaffen sie sich ihre eigene, ganz zauberhafte Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Um die Privatsphäre der Personen zu schützen, wurden alle Namen geändert. Aus demselben Grund wurden Verfremdung und Maskierung angewendet. Jede Namensgleichheit oder sonstige Ähnlichkeit mit derzeit lebenden oder verstorbenen Personen, wäre daher unbeabsichtigt und rein zufällig.
Und immer noch
ist da die Frage:
Wieviel von mir bin ich?
Und wieviel ist das,
was die Gesellschaft mir gestattet, zu sein …
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
Alte Geschichten
Mädchen sind dumm
Der Friseur
Der Herr Pfarrer von Großvaters Grab
Rollenspiele
Freizeitbeschäftigungen
Was ist ein Voyeur?
Der kleine Marder
Der Mann mit dem Dackel
Warum muss man arbeiten?
Der Staubsauger
Albträume
Urlaub in Kroatien
Das Fahrrad
Mutti in Paris
Die Erstkommunion
Ferien in der Tschechei
Ein neuer bester Freund
Das Fenster und der Zug
Im Dunkeln
Die Aufnahmeprüfung
Alltag im Internat
Nonnen sind gut
Mama Melanie
Wenn ich groß bin…
Aufklärung
Kann man ein Mann werden?
Ferien
Die Beichte
Gutes Benehmen
Das Gegenteil von Religion
Teil 2
Sieben Jahre später
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Viele Jahre später
TEIL 1
Alte Geschichten
Mädchen sind dumm
„Mädchen sind dumm!“, sagte die Großmutter. „Sie sind eitel und hysterisch. Und schon als Baby nerven sie durch ihren hohen, schrillen Ton, wenn sie weinen.
Das hält kein Mensch aus.
Da muss man ihnen dann halt ein paar ordentliche Ohrfeigen reinhauen, damit das aufhört. Und selbst das kapieren sie nicht gleich. Sie schreien dann nur noch lauter. Unerträglich! Man möchte ihnen oft am liebsten den Kragen umdrehen, weil man ja selbst schon ganz nervös wird.
Aber irgendwann hat man sie endlich doch so weit, dass man nur noch die Hand heben muss und schon verstummen sie. Sie sind nämlich auch von Natur aus feige und devot!“
Die Großmutter betrachtete Maria unzufrieden.
„Oh Gott! Deine Haare sind eine Katastrophe“, seufzte sie. „Das ist eben der nächste Nachteil, wenn das Kind ein Mädchen ist. Die langen Haare! Die sind so fein, dass sie immer verfilzen und es macht eine Heidenarbeit, sie auszukämmen. Und dann schreien sie wieder wie am Spieß, wenn man sie frisiert. Und das nur, weil es ein bisschen reißt. Mädchen sind halt wehleidig …
Ich, für meinen Teil, wollte nie ein Mädchen. Mein Sohn war so ein angenehmes, pflegeleichtes Kind. Deine Mutter hingegen war eine richtige Heulsuse. Dieses ewige Geschrei beim Frisieren! Ich muss die Haare ja auskämmen. Was sollen denn sonst die Leute denken, wenn mein Kind so schlampig in der Gegend herumläuft!
Und damals, als deine Mutter klein war, da mussten diese Zöpfe auch noch möglichst lang sein! Das ist ja heute schon ein Fortschritt, dass man die Haare auch kürzer schneiden kann.“
Maria hörte nur halb zu … Sie war gerade damit beschäftigt, einen Marienkäfer zu zähmen.
„Flieg auf meinen Zeigefinger!“, wünschte sie mit all ihrer Kraft. „Bitte, flieg auf meinen Finger!“, flüsterte sie dann hörbar und öffnete zaghaft ihre Handflächen, zwischen denen sie das Tierchen eingeschlossen hielt. Der Marienkäfer ordnete seine leicht zerknitterten Flügel und krabbelte dann schnell nach oben, bis er auf Marias Schulter saß, wie auf einer Aussichtsplattform. Dann wagte er einen bescheidenen Flugversuch …
„Hör schon auf, du dummes Ding, du glaubst doch nicht wirklich, dass der Käfer macht, was du willst!“, schimpfte die Großmutter. „Und heute Nachmittag gehen wir zum Friseur. Ich brauche eine neue Dauerwelle!“
Der Friseur
„Guten Tag Frau Watzlavic!“, sagte der Friseur mit
einer kleinen Verbeugung, „Schnitt und Dauerwelle, wie immer?“
„Jawohl! Sie kennen ja alle meine Wünsche. Hinten im Nacken schön kurz und vorne ein bisschen voller.
– Und mit dem Kind muss man auch was machen.
Schneiden sie ihr einen Kurzhaarschnitt. Richtig kurz, wie für einen Jungen! Verstehen sie, so kurz, dass
man sie nicht mehr frisieren muss!“
„Wie Frau Watzlavic wünschen!“, sagte der Friseur mit einer neuerlichen Verbeugung.
Als er sein Werk dann vollendet hatte, war selbst die Großmutter verblüfft.
„Maria!“, rief sie begeistert, „Du siehst ja wirklich aus, wie ein Bub! … Was meinen sie?“, wandte sie sich an den Friseur. „Na wenn ich die jetzt Mario rufe und die Leute es nicht wissen, glaubt mir doch jeder, dass das ein Junge ist!“
„Da ist schon was dran, gnädige Frau!“, antwortete der Friseur und schmeichelnd fügte er hinzu: „Und gnädige Frau sehen auch ganz fabelhaft aus!“
„Komm Mario!“, sagte die Großmutter, nachdem sie bezahlt hatte. „Ab sofort bist du mein Junge. Du weißt ja, Oma mag keine dummen, hysterischen kleinen Mädchen. Oma möchte einen starken, kleinen Jungen, der ihr helfen kann. Nicht so ein dummes, unnützes Mädchen. Weil du weißt ja, Oma ist schon alt und hat ein kaputtes Kreuz.“
„Um Gottes willen! Was hast du denn mit dem Kind gemacht?“, sagte Marias Mutter entsetzt, als sie am Abend vom Büro nachhause kam.
„Ist viel praktischer so!“, konterte die Großmutter.
„Aber sie sieht aus, wie ein Junge!“
„Na und! Ein Bub wäre mir ohnehin lieber gewesen.“
Und erbittert fügte sie hinzu: „Du hast leicht reden, du frisierst sie ja nicht! Und solange ich hier die Arbeit mache, hast du nichts zu sagen!“
Der Herr Pfarrer von Großvaters Grab
Großvaters Grab befand sich fünf Kilometer entfernt, in einer Nachbargemeinde am See. In dieser entlegenen Ortschaft kannte Marias Familie niemanden, nur Großvater wohnte auf dem dortigen Friedhof.
Dieser war auf einem Hügel gelegen und die Großmutter schnaufte immer recht angestrengt, wenn sie sich mit dem Kind zusammen bergauf mühte. In ihrer klobigen, kastenförmigen Handtasche, hatte sie ein kleines Set von Gartengeräten untergebracht, die sie zur Grabpflege benötigte.
Vor dem Grab blieb sie dann immer erschöpft stehen und Maria beobachtete, wie die Großmutter weinte. Sie betrachtete einstweilen das Foto des Großvaters auf dem Grabstein aus Marmor. Ein ovales, verblichenes Bild in braun-weiß, auf dem man nicht sehen konnte, dass der Großvater in Wirklichkeit ganz hellblaue Augen und tiefschwarze Haare gehabt hatte.
„Wenn dein Opa noch leben würde, dann wäre alles anders! Aber so ist es halt ein Unglück! Als Frau alleine ist man nur ein halber Mensch! Als Frau alleine ist man nichts wert! Geh mal und hol Wasser von oben neben der Kirche, Mario.“
Inzwischen entfernte die Großmutter verbittert alles Unkraut, das sich jedes Mal besser entwickelte, als die liebevoll angepflanzten Blumen.
Mario fand die Farbkombination unangenehm. Das Rot der Salvien schlug sich mit den fliederfarbenen anderen Blumen, deren Namen niemand kannte.
Mario wartete, bis eine von den großen Gießkannen, die der Friedhof zur Verfügung stellte, frei war.
„Na, du bist aber ein tüchtiger, kleiner Junge!“, sagte der Herr Pfarrer, der gerade aus der Kirche herauskam, wohlwollend. „Wie heißt du denn?“
„Georg“, sagte Mario.
„Oh, Georg!“ wiederholte der Herr Pfarrer begeistert. „Weißt du, wer der heilige Georg war? Das war ein ganz großer Held. Der hat sogar siegreich gegen Drachen gekämpft. Komm mal mit mir! Ich glaub‘, ich hab‘ in der Sakristei noch ein Heiligenbildchen für den Namen Georg! Möchtest du das haben?“
„Ja, gerne!“
Danach begab sich der Pfarrer auf einen Rundgang durch den Friedhof.
„Tüchtiger, kleiner Junge!“, meinte er anerkennend, als er an Marios Großmutter vorbeischritt.
„Entschuldigen sie, Herr Pfarrer! Das Kind heißt gar nicht Georg.“ Die Großmutter verbeugte sich unterwürfig und gab dem Herrn Pfarrer das Bildchen des heiligen Georgs zurück. „Entschuldigen sie, das Kind hat eine lebhafte Fantasie!“
…
„Wehe, du lügst den Herrn Pfarrer noch einmal an, Mario!“, sagte die Großmutter streng, als sie den Friedhof wieder verlassen hatten. „Zur Strafe gibt es heute keinen Pudding!“
Rollenspiele
Wenn er mit der Großmutter allein war, wurde er Mario gerufen. Mit Hose und Pullover bekleidet, stand er dann breitbeinig da, wie ein kleiner Mann.
Wenn sie mit ihrer Mutter allein war, wurde sie Maria genannt. Die Mutter steckte sie in ein Kleidchen mit Rüschen, was zu dem kurzen Haarschnitt lächerlich aussah. Sie band ihr eine Schleife mit einer großen Masche um den Kopf, um von den fehlenden Haaren abzulenken. Maria fühlte sich dann immer unwohl. Irgendwie verkleidet. Gezwungen, etwas zu sein, das sie gar nicht war.
Wenn er Mario war, half er seiner Großmutter den riesigen Berg von Kohle, die bei der Lieferung einfach in den Vorgarten gekippt wurde, in den Keller zu räumen. Mario durfte auch mit sechs Jahren schon mit einer richtigen, scharfen Axt Holz hacken. Das fühlte sich gut an.
Wenn Mutter und Großmutter gleichzeitig anwesend waren, vermieden sie zumeist die direkte Anrede. Die Mutter sagte dann „Liebling“ und die Großmutter „Gfrast“.
Mario war damals felsenfest überzeugt, ein Junge zu sein. Durch irgendeinen Fehler war der Name wohl falsch eingetragen worden und deshalb stand jetzt in der Geburtsurkunde „Maria“. Das war recht ärgerlich, aber anscheinend nicht mehr rückgängig zu machen.
So kam es auch, dass die Frau Lehrerin Mitterlehner sie am ersten Schultag fälschlich als Mädchen bezeichnete!
„So eine dumme Kuh! Man sieht doch, dass ich kein Mädchen bin!“, dachte Mario insgeheim verärgert.
„Ich heiße nicht Maria!“, berichtigte sie immer wieder bockig.
Es gab in der Klasse auch ein Kind, das darauf bestand „Sissi“ genannt zu werden und nicht „Elisabeth“. Sogar Tränen gab es deshalb.
Die Lehrerin ging auf die Kinder ein und achtete fortan darauf, Elisabeth „Sissi“ zu rufen.
Maria war ihr anfangs ein Rätsel. Aber die erfahrene Pädagogin war eine tolerante Frau mit Verständnis für Eigenheiten. Sie entschied sich dafür, das Rollenspiel zu tolerieren. Es war ihr egal, dass das Kind zum Turnunterricht mit Leibchen und Hose erschien und nicht, wie die anderen Mädchen, in einem Turnanzug. Sie hatte auch nichts dagegen einzuwenden, dass dieses Mädchen lieber neben einem Jungen sitzen wollte. Das Kind war intelligent und lernte leicht. Warum sich also mit dem Junge oder Mädchen Thema aufhalten. Die Lehrerin stellte mit anfänglichem Erstaunen fest, dass die anderen Mädchen Maria mieden, während sie/er von den Buben der Klasse als ihresgleichen akzeptiert wurde. Sie beobachtete amüsiert, wie Maria an den Handgreiflichkeiten und Rangkämpfen der Jungen teilnahm. Ein Mädchen das raufte! Und das dabei auch noch häufig gewann!
Frau Mitterlehner fand dann letztlich eine neutrale Lösung für das Namenproblem. Sie machte den Vorschlag, das Kind fortan Marion zu rufen.
„Marion ist ein Unisex-Name“, erklärte sie. Bei uns ist es häufig ein Mädchenname, aber in Amerika gibt es sogar einen Schauspieler, der Marion heißt.
Freizeitbeschäftigungen
Als kleines Kind war Marion am liebsten im Garten. Dort sammelte sie nach Regenfällen gerne Schnecken ein, die hektisch aus ihren überfluteten Behausungen flüchteten. Dann setzte sie die Tiere in eine alte Schuhschachtel, in deren Deckel sie vorsorglich ein paar Luftlöcher gestochen hatte.
Ihre Großmutter war gegen Haustiere, weil sie zu viel Schmutz machten.
Marion hätte gerne einen Hund gehabt oder eine Katze, aber sie begnügte sich ersatzweise auch mit den Schnecken. Sie gab ihnen Namen und fütterte sie mit Salat; und in regelmäßigen Abständen veranstaltete sie Schneckenrennen. Dazu wurden sieben Schnecken nebeneinander aufgereiht. Die Startlinie war dort, wo die mit Steinen gepflasterte Terrasse in den schmalen Weg überging, der zum hinteren Teil des Gartens führte und als Ziel bestimmte Marion jene Stelle, an der eine Böschung steil bergab ging. Dort wurde das Grundstück auch nicht mehr gepflegt, sondern das wildwachsende Gras bot einen idealen Unterschlupf für Raupen, Schnecken, Maulwürfe und sonstiges Getier.
Wer zuerst die Böschung erreichte war Sieger und bekam zur Belohnung einen Halm Petersilie. Auch wurde die Siegerschnecke ausgiebig gestreichelt und Marion trug sie dann oft den Rest des Tages mit sich herum. Sogar in der Schule versteckte sie das Tierchen in ihrer Bekleidung und wenn sie sich im Unterricht langweilte, dann schlüpfte ihre Hand ganz von selbst in die Hosentasche und ihre Finger glitten versonnen über die glatten Windungen des Schneckenhauses.
Daheim musste Marion immer vorsichtig sein, denn es war schon einmal vorgekommen, dass die Großmutter Marions Lieblingsschnecke einfach in die Abfalltonne geworfen hatte.
Später an jenem Abend, während die Oma bei den Stiegler-Nachbarn zum Fernsehen eingeladen war, schlich Marion aus dem Haus und kletterte in die Mülltonne. Sie suchte lange und wühlte den ganzen Mist durch.
„Mimi, wo bist du? ... Mimi, das ist jetzt nicht lustig! Wenn ich dich nicht finde, wirst du sterben!“, rief sie verzweifelt. Aber Mimi blieb verschwunden.
„Wieso stinkt es denn hier so?“, fragte die Großmutter am nächsten Morgen und schnupperte misstrauisch an Marion herum.
„Wasch dich jetzt sofort, du Ferkel!“, herrschte sie das Kind an. „Gott weiß, wo du dich wieder herumgetrieben hast! Und wenn man fragt, bekommt man ja keine Antwort. Aber weißt du, der liebe Gott sieht alles!!“
Zwei Tage später, tauchte Mimi wieder auf. Sie saß einfach auf der Innenseite des Mülltonnendeckels.
„Mimi!“, rief Marion erleichtert, während ihr Herz einen Luftsprung machte.
Schnell verbarg sie das Tier in ihrer Hand und Mimi kroch die längste Zeit gut ausgeschlafen herum.
… Eine andere Freizeitbeschäftigung war: „Wolken schauen“. Dazu suchte man sich eine schöne Stelle auf einer offenen Wiese, wo man den Himmel gut sehen konnte. Dann legte man sich im duftenden Gras auf den Rücken und beobachtete die Wolken. Man ließ seiner Fantasie freien Lauf und entdeckte immer neue Formen, in den luftigen, watteartigen Gebilden.
„Oh! Die dort sieht wie ein Häschen aus!“, freute sich Marion. „Nur schade, dass ich es nicht streicheln kann … Oh! Aber dort drüben erst! … Da kommt ja ein Elefant …“ Sie beobachtete, wie der Rüssel des Elefanten sich immer mehr verkürzte und seine Beine zunehmend dicker wurden.
„Jetzt ist es ein Drache! Oh! Und dort drüben kommen zwei Pferde geritten …“
Und dann plötzlich verwandelte sich eine dicke Wolke in lauter kleine Schäfchen, die vom Wind getrieben schnell davon liefen …
„Marion! ... Marion!! ... Herrschaft! Wie lange soll ich denn noch rufen!“
Marion hörte die Stimme der Großmutter wie aus weiter Ferne.
„Steh auf und komm rein! Was liegst du denn schon wieder den ganzen Tag im Gras herum und träumst! Mach dich lieber nützlich! Vergiss nicht: Müßiggang ist aller Laster Anfang!! Und wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen! Du kannst doch nicht schon wieder unserem Herrgott den Tag stehlen! Für rechtschaffene Menschen gibt es immer was zu tun.“
Marion liebte Glaskugeln. Die ersten waren ein Geschenk von Tante Mariechen gewesen, den Großteil ihrer stattlichen Sammlung aber hatte sie im Kugelspiel gewonnen.
Dabei setzte jedes Kind anfangs eine Kugel an einen Platz seiner Wahl und dann wurden die Murmeln abwechselnd mit den Fingern angestoßen. Wer es zuerst schaffte, die Kugel des anderen mit der eigenen abzuschießen, war Sieger und durfte beide Kugeln behalten.
Die Blechdose mit den Schnecken und der Beutel mit den Glaskugeln waren zumeist im Seitenfach von Marions Schultasche versteckt.
Abends pflegte die Großmutter den Schulranzen zu kontrollieren, um dort nach Resten des Pausenbrotes zu fahnden. Dann übersiedelten Dose und Beutel kurzfristig unter Marions Bett.
„Du hast schon wieder dein Brot nicht aufgegessen! Du weißt doch, man muss ordentlich essen, sonst hat man keine Kraft. Wenn du nicht isst, wird nichts aus dir!! Die armen Kinderlein in Afrika, die haben nichts zu essen!! Die wären dankbar, wenn sie deine Jause hätten!!“
„Du kannst sie ihnen schicken!“, schlug Marion kurzerhand vor.
„Werd jetzt nicht auch noch frech! Es ist immer das Gleiche mit dir!“
„Aber wirklich! Ich mag dieses Brot nicht! Und wenn die Kinder in Afrika das gerne essen, dann können sie mein Brot haben! Also schick es ihnen doch!“
„Ach du dummes Ding, das geht doch nicht. Wer soll denn dafür bezahlen, dass man das dorthin schickt!? Und außerdem wäre das ja verdorben, bis es dort ankommt! ... Du sollst es essen – und dankbar sein, dass du was zu essen hast!!“
Auf dem Heimweg von der Schule, streifte Marion immer noch eine Stunde im Wald herum. Sie liebte es, die unterschiedlichen Bäume, Moose und Farne zu betrachten und sie beobachtete die kleinen Tiere, die sich darauf tummelten. Sie liebte auch die Himbeeren, von denen es im Sommer reichlich gab, die Heidelbeeren, die in dieser Gegend selten waren und später im Jahr die Brombeeren, die noch bis weit in den Herbst hinein reiften. Sie aß gerne Sauerampfer und saugte das Süße aus den Blüten des Klees. Sie entdeckte auch, dass sich das Harz mancher Bäume in eine Art Kaugummi verwandelte, wenn man es nur lang genug kaute.
Dort im Wald, war Marion immer glücklich. Selbst ihre Hausaufgaben erledigte sie am liebsten, indem sie einen Baumstumpf als Tisch benützte und umgeben von Pilzen und Tannennadelgeruch, ihre Zeilen abschrieb und ihre Zahlen addierte.
Da sie zumeist bereits mit gemachten Aufgaben daheim ankam, hatte die Großmutter keinen triftigen Grund, sie nachmittags im Haus zu behalten.
Marion musste nur das Mittagessen hinter sich bringen und dann den Abwasch erledigen.
Danach wechselte sie schnell die Bekleidung und schlüpfte flink mit beiden Beinen gleichzeitig in ihre heißgeliebten Jeanshosen. Dann verließ sie das Haus wieder im Laufschritt. Erst ging es durch den Garten, dann die Böschung hinunter. Zuletzt über den Zaun und entlang der Bahngeleise zurück zum Wald.
Im Wald wohnten das Glück und die Freiheit.
Im Wald fand Marion auch den Eingang zu einem alten Bunker, der den Bewohnern der Ortschaft im zweiten Weltkrieg als Schutz vor Bomben gedient hatte. Jetzt war er verfallen und der Eingang dicht mit Gebüsch zugewachsen, so dass man ihn kaum mehr finden konnte. Marion richtete sich dort eine Höhle ein, die sie mit Moos weich austapezierte. Nur ihren besten Freunden erzählte sie von diesem Versteck. Mädchen oder Erwachsene, brachte sie nie dorthin.
Die Mädchen hätten sich ja doch nur gefürchtet.
Was ist ein Voyeur?
„Wer hätte das gedacht! Der Herr P. ist ein Voyeur!“, flüsterte die Nachbarin Marions Großmutter ins Ohr. Und dabei leuchteten ihre Augen auf eine Art, die das Interesse des Kindes weckte.
„Was ist ein Voyeur?“, fragte Marion zuhause.
„Das braucht du nicht zu wissen!“, entgegnete die Großmutter. „Horch gefälligst weg, wenn Erwachsene miteinander reden. Das ist alles nicht für deine Ohren bestimmt! Aber das hörst du natürlich sofort. Wenn du, so man dich ruft, auch so flott wärst beim Zuhören, dann wäre es schön!“
„Was ist ein Voyeur?“, fragte Marion am Abend ihre Mutter.
„Ein Voyeur? Na ja, das ist jemand, der andere heimlich beobachtet.“
„Also, so jemand wie Gott?“, fragte Marion nach.
„Halt dein freches Mundwerk!“, sagte die Großmutter und schlug nach ihrer Enkelin, die geschickt auswich.
Marion spitzte die Lippen und hielt sie mit Daumen und Zeigefinger fest.
„Was soll das, du sekantes Rabenvieh?“
„Ich halte meinen Mund! Du hast doch gesagt, ich soll meinen Mund halten!“
„Du weißt ganz genau, wie ich das meine“, entgegnete die Großmutter unwirsch. „Und wenn du nicht sofort aufhörst mit dem Blödsinn, dann fängst du eine!“
Marion schwieg und dachte nach. Ein Voyeur war also jemand, der andere heimlich beobachtet …
„Der liebe Gott sieht alles!“, sagte die Großmutter immer. „Er sieht es, wenn du heimlich von der Marmelade nascht!“
Irgendwie war es peinlich, zu denken, dass der liebe Gott wirklich alles sieht. Auch, wenn die Menschen zur Toilette gehen. Oder sich waschen.
Der liebe Gott interessiert sich für Kinderfinger, die in Marmeladetöpfen stecken oder in Schokosauce.
Selbst wenn die Großmutter es nicht merken sollte, dem lieben Gott entgeht das nicht; und dann bekommen die Kinder, in solchen Fällen, ihre Strafe direkt von ihm. Es regnet dann am Geburtstag, oder das Kaninchen stirbt; oder man bricht sich ein Bein.
Alles nur, wegen ein bisschen Marmelade.
Alles nur, weil der liebe Gott nichts Besseres zu tun hat, als nach diebischen Kinderfingern in Marmelade Ausschau zu halten. Der sollte mal lieber schauen, wie es in Afrika zugeht, wo arme Kinder sich freuen würden, über die Pausenbrote der Großmutter. Oder die Länder, in denen es Krieg gibt! Da hält sich der liebe Gott immer fein raus …
Aber der liebe Gott war eben nur ein Voyeur. Marions Meinung nach, war er der größte Voyeur von allen.
Der kleine Marder
Eines Tages entdeckte Marion in der Schulbücherei das Kinderbuch „Der kleine Marder“.
Ein Waisenjunge lebte in einem Landgasthof, wo er von der Wirtin schlecht behandelt wurde. Aber dann fand er im Wald einen Babymarder, dessen Mutter von Jägern erschossen worden war. Timmi entschied sich das Junge zu retten und versteckte das Tierchen heimlich in seiner Kammer …
Marion identifizierte sich augenblicklich mit dem Waisenjungen.
Sie beschloss, diese wunderbare Geschichte im wirklichen Leben weiterzuspielen. Die Großmutter war fortan die böse Wirtin, die es zu vermeiden galt. Und der ältere Mann, den sie manchmal im Wald traf, war der Förster aus dem Buch …
Nur der Marder fehlte …
Marion wusste recht gut, dass es in ihrem Wald keine Marder gab. Aber am Ende des Forstes, angrenzend an eine kleine Lichtung, lebte auf einem großen, abgezäunten Grundstück ein Reh. Als kleines Kitz war es verwaist im Wald gefunden worden und so hatte man es zunächst mit der Flasche aufgezogen. Als er dann irgendwann zu groß wurde, fürs Haus, übersiedelte der kleine Hansi in den Garten.
Dieses Reh kam Marion sehr gelegen und sie besetzte es mit der Rolle des Wildtiers.
Fortan hatte sie ein Leben, wie in einer Fortsetzung des Buches „Der kleine Marder“.
„Das kleine Reh“, hieß es und Marion versuchte, sich in so vielen Details wie möglich, an die Vorlage anzunähern.
Weil der Waisenjunge Timmi gerne Milch trank, liebte auch Marion plötzlich Milch, sehr zur Überraschung ihrer Großmutter. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Oma immer darüber geärgert, dass Marion ihre Frühstücksmilch ungern trank und dabei ein angeekeltes Gesicht zog.
„Ich liebe Milch!“, zitierte sie jetzt den Text aus dem Buch. „Und du solltest mir mehr Milch geben, damit ich groß und stark werde!“
„Na ja, Kind, allmählich geht dir doch noch der Knopf auf!“, freute sich die Großmutter. „Ich hab‘ schon befürchtet, dass du für alle Zeiten so heikel bleibst. Trink nur, damit was wird aus dir. Man muss groß und stark werden, damit man ordentlich arbeiten kann. Sonst bleibt man ewig so ein Zniachterl, das zu nichts taugt.“
Jeden Tag nach der Schule besuchte Marion von jetzt an das zahme Rehböckchen und allmählich gewöhnte sie sich daran, Hansi als ihr Reh zu betrachten. Sicher war ihr Liebling einsam, so ganz allein in seinem großen Garten. Die Menschen, die ihn dort eingesperrt hatten, waren ja gewöhnlich nur im Haus oder auf der angrenzenden Terrasse.
Anfangs lief das Reh immer fort und Marion überlegte, wie sie es anlocken könnte. Dann beobachtete sie, dass Hansi alle Himbeerblätter fraß, die er durch das Maschengitter erreichen konnte. Sofort brach sie einen langen Ast von einer Himbeerstaude ab und steckte ihn durch den Zaun. Hansi kam vorsichtig näher, so nahe, dass sie zum ersten Mal dem vorsichtigen, aber doch neugierigen Blick seiner feuchten, braunen Augen begegnete.
„Komm!“, flüsterte sie. „Komm her! Das frisst du doch gerne!“
Und dann kam Hansi wirklich näher und zupfte mit vorgestrecktem Kopf das erste Blatt vom äußersten Ende des Himbeerzweiges.
Marion durchflutete ein Hochgefühl, wie sie es noch nie zuvor in ihrem Leben verspürt hatte.
„Ich habe ein Reh und es lässt sich schon von mir füttern“, dachte sie glücklich.
Fortan brachte sie täglich Himbeerblätter für Hansi und sie achtete darauf, den Ast jeden Tag ein bisschen kürzer zu machen. Geduldig wartete sie, bis das Tier seine natürliche Scheu überwand …
Am Ende eines Monats, fraß das kleine Reh aus Marions Hand.
Wieder einige Wochen später, konnte sie Hansi das erste Mal anfassen. Er lief zwar sofort erschrocken weg, als er ihre Berührung spürte, kam aber innerhalb weniger Minuten wieder, um sich weitere Blätter zu holen. Und bald schon gewöhnte er sich an Marions Hand und ließ sich von ihr durch das Gitter streicheln.
Einmal kletterte Marion auch über den Zaun.
Unten vor dem Haus war ein großer, schwarzer Hund an der Kette, der augenblicklich anschlug. Marion dachte an das Schild:
„Achtung bissiger Hund!
Betreten des Grundstücks verboten!“,
das sie neben dem Eingang gesehen hatte und sie hoffte innständig, dass der Mann den Hund nicht von der Kette lassen würde.
Vorsichtshalber versteckte sie sich schnell in einem Gebüsch, ganz in der Nähe des Zauns:
„Der Hund würde aber das Reh erschrecken“, ging es ihr dann durch den Kopf.
„Was gibt´s Bello?“, hörte sie den Hausherrn fragen, dessen dunkler Umriss sich auf der Terrasse abzeichnete.
„Ach Grete, es ist nichts!“, rief er seiner Frau zu, die forschend den Kopf zum Fenster heraussteckte.
„Vermutlich riecht er nur irgendetwas im Wald oben. Vielleicht einen Hasen! Ich komm jetzt wieder rein, weil es ist kalt!“
Fortan ging Marion immer auf Nummer sicher, bevor sie über den Zaun kletterte. Sie schlich zunächst unten am Haus vorbei und sah nach, ob das Auto der Familie da war. Denn der kleine Opel wurde zumeist nur für weitere Wege in die nächste Kreisstadt benützt, wo dann die ganze Familie für geraume Zeit zum Einkaufen unterwegs war. Dann kletterte Marion flink über den Zaun, um mit Hansi, ganz ohne störende Trenngitter, Zärtlichkeiten auszutauschen. Sie liebte den erdigen Geruch des Tieres und seine glänzende Schnauze, mit der es sie schon bald auch anstupste.
„Hansi, mein Liebling!“, flüsterte Marion oft zärtlich. „Ohne dich wäre das Leben überhaupt nicht schön!“
Der Mann mit dem Dackel
Der Spaziergänger mit dem Dackel, dem Marion die Rolle des Försters zugedacht hatte, unterhielt sich oft mit ihr. Ganz so, wie auch der Junge im Buch mit seinem Förster, lange, vertrauliche Gespräche führte.
Marion verfolgte ihn oft heimlich, so wie auch der Junge im Buch alle beobachtete, die sich im Wald aufhielten. Sie lernte, genau wie ihr Vorbild Timmi, geradezu lautlos über den unebenen Waldboden zu gleiten. Im Schutz der dichten Himbeerbüsche beobachtete sie alles, was geschah, während sie selbst unbemerkt blieb. Und so, wie sie es von den Waldtieren gelernt hatte, bewegte sich auch Marion immer abseits der befestigten Wege.
Den spärlichen Spaziergängern jedoch, wurden die Rollen von Eindringlingen zugedacht, die es sorgfältig zu überwachen galt, bis sie den Wald wieder verließen.
Der Mann mit dem Dackel aber kam jeden Tag, insofern hatte er sich eine Hauptrolle verdient.
Marion beobachtete ihn zumeist eine Zeitlang, wie er mit seinem Hund einherschlenderte. Sie belauschte seine Selbstgespräche, während der alte Dackel langsam und gemächlich auf seinen kurzen Beinen hinterherwackelte.
Bei einer einsamen Bank, die einige Meter vom Weg entfernt und ganz von Himbeersträuchern überwuchert war, machte der alte Mann gewöhnlich Rast. Er holte dann zunächst seine Pfeife aus der wildledernen Umhängtasche, die er immer dabei hatte und begann umständlich, sie zu stopfen. Dann entzündete er langsam und bedächtig den Tabak, schloss genüsslich die Augen und tat einen tiefen Zug. Dies war der Moment, in dem Marion zumeist aus ihrer grünen Deckung hervortrat.
„Na, du kleiner Strolch! Wo kommst denn du wieder her? Ist die Schule schon aus?“
„Ja, schon lang. Darf ich den Waldi streicheln?“
„Na klar, du schon, dich kennt er ja. Aber du weißt ja, der Waldi ist schon ein alter Herr und hat seine Launen. Nicht ärgern und nicht an der Schnauze angreifen. Das mag er gar nicht und dann schnappt er auch manchmal.“
„Ja, ich weiß“, sagte Marion.
…
Plötzlich knackten einige Äste im Gebüsch. Dann hörte man ein Kichern … ein Flüstern … ein Lachen.
„Pssst!“ flüsterte der „Förster“ und legte seinen Zeigefinger senkrecht vor die Lippen … Mit der einen Hand zerrte er den Hund zwischen seine Beine, mit der anderen zog er Marion am Ärmel näher zu sich. „Sieh mal, das junge Pärchen da drüben! Die kommen manchmal hierher …“
„Nein, lass das, nicht so schnell!!“
Das junge Mädchen stieß seinen Begleiter zurück.
„Nur küssen“, sagte sie sanft und warf ihren Kopf mit den langen, blonden Haaren neckisch in den Nacken zurück. Der junge Mann beugte sich nach vorne und biss sie spielerisch in den Hals.
„Spinnst du total!? Wehe, wenn man da jetzt was sieht davon! Wie soll ich denn das meiner Mutter erklären!?“
„Ach komm, sei nicht so! Du magst mich doch! Oder? Magst mi nimmer?“
„I mag di schon, aber du bist so a Depp!“
„Geh komm, küss mich doch einfach!“
Er legte den Arm um sie und sie kuschelte sich an seine Brust.
„Na bitte“, sagte er, „so gefällst du mir schon viel besser …“
Dann streichelte er lange Zeit die blonden Haare des Mädchens und küsste sanft und vorsichtig ihre Hände, ihre Stirn und zuletzt ihren Mund. Eine Zeitlang küssten sie sich und Marion konnte das schmatzende Geräusch ihrer Küsse deutlich hören. Ihre Empfindungen schwankten zwischen Ekel und Neugier und sie fand das Mädchen doof. Dieses dämliche Gekicher und Getue. Marion konnte nicht verstehen, was der Mann an dem Mädchen fand. Die blonde, junge Frau hatte die Knöpfe ihrer Bluse so weit offen, dass der Junge ihr das Kleidungsstück mühelos von den Schultern streifen konnte. Das Mädchen kicherte wieder und sagte:
„Nein! Nicht jetzt! Wir müssen doch gleich zurück zur Arbeit!“ Aber sie ließ sich viel Zeit damit, ihre Bluse wieder hochzuziehen und Marion konnte deutlich sehen, wie sich die prallen Brüste durch den leichten Spitzen-BH abzeichneten. Dabei wiegte sie ihren Oberkörper verlockend hin und her und lächelte ihn an. „Sag, findest du mich schön?“, fragte sie eitel und atmete tief ein, damit sich ihre Brüste noch weiter nach vorne wölbten. Dann schob sie den einen Träger des BHs nach unten und entblößte einen Moment lang ihre rechte Brust. „Findest du mich schön?“, fragte sie noch einmal eindringlich.
„Zieh den BH ganz aus, dann sag ich‘s dir!“
„Das würde dir so passen!“ Schnell zog sie den Träger wieder hoch.
„Hab dich nicht so!“, sagte er, lachte verwegen und fasste ihr keck an die Brust!“
„Spinnst!? Du tust mir ja weh!“ Das Mädchen gab dem Jungen eine schallende Ohrfeige, knöpfte ihre Bluse zu und drehte ihre Haare zu einem Knoten.
„Hahahaha!“, kicherte der alte Mann mit dem Dackel genüsslich vor sich hin. „Da schaust du, mein kleiner Waldstrolch, das ist besser als Fernsehen! Die kommen manchmal hierher, immer um die gleiche Zeit, in ihrer Mittagspause und sie sind sehr achtlos und nur mit sich selbst beschäftigt. Die haben keine Ahnung, dass wir auch hier sind … Und wenn du schön leise bist und nicht störst, darfst du ruhig neben mir sitzen und zusehen. Da kannst du was lernen für das spätere Leben! Aber niemandem sagen!! Verstehst du? Das ist wichtig! Weil sonst gibt es Ärger! Tut ja niemandem weh, dass wir hier zuschauen … Wenn die so blöd sind, dass sie hier rummachen, sind sie wirklich selber schuld! … Anständige Leute machen sowas zuhause … Und ich geb‘ dir auch einen Schilling dafür, dass du nichts weitererzählst! Und das nächste Mal kannst du wieder einen Schilling haben! Kann man doch immer brauchen, oder? Geh und kauf dir auf dem Heimweg einen Kaugummi beim Automaten.“
Marion hatte ein schlechtes Gewissen, aber sie nahm den Schilling an. Den ersten von vielen Schillingen.