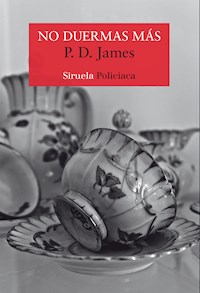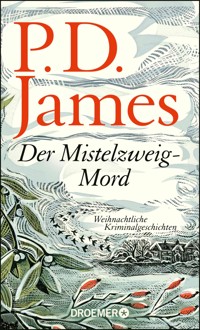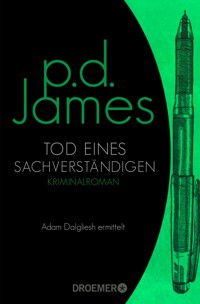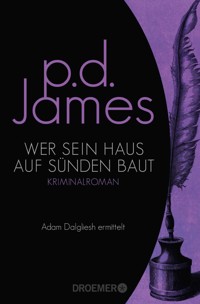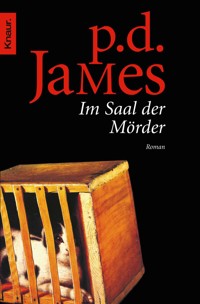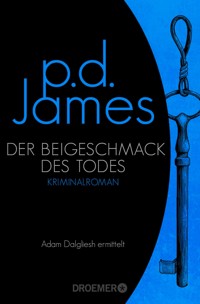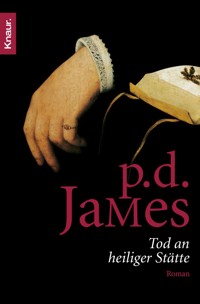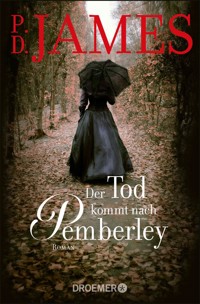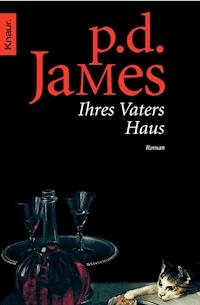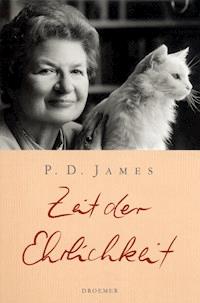6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Dalgliesh-Romane
- Sprache: Deutsch
Die Journalistin Rhoda Gradwyn, berühmt-berüchtigt wegen ihrer spitzen Feder, beschließt mit 47 Jahren, sich endlich die unschöne Narbe aus dem Gesicht entfernen zu lassen. Doch sie wird die idyllisch gelegene Privatklinik nicht mehr lebend verlassen – am Tag nach der Operation liegt Rhoda erwürgt im Bett. Kurz darauf wird ein Freund des feinen Hauses ebenfalls ermordet aufgefunden. Commander Adam Dalgliesh und sein Team müssen sich bald mit viel Komplizierterem herumschlagen als der Frage nach dem Schuldigen ... Ein makelloser Tod von P. D. James: packender Thriller im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
P.D. James
Ein makelloser Tod
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Dieses Buch widme ich [...]
Anmerkung der Autorin
Erstes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Zweites Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Drittes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Viertes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Fünftes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Dieses Buch widme ich dem Verleger Stephen Page und allen meinen Freunden bei Faber & Faber, den alten und den neuen, zur Feier meiner sechsundvierzig Jahre als Autorin des Verlags.
Anmerkung der Autorin
Dorset ist bekannt für Tradition und Vielfalt seiner Manor Houses, aber der Reisende, der in diese schöne Grafschaft kommt, wird vergeblich nach Cheverell Manor suchen. Das Manor und alles, was damit verbunden ist, die betrüblichen Ereignisse, die sich dort abgespielt haben, existieren ausschließlich in der Fantasie der Autorin und ihrer Leser und stehen in keinerlei Zusammenhang mit irgendwelchen lebenden oder verstorbenen Personen.
P.D. James
Erstes Buch
21. November – 14. Dezember London, Dorset
1
Am 21. November, ihrem siebenundvierzigsten Geburtstag, drei Wochen und zwei Tage vor ihrer Ermordung, fuhr Rhoda Gradwyn zu einem ersten Termin bei ihrem plastischen Chirurgen, um in einem Sprechzimmer, das man eigentlich aufsuchte, um sich Mut machen und von Sorgen befreien zu lassen, den Entschluss zu fassen, der sie letztlich das Leben kostete. Danach würde sie im Ivy zu Mittag essen. Das Zusammentreffen der beiden Verabredungen war Zufall. Mr. Chandler-Powell hatte keinen früheren Termin zur Verfügung gehabt, und der Lunch mit Robin Boyton, für Viertel vor eins gebucht, war schon vor zwei Monaten verabredet worden; im Ivy durfte man nicht damit rechnen, auf gut Glück einen Tisch zu bekommen. Keines der beiden Ereignisse betrachtete sie als Feierlichkeit zu ihrem Geburtstag. Über dieses Detail ihres Privatlebens wurde, wie über vieles andere, nicht gesprochen. Sie bezweifelte, dass Robin ihr Geburtsdatum erfahren oder sich auch nur dafür interessiert hatte. Auch wenn sie eine angesehene, sogar namhafte Journalistin war, erwartete sie nicht, ihren Namen auf der VIP-Geburtstagsliste der Times zu lesen.
In der Harley Street wurde sie um Viertel nach elf erwartet. Bei den meisten Verabredungen in London ging sie wenigstens einen Teil des Weges zu Fuß, diesmal hatte sie für halb elf ein Taxi bestellt. Eigentlich dauerte die Fahrt aus der City heraus keine Dreiviertelstunde, aber beim Londoner Verkehr wusste man nie. Sie begab sich auf ein ihr fremdes Terrain und wollte sich bei ihrem Chirurgen nicht gleich unbeliebt machen, indem sie bereits zum ersten Termin zu spät kam.
Vor acht Jahren hatte sie ein Haus in der City gemietet. Es gehörte zu einer schmalen Häuserzeile an einem kleinen Rondell am Ende der Absolution Alley nahe Cheapside. Kaum war sie damals eingezogen, wusste sie, dass sie in keinem anderen Teil Londons mehr leben wollte. Sie hatte einen langfristigen Mietvertrag, der verlängert werden konnte; gerne hätte sie das Haus gekauft, aber sie wusste, dass es niemals zum Verkauf stehen würde. Es bereitete ihr keinen Kummer, dass sie nicht darauf hoffen durfte, es einmal ganz zu besitzen. Es stammte zum größten Teil aus dem siebzehnten Jahrhundert. Viele Generationen hatten in dem Haus gewohnt, waren dort zur Welt gekommen und gestorben und hatten nichts hinterlassen als ihre Namen auf uralten, vergilbten Mietverträgen, und sie fühlte sich ganz wohl in ihrer Gesellschaft. Die unteren Räume mit den Kassettenfenstern waren dunkel, aber ganz oben in ihrem Arbeitszimmer und im Wohnzimmer öffneten sich die Fenster dem Himmel, und man blickte auf die Hochhäuser und Kirchtürme der City und noch weit darüber hinaus. Eine Eisentreppe führte von einem schmalen Balkon im dritten Stock auf ein eigenes Dach, auf dem Blumentöpfe aus Terrakotta standen; an Sonntagen, wenn der Feiertagsfriede bis in die Mittagsstunden hineinreichte, konnte sie dort bei schönem Wetter mit der Zeitung oder einem Buch sitzen, und die vormittägliche Ruhe wurde nur durch das vertraute Läuten der Glocken in der Stadt gestört.
Die Stadt unter ihr war ein Beinhaus, errichtet auf vielen Schichten Knochen, die Jahrhunderte älter waren als die, die unter den Innenstädten von Dresden oder Hamburg ruhten. War dieses Wissen Teil des Geheimnisses, das die Stadt für sie bewahrte und das sie nie deutlicher spürte als auf ihren einsamen, vom sonntäglichen Geläut begleiteten Erkundungsgängen durch ihre versteckten Straßen und Plätze? Die Zeit hatte sie schon als Kind fasziniert, ihre augenscheinliche Fähigkeit, sich in verschiedenen Geschwindigkeiten zu bewegen, Geist und Körper zu zersetzen, alle Augenblicke, die gewesenen und die zukünftigen, in einer illusorischen Gegenwart zu verschmelzen, die sich mit jedem Atemzug in unverrückbare, unabänderliche Vergangenheit verwandelte. In der City of London waren diese Augenblicke in Granit und Backstein festgehalten und verfestigt, in Kirchen und Monumenten und den Brücken, die sich über die graubraune, ewig dahinfließende Themse spannten. Wenn sie im Frühling oder Sommer um sechs Uhr früh das Haus verließ, drehte sie hinter sich zweimal den Schlüssel im Schloss und trat hinaus in eine Stille, die ihr tiefer und geheimnisvoller erschien als das bloße Fehlen von Geräuschen. Manchmal kamen ihr auf diesen einsamen Gängen sogar ihre Schritte gedämpft vor, als fürchtete etwas in ihr, die Toten zu wecken, die durch diese Straßen gegangen waren und dieselbe Stille gekannt hatten. An Sommerwochenenden wusste sie, dass nur wenige Hundert Meter entfernt schon bald Einheimische und Touristen in hellen Scharen über die Millennium Bridge strömen, die vollbeladenen Flussschiffe mit majestätischer Plumpheit von ihren Ankerplätzen ablegen würden und das öffentliche London zu lärmendem Leben erwachte.
Aber von dieser Geschäftigkeit drang nichts in den Sanctuary Court. Das Haus, das sie sich ausgesucht hatte, konnte sich nicht gründlicher unterscheiden von der mit Gardinen verhängten klaustrophobischen Doppelhaushälfte im Laburnum Grove in Silford Green, dem Londoner Vorort, in dem sie zur Welt gekommen war und die ersten sechzehn Jahre ihres Lebens verbracht hatte. Heute würde sie den ersten Schritt tun, um sich mit dieser Zeit auszusöhnen oder – sollte Aussöhnung nicht möglich sein – ihr wenigstens die zerstörerische Wirkung zu nehmen.
Es war halb neun, sie war in ihrem Badezimmer. Sie drehte das Duschwasser ab und trat, in ein Handtuch gehüllt, vor den Spiegel über dem Waschbecken. Als sie mit der Hand über das beschlagene Glas wischte, erschien ihr Gesicht blass und namenlos wie ein verschwommenes Gemälde. Seit Monaten hatte sie die Narbe nicht mehr bewusst berührt. Jetzt fuhr sie mit den Fingerspitzen behutsam über ihre ganze Länge, tastete den silbrigen Streifen in der Mitte, die harten, unebenen Konturen der Ränder ab. Sie verdeckte die Wange mit einer Hand und stellte sich die Fremde vor, die in ein paar Wochen in denselben Spiegel schauen und dort eine Doppelgängerin von ihr sehen würde, eine unvollkommene, nicht entstellte allerdings, auf deren Gesicht vielleicht nur noch eine schmale weiße Linie anzeigte, wo dieser wuchernde Spalt verlaufen war. Während sie auf ihr Antlitz blickte, das ihr wie eine verblichene Fotografie eines früheren Selbst erschien, riss sie langsam, aber systematisch ihre sorgsam errichteten Schutzwälle ein und ließ die turbulente Vergangenheit wie einen anschwellenden Bach zuerst, dann wie einen Hochwasser führenden Fluss hereinbrechen und ihre Gedanken überspülen.
2
Sie war wieder in dem kleinen hinteren Zimmer, Küche und Wohnzimmer zugleich, in dem ihre Eltern ihre Lügen gelebt, ihr selbst gewähltes Exil vom Leben durchlitten hatten. Das vordere Zimmer mit seinem Erkerfenster war besonderen Gelegenheiten vorbehalten, Familienfesten, die nicht gefeiert wurden, Besuchern, die nicht kamen; seine Stille roch nach Möbelpolitur mit Lavendelaroma und abgestandener, so unheilschwangerer Luft, dass sie versuchte, sie nicht zu atmen. Sie war das einzige Kind einer ängstlichen, unfähigen Mutter und eines trinkenden Vaters. Seit über dreißig Jahren definierte sie sich so, und daran hatte sich nichts geändert. Scham und Schuldgefühle hatten ihre Kindheit und Jugend eingeengt. Die periodischen Gewaltausbrüche ihres Vaters waren unberechenbar gewesen. Man konnte nicht ruhigen Gewissens Schulfreundinnen mit nach Hause bringen oder Weihnachts- oder Geburtstagspartys geben, und weil sie niemanden eingeladen hatte, war sie auch von niemandem eingeladen worden. Ihre Grundschule war eine reine Mädchenschule gewesen, und die Mädchen pflegten untereinander sehr enge Freundschaften. Es galt als ein großer Gunstbeweis, von einer Freundin eingeladen zu werden, im Hause ihrer Eltern zu übernachten. Im Laburnum Grove 239 hatte nie ein fremdes Kind geschlafen. Aber die Isolation machte ihr nicht viel aus. Sie wusste, dass sie intelligenter als ihre Klassenkameradinnen war, und konnte sich einreden, keinen Bedarf an Freundschaften zu haben, die intellektuell unbefriedigend bleiben mussten und die ihr ohnehin niemand anbot.
Es war an einem Freitagabend um halb zwölf. Ihr Vater hatte seinen Lohn ausbezahlt bekommen, der schlimmste Tag der Woche.
Sie hörte das gefürchtete Geräusch, das harte Zuschlagen der Eingangstür. Er kam hereingepoltert; Rhoda sah ihre Mutter vor dem Lehnsessel, der Sekunden später seinen Zorn erregen würde. Es war sein Sessel. Er hatte ihn ausgesucht und bezahlt. Am Vormittag war er geliefert worden. Der Lieferwagen war schon wieder fort gewesen, als ihre Mutter entdeckt hatte, dass es die falsche Farbe war. Man hätte ihn umtauschen können, aber bis Ladenschluss war dazu keine Zeit gewesen. Rhoda wusste, dass das weinerliche, kleinlaute Wimmern ihrer Mutter ihn bis aufs Blut reizen würde und dass ihre eigene misslaunige Anwesenheit keinem von beiden half, doch sie konnte nicht einfach zu Bett gehen. Der Lärm von unten herauf wäre unerträglicher gewesen als dabeizubleiben. Und jetzt war der Raum von seiner Gegenwart erfüllt, seinem torkelnden Körper, seinem Gestank. Als sie das rasende Gebrüll, seine wirren Beschimpfungen hörte, wallte Zorn in ihr auf, und mit dem Zorn kam der Mut. Sie hörte sich sagen: »Mutter kann nichts dafür. Der Sessel war noch verpackt, als der Mann weggefahren ist. Sie hat nicht sehen können, dass es die falsche Farbe ist. Die müssen ihn umtauschen.«
Da ging er auf sie los. Sie konnte sich nicht erinnern, was er gesagt hatte. Vielleicht gar nichts, oder sie hatte es nicht gehört. Da war nur das Krachen der berstenden Flasche, wie ein Pistolenschuss, und der Whiskygeruch, ein Augenblick sengenden Schmerzes, der fast so schnell verging, wie er gekommen war, das warme Blut, das ihr von der Wange auf das Sitzkissen des Sessels tropfte, der gequälte Schrei ihrer Mutter: »O Gott, Rhoda, was machst du da? Das Blut! Jetzt können wir ihn nicht mehr umtauschen. Den nehmen sie bestimmt nicht zurück.«
Ihr Vater schaute sie kurz an, bevor er hinausstolperte und sich hinauf ins Schlafzimmer schleppte. In den Sekunden, in denen ihre Blicke sich begegneten, meinte sie bei ihm eine Verwirrung der Gefühle zu erkennen: Fassungslosigkeit, Entsetzen, Ungläubigkeit. Jetzt erst kümmerte sich die Mutter um ihr Kind. Rhoda hatte versucht, die Wunde zusammenzudrücken, Blut klebte an ihren Händen. Ihre Mutter holte Handtücher und eine Schachtel Heftpflaster, versuchte mit zittrigen Fingern, sie zu öffnen, ihre Tränen vermischten sich mit Blut. Rhoda nahm ihr die Schachtel vorsichtig aus der Hand und zog die Hüllen von einigen Pflastern, mit denen sie zumindest den größten Teil der Wunde verschließen konnte. Als sie nicht einmal eine Stunde später in ihrem Bett lag, war die Blutung gestillt und ihre Zukunft vorgezeichnet. Es würde weder ein Arztbesuch stattfinden noch eine wahrheitsgetreue Erklärung geben; sie würde ein paar Tage nicht zur Schule gehen, telefonisch entschuldigt von ihrer Mutter, sie fühle sich nicht wohl. Und wenn sie wieder hinging, hätte sie eine erfundene Geschichte parat: Sie war gegen die Kante der offenen Küchentür geprallt.
Inzwischen wurden die gestochen scharfen Bilder dieses einen, vernichtenden Augenblicks durch profanere Erinnerungen an die folgenden Jahre abgeschwächt. Die Wunde hatte sich entzündet, war schmerzhaft und langsam abgeheilt, und ihre Eltern hatten beide nie wieder ein Wort darüber verloren. Ihr Vater, der ihr noch nie offen in die Augen sehen konnte, mied fortan ihre Nähe. Die Klassenkameradinnen wandten den Blick ab, und es schien ihr, als wäre Furcht an die Stelle offener Abneigung getreten. Niemand in der Schule sprach in ihrer Gegenwart von der Verunstaltung, bis sie gegen Ende der sechsten Klasse ihrer Englischlehrerin gegenübersaß, die sie dazu bringen wollte, sich in Cambridge – ihrer Universität – und nicht in London um einen Studienplatz zu bewerben. Ohne von ihren Unterlagen aufzublicken, sagte Miss Farrell: »Die Narbe auf Ihrem Gesicht, Rhoda. Sie glauben gar nicht, was die Gesichtschirurgie heutzutage alles leistet. Vielleicht sollten Sie sich einen Termin bei Ihrem Hausarzt geben lassen, bevor Sie hinfahren.« Ihre Blicke waren sich begegnet, Rhodas glühend vor Entrüstung, und nach ein paar Sekunden des Schweigens hatte sich Miss Farrell, ihr Gesicht übersät von hektischen Flecken, über ihre Unterlagen geduckt.
Man begegnete ihr zunehmend mit vorsichtigem Respekt. Weder Abneigung noch Respekt konnten ihr etwas anhaben. Sie entwickelte ihr ganz eigenes privates Interesse, eine Neugier auf das, was andere verbergen wollten. Das Stöbern nach den Geheimnissen anderer Menschen sollte zu einer lebenslangen Leidenschaft werden, ihrer beruflichen Karriere Nährboden und Richtung geben. Sie ging auf die Jagd nach Gedanken. Achtzehn Jahre nachdem sie aus Silford Green fortgezogen war, hatte ein aufsehenerregender Mordfall den Vorort in Atem gehalten. Sie hatte die körnigen Bilder von Opfer und Mörder in den Zeitungen ohne besonderes Interesse betrachtet. Der Mörder gestand nach ein paar Tagen, kam hinter Gitter, der Fall war gelöst. Als investigative Journalistin, die inzwischen immer erfolgreicher wurde, war sie weniger an Silford Greens kurzem Ruhm als vielmehr an ihren eigenen raffinierteren, einträglicheren und fesselnden Ermittlungsmethoden interessiert.
Sie hatte ihr Elternhaus an ihrem sechzehnten Geburtstag verlassen und sich im Nachbarvorort ein möbliertes Zimmer gesucht. Bis zu seinem Tode schickte ihr Vater ihr wöchentlich eine Fünfpfundnote in einem Briefumschlag. Sie bedankte sich nie für das Geld, behielt es aber, weil sie es als Zuschuss zu ihrem Wochenendjob als Aushilfskellnerin dringend benötigte, und rechtfertigte sich damit, dass es wahrscheinlich weniger war, als sie zu Hause verzehrt hätte. Als fünf Jahre später – nach einem ausgezeichneten Abschluss in Geschichte hatte sie in ihrer ersten Stelle Fuß gefasst – ihre Mutter anrief und ihr mitteilte, dass ihr Vater gestorben war, registrierte sie ein völliges Fehlen von Gefühlen, das ihr paradoxerweise stärker und nachhaltiger erschien als jede Form von Trauer. Sie hatten seine Leiche aus einem Fluss in Essex gezogen, dessen Namen sie sich nie merken konnte, und am Alkoholpegel im Blut hatte man ablesen können, dass er im Vollrausch gewesen war. Der amtliche Leichenbeschauer bescheinigte erwartungsgemäß und wohl auch korrekterweise Tod durch Unfall. Sie hatte darauf gehofft. Nicht ohne einen Hauch von Scham, der schnell wieder verflog, sagte sie sich, dass ein Selbstmord ein zu vernünftiger, zu bedeutsamer Schlussstrich unter ein so fruchtloses Leben gewesen wäre.
3
Das Taxi kam schneller voran als erwartet. Um nicht zu früh in der Harley Street anzukommen, ließ sie den Fahrer am Ende der Marylebone Street anhalten und legte den Rest des Weges zu ihrem Termin zu Fuß zurück. Wie bei den wenigen anderen Malen, die sie hier durchgekommen war, war sie fasziniert von der Verlassenheit der Straße, der beinahe unheimlichen Ruhe, die über diesen klassischen Reihenhäusern aus dem achtzehnten Jahrhundert lag. Fast jede Tür trug ein Messingschild mit einer Liste von Namen, die signalisierten, was ohnehin jeder in London wusste – man war auf dem Olymp der ärztlichen Kunst angekommen. Irgendwo hinter diesen glänzenden Haustüren und diskret verhängten Fenstern warteten Patienten in den verschiedensten Stadien der Furcht, Besorgnis, Hoffnung oder Verzweiflung, aber man sah so gut wie nie einen von ihnen kommen oder gehen. Es begegnete einem höchstens einmal ein Vertreter oder ein Bote, ansonsten wirkte die Straße wie eine verlassene Filmkulisse, die auf den Regisseur, die Kameraleute und Schauspieler wartete.
Als sie vor der Tür stand, studierte sie die Namen. Zwei Chirurgen und drei Internisten, der erwartete Name ganz oben: Mr. G. H. Chandler-Powell, FRCS, FRCS (Plast), MS – Mitglied der Königlichen Gesellschaft der Chirurgen und der Plastischen Chirurgen, aber die beiden letzten Buchstaben taten kund, dass ein Chirurg den Gipfel der Fachkompetenz und Reputation erklommen hatte: MS – Master of Surgery.Das klang gut, fand sie. Die Wundärzte und chirurgischen Handwerker, die ihre Diplome aus der Hand Heinrichs des Achten erhalten hatten, wären erstaunt, wie weit es ihre Profession gebracht hatte.
Die Tür öffnete ihr eine junge Frau mit ernstem Gesicht, ihr weißer Kittel war figurbetont geschnitten. Sie war attraktiv, aber nicht verstörend schön, und das kurze Begrüßungslächeln wirkte eher drohend als freundlich. Leitkuh, dachte Rhoda, Zugführerin bei den Pfadfinderinnen. So eine gab es in jeder Abschlussklasse.
Das Wartezimmer, in das man sie brachte, entsprach so genau ihren Erwartungen, dass sie für einen Moment das Gefühl hatte, schon einmal hier gewesen zu sein. Es machte durchaus Eindruck, ohne Dinge von echter Qualität zu enthalten. Der große Mahagonitisch in der Mitte, auf dem Ausgaben von Country Life, Horse and Hounds und ein paar der anspruchsvolleren Frauenzeitschriften so ordentlich aufgereiht lagen, dass man sie sich kaum zu lesen traute, war eindrucksvoll, aber nicht elegant. Das Sortiment an Stühlen, einige mit steiler Rückenlehne, andere etwas bequemer, sah aus wie auf einem Landhausverkauf ersteigert, aber selten benutzt. Die Jagdstiche waren groß und beliebig genug, nicht zum Diebstahl zu verführen, und sie zweifelte an der Echtheit der beiden hohen Balustervasen auf dem Kaminsims.
Außer ihr zeigte keiner der Patienten äußerliche Hinweise auf die spezifische Fachkenntnis, deren er bedurfte. Wie meistens, konnte sie die anderen beobachten, ohne befürchten zu müssen, dass neugierige Blicke lange auf sie gerichtet sein würden. Sie hatten kurz hochgeschaut, als sie eingetreten war, aber ohne ein kurzes Nicken der Begrüßung. Als Patient gab man einen Teil von sich auf, um Aufnahme in ein System zu finden, das einen, so harmlos es auch war, auf subtile Weise der Initiative, ja beinahe des freien Willens beraubte. Jeder saß dort in seiner eigenen Welt, geduldig und fügsam. Eine Frau in mittleren Jahren, ein Kind neben sich auf dem Stuhl, starrte ausdruckslos ins Nichts. Das kleine Mädchen langweilte sich und blickte unternehmungslustig um sich. Schließlich begann es mit den Füßen leise gegen die Stuhlbeine zu stoßen, bis die Frau ihm, ohne es anzuschauen, mit ausgestreckter Hand Einhalt gebot. Gegenüber von ihnen zog ein junger Mann, in seinem dunklen Anzug der Prototyp eines Bankers, die Financial Times aus seiner Aktenmappe, klappte sie mit geübten Bewegungen auseinander und richtete seine Aufmerksamkeit auf eine Seite. Eine modisch gekleidete Frau bewegte sich leise auf den Tisch zu, begutachtete die Magazine, konnte sich für keines entscheiden, kehrte zu ihrem Stuhl am Fenster zurück und schaute wieder auf die leere Straße hinaus.
Man ließ Rhoda nicht lange warten. Die junge Frau, die sie hereingebracht hatte, kam zu ihr und teilte ihr mit leiser Stimme mit, dass Mr. Chandler-Powell sie jetzt empfangen könne. Bei seiner Fachrichtung begann die Diskretion offenbar schon im Wartezimmer. Sie wurde in einen großen, hellen Raum auf der anderen Seite des Flurs geführt. Schwere Leinenvorhänge rahmten die beiden hohen Doppelfenster zur Straße hin, und ein weißer, beinahe durchsichtiger Store aus Musselin dämpfte das winterliche Sonnenlicht. In dem Raum fand sich nichts von dem Mobiliar und den Geräten, die sie eigentlich erwartet hatte; er glich eher einem Salon als einem Sprechzimmer. Links von der Tür in der Ecke stand ein schöner lackierter Wandschirm mit einem ländlichen Motiv, das Wiesen, einen Bach und ferne Berge darstellte. Er war offenkundig alt, wahrscheinlich aus dem achtzehnten Jahrhundert. Vielleicht, dachte sie, verdeckte er ein Waschbecken oder sogar eine Behandlungscouch, aber das schien eher unwahrscheinlich. Man konnte sich nicht recht vorstellen, dass sich in diesem privaten, wenn auch opulent eingerichteten Ambiente jemand seiner Kleider entledigte. Auf beiden Seiten des marmornen Kamins stand je ein großer Ohrensessel, und gegenüber der Tür waren zwei Stühle vor einen Sockelschreibtisch geschoben. Das einzige Ölbild hing über dem Kaminsims, das gewaltige Gemälde eines Tudor-Hauses, vor dem eine Familie des achtzehnten Jahrhunderts posierte, der Vater und zwei Söhne zu Pferde, die Frau mit drei jungen Töchtern in einer offenen Kutsche. An der Wand gegenüber hing eine Reihe kolorierter Stiche von Londoner Stadtansichten des achtzehnten Jahrhunderts. Die Stiche und das Ölgemälde gaben ihr das Gefühl, sanft der Zeit enthoben zu sein.
Mr. Chandler-Powell, der hinter seinem Schreibtisch gesessen hatte, war bei ihrem Eintritt aufgestanden und kam ihr mit ausgestreckter Hand entgegen, bevor er auf einen der beiden Stühle deutete. Sein Händedruck war fest, aber kurz, seine Hand kühl. Sie hatte ihn sich in einem dunklen Anzug vorgestellt. Stattdessen trug er hellen, blassgrauen Tweed, elegant geschnitten, der ihn kurioserweise noch förmlicher erscheinen ließ. Als sie Platz genommen hatte, schaute sie in ein kräftiges, kantiges Gesicht mit einem großen, beweglichen Mund und hellbraunen Augen unter buschigen Brauen. Das braune Haar, glatt und etwas widerspenstig, war über eine hohe Stirn gekämmt, ein paar Strähnen fielen fast bis in sein rechtes Auge. Als ersten Eindruck vermittelte er Selbstvertrauen, und sie erkannte sogleich die Patina, die etwas mit Erfolg zu tun hatte, wenn auch nicht alles. Es war ein anderes Selbstvertrauen als das, mit dem sie als Journalistin oft zu tun hatte: Berühmtheiten, immer begierig nach der nächsten Kamera spähend, allzeit bereit für die adäquate Pose; Schaumschläger, die zu wissen schienen, dass ihre Berühmtheit eine Erfindung der Medien war, ein flüchtiger Ruhm, den nur ihr verzweifelter Glaube an sich selbst aufrechterhalten konnte. Hier saß ihr ein Mann in der inneren Gewissheit gegenüber, im Zenit seiner Karriere zu stehen, unantastbar zu sein. Sie meinte sogar einen Hauch von Arroganz zu spüren, den er nicht ganz verstecken konnte, aber das mochte ein Vorurteil sein. Master of Surgery. Ja, das passte.
»Miss Gradwyn, Sie kommen ohne Überweisung Ihres Hausarztes zu mir.« Er sagte das als reine Feststellung, ohne Tadel. Er hatte eine tiefe, angenehme Stimme, wenn auch mit leicht ländlichem Einschlag, den sie nicht genau einzuordnen wusste und nicht erwartet hatte.
»Es wäre eine Verschwendung seiner und meiner Zeit gewesen. Ich werde seit acht Jahren in Dr. Macintyres Praxis geführt, ohne jemals ihn oder einen seiner Kollegen konsultiert zu haben. Ich gehe lediglich alle zwei Jahre zu ihm in die Sprechstunde, um mir den Blutdruck messen zu lassen.«
»Ich kenne Dr. Macintyre. Ich rufe ihn an.«
Ohne etwas zu sagen, kam er zu ihr herüber, drehte die Schreibtischlampe und richtete ihr grelles Licht direkt auf ihr Gesicht. Mit seinen kühlen Fingern tastete er die Haut an beiden Wangen ab, kniff sie zu Falten zusammen. Die Berührung war so unpersönlich, dass sie an einen Affront grenzte. Sie fragte sich, warum er nicht hinter dem Schirm verschwunden war, um sich die Hände zu waschen, aber falls er es bei dieser Voruntersuchung für nötig hielt, hatte er es vielleicht schon getan, bevor sie ins Zimmer kam. Einen Augenblick lang betrachtete er die Narbe eingehend, ohne sie zu berühren. Dann schaltete er die Lampe aus und setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch. Mit einem Blick auf das Karteiblatt fragte er: »Wie lang liegt diese Tat zurück?«
Die Formulierung der Frage verblüffte sie. »Vierunddreißig Jahre.«
»Und wie ist es passiert?«
»Muss ich darauf antworten?«, fragte sie.
»Nein, es sei denn, Sie haben sich das selbst zugefügt. Was ich nicht vermute.«
»Nein, ich habe es nicht selbst getan.«
»Sie haben vierunddreißig Jahre gewartet, um etwas zu unternehmen? Warum jetzt, Miss Gradwyn?«
Nach einer Pause sagte sie: »Weil ich sie jetzt nicht mehr brauche.«
Er antwortete nicht, aber die Hand, die gerade etwas auf das Karteiblatt schrieb, hielt für ein paar Sekunden inne. Er hob den Blick und fragte: »Was erhoffen Sie sich von dieser Operation, Miss Gradwyn?«
»Ich würde die Narbe gern ganz verschwinden lassen, aber mir ist klar, dass das nicht möglich ist. Ich glaube, ich hoffe auf eine schmale Linie statt des breiten, tiefen Risses.«
»Mit etwas Make-up wird sie so gut wie unsichtbar sein«, sagte er. »Ich will Sie nach der Operation gerne an eine Kosmetikerin zur Gesichtscamouflage überweisen.«
»Ich würde lieber ohne Schminke auskommen.«
»Vielleicht kommen wir mit sehr wenig oder ganz ohne aus, aber die Narbe ist tief. Sie wissen vermutlich, dass die Haut aus Schichten besteht, und wir müssen Schicht für Schicht öffnen, um sie wiederherzustellen. Nach der Operation wird die Narbe eine ganze Zeitlang rot und wund aussehen, schlimmer als vorher, bevor sie verheilt. Außerdem müssen wir uns auch um die Auswirkung auf die Nasolabialfalte kümmern, um die leicht herabhängende Lippe und die Stelle oben an der Narbe, wo sie den Augenwinkel herunterzieht. Zum Abschluss muss ich mit einer Fettinjektion alle Unregelmäßigkeiten in den Konturen auffüllen und ausgleichen. Aber wenn Sie am Tag vor der Operation zu mir kommen, zeige ich Ihnen anhand eines Schaubilds in allen Einzelheiten, was ich vorhabe. Die Operation findet unter Vollnarkose statt. Hatten Sie schon einmal eine Narkose?«
»Nein, das ist das erste Mal.«
»Der Anästhesist wird vor der Operation mit Ihnen reden. Ich würde gerne ein paar Tests machen lassen, unter anderem Blutuntersuchungen und ein EKG, aber das machen wir am besten im St. Angela’s. Vor und nach der Operation wird die Narbe fotografiert.«
»Sie sprachen von einer Fettinjektion«, sagte sie. »Was ist das für ein Fett?«
»Ihr eigenes. Wir entnehmen es mit einer Spritze vom Bauch.«
Na klar, dachte sie, dumme Frage.
Er sagte: »Was denken Sie, wann wollen Sie es machen lassen? Ich habe Belegbetten im St. Angela’s, aber Sie können auch ins Cheverell Manor kommen, meine Klinik in Dorset, wenn Sie es vorziehen, nicht in London zu sein. Der früheste Termin, den ich Ihnen anbieten kann, wäre Freitag, der 14. Dezember. Aber dann müssten wir es im Manor machen. Zu der Zeit ist außer Ihnen nur noch eine Patientin dort, denn über Weihnachten schließe ich die Klinik.«
»Ich würde es lieber nicht in London machen lassen.«
»Mrs. Snelling bringt Sie nach der Beratung in unser Büro. Dort bekommen Sie von meiner Sekretärin eine Broschüre über Cheverell Manor. Wie lange Sie bei uns bleiben, ist Ihnen überlassen. Die Fäden ziehen wir voraussichtlich am sechsten Tag, und nur wenige Patienten müssen oder wollen nach der Operation länger als eine Woche bleiben. Wenn Sie sich für das Manor entscheiden, würde ich Ihnen raten, sich einen oder zwei Tage Zeit für einen vorbereitenden Besuch zu nehmen. Es ist mir lieber, wenn sich die Patienten vorher ansehen, wo man sich um sie kümmern wird. Es trägt zur Beruhigung bei, wenn man nicht an einen völlig fremden Ort kommt.«
»Wird die Wunde schmerzhaft sein, nach der Operation, meine ich?«
»Nein, das ist unwahrscheinlich. Es brennt vielleicht ein bisschen, und es wird eine beträchtliche Schwellung geben. Sollten Sie Schmerzen haben, geben wir Ihnen etwas.«
»Bekomme ich einen Kopfverband?«
»Keinen Verband. Eine Kompresse mit Klebeband.«
Es blieb noch eine Frage, und sie scheute sich nicht, sie zu stellen, auch wenn sie meinte, die Antwort schon zu kennen. Sie fragte nicht aus Furcht und hoffte, er würde das verstehen, und wenn nicht, war es auch nicht schlimm. »Ist die Operation gefährlich?«
»Keine Vollnarkose ist ganz ohne Risiko. Die Operation an sich kostet Zeit, ist schwierig und wahrscheinlich nicht ganz unkompliziert. Aber das soll meine Sorge sein, nicht Ihre. Ich würde den Eingriff als chirurgisch nicht gefährlich bezeichnen.«
Sie fragte sich, ob er damit auf andere Gefahren verweisen wollte, vielleicht auf seelische Probleme nach einer so drastischen Veränderung des Aussehens. Damit rechnete sie jedoch nicht. Sie hatte vierunddreißig Jahre lang mit den Auswirkungen der Narbe leben müssen. Da würde sie wohl mit ihrem Verschwinden zurechtkommen.
Er fragte sie noch, ob sie irgendwelche anderen Probleme hatte. Sie verneinte. Er stand auf, und als sie sich die Hand gaben, lächelte er zum ersten Mal. Das Lächeln verwandelte sein Gesicht. »Meine Sekretärin wird Ihnen den Termin für die Tests im St. Angela’s zusenden«, sagte er. »Könnte das ein Problem werden? Sind Sie in den nächsten zwei Wochen in London?«
»Ich bin in London.«
Sie folgte Mrs. Snelling in ein Büro am Ende des Flurs im Erdgeschoss. Dort überreichte ihr eine Frau mittleren Alters eine Broschüre über Cheverell Manor und seine Einrichtungen und informierte sie über die Kosten sowohl des vorbereitenden Besuchs, den Mr. Chandler-Powell für ratsam halte, wie sie erklärte, der allerdings nicht obligatorisch sei, als auch über die höhere Summe für die eigentliche Operation einschließlich einer Woche postoperativen Aufenthalts in der Klinik. Mit hohen Kosten hatte sie gerechnet, aber die Wirklichkeit übertraf ihre Schätzungen. Kein Zweifel, dass sich in diesen Zahlen neben medizinischem auch gesellschaftliches Prestige spiegelte. Sie meinte sich an die Worte einer Dame zu erinnern: »Aber natürlich, ich gehe nur ins Manor.« Als symbolisiere der Landsitz den Zugang zu einem Zirkel privilegierter Patienten. Sie wusste, dass sie die Operation auch von der Krankenkasse hätte bezahlen lassen können, aber für nicht dringende Fälle gab es eine Warteliste, außerdem legte sie Wert auf Vertraulichkeit. Vertraulichkeit und geringe Wartezeit waren allenthalben zu einem kostspieligen Luxus geworden.
Nur dreißig Minuten nach ihrem Eintreffen wurde sie wieder verabschiedet. Sie hatte noch eine Stunde Zeit bis zu ihrer Verabredung im Ivy. Sie würde zu Fuß gehen.
4
In einem beliebten Restaurant wie dem Ivy durfte man nicht auf Anonymität hoffen, aber so wichtig ihr gesellschaftliche Diskretion auf allen anderen Gebieten war, im Zusammenhang mit Robin machte sie sich darum keine Gedanken. In einer Zeit, in der es für einen schlechten Ruf immer skandalöserer Indiskretionen bedurfte, hätte nicht einmal das trostloseste Klatschblatt der Enthüllung, dass die bekannte Journalistin Rhoda Gradwyn mit einem zwanzig Jahre jüngeren Mann zu Mittag aß, auch nur einen Absatz gewidmet. Sie hatte sich an ihn gewöhnt; er amüsierte sie. Er öffnete ihr die Bereiche des Lebens, in denen sie – wenn auch nur indirekt – Erfahrungen sammeln wollte. Und er tat ihr leid. Das war nicht gerade eine Basis für Vertraulichkeiten, und was sie anging, gab es auch keine. Er beichtete, sie hörte zu. Aber eine gewisse Befriedigung musste ihr die Beziehung wohl doch verschaffen, wie hätte sie sich sonst erklären sollen, dass sie immer noch bereit war, ihm Zugang zu einem der Sperrgebiete ihres Lebens zu gewähren? Wenn sie über diese Freundschaft nachdachte, was selten genug vorkam, erschien sie ihr wie eine Gewohnheit, die keine größeren Investitionen erforderte als ein gelegentliches Mittag- oder Abendessen auf ihre Kosten, und mit ihr Schluss zu machen würde wahrscheinlich mehr Zeit und Mühe kosten, als sie fortzusetzen.
Wie immer erwartete er sie an seinem Lieblingstisch bei der Tür, den sie vorbestellt hatte, und als sie hereinkam, hatte sie Gelegenheit, ihn noch kurz beim Studium der Speisekarte zu beobachten, ehe er aufblickte und sie bemerkte. Sie war – jedes Mal wieder – von seiner Schönheit beeindruckt. Er selbst schien sich ihrer gar nicht bewusst zu sein, auch wenn es schwerfiel zu glauben, dass ein so durch und durch solipsistischer Mensch nicht erkannte, mit welchem Kapital Schicksal und Gene ihn beschenkt hatten, und es nicht zu seinem Vorteil zu nutzen versuchte. Bis zu einem gewissen Grade tat er es ja, aber offenbar ohne großes Engagement. Es fiel ihr immer wieder schwer, zu glauben, was die Erfahrung sie lehrte, nämlich dass Männer oder Frauen von physischer Vollkommenheit sein konnten, ohne über vergleichbare Qualitäten der Seele und des Geistes zu verfügen, dass Schönheit an gewöhnliche, ungebildete oder dumme Menschen verschwendet sein konnte.
Sie vermutete, dass Robin Boyton den Platz auf der Schauspielschule, sein erstes Engagement, seinen kurzen Auftritt in einer vielversprechenden, aber nach drei Folgen wieder abgesetzten Fernsehserie seinem Aussehen zu verdanken gehabt hatte. Nichts war von Dauer gewesen. Selbst der geduldigste oder nachgiebigste Produzent oder Regisseur hatte irgendwann die Nase voll von nicht gelernten Texten und ständigen Abwesenheiten bei Proben. Nach seinem Scheitern als Schauspieler hatte er eine Reihe von anderen fantasievollen Projekten verfolgt, von denen einige vielleicht sogar erfolgreich gewesen wären, hätte seine Begeisterung nur länger als sechs Monate vorgehalten. Sie hatte seinen Überredungskünsten widerstanden und in keines dieser Projekte investiert, und er hatte ihre Weigerung ohne Groll akzeptiert. Aber keine ihrer Absagen hatte ihn davon abhalten können, es wieder zu versuchen.
Er stand auf, als sie auf den Tisch zuging, und während er ihre Hand hielt, küsste er sie schicklich auf die Wange. Die Flasche Meursault im Weinkühler, die nachher auf ihrer Rechnung stehen würde, war bereits zu einem Drittel geleert.
»Wie schön, dich zu sehen, Rhoda«, sagte er. »Wie ist es dir mit Big George ergangen?«
Sie benutzten keine Kosenamen. Einmal hatte er sie Liebling genannt, sich aber kein zweites Mal getraut. »Big George?«, fragte sie. »So wird Chandler-Powell in Cheverell Manor genannt?«
»Nicht in seiner Gegenwart. Du wirkst ausgesprochen ruhig nach dem Martyrium, aber das kenne ich ja nicht anders von dir. Wie war es denn? Ich sitze hier außer mir vor Sorge.«
»Wie soll es schon gewesen sein? Er hat mich empfangen. Sich mein Gesicht angesehen. Wir haben einen Termin vereinbart.«
»Hat er denn keinen Eindruck auf dich gemacht? Da wärst du die Erste.«
»Sein Auftreten ist beeindruckend. Für eine Beurteilung seines Charakters fehlte die Zeit. Er wirkte kompetent. Hast du schon bestellt?«
»Als hätte ich das je getan, bevor du hier warst? Aber ich habe mir ein geniales Menü für uns beide ausgedacht. Ich weiß, was dir schmeckt. Auch beim Wein hatte ich mehr Fantasie als sonst.«
Beim Studium der Weinkarte sah sie, wie viel Fantasie er auch beim Preis an den Tag gelegt hatte.
Sie hatten kaum mit dem ersten Gang begonnen, als er die Katze aus dem Sack ließ. »Ich brauche etwas Kapital. Nicht viel, nur ein paar tausend. Es ist eine erstklassige Investition, geringes Risiko – im Grunde null Risiko bei garantierter Rendite. Jeremy schätzt sie auf zehn Prozent jährlich. Ich hab mir gedacht, es könnte dich interessieren.«
Er bezeichnete Jeremy Coxon als seinen Geschäftspartner. Rhoda fragte sich, ob er vielleicht mehr als das war. Sie war ihm nur einmal begegnet und hatte ihn als redseligen, aber harmlosen Menschen nicht ohne Verstand erlebt. Wenn er einen Einfluss auf Robin hatte, konnte das nur zum Guten sein.
»An risikolosen Investitionen mit einer garantierten Rendite von zehn Prozent bin ich immer interessiert«, sagte sie. »Mich wundert bloß, dass man dir nicht die Türen einrennt. Was ist das für ein Deal, den du da mit Jeremy ausgeheckt hast?«
»Derselbe, von dem ich dir schon bei unserem Lunch im September erzählt habe. Na ja, in der Zwischenzeit haben die Dinge sich entwickelt, aber an die Grundidee kannst du dich vielleicht erinnern. Eigentlich ist sie von mir, nicht von Jeremy, aber wir haben sie zusammen ausgearbeitet.«
»Du hast mal was von einer Schule für Umgangsformen erzählt, die du mit Jeremy für gesellschaftlich unbeleckte Neureiche einrichten wolltest. Irgendwie sehe ich dich nicht als Lehrer – schon gar nicht als Experten für Umgangsformen.«
»Ich lerne es aus Büchern. Es ist verblüffend einfach. Und der Experte ist Jeremy, der hat da keine Probleme.«
»Und warum bringen deine gesellschaftlich Unbeleckten es sich nicht selber aus Büchern bei?«
»Das könnten sie zwar, aber es geht ihnen um den zwischenmenschlichen Touch. Wir impfen ihnen Selbstvertrauen ein. Und sie bezahlen uns dafür. Wir haben da eine echte Marktlücke aufgetan, Rhoda. Viele junge Leute – also, vor allem junge Männer, und nicht nur reiche – sind verunsichert, weil sie nicht wissen, was sie zu welchen Gelegenheiten tragen sollen, was sie tun müssen, wenn sie zum ersten Mal ein Mädchen in ein feines Restaurant ausführen. Sie wissen nicht, wie sie sich in Gesellschaft verhalten müssen, wie sie Eindruck auf ihren Chef machen können. Jeremy hat ein Haus in Maida Vale, das er mit seinem Erbe einer reichen Tante gekauft hat, und das nehmen wir fürs Erste. Natürlich müssen wir diskret vorgehen. Jeremy weiß nicht, ob er das Haus für gewerbliche Zwecke nutzen darf. Wir leben in Angst vor den Nachbarn. Im Erdgeschoss haben wir ein Zimmer wie ein Restaurant eingerichtet, dort machen wir Rollenspiele. Erst wenn unsere Klienten das nötige Selbstvertrauen haben, gehen wir mit ihnen in ein richtiges Restaurant. Nicht in solche wie dieses, in andere, auch keine ganz billigen, die uns Sonderpreise einräumen. Natürlich auf Rechnung der Klienten. Die Sache läuft nicht schlecht, das Unternehmen gedeiht, aber wir brauchen ein anderes Haus oder zumindest eine Wohnung. Langsam stinkt es Jeremy, auf sein Erdgeschoss praktisch verzichten zu müssen, und dass diese seltsamen Typen auch noch auftauchen, wenn er Freunde eingeladen hat. Und dann ist da noch das Büro, das er in einem seiner Schlafzimmer eingerichtet hat. Er bekommt drei Viertel des Profits, wegen dem Haus, aber ich merke ihm an, dass er langsam mal meinen Anteil sehen will. Und meine Wohnung eignet sich beim besten Willen nicht. Du weißt ja, wie es da aussieht, nicht gerade das ideale Ambiente für unsere Zwecke. Und wer weiß, wie lange ich da noch bin. Der Hauswirt wird langsam ungemütlich wegen der Miete. Wenn wir erst eine neue Adresse haben, geht es auch voran. Na, was meinst du, Rhoda? Interessiert?«
»Interessiert, davon zu erfahren. Nicht interessiert, Geld in die Sache zu stecken. Aber vielleicht funktioniert es. Hört sich vernünftiger an als deine bisherigen Passionen. Ich wünsch dir jedenfalls viel Glück.«
»Also ist die Antwort nein.«
»Die Antwort ist nein.« Spontan fügte sie hinzu: »Da musst du schon auf mein Testament warten. Karitative Anwandlungen lebe ich lieber erst nach meinem Tode aus. Man trennt sich leichter von seinem Geld, wenn man selber nichts mehr damit anfangen kann.«
In ihrem Testament war er mit zwanzigtausend Pfund bedacht, nicht genug für die Finanzierung exzentrischer Hirngespinste, aber immerhin eine gewisse Garantie, dass die Erleichterung, überhaupt etwas vererbt zu bekommen, die Enttäuschung über die Summe überdauert. Es machte ihr Spaß, sein Gesicht zu betrachten. Mit einer leisen Reue, der Scham zu ähnlich, um angenehm zu sein, registrierte sie, dass sie sich an diesem ersten, maliziös von ihr hervorgerufenen Aufblitzen freudiger Überraschung, der Gier in seinen Augen und dem raschen Zurücksinken in realistisches Denken weidete. Weshalb musste sie sich immer wieder bestätigen, was sie ohnehin über ihn wusste?
Er sagte: »Du hast dich natürlich für Cheverell Manor entschieden, und gegen seine Belegbetten im St. Angela’s.«
»Ich will lieber fort von London, da sind die Aussichten besser, in Ruhe gelassen zu werden. Am 27. fahre ich für zwei Tage zur Vorbereitung hin. Anscheinend ein Angebot. Es ist ihm lieb, wenn die Patienten den Ort schon kennen, bevor er operiert.«
»Das Geld ist ihm auch lieb.«
»Dir etwa nicht, Robin? Du musst gerade reden.«
Mit dem Blick auf seinen Teller antwortete er: »Ich würde dich gerne im Manor besuchen, wenn du dort bist. Ein bisschen Zerstreuung wird dir nicht schaden. Es gibt nichts Langweiligeres als die Genesung.«
»Nein, Robin, auf ein bisschen Zerstreuung kann ich bestens verzichten. Die Leute dort werden hoffentlich dafür sorgen, dass ich ungestört bleibe. Schließlich ist das Sinn und Zweck der Einrichtung.«
»Du bist ganz schön undankbar, wenn man bedenkt, dass Cheverell Manor meine Empfehlung war. Würdest du dort hingehen, wenn ich nicht wäre?«
»Da du kein Arzt bist und noch nie eine kosmetische Operation hattest, wüsste ich nicht, was eine Empfehlung von dir wert sein sollte. Du hast das Manor mal nebenbei erwähnt, mehr nicht. Ich hatte schon vorher von George Chandler-Powell gehört. Ist ja auch kein Wunder, schließlich ist er einer der besten Chirurgen Englands, wenn nicht Europas, und die Schönheitschirurgie ist inzwischen genauso populär wie Schönheitsfarmen. Ich habe ihn mir ausgesucht, seine Leistungen verglichen, mir fachmännischen Rat geholt und mich für ihn entschieden. Du hast mir übrigens nie erzählt, welche Verbindungen du zum Cheverell Manor hast. Vielleicht sollte ich das wissen, damit ich nicht mal beiläufig deinen Namen erwähne und dann in eisige Gesichter schaue und womöglich noch das schlechteste Zimmer bekomme.«
»Das könnte allerdings passieren. Ich bin nicht gerade ihr Lieblingsgast. Im Manor lass ich mich gar nicht erst blicken – das würde für beide Seiten zu weit gehen. Sie haben ein Besucherhaus, Rose Cottage, dort miete ich mich ein. Ich muss sogar dafür zahlen, was eigentlich eine Frechheit ist. Sie schicken mir nicht einmal etwas zu essen herüber. Im Sommer ist oft alles besetzt, aber im Dezember können sie schlecht behaupten, dass sie nichts frei haben.«
»Du bist eine Art Verwandter, hast du mal gesagt.«
»Nicht von Chandler-Powell. Sein chirurgischer Assistent, Marcus Westhall, ist mein Cousin. Er assistiert bei den Operationen und betreut die Patienten, wenn Big George in London ist. Marcus wohnt zusammen mit seiner Schwester Candace in dem anderen Cottage. Candace hat nichts mit den Patienten zu tun; sie hilft im Büro. Ich bin ihr einziger lebender Verwandter. Man sollte meinen, dass ihnen das etwas bedeutet.«
»Und? Tut es das?«
»Wenn es dich nicht langweilt, erzähle ich dir von meiner Familie. Es ist eine lange Geschichte. Ich mache es so kurz wie möglich. Natürlich geht es um Geld.«
»Wie immer.«
»Es ist auch eine traurige Geschichte von einem armen Waisenjungen, der ohne einen Penny in die Welt gestoßen wird. Tut mir leid, wenn ich sie dir jetzt auf die Seele laden muss. Es wäre ein Jammer, wenn dir salzige Tränen auf deinen köstlichen gefüllten Taschenkrebs fallen würden.«
»Das Risiko gehe ich ein. Es kann nicht schaden, etwas über den Ort zu wissen, bevor ich dort hinfahre.«
»Ich hab mich schon gefragt, was hinter dieser Essenseinladung heute stecken könnte. Wenn du gut vorbereitet hinfahren willst, bist du bei mir richtig. Die Kosten für ein gutes Essen wiegt es allemal auf.«
Er sagte das ganz ohne Groll, dafür mit einem amüsierten Lächeln. Sie musste sich daran erinnern, dass es nicht klug war, ihn zu unterschätzen. Er hatte vorher noch nie über seine Familiengeschichte oder seine Vergangenheit gesprochen. Für jemanden, der so bereitwillig Auskunft über alle Einzelheiten seines Alltags gab und von den kleinen Siegen und den wesentlich zahlreicheren Fehlschlägen in Liebesdingen und Geschäftsangelegenheiten meistens voller Humor erzählte, hatte er sich über seine Vorgeschichte bemerkenswert bedeckt gehalten. Rhoda vermutete, dass er eine sehr traurige Kindheit gehabt haben könnte und dass dieses frühe Trauma, von dem sich niemand vollständig erholt, die Wurzel seiner Unsicherheit war. Da es ihr selber fern lag, auf vertrauliche Mitteilungen mit ähnlicher Offenheit zu antworten, war sie auch nicht in ihn gedrungen. Aber es konnte tatsächlich nützlich sein, gewisse Dinge über Cheverell Manor im Voraus zu wissen. Sie würde als Patientin dorthin kommen, was nichts anderes bedeutete, als dass sie dort verletzlich sein und sich in einer gewissen physischen und seelischen Abhängigkeit befinden würde. Völlig uninformiert anzureisen, würde sie gleich ins Hintertreffen bringen.
»Erzähl mir von deinen Verwandten«, sagte sie.
»Sie sind gut gestellt, verglichen mit meinem Standard, und werden bald, nach jedermanns Standard, steinreich sein. Ihr Vater, mein Onkel Peregrine, ist vor neun Monaten gestorben und hat ihnen um die acht Millionen Pfund hinterlassen. Er hat sie von seinem Vater Theodore geerbt, der nur wenige Wochen vor ihm gestorben ist und der das Familienvermögen verdient hat. Von T.R. Westhalls Lateinfibel oder Neugriechisch, Erste Schritte oder so ähnlich, hast du vielleicht schon gehört. Ich selber hab sie nie in der Hand gehabt, weil ich nicht auf solchen Schulen war. Aber wenn Schulbücher zum Standard werden, geadelt durch langen Gebrauch, verdient man einen Haufen Geld damit. Sie werden immer wieder aufgelegt. Und mit Geld konnte der Alte umgehen. Er hatte das Talent, es zu vermehren.«
Rhoda antwortete: »Es erstaunt mich, dass es für deine Cousins so viel zu erben gibt. Zwei Todesfälle so kurz hintereinander, Vater und Großvater, da müssen die Forderungen des Finanzamts doch horrend gewesen sein.«
»Da hatte Großpapa Theodore vorgesorgt. Ich sag ja, mit Geld kannte er sich aus. Er hat eine Art Versicherung abgezweigt, bevor die Geschichte mit seiner letzten Krankheit anfing. Auf jeden Fall ist das Geld da. Sobald das Testament rechtskräftig ist, gehört es ihnen.«
»Und du hättest gerne einen Teil davon.«
»Offen gesagt finde ich, mir würde ein Teil davon zustehen. Theodore Westhall hatte zwei Kinder, Peregrine und Sophie. Sophie war meine Mutter. Ihre Eheschließung mit Keith Boyton stieß bei ihrem Vater auf wenig Verständnis. Ich glaube, er hat sogar versucht, sie zu unterbinden. Er hielt Keith für einen faulen, nichtsnutzigen Goldgräber, der nur hinter dem Geld der Familie her war, und wenn ich ehrlich bin, lag er damit nicht ganz falsch. Meine arme Mami ist gestorben, als ich sieben war. Ich wurde von meinem Vater großgezogen – mitgeschleppt ist das passendere Wort. Irgendwann hat er es aufgegeben und mich in Dotheboys Hall, dieses sogenannte Internat, gesteckt. Seit Dickens hat sich vielleicht ein bisschen was verbessert, aber nicht wesentlich. Das Schulgeld übernahm ein Wohlfahrtsverein, viel war’s eh nicht. Das war keine Schule für einen hübschen Knaben wie mich, schon gar nicht für einen, der das Schild Fürsorgekind um den Hals baumeln hatte.«
Er griff nach seinem Weinglas, als wäre es eine Handgranate, seine Knöchel waren weiß. Rhoda fürchtete schon, es könnte ihm in der Hand zerspringen, aber er lockerte den Griff, lächelte sie an und hob das Glas an die Lippen. »Seit Mamis Heirat waren die Boytons die Aussätzigen der Familie«, sagte er. »Die Westhalls vergessen und vergeben nichts.«
»Wo ist dein Vater jetzt?«
»Ehrlich gesagt habe ich nicht die leiseste Ahnung, Rhoda. Als ich mein Stipendium für die Schauspielschule bekam, war er gerade nach Australien ausgewandert. Seitdem haben wir keinen Kontakt mehr gehabt. Vielleicht ist er wieder verheiratet, oder er ist tot oder beides. Wir standen uns nicht besonders nahe. Er hat uns nicht einmal Geld geschickt. Die arme Mami musste Schreibmaschine lernen, um in einem Sekretärinnenpool ein schmales Einkommen zu verdienen. Seltsamer Ausdruck, Sekretärinnenpool. So etwas gibt es glaube ich gar nicht mehr. Und Mamis Firma war ein besonders schlimmer Sauladen.«
»Hast du nicht mal gesagt, du bist Waise?«
»Bin ich das denn nicht? Und wenn mein Vater nicht tot ist, er ist jedenfalls nicht mehr da. Nicht einmal eine Postkarte in acht Jahren. Wenn er nicht tot ist, ist er alt. Er war fünfzehn Jahre älter als meine Mutter, er muss weit über sechzig sein.«
»Es ist also nicht damit zu rechnen, dass er plötzlich auftaucht und ein Teil vom Erbe beansprucht.«
»Und wenn er es täte, würde er nichts kriegen. Ich habe das Testament nicht gesehen, aber als ich beim Familiennotar angerufen habe – nur interessehalber versteht sich –, wollte er nicht mit einer Kopie rausrücken. Er schickt mir eine, sobald das Testament rechtskräftig ist, hat er gesagt. Aber ich glaube nicht, dass ich mich da reinhänge. Bevor die Westhalls einem Boyton etwas geben, spenden sie ihr Geld lieber einem Katzenasyl. Mein Anspruch gründet sich auf Fairness, nicht auf das Gesetz. Ich bin ihr Cousin. Ich habe den Kontakt aufrechterhalten. Sie haben mehr Geld, als sie ausgeben können, und sind stinkreich, wenn das Testament vollstreckt ist. Ein bisschen Großzügigkeit würde ihnen nicht weh tun. Deshalb fahre ich hin. Damit sie nicht vergessen, dass es mich gibt. Onkel Peregrine hat Großvater um ganze fünfunddreißig Tage überlebt. Ich möchte wetten, der alte Theodore hat nur so lange durchgehalten, weil er seinen Sohn überleben wollte. Ich weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn Onkel Peregrine als Erster gestorben wäre, aber wenn es juristisch noch so kompliziert geworden wäre, ich hätte doch keinen müden Penny gesehen.«
»Trotzdem müssen deine Cousins sich Sorgen gemacht haben. Es gibt eine Klausel, die für alle Testamente gilt: Wenn der Vermächtnisnehmer den Tod des Erblassers nicht um achtundzwanzig Tage überlebt, ist er nicht erbberechtigt. Sie werden sich größte Mühe gegeben haben, ihren Vater am Leben zu erhalten – falls er die entscheidenden achtundzwanzig Tage überhaupt überlebt hat. Vielleicht haben sie ihn auch in eine Gefriertruhe gesteckt und am Stichtag hübsch und frisch wieder vorgezeigt. Diese Geschichte gibt es in einem Kriminalroman von Cyril Hare. Ich glaube, das Buch heißt Der Tote von Exmoor, kann auch sein, dass es ursprünglich unter einem anderen Titel veröffentlicht war. An viel kann ich mich nicht erinnern. Ich hab es vor Jahren mal gelesen. Er war ein eleganter Autor.«
Er schwieg und schenkte Wein ein, mit den Gedanken ganz woanders.
Mein Gott, nimmt er diesen Unsinn tatsächlich für bare Münze, dachte sie belustigt und auch ein bisschen besorgt. Wenn er der Sache allen Ernstes nachging, würde eine solche Beschuldigung unweigerlich zum endgültigen Zerwürfnis mit Cousin und Cousine führen. Nichts dürfte ihm die Türen zum Rose Cottage und dem Cheverell Manor endgültiger verschließen als der Vorwurf des Testamentsbetrugs. Der Roman war ihr spontan in den Sinn gekommen, und sie hatte drauflos geplappert, ohne nachzudenken. Dass er ihre Worte jetzt ernst zu nehmen schien war absurd.
Wie um den Gedanken abzuschütteln, sagte er: »Das ist natürlich abwegig.«
»Natürlich. Was stellst du dir vor, dass Candace und Marcus Westhall im Krankenhaus auftauchen, wenn ihr Vater schon im Sterben liegt, ihn mit nach Hause nehmen und in eine Gefriertruhe stecken, sobald er gestorben ist, um ihn acht Tage später wieder aufzutauen?«
»Dazu hätten sie nicht ins Krankenhaus gehen müssen. Candace hat ihn während der letzten zwei Jahre bei sich zu Hause gepflegt. Die beiden alten Männer, Großvater Theodore und Onkel Peregrine, lagen im selben Pflegeheim in der Nähe von Bournemouth, doch als das zu einer immer größeren Zumutung für das Pflegepersonal wurde, bestand die Leitung darauf, dass einer von beiden das Heim verließ. Peregrine verlangte von Candace, dass sie ihn zu sich nahm. Dort ist er bis zuletzt geblieben, nur ein tatteriger alter Hausarzt hat hin und wieder nach ihm gesehen. Ich habe ihn während der letzten zwei Jahre gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Er ließ keine Besucher zu sich. Es wäre also möglich gewesen.«
»Ach, Unsinn«, sagte sie. »Erzähl mir von den anderen Leuten im Manor. Zumindest von denen, auf die es ankommt. Wen werde ich dort kennenlernen?«
»Also, zuerst natürlich Big George persönlich. Und dann die Bienenkönigin des Pflegepersonals, Oberschwester Flavia Holland – sehr sexy, wenn man auf Schwesterntracht steht. Mit den anderen Pflegern will ich dich nicht langweilen. Die meisten kommen morgens mit dem Auto aus Wareham, Bournemouth oder Poole. Der Anästhesist hat früher als Kassenarzt gearbeitet und von der Gesundheitsbehörde genommen, was er kriegen konnte. Später hat er sich in ein gemütliches kleines Cottage an der Küste bei Purbeck zurückgezogen. Die Halbtagsstelle im Manor ist der ideale Job für ihn. Interessanter ist Helena Haverland, geborene Cressett. Sie nennt sich Verwalterin, und das bezeichnet so ziemlich alles, von der Haushaltsleitung bis zur Kontrolle der Geschäftsbücher. Sie kam nach ihrer Scheidung vor sechs Jahren ins Manor. Das Interessante an Helena ist ihr Name. George hat das Manor nach dem Debakel bei Lloyd’s von ihrem Vater, Sir Nicholas Cressett, gekauft. Er war im falschen Syndikat und hat alles verloren. Als George den Job des Hauptverwalters ausschrieb, hat Helena sich beworben und wurde eingestellt. Ein Mann mit mehr Fingerspitzengefühl als George hätte sie nicht genommen. Aber sie kannte das Haus genauestens, und soviel ich gehört habe, hat sie sich unentbehrlich gemacht, und das war klug von ihr. Sie kann mich nicht ausstehen.«
»Wie unvernünftig.«
»So sehe ich das auch. Aber im Grunde kann sie niemanden ausstehen. Da dürfte ein gewisser Familiendünkel im Spiel sein. Immerhin hat das Landgut den Cressetts fast vierhundert Jahre gehört. Ach, und die beiden Köche sollte ich noch erwähnen, Dean und Kim Bostock. George scheint das Ehepaar von einem richtig guten Laden abgeworben zu haben. Das Essen soll ausgezeichnet sein. Ich bin leider nie eingeladen worden, es zu probieren. Dann ist da noch Mrs. Frensham, Helenas alte Gouvernante, die für das Büro zuständig ist. Sie ist die Witwe eines Priesters der Church of England, und genau so sieht sie auch aus, eine Art wandelndes Gewissen, das dich an deine Sünden erinnert. Und es gibt noch dieses seltsame Mädchen, das sie wer weiß wo aufgegabelt haben, Sharon Bateman, eine Art Faktotum, die alle möglichen Arbeiten in der Küche und für Miss Cressett erledigt. Sie latscht überall herum und trägt Tabletts durch die Gegend. Das wären in etwa die, die du kennen musst.«
»Woher weißt du das alles, Robin?«
»Ich halte Augen und Ohren offen, wenn ich mit den Dorfleuten im Cressett Arms Bier trinke. Außer mir macht das keiner. Und die sind auch nicht gerade gesprächig gegenüber Fremden. Entgegen der allgemeinen Auffassung. Aber ich habe auch für Nebensächlichkeiten und Untertöne ein Ohr. Im siebzehnten Jahrhundert hatten die Cressetts einen höllischen Streit mit dem Gemeindepfarrer und sind danach nicht mehr in die Kirche gegangen. Das Dorf ergriff damals Partei für den Pfarrer, und der Zwist zog sich durch die Jahrhunderte, wie das eben so ist. Chandler-Powell hat nichts getan, um ihn beizulegen. Weil er ihm gerade recht kommt. Die Patienten wollen dort ungestört sein, es legt bestimmt keiner Wert darauf, dass man sich im Dorf das Maul über ihn zerreißt. Ein paar Frauen aus dem Dorf gehören zur Putzkolonne in der Klinik, aber die meisten anderen Angestellten kommen von weiter weg. Ach, beinahe hätte ich den alten Mog vergessen – Mr. Mogworthy. Er hat für die Cressetts als Gärtner und Mädchen für alles gearbeitet, und George hat ihn übernommen. Er ist ein Quell an Informationen, man muss nur wissen, wie man sie ihm entlockt.«
»Unglaublich.«
»Was?«
»Der Name. Der muss erfunden sein. Kein Mensch heißt Mogworthy.«
»Er schon. Es hat mal einen Pfarrer mit dem Namen gegeben, sagt er, in der Holy Trinity Church in Bradpole, Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Mogworthy behauptet, von ihm abzustammen.«
»Das ist schwer möglich. Wenn der erste Mogworthy ein Priester war, dann ja wohl ein römisch-katholischer, der im Zölibat leben musste.«
»Gut, dann eben von derselben Familie. Jedenfalls gibt es ihn. Er hat in dem Cottage gewohnt, das jetzt Marcus und Candace bewohnen, aber George wollte das Cottage für sich und hat ihm gekündigt. Er lebt jetzt bei seiner alten Schwester im Dorf. Ja, Mog ist ein Quell an Informationen. Dorset ist voll von Legenden, eine schrecklicher als die andere, und Mog kennt sie alle. Dabei ist er gar nicht in der Grafschaft geboren. Alle seine Vorfahren haben dort gelebt, aber Mogs Vater ist vor seiner Geburt nach Lambeth gezogen. Du musst ihn nach den Cheverell-Steinen fragen.«
»Hab noch nie davon gehört.«
»Oh, das wird sich ändern, wenn Mog in der Nähe ist. Du kannst eigentlich gar nicht dran vorbeilaufen. Es ist ein Steinkreis aus der Jungsteinzeit auf einem Feld direkt beim Manor. Und dazu gibt es eine schaurige Geschichte.«
»Erzähl.«
»Nein, das überlasse ich Mog oder Sharon. Mog behauptet, dass sie von den Steinen besessen ist.«
Der Kellner servierte den Hauptgang, und Robin hörte auf zu reden. Mit beifälliger Zufriedenheit betrachtete er die Speisen auf dem Teller. Er hatte das Interesse an Cheverell Manor verloren. Ihr Gespräch wurde oberflächlich, offensichtlich war er mit den Gedanken woanders. Erst beim Kaffee richtete sein Blick sich wieder auf sie, und sie war aufs Neue fasziniert von der Tiefe und Klarheit seiner Augen, ihrem beinahe übernatürlichen Blau. Die durchdringende Kraft seines Blicks war verstörend. Er streckte ihr die Hand über den Tisch entgegen und sagte: »Rhoda, komm mit zu mir. Jetzt gleich. Ich bitte dich darum. Es ist wichtig. Wir müssen reden.«
»Haben wir doch schon.«
»Über dich und über das Manor. Nicht über uns.«
»Wartet Jeremy denn nicht auf dich? Müsstest du deinen Klienten nicht beibringen, wie sie auf renitente Kellner und korkigen Wein zu reagieren haben?«
»Die Leute, denen ich das beibringe, kommen in der Regel abends. Bitte, Rhoda.«
Sie beugte sich zu ihrer Handtasche hinüber. »Tut mir leid, Robin, aber es geht nicht. Ich habe noch eine Menge zu erledigen, bis ich in die Klinik gehe.«
»Natürlich geht es. Warum sollte es nicht gehen? Du willst bloß nicht.«
»Es würde gehen, aber heute passt es mir nicht. Lass uns nach der Operation reden.«
»Dann ist es vielleicht zu spät.«
»Zu spät für was?«
»Für vieles. Merkst du denn nicht, dass ich Angst habe, dass du mir den Laufpass gibst? Du stehst vor einer großen Veränderung. Vielleicht denkst du darüber nach, mehr als nur eine Narbe loszuwerden.«
Zum ersten Mal in den sechs Jahren ihrer Beziehung war dieses Wort zwischen ihnen gefallen. Ein Tabu, dessen sie sich gar nicht bewusst gewesen waren, war gebrochen. Da die Rechnung gezahlt war, erhob sie sich, bemüht, den Zorn in ihrer Stimme nicht durchklingen zu lassen. Ohne ihn anzusehen, sagte sie: »Es tut mir leid, Robin. Lass uns nach der Operation reden. Ich fahre mit dem Taxi in die Stadt zurück. Soll ich dich irgendwo rauswerfen?« Das machten sie oft so. Er fuhr nicht gerne U-Bahn.
Der Ausdruck war unglücklich gewählt, sie merkte es ihm an. Ohne eine Antwort zu geben, schüttelte er den Kopf und folgte ihr schweigend zur Tür. Bevor sie draußen in unterschiedliche Richtungen auseinandergingen, sagte er plötzlich: »Wenn ich mich von jemandem verabschiede, hab ich jedes Mal Angst, ich könnte ihn vielleicht nie wiedersehen. Ich habe meiner Mutter immer vom Fenster aus nachgeschaut, wenn sie zur Arbeit ging. Ich hatte schreckliche Angst, sie könnte nicht mehr wiederkommen. Kennst du das Gefühl?«
»Nur wenn ich mich von jemandem trenne, der über neunzig ist oder an einer unheilbaren Krankheit leidet. Beides trifft auf mich nicht zu.«
Nachdem sie sich getrennt hatten, blieb sie zum ersten Mal stehen und schaute seiner sich entfernenden Gestalt nach, bis sie verschwunden war. Sie fürchtete sich nicht vor der Operation, war frei von allen Todesahnungen. Mr. Chandler-Powell hatte gesagt, bei einer Vollnarkose gebe es immer ein Restrisiko, das bei Spezialisten aber zu vernachlässigen sei. Doch als er außer Sicht war und sie sich wieder umdrehte, spürte sie Robins irrationale Angst einen Moment lang am eigenen Leib.
5
Am Dienstag, dem 27. November, war Rhoda Gradwyn um zwei Uhr nachmittags bereit für die Abfahrt zu ihrem ersten Besuch im Cheverell Manor. Ausstehende Arbeiten waren wie immer rechtzeitig fertig geworden und geliefert. Sie konnte das Haus nicht einmal für eine Nacht verlassen, ohne gründlich geputzt, aufgeräumt, die Papierkörbe geleert, sämtliche Unterlagen in ihrem Arbeitszimmer eingeschlossen und ein letztes Mal alle Innentüren und Fenster überprüft zu haben. Was sie ein Zuhause nannte, musste tadellos in Ordnung sein, bevor sie es verließ, als wäre diese Pedanterie eine Garantie für eine wohlbehaltene Rückkehr.
Mit der Broschüre über das Manor hatte sie auch eine Wegbeschreibung für die Fahrt nach Dorset bekommen, aber wie jedes Mal, wenn sie eine unbekannte Strecke fuhr, schrieb sie die einzelnen Etappen auf eine Karte und heftete sie ans Armaturenbrett. Am Vormittag hatte manchmal die Sonne geschienen, aber sie war – trotz des späten Aufbruchs – nur langsam aus London herausgekommen, und als sie fast zwei Stunden später vom M3 auf die Ringwood Road abbog, setzte bereits die Dämmerung ein und brachte einen heftigen Regenschauer mit, der sich binnen Sekunden in einen Wolkenbruch verwandelte. Die Scheibenwischer rackerten sich ab wie lebende Wesen, aber gegen diese Fluten waren sie machtlos. Vor sich erkannte sie nur noch die Lichtkegel ihrer Scheinwerfer auf dem gerippten Wasser, das im Nu zu einem kleinen Fluss anschwoll. Es begegneten ihr nur wenige Autos. Jeglicher Versuch weiterzufahren war sinnlos, und sie spähte durch die Regenwand nach einem Seitenstreifen, der festen Stand bot. Nach einer Minute rollte sie vorsichtig auf einem mit Gras bewachsenen Bankett vor einem schweren Bauernhoftor aus. Hier drohte zumindest kein versteckter Graben oder tückisches Schlammloch. Sie stellte den Motor ab und lauschte dem Regen, der wie ein Kugelhagel auf das Dach prasselte. Unter diesem Ansturm herrschte im Inneren des BMW metallische Grabesstille, die das Getöse draußen noch lauter erscheinen ließ. Sie wusste, dass hinter den gestutzten unsichtbaren Hecken eine der schönsten Landschaften Englands lag, aber jetzt fühlte sie sich gefangen in einer unermesslichen, potenziell feindseligen Weite. Das Mobiltelefon hatte sie abgeschaltet – wie immer mit Erleichterung. Kein Mensch wusste, wo sie war, niemand konnte sie erreichen. Es kamen keine Autos mehr vorbei, und wenn sie durch die Windschutzscheibe spähte, sah sie nur die Wand aus Wasser und die zitternden Lichtpunkte entfernter Häuser dahinter. Normalerweise schätzte sie die Stille und war in der Lage, ihre Fantasie zu zügeln. Der anstehenden Operation sah sie zuversichtlich entgegen, auch wenn es durchaus vernünftige Gründe dafür gab, nervös zu sein; eine Vollnarkose war nicht ohne Risiken. Doch die Beklommenheit, die sie jetzt spürte, ging tiefer als die Sorge über diesen vorbereitenden Besuch oder die Operation. Es war ein unangenehmes, irrationales Gefühl, als würde eine bisher unbekannte oder aus ihrem Bewusstsein verdrängte Realität sich langsam bemerkbar machen und darauf bestehen, wahrgenommen zu werden.