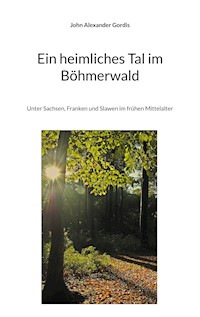3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Südfrankreich im sechsten Jahrhundert werden Juden aus Clermont vertrieben. Die Jüdin Rahel verliebt sich in den Franken Rikulf, aber heiraten dürfen sie nicht. Jahre später sehen sie sich in Palästina wieder...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
www.tredition.de
John Alexander Gordis
www.tredition.de
© 2015 John Alexander Gordis
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7323-6365-0
Hardcover:
978-3-7323-6366-7
e-Book:
978-3-7323-6367-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
EIN MANDELBAUM VOR DEM JAFFATOR
ROMAN
VON JOHN ALEXANDER GORDIS
INHALTSVERZEICHNIS
Erstes Kapitel: Rahel
Zweites Kapitel: Die Taufe des Schuach
Drittes Kapitel: Die Vertreibung
Viertes Kapitel: Der Weg der Franken
Fünftes Kapitel: Rettung
Sechstes Kapitel: In Issoire
Siebtes Kapitel: Der Totschlag
Achtes Kapitel: Salers
Neuntes Kapitel: Die lange Wanderung
Zehntes Kapitel: Rikulfs Reue
Elftes Kapitel: Neuanfang in Marseille
Zwölftes Kapitel: Nach Palästina
Dreizehntes Kapitel: Die Seereise
Vierzehntes Kapitel: Caesarea
Fünfzehntes Kapitel: Heilungen
Sechzehntes Kapitel: Nach Jerusalem
Siebzehntes Kapitel: Tiberias
Achtzehntes Kapitel: Der Flüchtling
Neunzehntes Kapitel: Krieg
Zwanzigstes Kapitel: Die Befreiung
ERSTES KAPITEL
RAHEL
„Komm her, Rahel, hilf mir bei der Zubereitung der Sabbatspeisen! Wir sind schon recht spät dran, wir müssen ja auch noch die Sabbatbrote, die Challot, backen!“
Die Stimme Hannas hallte energisch durch das Haus in der schmalen Gasse in Clermont, in der mehrere jüdische Familien wohnten. Diese waren schon zur Zeit des römischen Reiches nach Gallien eingewandert, und auch unter den fränkischen Königen aus dem Geschlecht der Merowinger konnten sie bisher hier unbehelligt leben.
Hanna war eine Frau in den mittleren Jahren, eher klein und etwas rundlich, mit wunderschönem dunkelblondem Haar, das freilich weitgehend von einem Tuch bedeckt war. Sie trug ein langes, hellgraues Kleid aus feinem Leinen, das ein Ledergürtel mit einer schönen bronzenen Gürtelschnalle zusammenhielt. Hannas Haut war ungewöhnlich hell; die feinen Linien ihrer kleinen, geraden Nase und ihrer wunderbar geschwungenen, vollen Lippen machten sie zu einer immer noch sehr attraktiven Frau. Ihre dunkelblauen Augen hatten stets einen liebevollen Ausdruck, wenn sie – wie jetzt – ihre Tochter betrachtete, die gerade auf ihren Ruf hin den Raum betrat.
„Ich bin schon da, Mutter, wir können gleich anfangen“, rief Rahel. Hannas fünfzehnjährige Tochter wirkte trotz ihres jugendlichen Alters schon wie eine schöne junge Frau. Rahel war, wie ihre Mutter, ziemlich klein, aber sehr schlank und zart gebaut. Sie hatte ein schmales, ovales Gesicht, große, ausdrucksvolle Augen, deren Farbe zwischen grün und blau zu wechseln schien, und eine feine, recht kleine Nase, über der sich ihre wundervoll gewölbte Stirn erhob. Ihre Lippen waren nicht so voll wie die ihrer Mutter, aber ebenso schön geschwungen. Wenn sie lächelte, war es dem Betrachter, als sei sie gerade in einer anderen Welt, so versonnen und träumerisch wirkte ihr Gesichtsausdruck. Rahels Haar war ganz dunkel, beinahe schwarz, es wurde großenteils von einem Tuch bedeckt, wie es bei den Frauen im Frankenreich der Brauch war. Sie trug heute ein dunkelblaues Leinenkleid und darüber eine lange Schürze, die mehr einem Kittel glich.
„Weshalb machen wir diese besonderen Speisen eigentlich, kannst du es mir noch einmal erklären?“, fragte Rahel schüchtern ihre Mutter.
„Hatte ich es dir nicht schon mal erklärt?“, erwiderte Hanna geduldig.
„Ja, aber ich höre es so gern immer wieder“. Lächelnd, mit großen Augen, schaute Rahel ihre Mutter erwartungsvoll an.
„Es ist eine Erinnerung an den Einzug der Israeliten in das gelobte Land. Der Herr, unser Gott – er sei gepriesen – hatte zu Mose gesagt: ‚Wenn ihr vom Brot des Landes, das ich euch geben werde, esst, sollt ihr mir vom Brotteig ein Hebopfer darbringen.‘ Wir haben ja schon lange keinen Tempel für die Opfer mehr; aber wir sondern nach wie vor ein kleines Stück von dem Teig ab, es symbolisiert das Hebopfer und wird verbrannt. Und die beiden Sabbatbrote versinnbildlichen das Manna, das die in der Wüste wandernden Israeliten täglich von Gott erhielten, das am Sabbat ausblieb, dafür aber am Freitag in doppelter Menge vom Himmel fiel.“
„Aber die Geschichte von den zwei Engeln, die den Menschen am Sabbatabend begleiten, habe ich nicht vergessen“, fiel Rahel eifrig ein. „Wenn sie hören, wie der Mensch die Schlussworte des Schöpfungsberichtes spricht - ‚so wurden vollendet Himmel und Erde‘ -, dann legen sie ihre Hände auf seinen Kopf und sagen: ‚Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt.‘“
„Sehr gut hast du das behalten, Rahel“, lobte sie ihre Mutter. „Aber nun müssen wir uns sputen. Du weißt ja, wir müssen heute nicht nur das Essen für den heutigen Abend vor dem Sabbat bereiten, sondern auch die zwei Mahlzeiten des Sabbattages fertig bekommen, denn das ist der Tag, als Gott ruhte von seinem Schöpfungswerk, und an dem auch wir nicht arbeiten sollen.“
Während der gemeinsamen Arbeit in der Küche hielt Rahel es nicht mehr aus, sie musste unbedingt mit ihrer Mutter über die neuesten Neuigkeiten sprechen: „Hast du schon den gut aussehenden jungen Mann gesehen, Mutter, der hier zu Besuch ist?“ Sie wurde ein bisschen rot bei der Frage.
Hanna tat, als hätte sie das nicht bemerkt. „Ja, Rahel, ich habe ihn neulich auch kurz in der Synagoge gesehen. Wie ich gehört habe, ist er aus Marseille gekommen und wohnt jetzt als Gast bei unserem Rabbi. Sein Name ist Josua. Er soll schon sehr gelehrt sein. Bestimmt wird er eines Tages auch Rabbi.“
Jetzt gab es für Rahel kein Halten mehr. Die Worte sprudelten aus ihrem Mund wie ein munterer, fröhlicher Gebirgsbach: „Stell dir vor, Gabriel war neulich mit diesem Josua gemeinsam mit einigen anderen im Lehrhaus, dem Bet Midrasch. Er hat mir anschließend von einer Diskussion dort berichtet. Sie kamen auf einen sehr interessanten Abschnitt im Talmud zu sprechen. Dieser Josua zitierte einen Rabbi Jakob, der sich auf Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja bezogen hatte: ‚Er bildet das Licht und schafft die Finsternis.‘ Man sage doch lieber: ‚Er bildet das Licht und schafft den Glanz.‘ Sein Gesprächspartner erwiderte: ‚Man spreche, wie es in der Schrift heißt.‘ Darauf wieder Rabbi Jakob: ‚Sprechen wir etwa auch: ‚Er stiftet Frieden und schafft Böses‘, wie es in der Schrift heißt? Vielmehr heißt es in der Schrift ‚Böses‘, aber wir sagen beschönigend ‚alles‘; ebenso sollte man beschönigend ‚Glanz‘ sagen.
Hanna sah etwas bekümmert ihre Tochter an: „Was scherst du dich um diese Gelehrtengespräche, Rahel? Das ist Sache der Männer.“
Aber Rahel widersprach: „Ich finde, dass diese Fragen zur Herkunft des Bösen in der Welt doch jeden Menschen bewegen, ganz gleich, ob Männer oder Frauen. Das ist doch eine sehr drängende Frage, ob das Böse von einem Satan herrührt, der es eigenmächtig in die Welt gesetzt hat gegen den Willen des allmächtigen Gottes, oder ob Gott es selber geschaffen hat, wie Jesaja an dieser berühmten Stelle sagt.“
„Das mag ja alles sein“, seufzte Hanna, „aber Ruhe und Frieden wirst du nicht finden, Rahel, wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst.“
„Ich kann nun mal nicht anders, Mutter, Ruhe und Frieden können doch ohnehin sehr trügerisch sein. Wie ist es denn unseren Vorfahren ergangen, als die Römer unseren Tempel und unsere heilige Stadt Jerusalem zerstörten, und als Kaiser Hadrian uns Juden sogar verboten hat, die Stadt überhaupt noch zu betreten? Da haben sich doch viele unserer Vorfahren bestimmt gefragt, wie der Herr, unser Gott – er sei gepriesen in Ewigkeit – diese Gräuel und dieses Unrecht an seinem auserwählten Volk zulassen konnte.“
Hanna gab es auf, ihre Tochter zur Zurückhaltung zu ermahnen. „Das ist ja alles schön und gut, aber vergiss deine Arbeit nicht darüber!“
Aber Rahel war jetzt nicht mehr zu bremsen. „Stell dir vor, Mutter, der Talmudschüler Josua verteidigte vehement die Abweichung vom Bibeltext in unserem Segensspruch, aber Gabriel, mein mein schlauer Bruder, hat ihm widersprochen, wie er mir berichtet hat. Er hat offenbar frei heraus zu Josua gesagt: ‚Ich finde es nicht richtig, dass die Rabbinen Jesajas Wort für den Segensspruch verändert haben. Diese Beschönigung verfälscht den Sinn der Aussage des großen Propheten. In der Heiligen Schrift steht, es gibt nur einen Gott; und Gott, der Allmächtige, hat die Welt ganz allein geschaffen, somit auch das Böse, wenn auch wir Menschen das nicht begreifen können. Aber Gott ist unserem Verstehen doch ohnehin weit entrückt. Denk an die berühmte Stelle, an der er sagt: ‚Ich will im Dunkel leben.‘ Es gab wohl noch eine längere hitzige Diskussion um diese Frage im Lehrhaus, aber es soll schließlich doch noch ein versöhnliches Ende gegeben haben.“
Hanna schüttelte den Kopf. Sie machte sich Sorgen um Rahel, die unbedingt an diesen theologischen Disputen der Männer teilnehmen wollte. Doch dann lächelte sie verschmitzt und sagte in völlig harmlosen Ton: „Übrigens wird dieser Josua aus Marseille heute Abend unser Gast sein.“
Bei diesen Worten ihrer Mutter errötete Rahel wieder. Sie versuchte aber, sich nichts weiter anmerken zu lassen und meinte nur beiläufig: „Er soll uns willkommen sein.“
Inzwischen waren die beiden mit den Essensvorbereitungen fertig geworden, und da die Männer schon bald vom Synagogengottesdienst zurückerwartet wurden, zündete Hanna auf dem Esstisch die Sabbatkerzen an und sprach den Segen darüber mit geschlossenen Augen, ihre Hände hielt sie dabei vor die Augen, die Handflächen den Kerzen zugewandt. Nachdem sie ihre Augen wieder geöffnet hatte, breitete sie ihre Hände nach rechts und links aus, um das Licht der Sabbatkerzen symbolisch nach allen Seiten hin zu verteilen. Endlich waren die Männer zurück und traten in den Raum. Jetzt wurde von den Eltern der Segen über die Kinder des Hauses gesprochen. Zu Gabriel sagten sie: „Gott mache dich wie Ephraim und Manasse, so wie einst Jakob auf dem Totenbett Josephs Kinder gesegnet hat!“ Und der Segen über Rahel lautete: „Gott mache dich wie die Stammmütter Sara, Rebekka, Rahel und Lea!“
Auf dem Tisch, an dem nun alle Platz nahmen, lagen jetzt die beiden Sabbatbrote, liebevoll in Tücher gewickelt, vor allem standen dort aber auch eine Karaffe Wein, sowie ein Becher und ein Salznapf auf einem Teller. Bevor die Familie und der Gast, der ebenfalls anwesende Josua, zu essen begannen, füllte Salomo ben Isaak, Gabriels und Rahels Vater, seinen Becher mit Wein, stellte ihn auf seinen rechten Handteller und sprach: „Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.“ Nach diesem Bibelwort sprach Salomo den Kiddusch über den Wein und einen Segen zum Sabbatbeginn. Darauf trank er erst selbst einen Schluck von dem Wein und gab den Becher an die anderen weiter, die ebenfalls daraus tranken. Nach einer rituellen Waschung seiner Hände nahm Salomo die Tücher von den Challot, den Sabbatbroten, hob sie hoch und sprach den traditionellen Segen darüber. Nach dem Brechen der ersten Challa wurden die Stücke in das Salz gestippt und an alle am Tisch verteilt. Jetzt konnte die eigentliche Mahlzeit beginnen.
Rahel blickte natürlich mit größtem Interesse, aber so verstohlen wie möglich, zu Josua, dem Talmudschüler aus Marseille, hinüber. Sie hoffte inständig, er würde auch mal zu ihr hersehen. Doch Josua würdigte sie keines Blickes, er schien sie gar nicht zu bemerken. Sie konnte sich das nicht anders erklären, als dass der junge Mann in Marseille wohl schon eine Verlobte hatte, und es daher für ihn nicht schicklich war, ein anderes Mädchen anzusehen. Sie seufzte. Was für eine Enttäuschung! Sie musste unbedingt von ihrer Mutter und ihrem Bruder herauszukriegen versuchen, ob ihre Vermutung zutraf. Doch das Essen ging in allgemein gehobener Stimmung weiter, zwischendurch wurden auch einige von den schönen alten Liedern gesungen, was diesem Festessen eine besonders feierliche Note verlieh. Nach dem Essen saß man noch eine ganze Weile beisammen, knabberte Süßigkeiten, trank etwas mit Wasser vermischten Wein, plauderte und hörte Salomo zu, der die Geschichte von Joseph und seinen Brüdern vorlas.
Am nächsten Morgen, am Sabbat, sprachen Salomo und Hanna über den Verlauf des Sabbatabends. Ihnen war beiden keineswegs entgangen, wie interessiert ihre Tochter oftmals zu Josua hinübergeblickt hatte. Sie waren sich darin einig, dass es an der Zeit sei, sich um einen passenden Ehemann für Rahel zu kümmern; sie war anscheinend bereit für die Ehe. Nicht dass Rahel noch auf dumme Gedanken käme und sich selbst einen Mann aussuchte, nicht dass sie sich auf einmal in einen völlig unpassenden Mann verliebte! So wurde Rahel zu einer Unterredung mit ihren Eltern gerufen. Zuerst ergriff ihr Vater das Wort. Salomo war ein schlanker Mann Anfang vierzig, der gleichwohl sehnig und kraftvoll wirkte. Er trug ziemlich langes dunkles Haupthaar, das an den Schläfen schon ergraut war, und einen ebenso dunklen Vollbart. Er hatte eine große, leicht gebogene Nase und lebhafte braune Augen. Sein längliches Gesicht erhielt besonders durch die schmalen Lippen ein ziemlich strenges Aussehen, doch seine Augen strahlten meist Wärme und Güte aus. Er lächelte Rahel zu, als er zu reden begann: „Deine Mutter und ich hatten gestern den Eindruck, dass dir der junge Talmudstudent aus Marseille gut gefallen hat, Rahel, und dass du ihn einige Male sehr interessiert betrachtet hast.“
Rahel schoss das Blut ins Gesicht bei diesen Worten ihres Vaters, sie zögerte einen Moment, dann sagte sie verlegen: „Na ja, ich sehe ja nur selten junge Männer, und dazu noch welche, die gut aussehen wie dieser Josua. Aber ihr braucht euch deswegen keine Sorgen zu machen. Ich weiß sehr wohl, was sich für eine jüdische Tochter schickt, und werde mich immer daran halten.“ Insgeheim ärgerte sie sich, dass ihren Eltern ihr Interesse für Josua nicht verborgen geblieben war.
Hanna ergriff die rechte Hand ihrer Tochter und strich mit der anderen Hand über Rahels Haar. Sie versuchte mit sanfter Stimme, sie zu beruhigen. „Aber daran zweifeln wir doch gar nicht, Rahel, wir wissen, dass du ein gutes Kind bist, immer bist du deinen Eltern gegenüber gehorsam gewesen.“
Jetzt fiel Salomo ein: „Wir sind der Meinung, dass es bald Zeit sein wird, dass wir dich verheiraten. Du bist schon eine verständige, junge Frau, Rahel, die ihr Glück mit einem tüchtigen Ehemann und eigenen Kindern finden wird, so wie es der Allmächtige für die Menschen bestimmt hat.“
Vorsichtig wandte Rahel ein: „Bin ich nicht doch ein wenig zu jung für die Ehe?“
Rasch erwiderte Hanna: „O nein, das bist du überhaupt nicht. Ich habe deinen Vater auch schon geheiratet, als ich sechzehn Jahre alt war. Das ist ein gutes Alter zum Heiraten.“ Sie lächelte, während sie die Hand der Tochter drückte.
Rahel war verwirrt über dieses ernste Gespräch mit ihren Eltern, auf das sie überhaupt nicht vorbereitet war. Sie fühlte sich überrumpelt. Im Moment fiel ihr nichts ein, was sie dazu noch sagen sollte, so schlug sie die Augen nieder und schwieg.
Doch das Gespräch war noch nicht zu Ende. Jetzt fuhr Salomo fort: „Wir haben auch schon an einen jungen Mann gedacht, der bestimmt gut zu dir passen würde, und mit dem du dich in nächster Zeit verloben könntest. Es ist Ehud, der Sohn meiner Cousine Mirjam. Er hat sich bisher vor allem mit dem Studium der Thora und des Talmud beschäftigt, aber soviel ich weiß, hat er einen Onkel, der ein kleines Weingut an der Rhone besitzt. Dieser Onkel hat keinen Erben, und so ist vorgesehen, dass Ehud einmal dieses Weingut bewirtschaften soll.“
Rahel bekam auf einmal ein ganz mulmiges Gefühl in der Magengrube. Etwas gequält stieß sie hervor: „Aber ich habe Ehud erst zwei Mal bei Familienfeiern gesehen. Er hat nicht ein einziges Mal zu mir herübergeschaut. Er hat mir gar nicht gefallen, ich fand sogar, dass er ein richtiger Stiesel ist.“
Hanna und Salomo sahen sich ziemlich betreten an. Salomo räusperte sich und redete nun in ziemlich strengem Ton zu seiner Tochter: „Das kannst du gar nicht beurteilen, Rahel, und es steht dir auch nicht zu, einen Ehemann abzulehnen, den deine Eltern für dich aussuchen. Du kannst mir glauben, deine Mutter und ich werden erst nach reiflicher Überlegung einen Ehemann für dich bestimmen. Im Übrigen haben wir noch gar nicht mit Ehuds Familie gesprochen. Eine Verlobung steht also nicht unmittelbar bevor.“
Zitternd, mit hochrotem Kopf, stürzte Rahel aus dem Raum und warf sich auf ihr Lager. Wie konnten ihre Eltern, die sie doch über alles liebte, ihr in so jungen Jahren schon einen Ehemann vor die Nase setzen wollen, vor allem einen, den sie bestimmt nie lieben könnte? Sie schluchzte immer noch, als ihre Mutter sich schließlich zu ihr auf die Schlafbank setzte und begütigend zu ihr sprach: „Nun reg dich nicht so auf, mein Kind, es ist ja noch gar nichts entschieden. Es wird schon alles gut werden, glaub mir. Es dauert sowieso immer eine Weile, bis man lernt, seinen Ehemann zu lieben. Das war bei mir und deinem Vater auch so. Aber dass du deinen Eltern gehorchen musst, das weißt du ja.“ Rahel hatte ihren Kopf noch immer in den Kissen vergraben und wollte nicht aufhören zu schluchzen. Seufzend erhob sich Hanna und begab sich in die Küche, um die erste Mahlzeit des Sabbats aufzutischen.
Rahel war traurig und wütend zugleich. Natürlich wusste sie, dass Ehen im Allgemeinen von den Eltern arrangiert wurden, wobei manchmal auch ein Heiratsvermittler zu Rate gezogen wurde. Das alles war für Rahel einerseits selbstverständlich, trotzdem hatte sie in einem Winkel ihres Herzens gehofft, dass es bei ihr vielleicht anders sein könnte. Vor ungefähr zwei Jahren hatte sie ihre erste Monatsblutung gehabt, ihre Mutter hatte ihr erklärt, dass dies den Übergang vom Kind zur jungen Frau bedeute. Und dass sie von nun an grundsätzlich in der Lage sei, schwanger zu werden und ein eigenes Kind zu gebären. Das war alles sehr aufregend gewesen, sie hatte von nun an ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickelt. Sie fühlte sich als vollwertige, erwachsene Frau. Rahel wusste, dass in den alten Zeiten Mädchen manchmal schon mit zwölf Jahren und sechs Monaten verheiratet wurden. Das kam jetzt wohl nicht mehr vor, aber eine Heirat mit sechzehn war nicht ungewöhnlich. Sie fand es eigentlich unvereinbar mit ihrem Selbstbewusstsein, dass sie bei der Auswahl eines Ehemanns nicht mitreden sollte. Oft versuchte sie sich vorzustellen, wie das Leben mit einem Mann wohl sein würde. Ihre Mutter erwies sich da als nicht besonders auskunftsfreudig, aber immerhin hatte Rahel durch sie doch eine klare Vorstellung von der körperlichen Liebe.
Sie träumte oft von der Liebe und malte sich dann aus, wie sie eines Tages einem blendend aussehenden jungen Mann begegnen würde, einem richtigen Helden, von denen es so viele in den Erzählungen der Heiligen Schrift gab. Er würde vielleicht auf einem prächtigen Pferd angeritten kommen, mit wehendem Mantel und einem Schwert an seiner Seite. Sie würden sich ansehen, und sie würden beide wissen, dass sie füreinander bestimmt wären. Weiter reichte ihre Vorstellungskraft nicht, aber sie musste dann immer an die berühmte Rahel denken, nach der sie selbst benannt war. Die hatte ihren Jakob bestimmt glühend geliebt, der dem Laban insgesamt vierzehn Jahre gedient hatte, bis er Rahel endlich heiraten durfte. Wie romantisch war die erste Begegnung der beiden am Brunnen, als Rahel gekommen war, um ihre Schafe zu tränken, und Jakob sie begrüßt und geküsst hatte! Noch lieber aber hatte Rahel die Geschichte von David und Abigajil, denn es war Abigajil gewesen, von der die Initiative ausgegangen war. Zu dieser Zeit war David zwar von Samuel schon zum König gesalbt, aber noch nicht als Herrscher über Israel und Juda ausgerufen worden, denn noch lebte König Saul, der David nach dem Leben trachtete. Als David nun eines Tages auf den reichen Nabal traf, der gerade auf dem Karmel Gebirge seine Schafe scheren ließ, erbat er von ihm für sich und seine Leute etwas Proviant, denn sie waren gerade knapp an Nahrungsmitteln. Doch Nabal verhöhnte ihn und wies ihn ab. Davon erfuhr jedoch Abigajil, Nabals Frau, die ganz offensichtlich David, den Kriegshelden, über
die Maßen bewunderte. Kurz entschlossen ließ sie die Knechte von Nabals großem Anwesen eine beträchtliche Menge Proviant auf Esel packen. Auch Köstlichkeiten wie Rosinenkuchen und Feigenkuchen waren in großer Zahl dabei. Zusammen mit der Eselskarawane zog sie David entgegen. Sie fiel ihrem Helden zu Füßen, entschuldigte sich für das Verhalten ihres Ehemannes und bat David, den Proviant anzunehmen. Hierbei richtete sie an David die wunderbaren Worte: „Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott, aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuder.“
Rahel war immer ganz verzückt, wenn sie diese Worte hörte, die sie inzwischen auswendig konnte. David war natürlich hocherfreut gewesen über die Menge der Lebensmittel, die er nun unverhofft doch noch erhalten hatte. Er bedankte sich bei Abigajil, und als er etwas später hörte, dass Nabal gestorben war, ließ er Abigajil holen, und die beiden heirateten. Rahel wusste zwar, dass David auch noch andere Frauen hatte, aber in ihren Augen tat das dieser romantischen Geschichte keinen Abbruch. Für sie war Abigajil ein Vorbild, die sich den Helden ihrer Träume selber ausgewählt hatte. Sie war zu ihm geeilt, aber David hatte sie bestimmt nicht nur aus Dankbarkeit geheiratet, ganz sicher hatte er sich bei dieser Begegnung auch in Abigajil verliebt.
So jedenfalls sah Rahel die Geschichte, und sie erhoffte auch für sich selbst eine so romantische Begegnung mit einem Mann, bei der sie beide in Liebe füreinander entbrennen würden. Als sie darüber nachdachte, musste sie auf einmal über sich selbst lachen. Clermont war nicht gerade der Ort, an dem ein David vorbeigeritten kommen würde, und alle jüdischen Männer, die sie kannte, waren keineswegs Kriegsmänner, sondern Handwerker, Kaufleute oder auch Bauern. Aber was machte das schon? Die Hauptsache war doch, dass der Mann, den Gott ihr schicken würde, und sie einander in Liebe zugetan sein würden.
ZWEITES KAPITEL
DIE TAUFE DES SCHUACH
Hanna und Salomo beschlossen, die Sache mit der Verlobung erst mal auf sich beruhen zu lassen, bis sich ihre ziemlich widerspenstige Tochter etwas beruhigt hätte. Sie meinten, Rahel würde sich allmählich mit dem Gedanken an die Verlobung mit Ehud schon anfreunden. Doch was dann in den nächsten Tagen und Wochen geschah, machte alle Hochzeitspläne zunichte.
An einem schönen Frühlingsnachmittag des Jahres 576 A. D. traf Salomo im Lehrhaus seinen Bruder, den Gemeindevorsteher Elieser. Nach einem kleinen Schwätzchen über den neuesten Klatsch in der Stadt verfinsterte sich Eliesers Gesicht auf einmal: „Salomo, mir ist vor einigen Tagen sehr Beunruhigendes über den Bischof unserer schönen Stadt Clermont zu Ohren gekommen.“
Erstaunt sah Salomo seinen Bruder an: „Wieso denn das? Ist Bischof Avitus nicht ein völlig integrer Mann? Er stammt doch aus einer alten, sehr vornehmen senatorischen Familie. Seine Sippe ist ja so vermögend, dass Avitus es auch nicht nötig hat, Bestechungsgelder anzunehmen.“
„Das mag ja alles sein“, erwiderte Elieser geduldig, „Ich sage auch nicht, dass der Bischof seine Pflichten gegenüber seiner Gemeinde vernachlässigt. Er ist ganz sicher ein gebildeter, frommer Mann, nichtsdestotrotz habe ich schon mehrmals läuten gehört, dass er uns Juden nicht mag.“
„Aber das Verhältnis der Juden zu ihren christlichen Mitbürgern war im Frankenreich doch bisher recht friedlich und unkompliziert.“
„Das ist auch meine Meinung, Salomo. Die fränkischen Könige haben uns immer in Ruhe gelassen, einige Juden haben ja sogar Ämter an fränkischen Königshöfen bekleidet, von Seiten der katholischen Kirche hat es aber schon seit einiger Zeit Bestrebungen gegeben, gegen uns vorzugehen, falls wir nicht zum Christentum konvertieren. Denk an das Konzil von Clermont im Jahr 535, als Ehen zwischen Christen und Juden untersagt wurden.“
„Davon habe ich noch nie gehört, Elieser.“
„Das ist ja auch schon lange her. Da waren wir beide gerade erst geboren, Salomo. Und außerdem wurde unser Leben davon ja gar nicht berührt.“
Salomo seufzte: „Das waren noch Zeiten, als vor etwas mehr als hundert Jahren beim Tod des Hilarius, des Bischofs von Arles, auch die Juden zusammen mit den Christen getrauert haben. An seinem Grab sollen sich die hebräischen Trauergesänge mit den christlichen Litaneien vermischt haben.“
„Nun jammere nicht, Salomo“, unterbrach ihn Elieser, „das ist wirklich schon sehr lange her. Wir müssen unserer jetzigen Situation ins Auge blicken. Und da sieht es, wie ich gehört habe, gar nicht gut aus. Offenbar ist Bischof Avitus ein richtiger Fanatiker, ein Judenhasser. Wir haben es nicht bemerkt, weil wir es wohl nicht wahrhaben wollten, aber er ist anscheinend schon seit einiger Zeit dabei, die christlichen Bürger von Clermont gegen uns aufzuhetzen.“
„Das möge Gott, der Allmächtige und Barmherzige – gepriesen sei sein Name – verhüten!“, rief Salomo ganz entsetzt. „Was sollen wir denn nur tun?“
Elieser strich sich über den langen Bart. „Woher soll ich das wissen, mein Lieber? Haben wir etwa den Christen jemals einen Anlass gegeben, sich zu beklagen? Wir zahlen pünktlich unsere Steuern, wir achten die fränkischen Gesetze und sind dem König treu ergeben. Aber wenn sie verlangen, dass wir den Glauben unserer Väter verraten und zum Christentum übertreten, ist das eine todernste Sache. Das werden die meisten von uns niemals tun.“
Hier wandte sich einer der Umstehenden, ein junger Mann namens Pinchas, an die beiden: „Verzeiht mir, aber ich habe euer Gespräch teilweise mit angehört. Es ist alles wahr, was du sagst, Elieser. Ich bin Viehhändler und mache auch Geschäfte mit christlichen Viehhändlern. Einer von denen hat mir neulich berichtet, dass Bischof Avitus im Gottesdienst zu den Gläubigen gesagt hat, die Juden müssten die Decke des Mosaischen Gesetzes fallen lassen; und sie müssten geistlich verstehen, was sie in der Bibel läsen und erleuchteten Sinnes in den heiligen Schriften Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, verheißen durch das Gesetz und die Propheten, erkennen. Schon oft habe er sie ermahnt, das zu tun, doch sie würden sich hartnäckig weigern. Stellt euch vor, liebe Brüder, mit solchen Reden wiegelt der Bischof die Leute auf.“
Sprachlos starrten die beiden den jungen Mann eine ganze Weile an. Dann presste Elieser hervor: „Das ist ja schrecklich!“
Salomo umarmte seinen Bruder. „Möge es nicht so weit kommen“, murmelte er, „dass wieder Juden für ihren Glauben sterben müssen, wie es das schon oft gegeben hat.“ Bedrückt gingen die beiden auseinander.
Die Befürchtungen der Juden in Clermont sollten sich als allzu begründet erweisen. Eine große Menge von Bürgern der Stadt und ihrer Umgebung hatte sich zur Hauptmesse am Karfreitag in der Kathedrale versammelt. Natürlich sollte sie von Bischof Avitus zelebriert werden. Unter den Gläubigen waren auch vier junge Männer, die in ihrer Mitte einen sehr ungewöhnlichen Besucher einer katholischen Messe mitgebracht hatten, nämlich Schuach, einen jungen Juden. Dieser verfolgte sichtlich aufgeregt, mit bleichem Antlitz, den Verlauf des Gottesdienstes, bis der Bischof während seiner Predigt wieder einmal auf die Bekehrung der Juden zum christlichen Glauben zu sprechen kam, die ihm so sehr am Herzen lag. Gerade hatte Bischof Avitus mit einer seiner typischen Formulierungen gerufen: „Herr Jesus Christus, hilf den Söhnen Israels, dass die Decke des Buchstabens vor ihnen zerrissen werde, und lass sie sich zu dir bekehren, dem eingeborenen Sohn Gottes, unserem Herrn! Kyrie eleison!“
Kaum waren diese Worte verklungen, als Schuach nach vorn stürzte und sich vor dem Bischof zu Boden warf. Ein Skandal! Im ersten Moment der Überraschung herrschte Totenstille in der Gemeinde. Dann erhob sich in der ganzen Kathedrale ein allgemeines Raunen und Flüstern, das allmählich lauter wurde und zu einem Brausen anschwoll. Vereinzelt waren Rufe zu hören: „Wer ist das?“ „Ich kenne ihn, es ist ein Jude!“ „Was erdreistet sich dieser Jude!“ „Eine Unverschämtheit!“ „Werft ihn hinaus!“ Doch Bischof Avitus hob die rechte Hand, blickte die Menge streng an und hieß sie schweigen. Laut und deutlich fragte er den immer noch auf dem Steinboden der Kathedrale liegenden Schuach: „Was tust du da, Jude? Was willst du?“ Avitus bemühte sich, eine ruhige, beherrschte Miene aufzusetzen, doch eine gewisse Verärgerung konnte er nicht ganz verbergen. Insgeheim aber genoss er auch dieses außergewöhnliche Schauspiel, in dessen Mittelpunkt er, der Bischof, stand.
Schuach hob ein wenig den Kopf und rief – doch eigentlich war es mehr ein Schrei: „Mein Herr, vergib mir!“ Dann fuhr er etwas leiser fort: „Ich bin der Jude Schuach, ich bin nicht würdig, in diesem Haus Gottes zu sein und dich, den Priester Gottes, anzusprechen. Doch dein Sklave fleht dich an: Lass mich ein Sohn der rechtgläubigen Kirche des Herrn Jesus Christus werden!“ Nach diesen Worten ließ er den Kopf wieder auf den Boden sinken und verharrte schweigend, als erwarte er das Urteil eines strengen Richters.
Die Überraschung in der ganzen Gemeinde hätte kaum größer sein können, als wenn ein gefallener Engel vor ihren Augen Gott um Gnade angefleht hätte. Wieder redeten und schrien alle durcheinander, und Bischof Avitus hatte Mühe, die Gläubigen zu beruhigen. Endlich befahl er Schuach: „Steh auf, mein Sohn! Jesus spricht: ‚Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.‘ Wenn du, Schuach, wirklich begehrst, Jesus Christus als den Sohn des lebendigen Gottes anzuerkennen und an ihn zu glauben, dann wird unser Herr und Erlöser dich als Mitglied in die Schar seiner Gläubigen aufnehmen. Ich werde dich am heiligen Osterfest taufen!“
Hochzufrieden und beglückt, dieses Schauspiel mit angesehen zu haben, zogen die Besucher des Gottesdienstes schließlich aus der Kathedrale. Einige sprachen sogar zu ihren Nachbarn: „Da seht ihr, was für ein heiliger Mann unser Bischof ist.“ „Auf Bischof Avitus ruht wahrhaftig der Geist Gottes.“ „Ein Wunder hat unser Bischof durch die Kraft des Heiligen Geistes bewirkt!“ Der junge Schuach aber wurde von einigen Diakonen in ihre Mitte genommen und herausgeführt. Trotz der Kürze der Zeit bis zum Osterfest sollte er noch möglichst ausführlich über die Beweggründe seines Glaubenswechsels befragt und über die Grundzüge des christlichen Glaubens belehrt werden.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von diesem Ereignis in der ganzen Stadt, natürlich auch unter den jüdischen Bürgern von Clermont. Groß war die Erschütterung über Schuachs Vorhaben bei ihnen, viele bedauerten ihn, aber bei vielen rief sein Schritt auch Entsetzen und Abscheu hervor. Doch keiner wagte es, seinen Unmut und seine Ablehnung der Konversion Schuachs in der Öffentlichkeit zu äußern, aus Angst vor Repressalien durch die Christen.
Auch im Hause Salomos wurde viel über das Vorhaben Schuachs, sich taufen zu lassen, gesprochen. Als die Familie beim Sabbat zusammensaß, mischte sich auch Gabriel, Rahels älterer Bruder, in die Diskussion ein. Gabriel war ein schlanker, hochgewachsener junger Mann mit hoher Stirn, buschigen Augenbrauen und fein geschwungenen, vollen Lippen. Im Blick seiner großen grünen Augen lag meist Freundlichkeit und Wohlwollen seinem Gesprächspartner gegenüber. Sein recht langes, dunkelbraunes Haar und der ganz leicht gestutzte Vollbart ließen ihn etwas älter aussehen als seine zwanzig Jahre. Er arbeitete in der Wein- und Olivenölhandlung seines Vaters. Mit erregter Stimme wandte sich Gabriel an Salomo: „Welch ein Unglück für unsere Gemeinde, Vater! Wir Juden sollten doch gerade in der Diaspora zusammenhalten und nicht dem Glauben unserer Väter Abraham, Isaak und Jakob den Rücken kehren. Du hast uns doch berichtet, dass Pinchas, der junge Viehhändler, dich und Elieser angesprochen hat. Ich kenne diesen Pinchas schon seit einiger Zeit ganz gut. Ich glaube, er ist sehr fromm und hat viele unserer alten Schriften gelesen. Aber er hat auch ein unberechenbares Temperament, ein richtiger Hitzkopf ist er. Ich hoffe, er lässt sich nicht zu unüberlegten Worten oder gar Taten gegen Schuach hinreißen.“
Sein Vater Salomo erwiderte: „Das glaube ich nicht. Wir alle müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Auch Pinchas weiß das. Er wird sich bestimmt besonnen verhalten, obwohl“, hier kräuselten sich Salomos Lippen zu einem ganz feinen Lächeln, „sein Namensvetter sich nach dem Auszug aus Ägypten auch schon durch übereifrige Frömmigkeit ausgezeichnet hat.“
Jetzt erhob Rahel ihre helle Stimme: „Ich verstehe das alles nicht. Machen wir uns nicht allzu viel Sorgen? Lasst doch Schuach, diesen einzelnen Mann, morgen zur Taufkapelle ziehen! Ist unsere Gemeinde nicht stark genug, um das zu verkraften, wenn nur ein einziger aus ihrer Mitte zu den Christen übergeht?“
Salomo wiegte bedächtig seinen Kopf: „Ich sehe das etwas anders, Rahel. So ein Beispiel könnte Schule machen. Wer weiß das schon? Vielleicht gehen Schuachs Geschäfte gerade nicht so gut, und er vespricht sich Zulauf von christlichen Mitbürgern zu seinem Tuchhandel.“
Leise meinte Rahel: „Mir tut dieser Schuach leid. Aus der Gemeinschaft der Juden wird er nun ausgestoßen sein, und ob ihn die Christen wirklich mit offenen Armen in ihre Mitte aufnehmen, bezweifle ich.“
Jetzt wandte sich auch Hanna an ihren Mann: „Salomo, du musst etwas tun, dass Pinchas morgen nicht etwas Unbedachtes unternimmt!“
Salomo zuckte ratlos die Schultern. „Was soll ich schon machen? Aber du hast recht, ich werde mir Pinchas morgen zur Brust nehmen und ihn ermahnen, sich zurückzuhalten.“
Eine gehobene, von frommer Andacht erfüllte Stimmung wollte an diesem Sabbat nicht mehr so recht aufkommen. Wie würde Schuachs Taufe durch Bischof Avitus velaufen? Mit schweren Gedanken gingen alle schlafen.
Am nächsten Tag, dem Ostersonntag, goss die Frühlingssonne von einem hellblauen, glasklaren Himmel ihr mildes Licht über Wiesen und
Wälder, über die Flüsse und Berge der Auvergne, und auch über die erwartungsvollen Christen und die bekümmerten Juden von Clermont. Nach der Frühmesse machte sich Bischof Avitus, begleitet vom Psalmen singenden Chor der Kathedrale, auf den Weg zur Taufkapelle, die etwas außerhalb der Stadtmauern lag. Ihm folgte eine kleine Schar von Männern und Frauen – alle mit weißen Taufkleidern angetan. Unter ihnen ging, ein klein wenig abgesondert, der Jude Schuach. Auch etliche Bürger von Clermont begleiteten den Zug, um dieses besondere Ereignis miterleben zu können.
Es wurde ein sehr feierlicher Taufgottesdienst. Der Chor sang, die vielen Kerzen strahlten und erhellten mit ihrem festlichen Schein die Kapelle, andächtig lauschten die Gläubigen der kraftvollen Stimme des Bischofs. Schließlich war der Höhepunkt des Gottesdienstes gekommen. Nach mehreren langen Gebeten sprach der Bischof zu den Täuflingen auf Latein die alten rituellen Formeln der Taufliturgie: „Entsagt ihr dem Satan, all seiner Pracht und Verführung – jeder Macht des Trugs und jeder bösen Eingebung, um würdig zu werden des heiligen christlichen Namens?“
Die Angesprochenen antworteten im Chor: „Wir entsagen.“
Und nach dem Glaubensbekenntnis fragte der Bischof wiederum: „Wollt ihr in diesem Glauben getauft werden?“
Noch einmal erwiderten die Täuflinge im Chor: „Ja, das wollen wir.“
Schließlich erfolgten die Einsetzungsworte: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ Nun wurden die Täuflinge in das Taufbecken, einen Wasserbottich, getaucht und anschließend in weiße Gewänder eingekleidet. Schuach hatte für sich den Taufnamen Johannes erbeten.
Sehr zufrieden hatten alle Gläubigen die Zeremonien verfolgt. Nach dem Gottesdienst bewegte sich der Zug unter Lob- und Jubelgesängen zurück zur Stadt. Von den jüdischen Bürgern Clermonts war weit und breit niemand zu sehen. Schon war man am Stadttor angekommen, Bischof Avitus, einige Priester, Diakone und der Chor in seinem Gefolge schritten hindurch, dann kamen die weiß gekleideten Täuflinge. Doch nun geschah das Unerhörte, Unfassbare: Als der gerade getaufte Schuach den Torbogen passierte, ergoss sich von oben ein Schwall von Öl über sein Haupt und begann, in dicken Tropfen über sein schönes neues Taufgewand hinabzufließen! Ganz offensichtlich war das Öl auch noch ranzig, denn den Zuschauern, die zu beiden Seiten des Zuges standen, stach sofort sein widerlicher Geruch in die Nase. Wie vom Donner gerührt war Schuach stehen geblieben, sein Gesicht drückte nur maßloses Erstaunen aus, ratlos und hilfesuchend blickte er sich nach allen Seiten um. Auch den Gläubigen und den Schaulustigen hatte es zunächst die Sprache verschlagen, so überrascht und schockiert waren sie von diesem Frevel.
Dann aber erhob sich ein ohrenbetäubendes Geschrei. Die Leute gestikulierten, schrien und liefen wild durcheinander, wobei einige von ihnen hinstürzten und fast zu Tode getrampelt wurden. Rufe gellten über den Platz vor dem Tor: „Wer war das?“ „Ergreift den Übeltäter!“ „Her mit dem Frevler!“ „Wer hat es gewagt, die Gemeinde Gottes zu verhöhnen?“ „Das schreit nach Rache!“ „Habt ihr den Verbrecher?“
Tatsächlich wurde jetzt aus dem obersten Stockwerk des Tores ein junger Mann die Treppe hinunter gezerrt. Es war Pinchas! Verängstigt, aber mit stolzer, trotziger Miene blickte er in die Runde. Nun gab es kein Halten mehr. Wütend drangen die Leute auf ihn ein, bespuckten und beschimpften ihn: „Verfluchtes Judenschwein!“ „Christusmörder!“ „Elender Feigling!“ Schnell hatte sich ein Haufen unter den Umstehenden zusammengerottet, die schon damit begannen, Steine aufzuheben und auf Pinchas zu werfen. Die ersten Steine trafen ihn an den Schultern, an der Brust und im Gesicht, so dass Blut an seinen Wangen herabrann. Er stöhnte auf und krümmte sich vor Schmerzen. Da bahnte sich plötzlich Bischof Avitus einen Weg durch die Menschenmenge, bis er vor Pinchas stand. Er hob die Hände und schrie mit donnernder Stimme: „Hört auf! Haltet ein! Ich lasse es nicht zu, dass dieser Mann gesteinigt wird, auch wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bei unserem Herrn Jesus Christus und der Heiligen Jungfrau, ich verbiete euch, auch nur noch einen einzigen Stein auf diesen Mann zu werfen! Ich werde dafür sorgen, dass er einer gerechten Strafe zugeführt wird. Und nun geht zurück in eure Häuser!“
In den folgenden Wochen herrschte in Clermont ein beklommenes Schweigen - jedenfalls in der Öffentlichkeit - über die dramatischen Ereignisse, die sich über die Ostertage in der Stadt abgespielt hatten. Wie zu allen Zeiten gingen die Leute ihren Geschäften nach. In den Gewölben der Kaufleute und auf den Märkten wurde gefeilscht, gekauft und verkauft; die Handwerker fertigten ihre Waren, die Bauern arbeiteten emsig auf den Feldern, zogen ihr Vieh groß und schlachteten es. Junge Leute verliebten sich ineinander und heirateten. Wie eh und je wurden Kinder gezeugt und geboren, die Menschen wurden krank und manchmal auch wieder gesund. Die Alten starben, und auch viele Kinder und junge Leute starben, denn die Heilkunst war in jenen Tagen nicht sehr weit entwickelt. Die Christen beteten zu ihrem dreieinigen Gott und flehten auch die Jungfrau Maria und die Heiligen um Hilfe und Beistand an. Viele Franken und Nachkommen der Gallier in den Dörfern beteten auch weiterhin zu den alten Göttern, und die Juden beteten so wie seit den Zeiten Abrahams zum Gott ihrer Väter, dem Herrn der Heerscharen, dem Allmächtigen und Barmherzigen, der ihre Vorfahren einst aus der ägyptischen Sklaverei befreit hatte.
In den Häusern der Juden, in den Familien, manchmal auch in den Lehrhäusern, war die Taufe Schuachs, den die Christen jetzt Johannes nannten, auch weiterhin das beherrschende Thema. An einem schönen Frühlingsabend saß Salomos Familie zusammen beim Abendessen, als Gabriel eine Frage aussprach, über die die ganze jüdische Gemeinde brütete und nachsann: „Wie wird es mit uns nur weitergehen? Seit diesen unglückseligen Ereignissen zum christlichen Osterfest verspüren die meisten eine zunehmende Feindseligkeit der Christen uns gegenüber. Früher gab es doch überhaupt keine nennenswerten Probleme zwischen den christlichen und jüdischen Bürgern von Clermont. Aber jetzt meiden sie uns, wo sie nur können, kaufen viel weniger als sonst bei unseren Handwerkern und Händlern; viele haben mir schon hasserfüllte Blicke auf den Gassen zugeworfen und mir Schimpfwörter nachgerufen. Wo soll das alles hinführen?“
Nachdenklich meinte Salomo: „Leider hast du recht, mein Sohn. Ich glaube, das dürfte den meisten von uns schon aufgefallen sein. Unser Gemeindevorsteher Elieser, mein Bruder, und Rabbi Samuel waren schon zu einer Audienz bei Bischof Avitus, um ihn auf diese unschöne Entwicklung anzusprechen. Doch der Bischof hat sie wohl nur kühl abblitzen lassen. Er soll gesagt haben: ‚Daran kann ich auch nichts ändern. Ihr allein tragt die Schuld an diesem Unwillen des Volkes euch gegenüber. Ihr seid ein Fremdkörper in unserer christlichen Gemeinschaft, ein Schandfleck seid ihr! Durch eure Gegenwart beleidigt ihr jeden rechtschaffenen Christen in der Stadt! Es ist an euch, das zu ändern. Lasst endlich ab von eurer Verblendung und bekennt euch zu unserem Erlöser Jesus Christus!‘ Rabbi Samuel und Elieser sind natürlich wie vor den Kopf geschlagen, bedrückt und verstört vom Bischof weggegangen.“
Hier mischte sich auch Rahel in die Unterhaltung: „Eigentlich kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass unsere christlichen Mitbürger gleichsam über Nacht zu anderen Menschen geworden sein sollen. Wir haben doch sonst immer friedlich mit ihnen zusammengelebt. Ich weiß auch von mehreren Franken und Römern in Clermont, die bei schwerer Krankheit jüdische Ärzte zu Rate gezogen haben, da diese im Ruf stehen, in der Heilkunst sehr bewandert zu sein. Ich kann es mir nur so erklären, dass Bischof Avitus die Leute ständig aufhetzt und zum Hass auf uns Juden anstachelt.“
Mit stockender Stimme warf leise Hanna ein: „Meine Freundin Tabita hat mir neulich weinend erzählt, dass ihr jüngster Sohn auf offener Straße von einigen christlichen Jugendlichen verprügelt worden ist. Er kannte diese Jugendlichen gar nicht, geschweige denn, dass er sie irgendwie provoziert hätte.“
Alle schwiegen bedrückt. Gabriel versuchte, von diesem verstörenden Thema abzulenken und fragte in die Runde: „Was macht eigentlich Josua, der junge Talmudschüler aus Marseille?“
„Er ist kürzlich wieder in seine Heimat abgereist“, antwortete ihm Salomo. „Er sagte mir beim Abschied: ‚Besucht mich doch mal in Marseille! Dort leben schon seit Jahrhunderten so viele Juden, dass es von manchen die hebräische Stadt genannt wird. Ihr werdet mir jeder Zeit willkommen sein!‘ Aber was du eben gesagt hast, Rahel, darüber habe ich auch schon nachgegrübelt. Solcher Hass entsteht nicht einfach von selbst, schon gar nicht durch unsere bloße Gegenwart. Dieser Hass wird schon seit langem von der Geistlichkeit geschürt, und unser Bischof Avitus ist leider ein besonders fanatischer Judenhasser. Das hat mir kürzlich Meschullam, ein weitgereister Kaufmann, erzählt, der schon in vielen anderen Städten war und dort auch mit Christen gesprochen hatte. Am schlimmsten soll es in Burgund sein, dort gilt selbst der König Guntram als Feind der Juden. Chlodwig hingegen, der erste König des Frankenreiches, hatte überhaupt nichts gegen die Juden. Wir können also sicher sein, dass Bischof Avitus ständig gegen uns hetzt und den Hass der Leute gegen uns schürt. Aber nun lasst uns beten und den Herrn Zebaoth, den Gott Israels, bitten, er möge sich unserer erbarmen.“
So kam der Tag der Himmelfahrt Jesu Christi. Bischof Avitus hatte den Festgottesdienst in der Kathedrale gehalten und zog nun unter Chorgesang zur Kirche des Heiligen Martin von Tours. Ihm folgte eine große Menge der christlichen Bürger. Doch plötzlich – wer weiß, wie es geschah – stürzten die meisten von ihnen, wohl auf ein verabredetes Zeichen hin, zur Synagoge. Unterwegs schlossen sich ihnen immer mehr Leute an, und so erreichte eine wütende Menge, schreiend, tobend und hasserfüllte Lieder singend, die Synagoge. Die Juden, die sich dort gerade aufhielten, hatten das Gebrüll der Menge schon von weitem gehört und waren vorsichtshalber geflohen. Nur ein einzelner alter Mann stand noch vor dem Tor mit ausgebreiteten Armen, als ob er den Mob aufhalten wollte. Doch er wurde einfach umgestoßen und von den Nachdrängenden zu Tode getrampelt. Was sich nun abspielte, war unbeschreiblich. Wie von Sinnen, wie von einem bösen Geist besessen, begannen die Leute, mit Knüppeln, Äxten und Spaten auf die Mauern der Synagoge einzuschlagen. Steine krachten, Holz splitterte, die Angreifer fluchten, brüllten und heulten, eine große Staubwolke stand bald über dem trostlosen Schauplatz. Es dauerte nicht allzu lange, bis die altehrwürdigen Mauern unter den wütenden Schlägen der fanatisierten Menge nachgaben und krachend in sich zusammenfielen. Jetzt nahmen sich die Leute die Inneneinrichtung des Hauses vor; als man die heilige Thorarolle fand, wurde diese bespuckt, zertrampelt und in tausend Stücke gerissen. Davon, dass ihr Inhalt – die fünf Bücher Mose – auch ein Teil der christlichen Bibel war, hatte wohl keiner dieser von Hass zerfressenen Menschen eine Ahnung. Das alles reichte ihnen aber noch nicht, zuletzt wurde auch noch der letzte darnieder liegende, geschändete Mauerteil zerstoßen und zerklopft, bis von der Synagoge nichts mehr übrig war als ein Haufen Staub.
DRITTES KAPITEL
DIE VERTREIBUNG
Doch damit war die blinde Wut der christlichen Bürger noch nicht verraucht. Von allen Seiten gellten Schreie: „Macht dieses verstockte, verfluchte Volk fertig!“ „Tötet sie!“ „Tötet sie alle!“ „Lasst keinen am Leben!“ Johlend und kreischend zogen die Leute nun zu den Häusern der Juden und hämmerten gegen die Tore, denn diese waren natürlich von den in Todesangst geflohenen Bewohnern verriegelt und verrammelt worden. Man schlug auch gegen die Mauern, einige riefen drohend: „Zittert ihr jetzt vor unseren Äxten und Schwertern, Judenpack?“ „Der Tag der Rache ist gekommen für den Mord an unserem geliebten Herrn Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes!“ „Sprecht euer letztes Gebet!“ „Die Rächer sind da, um euch zu töten!“ Doch den meisten Angreifern reichte es für diesen Tag zunächst mal.
Die erste Wut war nach der Zerstörung der Synagoge verraucht. Die meisten ließen von den schweren Eichentoren der Juden ab und trollten sich. Nur vor Salomos Haus hatten sich einige besonders fanatische junge Männer versammelt, die sich in einen Todesrausch hineingesteigert hatten. Sie wollten jetzt Blut sehen. Nachdem sie das Tor mit ihren Äxten zertrümmert hatten, stürmten sie mit hasserfüllten Gesichtern brüllend in das Haus und begannen, alles umzuwerfen und zu durchwühlen. Doch es schien sich kein Mensch im Haus zu befinden. „Kommt heraus, Juden!“ Wo seid ihr, elendes Pack?“, schrien sie und steigerten sich immer weiter in ihre Mordlust. Schließlich aber fanden sie die Familie, die sich im Keller zwischen Ölkrügen und Weinamphoren versteckt hatte. Die Magd war schon lange vorher geflohen. Grinsend zog einer der Christen Hanna an ihren Haaren hervor und rief seinen Kameraden zu: „Seht her, ein schönes Judenweib! Kriegt ihr nicht auch Lust? Mit diesen Worten schlug er der vor Angst völlig erstarrten Hanna ins Gesicht und riss ihr die Kleider vom Leib. Gabriel und Salomo hatten noch versucht, sich schützend vor Hanna zu stellen, doch die anderen Eindringlinge rissen die beiden weg und schlugen und traten auf sie ein, bis sie bewusstlos am Boden lagen. Dann packten sie Hanna und hielten sie fest, bis der erste, der sie gefunden hatte, fertig war, sie zu vergewaltigen. „Wollt ihr nicht auch noch?“, rief er seinen Spießgesellen zu. Doch diese hatten anscheinend erst einmal genug und schüttelten den Kopf. Der Vergewaltiger packte noch einmal Hannas Kopf und schlug ihn so heftig gegen die Wand, dass ihr helles Blut hervorspritzte und dem Mann über das Gesicht lief. Wütend ging er danach auf Salomo zu, der gerade im Begriff war, sich wieder zu erheben, und schlug ihn noch einmal zu Boden. Schließlich verließen die Angreifer den Keller, liefen wieder auf die Straße und eilten zusammen mit anderen jungen Leuten zur nächsten Kneipe.
Nur Rahel hatten die Unmenschen nicht gefunden. Sie hatte sich im oberen Stockwerk unter einem großen Stapel Leinentücher so gut versteckt, dass sie unentdeckt geblieben war. Zitternd hatte sie unter den Stoffen zusammengekauert gelegen und in Todesangst anhören müssen, wie die Männer auch diesen Raum durchsuchten. Jeden Moment musste sie damit rechnen, doch noch gefunden zu werden. Diese Augenblicke dehnten sich, als ob es Stunden oder Tage wären. Sie sandte ein Stoßgebet nach dem anderen zum Himmel und presste ihre Hand krampfhaft auf ihren Mund, dass ja nicht ein unterdrücktes Jammern oder gar ein Schrei zu vernehmen wäre. Und wirklich, nach einer qualvoll langen Zeit, die ihr vorkam, als gäbe es überhaupt keine Zeit mehr, als durchlebte sie immer und immer wieder alle Jahre ihrer Kindheit, war es endlich still im Haus. Als Rahel es zu begreifen begann, kam ihr ein schrecklicher Gedanke. War sie überhaupt die ganze Zeit bei Bewusstsein gewesen, oder hatte man sie doch gefunden, sich an ihr vergangen, und sie hatte nichts gespürt? Doch sie lag noch genau so unter den Leinentüchern, wie sie sich darin versteckt hatte, und sie stellte fest, dass sie äußerlich völlig unversehrt war. Im Haus war eine beunruhigende, unheimliche Stille, nichts rührte sich, nicht der leiseste Laut war zu hören. ‚Ob alle tot sind?‘, fragte sich Rahel verzweifelt. Ihr Herz krampfte sich zusammen, lange war sie nicht fähig, sich zu bewegen. Doch ganz allmählich fühlte sie, dass Leben in ihre Beine und Arme zurückkehrte. In ihrem Kopf spürte sie ein dumpfes Hämmern. Mühsam versuchte sie, klare Gedanken zu fassen. Sie musste jetzt feststellen, ob sie die einzige Überlebende im Haus war. Sie musste nachsehen, wo die anderen waren, was mit ihnen geschehen war! So erhob sie sich mühsam und wankte langsam durch alle Räume des Hauses. Nichts! Nur zertrümmerte Möbel überall. Aber was war das?
Sie hörte plötzlich ein schwaches Wimmern, das offenbar aus dem Keller heraufdrang. Mit ihren letzten Kräften schleppte sie sich die Stufen hinunter – und erblickte ihre Familie!
Ihre Mutter und ihr Vater lagen zusammengekrümmt auf dem Boden, alles war voll Blut. In einem Winkel kauerte Gabriel an der Wand und stöhnte. Zumindest war er nicht tot. Aber ihre Mutter! Rahel hatte sofort gesehen, dass Hanna halbnackt dalag. Sie sank vor ihr auf die Knie und flüsterte: „Mutter, Mutter, hörst du mich?“ Keine Antwort. Rahel erstarrte. Vorsichtig streckte sie die Hand aus und berührte ihre Mutter. Die Haut war ziemlich kühl, wie es Rahel schien. Panik ergriff sie, vor ihren Augen wurde es schwarz, sie hatte das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden. Doch sie zwang sich, einen klaren Kopf zu behalten. Vielleicht konnte sie der Mutter ja noch helfen! Mit aller Kraft schüttelte sie den leblosen Körper, doch keinerlei Reaktion! Als sie sah, wie Hannas Kopf dabei nach hinten und zur Seite fiel, begann Rahel, die entsetzliche Wahrheit zu begreifen. Ihre Mutter war tot! Es gab keinen Zweifel mehr, sie atmete nicht, ihr Herz schlug nicht mehr. Wie betäubt sackte Rahel auf dem Körper ihrer Mutter zusammen. Ihr Denken setzte aus, sie fühlte nichts in diesem Moment, nur, dass sie auch sterben wollte. Sie richtete sich wieder halb auf und starrte auf ihre tote Mutter. Keine Träne rann aus ihren Augen. Langsam begann sie, der Mutter die blutverschmierten Haare aus dem Gesicht zu streichen. Sie küsste ihren Mund, immer und immer wieder. „Mutter, liebe Mutter“, flüsterte sie, „wo bist du? Wach doch bitte auf! Du darfst jetzt nicht gehen!“
Schließlich kam Rahel etwas zur Besinnung, ihr Vater und ihr Bruder fielen ihr ein. Sie humpelte zu ihnen hinüber. Ihr Vater stöhnte ganz leise, er schien noch bewusstlos zu sein. Aber er war nicht tot! Ihr Bruder hockte immer noch bleich in seinem Winkel. Rahel setzte sich zu ihm, sie sagten beide nichts, aber hielten sich fest an den Händen. Inzwischen war auch Salomo wieder zu sich gekommen und richtete sich etwas auf. Rahel ging zu ihm hinüber und kniete schweigend vor ihm. Salomo nahm ihren Kopf zwischen seine Hände und küsste ihn. Jetzt verließen Rahel die Kräfte, sie lehnte sich völlig erschöpft an die Brust ihres Vaters. Er strich ihr sanft über das Haar und murmelte: „Ruhig, meine Kleine, ganz ruhig, alles wird wieder gut.“ Wie von ferne hörte sie, dass er ganz leise auf Hebräisch betete.
Es stellte sich heraus, dass Salomo und Gabriel nicht allzu schwer verletzt waren. Am nächsten Tag waren sie beide in der Lage, wenn auch gestützt von Verwandten und Bekannten, an Hannas Beerdigung teilzunehmen. Salomo sprach das Kaddisch an ihrem Grab. Hierauf wankte er zurück in sein verwüstetes Haus und legte sich hin. Unter Rahels Pflege begannen er und Gabriel, sich langsam wieder zu erholen. Natürlich herrschte nach diesem Tag des Entsetzens eine große Furcht unter den Juden von Clermont. Die Synagoge war jetzt zerstört, aber mehrere Lehrhäuser in der Stadt existierten noch; so trafen sich die Gemeindemitglieder hier einige Tage später, um über ihre prekäre Situation zu beraten. Alle bekundeten Salomo und Gabriel, die noch von den Misshandlungen der Mörder gezeichnet waren, ihr Beileid und ihr Mitgefühl. Rahel war nicht anwesend, da Frauen zum Lehrhaus keinen Zutritt hatten.
Mit zitternder Stimme wandte sich Salomo an die Versammlung: „Ich hoffe, ihr werdet verstehen, liebe Brüder, dass es nach dem Mord an meiner Frau für mich und meine Kinder nicht mehr möglich ist, länger in Clermont zu bleiben, obwohl meine Familie schon seit Generationen hier ansässig ist. Meine Frau ist tot, ich selbst und mein Sohn sind nur knapp dem Tod entronnen, unser Haus ist geschändet. Und wer weiß, wann diese hasserfüllten Christen wiederkommen, um weiter zu zerstören und zu morden? Deshalb haben wir beschlossen, weit weg zu ziehen, nach Marseille, falls wir es so weit schaffen.“
„Wir sind wirklich in einer verzweifelten Lage, liebe Brüder“, meldete sich jetzt der angesehene Kaufmann Nathan zu Wort, „wenn wir auch niemals die Hoffnung auf Rettung durch den Herrn, den Gott unserer Väter – gepriesen sei sein Name – aufgeben dürfen. Wir stehen vor einer äußerst schwierigen Entscheidung. Die Bedrohung durch die christlichen Bürger der Stadt bleibt natürlich sehr groß, zumal sie den Bischof und den Stadtgrafen mit seinen Soldaten auf ihrer Seite haben. Sicherlich könnten wir auch versuchen, uns zu verteidigen, schließlich sind wir Söhne unserer Helden Josua, Gideon, Simson und David, der als junger Hirt nur mit seiner Steinschleuder dem Riesen Goliath entgegengetreten ist. Doch sind uns die Christen nicht nur zahlenmäßig weit überlegen, wir besitzen auch keine Waffen, wir würden also unsere Familien und uns selbst nur sinnlos opfern. Aber aus Clermont wegzuziehen ist auch ein großes Wagnis. Wohin sollten wir gehen? Werden wir nicht in der Fremde im Elend zugrunde gehen? Das alles muss gründlich bedacht werden.“
Viele wandten ein, Ausbrüche von Gewalt gegen Juden hätte es auch in früheren Zeiten schon gegeben; das ginge auch wieder vorbei. Das Volk würde bestimmt wieder zur Besinnung kommen; man könne sich auch an den König wenden. Die fränkischen Könige seien zwar in letzter Zeit nicht gerade als Freunde der Juden bekannt, aber sie würden es sicher nicht dulden, dass Juden in ihrem Reich in großer Zahl massakriert würden. Man habe hier in Clermont immerhin eine bescheidene Existenz aufgebaut; ein langer und gefährlicher Weg ins Exil würde bestimmt alle ins Verderben stürzen. Während die Männer noch diskutierten, erschien zur großen Überraschung aller ein Bote des Bischofs, ein Diakon in der langen Kutte der Kirchenmänner, in der Versammlung. Sofort herrschte Totenstille. Was hatte das zu bedeuten?
Der Bote begann gleich, zur Versammlung zu reden: „Ich bringe euch eine Botschaft unseres Bischofs. Er lässt euch sagen: ‚Mit Gewalt will ich euch nicht zwingen, den Sohn Gottes zu bekennen, sondern ich verkündige ihn euch nur und streue das Salz des Wissens in eure Seelen. Denn ich bin zum Hirten gesetzt über die Schafe des Herrn, und von euch sagt jener wahre Hirt, der für uns gelitten hat, er habe andere Schafe, die nicht aus seinem Stall seien, die müsse er herbeiführen, auf dass e i n Hirt und e i n e Herde werde. Wenn ihr deshalb glauben wollt wie ich, so sollt ihr mit uns e i n e Herde sein und ich euer Hirte; wenn aber nicht, so verlasst diesen Ort!‘“
Die Botschaft kam für die jüdischen Männer im Bethaus nicht völlig überraschend. Aufforderungen des Bischofs, zum Christentum überzutreten, hatte es ja schon oft gegeben. Doch neu und gänzlich überraschend hatte er jetzt das Ultimatum gestellt: Konvertiert – oder verlasst die Stadt! Was auf sie und ihre Familien zukäme, wenn sie einfach blieben, ohne überzutreten, das wollten sie sich lieber nicht ausmalen. In düsterem Schweigen standen alle in kleinen Gruppen zusammen und starrten mit finsteren Mienen den Boten an. Schließlich trat der Rabbi auf diesen zu und sagte: „Bestelle Bischof Avitus Folgendes: Bis morgen erhält er unsere Entscheidung. Wir müssen untereinander und auch noch mit den Männern in den anderen zwei Lehrhäusern beraten, zu welcher Entscheidung wir kommen. Morgen also werden ich und der Gemeindevorsteher Elieser Bischof Avitus aufsuchen und ihm mitteilen, was wir beschlossen haben.“
Jetzt entspann sich eine noch hitzigere Diskussion unter den verzweifelten Männern. Hinter dem Ultimatum steckte ja zweifellos die gnadenlose Bedrohung der Existenz und des Lebens derer, die sich weigerten zu konvertieren. Es zeigte sich im weiteren Verlauf des Abends, dass die Mehrheit schweren Herzens bereit war, auf die Forderung des Bischofs zur Konversion einzugehen. Die versammelten Männer in den anderen zwei Lehrhäusern waren zuvor auch informiert worden und neigten in ihrer Mehrheit ebenso der Unterwerfung zu.
Am späten Abend kehrten Salomo und Gabriel mit bedrückten Mienen und Trauer im Herzen in ihr Haus zurück, wo sie Rahel schon ungeduldig erwartete. „Nun sagt schon!“, rief sie gleich beim Eintreten der beiden, „wie war es? Sind Beschlüsse gefasst worden?“
Salomo berichtete ihr vom Verlauf der Versammlung. „Und dass wir drei nach dem, was man uns angetan hat, nach dem Mord an meiner geliebten Hanna, eurer Mutter, hier nicht länger bleiben können, das stand für mich sowieso schon fest, auch wenn wir nun das Grab meiner lieben Frau zurücklassen und uns auf eine ungewisse, gefahrvolle Zukunft einstellen müssen.“
Rahel setzte sich erst mal auf einen Schemel und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Der Mord an ihrer Mutter, die Gewalt gegen ihren Vater und ihren Bruder, die Schändung ihres Elternhauses, die Zerstörung der Synagoge, jetzt die massive Drohung des Bischofs – es war alles zu viel. Zum ersten Mal seit dem Tag des Grauens stürzten die Tränen aus ihren Augen, und sie begann, hemmungslos zu weinen, still und in sich zusammengesunken. Sie aß nichts und trank nichts an diesem Abend. Sie legte sich früh hin und weinte bitterlich, bis ein gnädiger Schlaf sie endlich erlöste.
Am nächsten Tag überbrachten Rabbi Samuel und der Gemeindevorsteher Elieser dem Bischof die Nachricht, dass wohl die meisten Juden von Clermont bereit wären, sich taufen zu lassen und Jesus Christus als Sohn Gottes anbeten würden. Der Rest würde, wie gefordert, die Stadt verlassen. Bischof Avitus war natürlich hocherfreut, das zu hören. Er entließ die beiden Abgesandten mit den Worten: „Zu Pfingsten werde ich alle, die wünschen, das Sakrament der Taufe zu empfangen, in der Taufkapelle vor den Toren der Stadt taufen und in die Gemeinschaft der rechtgläubigen Christen aufnehmen. Gelobt sei Gott der Herr, Jesus Christus, sein Sohn, und der Heilige Geist, unser Tröster. Amen.“
Pfingsten war ja bereits in einer Woche. So blieb den Juden, die nicht konvertieren, sondern lieber in die Fremde ziehen wollten, sehr wenig Zeit, um ihre Häuser und Geschäfte zu verkaufen und ihre Sachen zu packen. Es war eine schreckliche Woche. Zum Glück gaben ihnen die Juden, die bleiben wollten, noch halbwegs anständige Preise für alles, was zurückgelassen werden musste. Und was dann noch übrig war, kauften ihnen die Christen hohnlachend zu Spottpreisen ab. Doch es blieb denen, die bereit waren zu emigrieren, ja keine andere Wahl. Sie mussten froh sein, überhaupt mit einigen Silberdenaren im Beutel wegziehen zu können.
Groß war die Zahl der Juden, um die fünfhundert, die schließlich in der Pfingstnacht mit Trauer im Herzen schweigend zur Taufkapelle zogen. Dort wurden sie von der schon wartenden Menge aufgefordert, beim Einzug des Bischofs auf die Knie zu fallen und von ihm die Taufe zu erbitten. Als Bischof Avitus dann einzog, sang der Chor, die Kerzen brannten, die Lampen strahlten, er sah die Scharen der Juden auf den Knien, da übermannte ihn die Freude über seinen Triumph, und es kamen ihm sogar die Tränen. Die Taufe so vieler Menschen dauerte natürlich Stunden, doch Avitus taufte sie alle mit dem Wasser, salbte sie mit dem heiligen Öl und nahm sie im Schoß der Mutter Kirche auf. Sie alle zogen nun zurück zur Stadt in ihren weißen Taufgewändern, wo sie von vielen Schaulustigen begafft wurden. Manche freuten sich aufrichtig über die neu gewonnenen Gemeindemitglieder, doch den meisten stand die bloße Schadenfreude ins Gesicht geschrieben.
Die anderen Juden aber, die sich nicht hatten taufen lassen, saßen derweil trauernd und betend in ihren Häusern, die sie nun für immer verlassen mussten. Totenblass hockte Salomo auf einem Schemel, leise sprach er zu seinen Kindern: „Ein trauriges, bitteres Wochenfest ist dies. Möge Gott uns gnädig sein und uns zum Wochenfest des nächsten Jahres wieder etwas Freude schenken. Unsere Sachen sind ja soweit gepackt, wir sollten uns jetzt lieber beeilen und gleich morgen die Stadt verlassen, zusammen mit den anderen, die dem Gott unserer Väter – sein Name sei gelobt in Ewigkeit – und seiner Thora, die er uns durch Mose geschenkt hat, treu bleiben. Und nun lasst uns beten!“
Zur Vertreibung der Juden aus Clermont am Pfingstsonntag hätte wohl besser ein trüber, regenverhangener Himmel gepasst, doch unerbittlich schien die Sonne auf den Treck der Vertriebenen herab, als ob sie kein Gefühl hätte für das Leid dieser Unglücklichen. Die Christen aber standen am Wegesrand, lachten und feixten, verhöhnten und verspotteten die Menschen, die bis jetzt friedlich mit ihnen in derselben Stadt gelebt hatten. Manche riefen sogar: „Man sollte ihnen den Rest geben!“ „Wir behandeln sie noch viel zu gut!“ „Man sollte sie fertig machen!“ Doch der Stadtgraf Venerandus hatte Soldaten an der Straße postieren lassen, um weitere Übergriffe gegen die Juden zu verhindern. Der eine oder andere christliche Bürger aber saß grübelnd in seinem Haus und trauerte darum, dass es in seiner Stadt so weit gekommen war.
Langsam und schwerfällig schleppte sich der Zug der Vertriebenen – es waren wohl einige hundert – auf der gepflasterten Römerstraße nach Süden dahin. Man war übereingekommen, bis nach Marseille zu marschieren. Manche hatten ihre Habseligkeiten auf Karren geladen, die von Maultieren und Eseln gezogen wurden, auch die ganz alten Frauen und Männer sowie die allerkleinsten Kinder durften darauf mitfahren. Alle anderen schritten zu Fuß nebenher, niedergedrückt von ihrem Gram, ihrer Trauer um ihre Heimat und alles, was sie verloren hatten. Gleichzeitig bedrückte sie die Furcht vor dem, was vor ihnen liegen mochte.