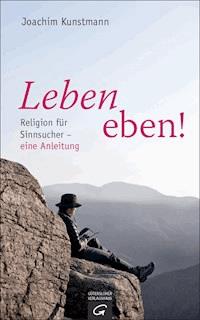10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Lebensdeutung statt Museums-Religion
Vor 2000 Jahren stellte eine tiefgreifende Erfahrung das Leben einiger Menschen auf einen neuen Grund. Aus dieser Erfahrung entstand das Christentum. Heute sind existenzielle Erfahrungen und deren Deutung aus der Kirche ausgewandert – ebenso wie das religiöse Erleben. Kirche praktiziert Glaubenslehren und rituelle Routinen, die kaum noch Bezug zum Leben der Gegenwart aufweisen.
Kann das wieder anders werden?
Es muss wieder anders werden, wenn Kirche und Christentum eine Zukunft haben und die Menschen wieder erreichen wollen. Das ist die These dieses Buches.
Joachim Kunstmann zeigt: Kirche kann zu einem Ort für die Religion der Menschen werden. Sie muss diese entscheidende Aufgabe nur anpacken und die längst überfällige Veränderung wagen.
- Religiöse Erfahrung statt staubige Tradition
- Gegen die Erlebnisvergessenheit der Kirchen
- Kirche als Ort lebendiger Erfahrung neu gestalten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Vor 2000 Jahren stellte eine tiefgreifende Erfahrung das Leben einiger Menschen auf einen neuen Grund. Aus dieser Erfahrung entstand das Christentum. Heute sind existenzielle Erfahrungen und deren Deutung aus der Kirche ausgewandert – ebenso wie das religiöse Erleben. Kirche praktiziert Glaubenslehren und rituelle Routinen, die kaum noch Bezug zum Leben der Gegenwart aufweisen.
Kann das wieder anders werden?
Es muss wieder anders werden, wenn Kirche und Christentum eine Zukunft haben und die Menschen wieder erreichen wollen. Das ist die These dieses Buches.
Joachim Kunstmann zeigt: Kirche kann zu einem Ort für die Religion der Menschen werden.
Joachim Kunstmann, geboren1961, ist Professor für Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.
Joachim Kunstmann
Ein Ort für das Leben
Der Weg zur religiösen Erneuerung der Kirche
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht gelungen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.
Copyright © 2022 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81 673 München
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv: © eugenesergeev – iStockphoto.com
ISBN 978-3-641-29691-9V001
www.gtvh.de
Man soll die Religion nicht den Religiösen überlassen
Kerim Pamuk
Inhalt
Einleitung
I Religionsbedarf
Die religiöse Lage und die Kirchenreligion
1 Religiöse Erfahrung und Kirchenreligion
2 Säkulare Lebenswelt und individualisierte Religion
3 Moderne Krisenerfahrung und das religiöse Versagen der Kirche
II Rettet die Kirche!
Warum die Kirche nicht ersetzbar ist
1 Das Wissen der Religion
2 Die Unverzichtbarkeit der Kirche für die Gesellschaft
III Zwei vor zwölf
Vom Zustand der Kirche
1 Alarmzeichen
2 Die Insel der Harmonieseligen
3 Religionsfreie Reformversuche
IV Traditionsverhaftung
Das kirchliche Grundproblem
1 Das traditionalistische Selbstbild der Kirchen
2 Ein Gang durch das Glaubensmuseum
3 Warum das so kommen musste – historische Hintergründe
V Symbolische Lebensdeutung
Die Aufgabe der Kirche
1 Religiöse Kommunikation
2 Anleitung zu religiösem Verstehen
VI Was zu tun ist
Konkrete Schritte
1 Fahrplan für einen Neubeginn
2 Vom Willen zur Veränderung
3 Konkrete Ideen
Literatur
Anmerkungen
Eine Gesellschaft ist lebendig, dynamisch und kreativ, wo sie die radikale Kritik nicht Außenstehenden überläßt, sondern selbst betreibt, wo also Selbstkritik möglich ist, wo sie sogar institutionell gefördert wird … Wie anders könnten sich religiöse und politische Zustände weiterentwickeln, wenn ihre Wahrheiten nicht immer wieder neu attackiert, sie durch die Kritik nicht immer wieder zu neuen Antworten gedrängt würden?
Navid Kermani1
Einleitung
Wozu noch Religion? Haben Religion und Kirche nicht ihre beste Zeit längst hinter sich? Sollte man sie nicht endlich aus dem modernen Leben verabschieden?
Keineswegs. Religion und Kirchen werden so dringend gebraucht wie nie zuvor.
Die Religion verfügt über ein Lebenswissen, das gerade im seelisch auszehrenden modernen Leben immer unverzichtbarer wird. Einsamkeit, Stress, Ängste, Erschöpfungserscheinungen und Sinnlosigkeitsgefühle greifen um sich. Die großen Lebensfragen bleiben ohne Mythen und Erzählungen ohne Stimme. Was wir dringend bräuchten, ist eine symbolische Verständigung zu den großen Erfahrungen zwischen Erfüllung und Schmerz, Liebe und Endlichkeit, Schicksalsschlag und Gelassenheit, Wertlosigkeitsgefühl und Sinn.
Genau das aber ist Religion: symbolische Kommunikation über die großen Erfahrungen und Fragen des Lebens. Religion bezieht diese Erfahrungen auf etwas, das größer ist als wir selbst. Darin ist Religion nicht ersetzbar, und auch in säkularen Zeiten bleibt sie darum von allgemeiner Bedeutung.
Mit »Religion« sind hier keine Glaubenslehren gemeint und auch kein Set von moralischen Verhaltensregeln, sondern das Orientierungsmuster, das für Menschen von letzter und unersetzbarer Bedeutung ist. Das also, was ihrem Leben Richtung gibt und ihr Leben prägt. Und das hat wenig mit Überzeugungen zu tun. Es kommt eher aus einem tiefen Erleben.
Man kann auch ohne Religion leben. Ebenso wie man ohne Freundschaft, ohne Liebe und ohne erfüllende Arbeit leben kann. Nur: Man lebt dann gar nicht wirklich. Genau dieses Gefühl, gar nicht wirklich zu leben, scheint die latente Angst zu sein, die in den modernen westlichen Gesellschaften zunehmend um sich greift. Die wache Präsenz im Hier und Jetzt, die »Achtsamkeit«, wird immer mehr zu einer unerfüllten Sehnsucht.
Wir brauchen die Religion. Und für solche Religion sind die Kirchen unverzichtbar. Denn es gibt in unserer Gesellschaft keine anderen Gemeinschaften, die so viel menschliche Erfahrung und kluges Lebenswissen bewahren und weitergeben. Und keine andere Gemeinschaft verfügt über ein vergleichbar flächendeckendes Netz von sakralen Räumen, in denen eine symbolische Kommunikation über die Lebensfragen möglich wäre.
Das Selbstverständnis der religiösen Kultur in den Kirchen steht allerdings dringend zur Revision an: Die Kirchen sind nicht, wie heute vielfach missverstanden, Orte für Glaubenslehren, die den Menschen zu vermitteln wären. Kirchen bieten auch kein sakral aufgeladenes Moralsystem. Und schon gar nicht die trostreiche Flucht in eine Parallelwelt. Kirchen sind Orte für die Religion der Menschen, für die Inspiration, die aus der Deutung der großen Erfahrungen des Lebens entsteht.
Angesichts der tiefen Krise der Kirchen kann die Revision nicht wohlwollend-harmlos daherkommen. Gewohntes muss infrage gestellt, der dramatische Bedeutungsverfall und seine Ursachen müssen benannt werden. Das ist unangenehm und provoziert Gegenreaktionen. Man wird mir die Lust am Untergang vorwerfen. Meine Absicht ist das genaue Gegenteil: religiöse Erneuerung.
Krisen können Zeiten hoher Produktivität sein – wenn man sich auf die eigenen Ressourcen besinnt und grundsätzliche Fragen zulässt. Wenn Kirche – egal welcher Konfession – Ort für die Religion der Menschen sein soll, dann ergeben sich zwei Fragen, die in diesem Buch mit allem Nachdruck gestellt werden:
Wie religionsfähig ist die Kirche?2 Empfiehlt sie sich als Anwältin heutiger Religion? Oder ist sie nur der Ort einer uralten Glaubenstradition, die niemanden mehr erreicht? Und zweitens:
Wie individualitätsfähig ist die Kirche? Nimmt sie den heutigen Menschen eigentlich wahr mit seinen Erfahrungen und Fragen? Oder behandelt sie ihn lediglich als Adressaten einer Botschaft, die längst unverständlich und uninteressant geworden ist – oder gar nur als Statisten, der sich ins kirchliche System einzufügen hat?
Religion ist die symbolische Verständigung über die Lebensfragen. Darum geht sie alle an, auch die Kirchendistanzierten; und selbst die vielen, die jeder Religion gegenüber auf Abstand gehen, geht Religion oft mehr an, als sie selbst vielleicht meinen. Und darum muss eine Kirche, die Ort und Platzhalter der Religion sein will, eine für alle offene Kirche sein. Sie kann sich weder auf die Kirchenmitglieder beschränken, noch auf die kleiner werdende Schar der Frommen, für die Glaubensbekenntnis, Bibellektüre und Sonntagskirchgang die Kennzeichen des Christseins sind. Kirche muss Platz bieten für verschiedene Stile von Religiosität. Sie muss vor allem ein Ort für diereligiös Suchenden sein.
Diese prinzipielle Offenheit bedeutet aber gerade nicht, dass die Kirche für jeden ein eigenes Angebot machen müsste. Das ist der Weg, den sie gerade beschreitet und der zunehmend in die Diffusion führt. Im Gegenteil: Es bedeutet, scheinbar paradox, die Konzentration auf daseine, das alle angeht – auf Religion. Die eine Aufgabe der Kirche ist die symbolische Deutung, also die erzählende, bildliche, musische oder spielerische Kommunikation der großen existenziellen Erfahrungen und Fragen. Wo das verstanden wird, wächst die Attraktivität der Kirche wie von selbst.
Das gilt für beide großen Kirchen gleichermaßen, die katholische wie die evangelische. Daher ist hier in der Regel von der Kirche die Rede. Nur wo die Unterschiede gravierend sind, wird von den Kirchen in der Mehrzahl gesprochen. Das mag im ersten Moment überraschen. Denn die katholische Kirche hat eine deutlich sichtbare Tendenz zur sakralen Routine, während die evangelische zur alltags-profanen Moral neigt. Es wird sich aber zeigen, dass die Logik hinter diesen Ausdrucksformen verblüffend gleich ist.
I Religionsbedarf
Die religiöse Lage und die Kirchenreligion
Der Verzicht auf die Suche nach dem Absoluten, eine Welt ohne große Wahrheitsansprüche und religiöse Leidenschaften wäre … der Triumph der Banalität.
Jan Ross3
1 Religiöse Erfahrung und Kirchenreligion
Vaclav Havel, tschechischer Dichter und Politiker, hat mehrere Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht. In einem Brief an seine Frau erinnert er sich an einen Moment,
»als ich an einem heißen, wolkenlosen Sommertag auf einem Haufen rostigen Eisens saß und in die Krone eines mächtigen Baumes blickte, der in erhabener Ruhe alle Zäune, Drähte, Gitter und Wachtürme überragte, die mich von ihm trennten. Ich betrachtete das unmerkliche Beben seiner Blätter auf dem Hintergrund des unendlichen Himmels, und allmählich beherrschte mich völlig ein schwer zu beschreibendes Gefühl. Mir schien, daß ich mich auf einmal hoch über alle Koordinaten meines momentanen Daseins und der Welt erhoben hatte in eine Art ›Über-Zeit‹ der totalen Gegenwart alles Schönen, das ich je gesehen und erlebt hatte. Eine versöhnte, ja fast zärtliche Zustimmung zu dem unausweichlichen Lauf der Dinge, wie sie mir dieser Standpunkt eröffnete, verband sich in mir mit der sorglosen Entschlossenheit, bis zum Ende all dem entgegenzutreten, dem man entgegentreten muss. Das tiefe Staunen über die Souveränität des Seins verwandelte sich in den Taumel unendlichen Fallens in den Abgrund seines Geheimnisses. Die uferlose Freude daran, daß ich lebe, daß mir gegeben war, all das zu durchleben, was ich durchlebt habe, und daß dies alles offenbar einen tiefen Sinn hat, verband sich in mir mit dem unbestimmten Schrecken vor der Unfassbarkeit und Unerreichbarkeit all dessen, an das ich gerade in diesem Moment, am ›Ende der Endlichkeit‹ selbst angelangt, so dicht herantrete. Ich war durchflutet von einer Art höchst glücklichem Einklang mit der Welt und mir selbst, mit diesem Augenblick, mit allen Augenblicken, die er mir vergegenwärtigt, auch mit all dem Unsichtbaren, das hinter ihm ist und Bedeutung trägt.«4
Eine religiöse Erfahrung. Es tut wenig zur Sache, ob, wer so etwas erlebt, da von Religion spricht oder nicht. Wichtiger ist, dass jeder Mensch so eine Erfahrung nachvollziehen kann, auch wenn er oder sie selbst sie so nicht erlebt hat. Es ist die Erfahrung einer tiefen Präsenz, eines erfüllten Augenblicks und vor allem: des Einsseins mit dem großen, alles umgebenden Leben.
William James hat in seinem epochalen Werk »Die Vielfalt der religiösen Erfahrung«5 bereits 1901 eine Fülle solcher Berichte gesammelt und mit großem Respekt besprochen. Er ist damit einer Spur gefolgt, die der Theologe Friedrich Schleiermacher 1799 gelegt hatte: Religion, so Schleiermacher, ist wesentlich kein Denken, kein Wissen, nicht einmal eine Überzeugung, sondern ein Gefühl. Religion ist nicht Theologie und nicht Moral, sondern vor allem Wahrnehmung, gesteigertes Präsenzgefühl, Ergriffenheit, Erfahrung des Bedeutsamen und des Heiligen. Sie ist der mit Faszination und Schrecken gemischte Schauer, der das Leben in ein neues Licht tauche, wie auch die folgenden Zitate deutlich machen.
»Ich erinnere mich an die Nacht und fast genau an die Stelle oben auf dem Berg, wo meine Seele sich gleichsam ins Grenzenlose öffnete … Die gewöhnliche Empfindung für die Dinge um mich herum verblaßte. In diesem Augenblick gab es nur eine unaussprechliche Freude und Verzückung. Es war wie die Wirkung eines großen Orchesters, wenn alle Einzelstimmen zu einer langsam anschwellenden Harmonie verschmolzen sind, die dem Zuhörer das sichere Gewühl gibt, daß seine Seele emporgehoben wird und an der inneren Erregung beinahe zerbirst.«
»Auf dem Rückweg hatte ich plötzlich, ohne Vorwarnung, das Gefühl, im Himmel zu sein – ein Zustand inneren Friedens und Freude und Gewissheit von unbeschreiblicher Intensität, begleitet von dem Empfinden, in einem warmen Lichtglanz zu baden, so als hätten die äußeren Grenzen nach innen gewirkt – ein Gefühl, die Grenzen des Körpers verlassen zu haben.«6
Die religiöse Erfahrung ist ur-menschlich. Es gibt sie in allen Abstufungen: von der Gänsehaut bis zur ekstatischen Ergriffenheit. Sie führt zu einem neuen Blick auf die Welt und das Leben. Oft ist es, als sehe man zum ersten Mal richtig. Das Leben ist kostbarer, als man je gedacht hatte, es ist tief bedeutsam. Automatisch entsteht so eine Haltung der Achtung und des umfassenden Respekts, also das, was man früher Demut nannte. So kann die religiöse Erfahrung zu einem Wechsel des Orientierungsrahmens führen. Man bekommt plötzlich ein ganz neues Gefühl für das, was wirklich wichtig ist. Meist ist das erheblich weniger, als man bisher dachte: nicht Geld, Ansehen, Status, Erfolg, Pläne …, sondern das Leben selbst: Es ist ein Geschenk, leben zu dürfen. Dankbarkeit, Gelassenheit und Lebensfreude können sich einstellen.
Religion ist symbolische Sinndeutung, so könnte man zusammenfassen. Denn das ganze Leben erhält mit ihr einen großen übergreifenden Zusammenhang, was auch im Begriff re-ligio zum Ausdruck kommt, der wörtlich »Verbindung« bedeutet. Zugleich ist Religion Lebenssteigerung, wie William James pointiert formuliert hat.
Religiöse Erfahrung lässt sich als ein intensives Erleben verstehen, das sich unmittelbar mit Fragen existenzieller Art verbindet. Was ist das Leben? Wer bin ich eigentlich? Was ist Glück? Warum trifft mich dieses Schicksal? Was bedeutet dieser Schmerz, und wie gehe ich mit ihm um? Das religiöse Erleben kann spontan geschehen und den Menschen im Alltag widerfahren: bei einem Spaziergang in der Natur, beim Sport, in der Begegnung mit Menschen und natürlich bei der Ausübung einer religiösen Praxis oder im Kirchenraum. Häufig aber stellt es sich in Momenten existenzieller Bedeutsamkeit ein: wenn Tod, Schmerz, ein Schicksalsschlag, Erfüllung, Befreiung oder Wandlung erlebt werden.
Der Philosoph Norbert Bolz spricht hier zutreffend von den »zu großen Fragen«, die dann aufbrechen. Prägende Erfahrungen haben also zwei zusammenhängende Aspekte: das Erleben selbst und die daraus entstehenden Gedanken und Fragen. »Religiös« ist ein solches Erleben dann, wenn es in einen übergreifenden Deutungsrahmen gestellt, also auf etwas bezogen wird, das der eigenen Verfügung entzogen ist: Gott, das Schicksal, die christliche Tradition usw. Erinnerte, prägende oder gedeutete Erlebnisse sind Erfahrungen; religiöse Erlebnisse können so zu religiösen Erfahrungen werden. Meist werden beide Begriffe aber auch synonym gebraucht. Oft ist das Erleben so tief und prägend, dass es von sich aus deutend wirkt: Das ganze Leben kann in den Momenten solchen Erlebens in neuem Licht erscheinen. Sehr oft haben Menschen, die solche Erlebnisse haben, darum den Eindruck: Jetzt erst sehe ich wirklich.
Ähnlich wie das Verliebtsein entziehen sich solche Erfahrungen einer logischen Erfassung oder begrifflichen Beschreibung. Sie brauchen darum symbolische Formen, damit sie ausgedrückt und mitgeteilt werden können: Erzählungen, Gleichnisse, Poesie, Legenden, Bilder, Musik. Religion hält ein ganzes Arsenal solcher Symbolisierungen bereit. Religiöse Tradition ist symbolischer Niederschlag von tiefer Erfahrung, die für die existenziellen Erlebnisse und Fragen der Menschen eine orientierende Deutung anbietet.
Warum aber gelingt es der Kirche immer weniger, die Erfahrungen der Menschen im christlichen Traditionsrahmen zu verorten?
Ich werde nie das Wochenendseminar über »religiöse Erfahrung« in einem Tagungshausvergessen, zu dem ich vor Jahren selbst einen Beitrag geleistet habe. Beeindruckend war schon, dass die Tagung fast dreimal überbucht war und viele Interessierte gar keinen Platz mehr bekommen hatten. Unvergesslich sind mir viele Berichte der Teilnehmenden von ihren tiefen Erlebnissen geblieben. Es wurde deutlich, dass für sehr viele Menschen tiefe und prägende religiöse Erfahrungen etwas ganz Selbstverständliches sind.
Eine Teilnehmerin erzählte dann, dass die Intensität ihrer eigenen Erfahrung sie dazu gedrängt habe, sich einem Priester anzuvertrauen. Der aber habe vollkommen hilflos reagiert: »Vielleicht sollten Sie mal in Therapie gehen!« Es stellte sich heraus: Sehr viele andere hatten ganz ähnliche Reaktionen vom kirchlichen Personal erlebt. Kannte die Kirche die religiöse Erfahrung nicht? Konnte Sie nicht (mehr) damit umgehen?
Viele Menschen vermeiden es auf diesem Hintergrund inzwischen, lebensprägende Erfahrungen als »religiös« zu bezeichnen, und nennen sie lieber »spirituell«. Offensichtlich wollen Menschen die Nähe zu dem, was sie als Kirchenreligion wahrnehmen, vermeiden. Eine der häufigsten Antworten bei Befragungen zur eigenen Religiosität lautet: »Ich bin schon religiös – aber natürlich nicht so, wie die Kirche das sieht.« Offensichtlich wird die Kirche nicht mehr als Ort wahrgenommen, an dem das eigene religiöse Erleben einen Platz findet. Wir werden sehen, dass das auch für die existenziellen Fragen gilt.
Entsprechend ist die Einstellung gegenüber dem, was als »Kirchenreligion« wahrgenommen wird, sehr negativ. Als Kirchenreligion gilt ein Sortiment an alten Glaubenssätzen, das man offenbar nur »nachglauben« kann. Solcher »Glaube«, also das Für-wahr-Halten dogmatischen Glaubenswissens, gilt in Umfragen heute durchgehend als Schwäche von Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Die Glaubenssätze der Kirche stehen inzwischen also im Ruf eines Trostpflasters für diejenigen, die sich nicht selbst zu helfen wissen. In der Psychotherapie werden »Glaubenssätze« als innere Blockierungen verstanden, die vom Leben abhalten. Wer selbstverantwortlich und autonom sein will, wird zu dieser Kirche also auf Distanz gehen. Entsprechend ist man heute nicht mehr religiös und schon gar nicht mehr kirchlich, sondern normal. Das ist nicht die Einstellung von kritischen Außenseitern, sondern Mehrheitsmeinung.
Das kirchliche Glaubensgebäude erscheint also offensichtlich als ein Museum für Antiquitäten, die nur noch Spezialisten inspirieren können. Steht die Kirche in der Weise, wie sie religiöse Gehalte vertritt, einer nachvollziehbaren Religion entgegen? In der Tat: »An Offenbarung als Archivgut kann außer dem Archivar … niemandem gelegen sein.«7
Die Religion vieler, wenn nicht der meisten modernen Individuen ist längst eine weitgehend freie, unverbindliche, schweifende und sehr persönliche geworden. Sie findet in der Kirche allerdings kaum Anknüpfungspunkte. Darum wenden sich auch religiös Interessierte von der Kirche ab und z. B. dem Buddhismus, einer freien Spiritualität oder der Therapieszene zu.
Wo in der Kirche gibt es bewusst gestaltete Orte und Zeiten religiöser Erfahrung? Der religiösen Kommunikation? Der Begleitung religiöser Entwicklung? Symptomatisch ist, dass die deutlich größte Anzahl an regelmäßiger Beteiligung in der Kirche in Chören stattfindet. Kirchenmusikalische Veranstaltungen ziehen bei Weitem die meisten Leute in die Kirchen. Denn die Musik ist dem religiösen Erleben erheblich näher, als es die Auslegung alter Texte oder ein Routinesakrament je sein könnten. Und auch überall dort, wo die Kirchen Angebote für individualisierte und erlebbare Religion machen, werden sie nachgefragt. Das gilt für Andachten im Taizéstil, für die Kasualhandlungen, die Kirchentage, für Nachtgottesdienste, Ostermorgenfeiern und natürlich für die Weihnachtsgottesdienste. Alle diese Angebote bleiben aber deutlich am Rand der kirchlichen Arbeit.
Kirchenreligion und religiöse Erfahrung sind offenbar in einen Gegensatz geraten. Erstere gilt als überholt, Letztere wird zur Privatsache. Damit wird deutlich: Es ist die Individualisierung der Religion, die 500 Jahre nach der Reformation das gesamte weltliche und religiöse Leben durch und durch prägt, in den Kirchen aber noch immer nicht wirklich angekommen ist. Lebendige Religion ist ein subjektives großes Erleben. Sie kreist um Gefühle und tiefe Lebenserfahrungen. Auch bei gläubigen Traditionschristen, ja selbst beim kirchlichen Personal dürfte es kaum jemanden geben, dessen eigene religiöse Biographie nicht durch derartige Erlebnisse und Erfahrungen bestimmt ist.
2 Säkulare Lebenswelt und individualisierte Religion
Die Untersuchung »Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft«8 – derzeit die differenzierteste und genaueste zur Lage der Religion in den westlichen Gesellschaften – bemerkt eine »vollständige religiöse Individualisierung und Konsumorientierung«.9 Die »Konfessionslosen« (besser eigentlich: Religionsdistanzierte oder Agnostiker) stellen inzwischen die »schweigende Mehrheit«. Ihre Weltanschauung ist ein Materialismus, der Religion für Einbildung hält. Er orientiert sich an Naturgesetzen und greifbaren Fakten und trifft eine schlichte Kosten-Nutzen-Abwägung: Was bringt mir das?
Wir haben heute eine eigenartig vielfältige Situation vor uns: Auf der einen Seite stehen massive Vorurteile gegenüber der Religion. Das Weltbild der meisten Menschen ist positivistisch. Es orientiert sich an der Naturwissenschaft und hält nur das für real, was sich messen und berechnen lässt. Auf der anderen Seite gibt es ein massives Anwachsen fundamentalistischer Religionsformen, die sich vehement gegen alle Ideen der Moderne richten (und sie technisch dennoch nutzen). Dazwischen liegt das breite Feld der religiösen Individualisten, die sich weder auf die eine, noch auf die andere Seite zuordnen lassen. Die überkommene kirchlich geprägte Frömmigkeit halten sie für naiv, die Wissenschaft für lebensfern. Ihre Religiosität hat oft die Form einer Bricolage, sie ist also aus verschiedenen religiösen Elementen zusammengebaut. Sie ist entsprechend flüchtig und unverbindlich. Vereinfacht kann man sagen: Die kulturell sichtbare Religion verliert an Bedeutung, während gleichzeitig mit der naturalistischen Haltung die individualisierte Religiosität immer weiter anwächst. Sie ist derzeit das Feld religiöser Lebendigkeit, bleibt aber weitgehend unstrukturiert und institutionell unsichtbar.
Der kanadische Soziologe und Philosoph Charles Taylor hat diese religiöse Lage in seinem epochalen Werk »Ein säkulares Zeitalter«10 umfassend recherchiert und eine eindringliche Beschreibung unserer Zeit geliefert. Taylor nennt die Position zwischen dem atheistischen Materialismus auf der einen und der kirchlich tradierten Religion auf der anderen Seite einen »mittleren Zustand«. Mit ihm ist eine tiefe Unruhe und Unzufriedenheit verbunden: Man weiß, dass der Materialismus nicht alles sein kann, weil er keine Bedeutung kennt und die Lebensfragen außen vor lässt. Die überkommene Religion aber, die dem Leben einst Bedeutung gab, hat man verloren; zu ihr gibt es nur noch eine Sehnsuchtsbeziehung. Allzu oft gerät man in diesem mittleren Zustand dann aus dem Gleichgewicht – in aller Regel, weil Sinnlosigkeitsgefühle auftauchen. Die wissenschaftlich-materialistische Weltsicht bewertet Taylor dabei keineswegs als höher oder besser als die religiöse, auch wenn der Materialismus sich überlegen gibt. Sie erscheint eher wie eine künstliche Zurechtlegung und gleicht darin einer Ideologie.
Es lohnt sich, Taylors Blick zurück als Kontrast heranzuziehen: Das tief religiöse Mittelalter mag religionsfreie Bereiche gehabt haben, in seiner Weltauffassung aber erscheint es gegenüber der heutigen Weltwahrnehmung als ein geradezu magisches Zeitalter der Verzauberung. Alltag und ausgelassene Festzeiten, Arbeit und Zeiten der Orgien, der Umkehrung und des Spotts waren aufeinander abgestimmt. Diese Spannung stellte die Energie für das Leben bereit. Komplementär aufeinander bezogen waren auch die einfache Frömmigkeit und die hohe asketische Religion der Mönche und vieler Kleriker, also des geistlichen Personals. König und Priester waren Repräsentanten einer höheren Ordnung, die an vielen Stellen spürbar ins Leben eingriff. Dinge konnten heilig sein, aber auch dämonisch. Alles hatte eine Bedeutung, alles war Platzhalter für einen tieferen Sinn.
Die Spannung zwischen Ideal und normalem Leben führte, so Taylor, bereits im späten Mittelalter immer wieder zu Versuchen des Ausgleichs. Alle sollten ein heiliges Leben führen, nicht nur die Kleriker oder die Mönche. Immer wieder gab es Reformen und Reformversuche. Die lutherische Reformation hat dann das ganze Leben als geheiligt verstanden, inklusive des Alltags, des Ehestands, der Arbeit und der Polizei. Damit ist aus frommer Motivation heraus eine Angleichung geschehen, die nach Taylor eine regelrechte »Ordnungswut« entfaltet hat: Das gesamte Leben sollte ordentlich, moralisch und tugendhaft werden – und zwar aus ursprünglich religiösen Gründen.
Damit aber stellte sich die gesamte Lebensorientierung um. Seit der Reformation gibt es eine »Feindseligkeit gegen die Mysterien«: Reliquienverehrung, Marienfrömmigkeit, die päpstliche Autorität, heilige Stätten, Wallfahrten und Amulette lösten jetzt einen regelrechten Widerwillen aus. Das nahm den Menschen zwar die Angst vor dem Einfluss des Teufels, ließ das Leben aber auch verarmen. Denn alles unterstand jetzt einer rationalen Ordnung. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass diese neue Wahrnehmung der Welt zwar durch die Religion ermöglicht wurde, sich dann aber selbstständig machte und von religiösen Vorstellung löste. Die moralische und die staatliche Ordnung konnten auch ohne religiöse Motive allein durch rationale Vernunft gestaltet werden.
In der späten Moderne ist das gesamte Leben von einer tiefgreifenden »Entzauberung« (Max Weber) bestimmt. An die Stelle des Heiligen ist kühle Kalkulation getreten. Alle Zwecke werden vom Menschen gesetzt, sie dienen seinem Wohlstand. Die Wirklichkeit besteht aus rationalen Gesetzmäßigkeiten, so etwas wie »Bedeutung« lässt sich gar nicht nachweisen. Liebe, Ergriffenheit, Schönheit, Kreativität und Empathie entziehen sich einer wissenschaftlichen Beschreibung. Damit ist ein geschlossenes »stahlhartes Gehäuse« (Max Weber) der Ernüchterung entstanden, das immer mehr in ein Gefühl der Bedeutungslosigkeit, des existenziellen Mangels und der Sinnleere umschlägt. »Die Regeln des modernen ›wissenschaftlichen‹ und analytischen Denkens privilegieren den unpersönlichen ›Blick von nirgendwo‹, den ›erfahrungsfernen‹ Standpunkt. Daher hat dieses Denken die Tendenz, uns zur systematischen Entwertung intuitiver Einsichten zu veranlassen«11, so Taylor. Sein Fazit: Das Leben in einer säkularen Zeit ist nicht das normale, sondern es ist »beunruhigend«.
Zwischen pragmatisch-materialistischer Ernüchterung und religiösem Fundamentalismus liegt also das Feld einer individualisierten Religion; einer Religion, für die jeder Mensch selbst zuständig ist, und die ebenso wie alles andere der Nutzenorientierung (»Was bringt mir das?«) unterstellt wird. »Individualisierung«12 bedeutet die Freisetzung der Menschen aus sozialen und geistigen Vorgaben, in die das Leben bisher eingebunden war. Milieu, Herkunftsbestimmungen, feste soziale Bindungen, Normen und Traditionen haben keine Definitionsmacht für den Lebensweg des Einzelnen mehr. Beruf, Partner, Wohnort, Werte, Lebensziele: Alles wird zur Sache freier Verfügung. Das bedeutet Freiheit. Es bedeutet aber auch ein hohes Risiko: Wenn alles Sache der eigenen Entscheidung ist, dann bedeutet das einen Verlust an Selbstverständlichkeit und an Orientierungsklarheit. Und jedes Scheitern wird zur Sache eigener Verantwortung. Es gibt niemanden mehr außer mir selbst, der für mein Leben zuständig ist.
»In sämtlichen Angelegenheiten nimmt das Subjekt bei sich selbst Maß.«13 In Sachen Religion heißt das: Nicht mehr die Kirche, sondern das Individuum ist Verantwortungsträger und Gestalter. Nur noch für eine sehr kleine konservative Minderheit kann die Kirche als Religionssouverän gelten. Für die individualisierte Mehrheit wird sie nur noch in der Rolle eines Gestalters und Förderers individueller Religiosität nachgefragt.
Man mag das bedauern oder für falsch halten: Religion wird heute am konkreten Lebensbezug gemessen. Plausibilität erhält Religion durch Relevanz. Und relevant ist, was mein eigenes Leben betrifft. Autonomie und Selbstbestimmung sind längst und umfassend zu grundlegenden Selbstverständlichkeiten geworden. Fast könnte man von einer »Sakralisierung« der eigenen Individualität sprechen. Als heilig gilt, was mein Leben und das Leben meiner nahen Angehörigen schützt und fördert.
Was bisher von oben, von Gott erwartet wurde, rückt seit der Aufklärung in die eigene Verantwortung. Wunder sind keine Fakten, sondern Ausdruck einer Erfahrung. Offenbarungen geschehen nicht mehr als Überschreitung von Naturgesetzen, sondern spielen sich im Inneren des seelischen Erlebens ab. Das ist wiederum ein Gewinn an Freiheit, aber auch ein Verlust an Eingebundenheit. Und es führt dazu, dass religiös Suchende von der Kirche heute fast nichts mehr erwarten. »Als religiös Obdachlose rechnen sie nicht mehr damit, hinter diesen Mauern etwas anderes zu finden als die oberhirtlichen Verwaltung einer rigiden Moral und einer lebensfernen Glaubensdoktrin.«14
Das ist auch Taylors Diagnose: An die Stelle der verlorenen religiösen Tiefe ist im »Zeitalter der Authentizität« die Selbstfindung gerückt. Sie ist das produktive Element der religiösen Individualisierung. Religiöse Praxis und religiöses Leben werden nicht nur selbst gewählt, sie müssen mich auch »ansprechen« und meine Selbstentwicklung fördern. Eine Einbettung dieser Religiosität in ein umfassenderes System, etwa in eine von allen geteilte Überzeugung oder eine religiöse Gemeinschaft, ist nicht mehr nötig. Damit ist ein Gewinn verbunden: die Befreiung von erzwungener Konformität und religiösem Machtmissbrauch.15 Die Kehrseite aber ist: Religiosität wird auch flüchtiger – mehr zu einer Suche als zu einer Gewissheit.
Die individualisierte Religion ist eine »verflüssigte Religiosität« (Volker Drehsen). Sie leitet sich nicht mehr aus religiösen Traditionen her und sie stellt keine Forderungen mehr an logische Zusammenhänge. Auch hat sie kaum noch ein Verlangen nach Konformität. Die Unterschiede zwischen den Konfessionen sind ihr nicht mehr wichtig. Wichtig ist ihr der konkrete Lebensbezug. Es sind dabei vor allem die großen Erfahrungen der Brüche und Diskontinuitäten in der eigenen Biographie, die Anlass zu religiösen Fragen und Deutungen geben: Scheitern, Trennung, Tod, Krankheit, Vergeblichkeit, Unglück lassen die Frage nach dem Sinn meines Lebens und meiner eigenen Geschichte wach werden. Die Frage nach dem wahren Glauben dagegen wird praktisch nirgendwo mehr gestellt. Auch nicht mehr die Frage Luthers nach einem gnädigen Gott.
Das Existenzproblem der Kirche besteht heute im Kern darin: Sie muss sich auf Religion unter den Bedingungen der Individualisierung einlassen. Die Beschwörung von »Glauben« und »Gemeinschaft« ist keine überzeugende Antwort mehr, im Gegenteil: Sie ist das Problem.
Individualisierung aber ist gar kein kirchlicher Fremdkörper, im Gegenteil: In der religiösen Tradition ist sie sogar eine besondere Triebkraft! Man muss nur an Jesus, Franz von Assisi, Meister Eckhart und Martin Luther denken. Sie alle waren religiöse Individualisten, störten das überkommene religiöse System – und haben es gerade so geprägt und lebendig gehalten.
Mehr noch: Die christliche Religion ist die eigentliche Erfinderin der Individualität – lange bevor der Humanismus der Renaissance das Individuum (wieder)entdeckte. Nirgendwo sonst ist der einzelne Mensch so radikal in die je eigene Verantwortung gestellt. Die alte Tradition der Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel hat Jesus auf jeden Einzelnen konzentriert. Jeden Menschen spricht er als konkreten Einzelnen in einer konkreten Lage an. Denn jeder Mensch ist anders, hat andere Nöte und ein anderes Maß an Vertrauen und Liebe. Jesus selbst war ein großer Einzelgänger, so wie die meisten Großen der Religionsgeschichte.
Mystik und Reformation haben die Religion noch einmal zur unvertretbaren Sache des einzelnen Menschen gemacht. Vor allem Martin Luther hat eine folgenreiche »grandiose Aufwertung des Individuums«16 in die Wege geleitet. Die sog. Rechtfertigungslehre, der Kerngedanke der Reformation, sagt: Jeder einzelne Mensch ist von Gott wertgeschätzt und geliebt, ganz unabhängig von seinem Tun. Religion kann nicht durch Priester vertreten oder an Dogmen delegiert, also nicht veräußerlicht werden. Immer ist sie die Sache des einzelnen Menschen. Ernst Troeltsch hat den Protestantismus darum die »Erfindung der religiösen Subjektivität« genannt, und die ist heute Allgemeingut. Kennzeichnend dafür ist, dass die kirchlichen Kasualien Taufe, Firmung/Konfirmation, Trauung und Beerdigung nach wie vor nachgefragt sind. Menschen sind an einer religiösen Begleitung ihrer Lebensläufe durchaus interessiert.
Religiöse Kompetenz ist unter den Bedingungen der Individualisierung dort zu erwarten, wo eine persönlich erfahrbare Religiosität angebahnt und gefördert wird. Genau das erwartet man von einer religiösen Institution heute. Hier liegt eine Chance, die noch viel zu selten genutzt wird. Matthias Kroeger formuliert: »Eben das, was die Kirchen recht eigentlich ermöglichen und ermutigen sollten: Förderung religiöser Identität und Entwicklung, das geschieht nur minimal, nicht vital in ihnen, es muss ihnen eher abgetrotzt werden.«17
Dadurch aber gerät die Kirche ins Abseits zur kulturellen Entwicklung. Die kulturelle Prägekraft des kirchlichen Christentums ist inzwischen so gut wie zum Erliegen gekommen. Faktisch ist sie in dem freien religiösen Feld nicht präsent – obwohl sie gerade hier ihren produktiven Arbeitsbereich hätte. Damit gerät die Kirche zunehmend auch in ein gesellschaftliches Getto. Und umgekehrt verstehen sich viele religiöse Menschen selbst nicht mehr als religiös – obwohl sie das mehr sind, als sie vielleicht meinen.
Die Schlussfolgerung, die Taylor in seiner großen Analyse für die Kirche zieht, entspricht dem genau. Kirchliche Gesetze und dogmatische Glaubensvorschriften haben, so Taylor, zu christlichen Vereinheitlichungen geführt. Diese wurden den einzelnen Menschen und ihren Fragen immer übergeordnet. »Die Kirche sollte aber eigentlich der Ort sein, an dem die Menschen mit all ihren verschiedenen und unvereinbaren Routen zusammenkommen. In dieser Hinsicht haben wir unser Ziel offenbar weit verfehlt.«18