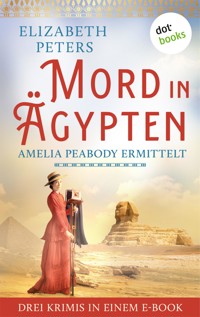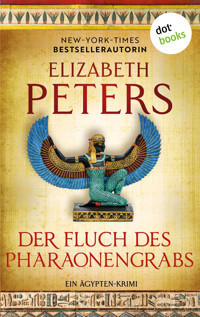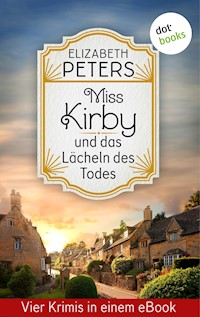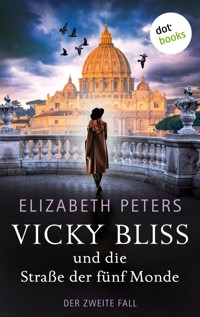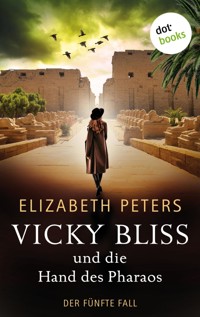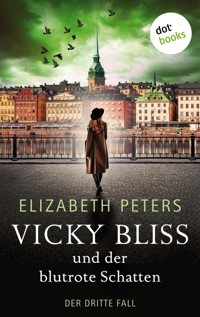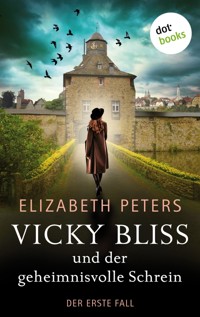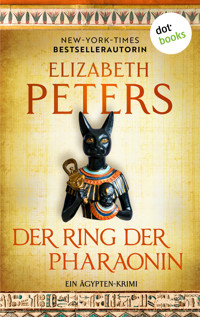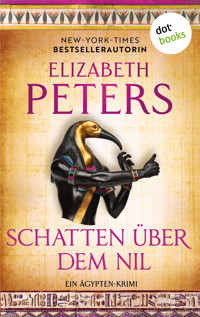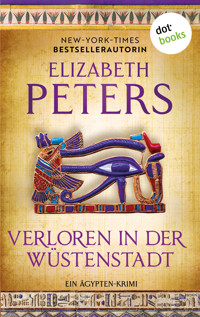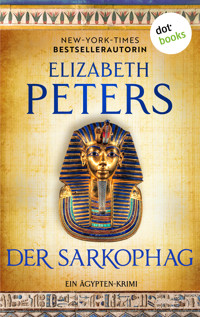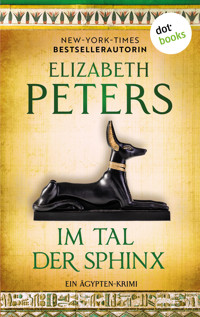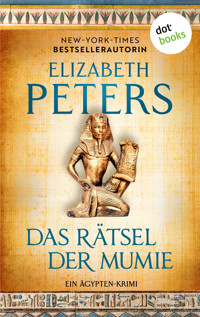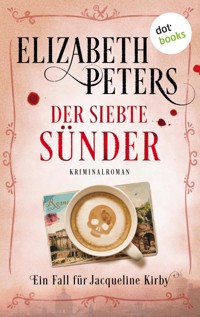Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jacqueline Kirby
- Sprache: Deutsch
Tinte, Feder und ein Mord: Der spritzige Kriminalroman »Ein preisgekrönter Mord« von Elizabeth Peters jetzt als eBook bei dotbooks. Schriftstellerin und Gelegenheitsdetektivin Jacqueline Kirby beschließt, sich mit einer Prise Romantik den öden Alltag zu versüßen und reist spontan zum Kongress der Liebesromanautorinnen in New York. Doch das Ganze ist kein Zuckerschlecken: Schon kurz nach ihrer Ankunft wird die Skandalkolumnistin Dubretta Duberstein tot aufgefunden … und alles deutet darauf hin, dass der Mörder mitten unter ihnen ist. Wer wird das nächste Opfer sein? Zwischen zickigen Autorinnen und enthemmten Romantikfans muss Jacqueline alles daransetzen, den Mörder zu finden … »Eine großartige Erzählerin!« Mary Higgins Clark »Niemand ist besser darin, mit brennenden Fackeln zu jonglieren, während sie auf einem hohen Drahtseil tanzt als Elizabeth Peters.« Chicago Tribune Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Krimi-Highlight »Ein preisgekrönter Mord« – Band 3 der erfolgreichen Krimireihe um die Hobby-Detektivin Jacqueline Kirby von Elizabeth Peters. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Lesetipps
Über dieses Buch:
Schriftstellerin und Gelegenheitsdetektivin Jacqueline Kirby beschließt, sich mit einer Prise Romantik den öden Alltag zu versüßen und reist spontan zum Kongress der Liebesromanautorinnen in New York. Doch das Ganze ist kein Zuckerschlecken: Schon kurz nach ihrer Ankunft wird die Skandalkolumnistin Dubretta Duberstein tot aufgefunden … und alles deutet darauf hin, dass der Mörder mitten unter ihnen ist. Wer wird das nächste Opfer sein? Zwischen zickigen Autorinnen und enthemmten Romantikfans muss Jacqueline alles daransetzen, den Mörder zu finden …
»Eine großartige Erzählerin!« Mary Higgins Clark
»Niemand ist besser darin, mit brennenden Fackeln zu jonglieren, während sie auf einem hohen Drahtseil tanzt als Elizabeth Peters.« Chicago Tribune
Über die Autorin:
Hinter der US-amerikanischen Bestsellerautorin Elizabeth Peters steht Barbara Louise Gross Mertz (1927–2013), die auch unter dem Pseudonym Barbara Michaels erfolgreich Krimis und Thriller schrieb. Die Autorin promovierte an der University of Chicago in Ägyptologie. So haben auch ihre über 20 Kriminalromane, für die sie zahlreiche Preise gewann, meist einen historischen Hintergrund.
Die Kriminalromanreihe um Jacqueline Kirby bei dotbooks umfasst: »Der siebte Sünder: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 1« »Der letzte Maskenball: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 2« »Ein preisgekrönter Mord: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 3« »Ein todsicherer Bestseller: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 4«
Ebenfalls bei dotbooks erscheint ihre Krimireihe um die abgebrühte Meisterdetektivin Vicky Bliss: »Vicky Bliss und der geheimnisvolle Schrein – Der erste Fall« »Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde – Der zweite Fall« »Vicky Bliss und der blutrote Schatten – Der dritte Fall« »Vicky Bliss und der versunkene Schatz – Der vierte Fall« »Vicky Bliss und die Hand des Pharaos – Der fünfte Fall«
***
eBook-Neuausgabe Februar 2019
Dieses Buch erschien bereits 1986 unter dem Titel »Die tödliche Arznei« bei Heyne und 1998 unter dem Titel »Ein preisgekrönter Mord« bei Econ.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1984 by Elizabeth Peters
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1984 unter dem Titel »Die for Love« bei Tom Doherty Associates, Inc..
Copyright © der deutschen Ausgabe 1989 by Heyne Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Published by Arrangement with BARBARA G. MERTZ REVOCABLE TRUST
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Rashad Ashur, Olga Nikonova, aekikuis und Ruslan Ivantsov
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-444-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ein preisgekrönter Mord« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Peters
Ein preisgekrönter Mord
Ein Fall für Jacqueline Kirby
Aus dem Amerikanischen von Beate Darius
dotbooks.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Lesetipps
Für Louise und Jim und ihrevierbeinigen Freunde
Kapitel 1
»Umhüllt von einem ungeahnt betörenden Duft erwachte Blaze inmitten weichseidener Kissen. Ein kühler Abendhauch – der exotisch verführerische Wüstenwind – streifte ihre nackte Haut. Nackt? Ein unterdrückter Aufschrei entwich ihren sinnlichen Lippen, als sie sich dessen bewußt wurde. Wo waren ihre Kleider? Welcher Unbekannte hatte ihren wehrlosen Körper entblößt? Und wo befand sie sich?
Aus feinstem Alabaster geschnitzte Fackeln spendeten genug Licht, um ihr diese letzte Frage zu beantworten. Ein seidener Baldachin beschirmte sie, doch durch den geöffneten Zelteingang sah sie den mit funkelnden Sternen übersäten Nachthimmel. Kaum daß sie das bemerkt hatte, wurde die Zeltöffnung von einer dunklen Gestalt ausgefüllt. Gebückt trat diese ein, und Blaze bemühte sich vergeblich, mit ihren zitternden Händen ihren schneeweißen, entblößten Körper zu bedecken. Es war der Araber, der sie im Basar bereits so unverhohlen betrachtet hatte. Tiefblaue Augen beobachteten sie aus den Falten seines Umhangs, der die untere Hälfte seines Gesichts verhüllte. ›Du bist kein Araber‹, hauchte Blaze. ›Ich kenne diese Augen ... du bist ... du bist ...‹
›Dein Ehemann.‹ Er ließ seine Vermummung fallen; und es war tatsächlich das Gesicht von Lance, dem Grafen von Deptford, dessen wohlgeformte Lippen ironisch lächelten. ›Komm, meine Geliebte, und hole dir, was dir so lange verwehrt war. Meine Verkleidung stört dich? Hinweg damit.‹ Und er warf sein Gewand beiseite.
Blazes Augen schweiften über seine braungebrannte, von unzähligen Duellen vernarbte Brust zu seiner schlanken Taille, der gestählten Bauchmuskulatur, bis hin zu seinem ...«
Jacqueline machte Stielaugen. »Gütiger Himmel«, entfuhr es ihr laut. »Das ist ja Der wollüstige Tyrann.«
»Ach wirklich?«
Jacqueline sah von den Seiten des Titels Sklave der Wollust auf. Die Stewardeß stand neben ihr und versuchte, einen Blick über ihre Schulter zu erhaschen. Höflich hielt sie das Buch so, daß die junge Frau es besser sehen konnte.
Die Augen der Stewardeß leuchteten auf. »Das ist die neue Valerie Vanderbilt! Die habe ich bislang noch nicht gelesen. Und ich liebe ihre Bücher, Sie auch?«
Jacqueline betrachtete den Einband des Taschenbuches genauer. Blaze (»der silbrige Schimmer ihrer weichfließenden Locken im Mondlicht hatte ihr diesen Namen verliehen«) lag hingegossen auf seidenen Laken, und die gebräunten, breiten Schultern des Grafen von Deptford bedeckten züchtig ihren Alabasterkörper. Der Titel und der Name der Autorin prangten in glänzenden dunkelroten Lettern auf dem Umschlag.
»Valerie Vanderbilt«, wiederholte Jacqueline. »Ich muß zugeben, daß dies der erste Titel ist, den ich von ihr lese.«
»Sie ist einfach göttlich.« Die Stewardeß seufzte schwärmerisch. »Man sagt, daß sie eigentlich eine Gräfin oder so etwas ist, aber sie benutzt ihren Titel nicht, weil ihre adlige Familie sie wegen ihrer vielen Liebesaffären enterbt hat. Und dieses Buch handelt von einem Tyrannen?«
»Da haben Sie mich wohl mißverstanden«, sagte Jacqueline. Sie blickte auf den Wagen mit den Flaschen und Gläsern, der aufgrund der literarischen Interessen der Stewardeß abrupt im Gang stehengeblieben war. »Verkaufen Sie zufällig auch Getränke? Ich nehme einen Scotch. Nein, besser noch einen doppelten.«
Es war acht Uhr morgens, eine recht unpassende Zeit für alkoholische Getränke, aber die Fluggesellschaften hatten es als gewinnbringend erkannt, daß einige ihrer Passagiere ihre Flugängste mit Alkoholika hinunterzuspülen versuchten. Jacqueline hatte keine Angst vorm Fliegen. Sie wollte lediglich ihre kritische Haltung abschwächen.
Ihren zarten Hinweis auf die unerfüllten Servicepflichten bekräftigten die umsitzenden Fluggäste aufgebracht. Mit einer gemurmelten Entschuldigung führte die Stewardeß Jacquelines Bestellung aus und reichte ihr ein Glas, zwei Fläschchen sowie eine kleine Tüte gerösteter Erdnüsse: »Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen das Buch, sobald ich es gelesen habe«, sagte Jacqueline.
»Wirklich? Oh, das ist furchtbar nett! Aber Sie werden es sicherlich noch nicht zu Ende gelesen haben, wenn wir in New York landen.«
»Oh, doch, das werde ich.«
»Nun, das ist aber wirklich nett von Ihnen. Bücher sind so teuer. Ich lese jede Woche vier oder fünf Romane, und das summiert sich, auch wenn ich mit meinen Freundinnen tausche und wir ...«
Ein zornig blickender Geschäftsmann in einer der vorderen Reihen hatte sich von seinem Platz in den Gang hinausgelehnt, fuchtelte mit einem Fünfdollarschein und stammelte wirres Zeug.
»Ja, Sir, komme sofort.« Die junge Frau lächelte Jacqueline zu und machte sich auf den Weg.
Jacqueline wandte sich erleichtert ihrer Erfrischung zu, entschied jedoch, daß sie immer noch nicht in der Lage war, wieder in das betörend duftende Zelt mit seinem seidenen Himmelbett zurückzukehren. Ich hätte drei doppelte Whisky bestellen sollen, dachte sie. Wenigstens wird mich die Stewardeß von nun an zuvorkommend bedienen. Vier oder fünf dieser Schwarten pro Woche? Wenn alle Beispiele dieses Genres wie der Sklave der Wollust waren, dann grenzte es an ein Wunder, daß sich die hartgesottenen Leser überhaupt noch artikulieren, geschweige denn einen zusammenhängenden Satz formulieren konnten.
Sie blickte aus dem Fenster. Nichts als eine undurchdringliche Wolkendecke. Als sie Nebraska verließ, hatte es geregnet. In den letzten vierzehn Tagen hatte es in Nebraska ununterbrochen geregnet. Die Bauern rauften sich die Haare, und die lokalen Tageszeitungen prognostizierten bereits Mißernten – verfaultes Getreide, modriges Heu – und damit Preiserhöhungen und allgemeine Verzweiflung. Jacqueline war vor drei Jahren nach Nebraska gezogen, und ihrer Meinung nach jammerten die Bauern dort ständig, und die Nahrungsmittelpreise stiegen unaufhörlich. Es war entweder zu heiß oder zu kalt, zu naß oder zu trocken. Sie hatte kein Interesse an Nebraska und seiner Landwirtschaft, doch dieses Frühjahr war selbst für ihr Empfinden viel zu verregnet gewesen. Das war einer der Auslöser dafür, daß sie sich am letzten Sonntag zu lautem Fluchen hatte hinreißen lassen, während sie an einem Fenster ihres Apartments stand und beobachtete, wie der strömende Regen in Sturzbächen auf ihren Balkon niederging.
»Ich muß aus diesem Provinznest verschwinden, sonst verliere ich noch den Verstand!«
»Provinznest ist nicht von der Hand zu weisen«, erwiderte ihr Freund, legte seine bestrumpften Füße auf einen Schemel und griff nach seinem Glas. »Wo willst du denn hin?«
»In eine Großstadt.« Jacqueline deutete mit dramatischer Geste zum Fenster. Im Umkreis der roten Backsteingebäude auf dem Universitätsgelände erstreckten sich, so weit das Auge reichte, trostlose Felder und Weiden. »Irgendeine Stadt. Vorzugsweise eine, wo es nicht regnet.«
»Dann könnte ich dir Kairo empfehlen. Oder Rom.«
»Ich kann es mir aber nicht leisten, nach Europa zu reisen.«
Ihr Kollege, Professor James Whittier, Dekan der Englischen Fakultät am Coldwater College, beobachtete sie mit einem schadenfrohen Grinsen. Sie war groß, schlank und so grazil wie eine Frau von höchstens zwanzig – es war nicht etwa so, daß James jemals ihr wahres Alter erfahren hätte, aber da sie zwei erwachsene Kinder hatte, mußte sie mindestens um die Vierzig sein. Ihr kräftiges kastanienbraunes Haar wies keine einzige graue Strähne auf, und James, der Jacquelines Haar ebenso gut kannte wie die Produkte, die Frauen zur Vertuschung dieser ersten Altersanzeichen anwenden, hätte schwören können, daß sie sich nicht färbte. Sie trug einen angejahrten Morgenmantel in auffälligen Blau-und Grüntönen, der ihm ebenso vertraut war und in Verbindung mit ihrer letzten Bemerkung seine Neugier weckte.
»Ich dachte, du wolltest diesen Sommer verreisen.«
»Wollte ich auch.«
»Und was ist dazwischengekommen?«
Jacqueline drehte sich abrupt um und funkelte ihn über den Rand ihrer Brille hinweg an. Die Tatsache, daß sie sie nicht auf ihren Nasenrücken schob, war ein schlechtes Zeichen. Jacquelines Brille war ihr Stimmungsbarometer. Hinabrutschen zur Nasenspitze bedeutete starke Emotionen – häufig negativen Ursprungs.
»Das geht dich nichts an, James. Du bist der neugierigste Mann, den ich jemals kennengelernt habe! Weißt du eigentlich, wie dich deine Studenten nennen?«
»Ich weiß, was mir die Studentinnen nachsagen«, erwiderte James mit einem vielsagenden Lächeln und fuhr sich nachlässig durch die silberne Lockenmähne.
»Du brauchst dein hinterhältiges Grinsen gar nicht auf mich zu verschwenden«, murmelte Jacqueline. »Mr. Lustgreis ... Nein, ich glaube, Opi Impotent gefällt mir noch besser.«
»Opi Impotent, tatsächlich? Komm her, und ich werd' dir zeigen ...«
»Ich bin nicht in Stimmung.«
»Hmmmm.« James entschied, daß dies nicht der richtige Zeitpunkt war, um Jacqueline an die Spitznamen zu erinnern, die die Studenten insgeheim für sie verwendeten. Sie hielt sich für eine zurückhaltend-ironische Betrachterin des Lebens. In der Tat war sie jedoch ebenso neugierig wie James und noch eher bereit, sich in die Angelegenheiten anderer Menschen einzumischen, wenn sie es für sinnvoll und angebracht hielt – und das war meistens der Fall. Allerdings glaubte sie bedingungslos an ihre eigene Selbsteinschätzung und wäre schockiert gewesen, wenn sie jemand eines Besseren belehrt hätte.
James war klar, daß es ebenfalls nicht ratsam war, weitere Fragen hinsichtlich Jacquelines veränderten Reiseplänen für den Sommer zu stellen. Sie hatte wohl mit finanziellen Engpässen zu kämpfen. Aber er würde ohnehin nichts aus ihr herausbringen. Was ihre persönlichen Angelegenheiten anging, konnte sie entsetzlich zugeknöpft sein. Völlig unweiblich, stellte James resigniert fest. Er mußte einen anderen Weg finden, um es zu erfahren.
»Wir könnten für ein paar Tage nach New Orleans fahren«, schlug er vor. »Oder nach San Francisco.«
»In San Francisco regnet es doch auch ständig. Ich reise nach New York.«
»Allein?«
»Allein.«
»Soweit ist es also schon gekommen«, bemerkte James bedauernd. »Der erste Riß in der Trutzburg der Liebe. Die erste verwelkte Blüte im Strauß. Der erste ...«
Weitere Metaphern wollten ihm nicht einfallen, deshalb griff er zu seinem Glas und trank.
Jacqueline setzte sich ihm gegenüber in einen Sessel, schob seine Füße von dem Schemel hinunter und legte statt dessen ihre eigenen darauf. »Der erste saure Apfel im Kompott der Zweisamkeit.«
James war sich dessen bewußt, daß er nicht der erste Mann in Jacquelines Leben war; er war sich nicht einmal sicher, ob er überhaupt der einzige war. Ihre Beziehung wurde mit der Diskretion behandelt, die das angestaubte, traditionsbewußte Kuratorium dieser Universität im Mittelwesten voraussetzte. Offiziell arbeiteten er und Jacqueline an einer Publikation. Die Aktentasche, die James jedesmal mit zu ihr ins Apartment nahm, brachte ihm Getuschel und wissendes Grinsen seiner Kollegen sowie bezeichnende Kommentare der spitzfindigeren unter seinen Studenten ein. Sicherlich jedoch wären alle überrascht gewesen, daß die Aktentasche tatsächlich drei Kapitel einer Publikation enthielt. Manchmal arbeiteten er und Jacqueline wirklich an ihrer Buchveröffentlichung.
Trotzdem war ihre Beziehung irgendwie festgefahren, mußte sich James eingestehen. Er saß mit Socken und aufgerollten Hemdsärmeln in demselben Sessel, in dem er die letzten vierzehn Sonntage auch gesessen hatte, die Sonntagszeitung lag um sie beide verstreut, und das Frühstücksgeschirr stand noch auf dem Tisch. Irgendwann würden sie den Abwasch erledigen und im Old Redde Barn zu Abend essen. Alle Freuden der Ehe ohne deren Unannehmlichkeiten. James gefiel diese Verbindung. Jacqueline offenbar nicht.
Sie wühlte sich durch einen Stapel Papiere und Zeitungsausschnitte. »Ich werde eine Autorenkonferenz besuchen«, kündigte sie an.
»Eine dienstliche Verpflichtung?«
»Selbstverständlich.«
»Aber du bist doch gar keine Schriftstellerin.«
Jacqueline deutete auf seine Aktentasche. »Wir arbeiten doch an einer Veröffentlichung, oder etwa nicht?«
»Selten«, sagte James. »Eher selten.«
»Egal, ich bin Bibliothekarin. Buchhandel, Bücher, Autoren ... Selbst die Fanatiker der Internal Revenue kapieren diesen Zusammenhang.«
James grinste. Jacquelines Fehde mit dem lokalen IRS-Büro war bereits Campus-Legende. Irgendwann einmal hatte sie unter dem Vorwand, Autoren aus reinem Berufsethos filmen zu müssen, versucht, ihre eigene, neue Videokamera abzusetzen.
»Welche Tagung willst du denn besuchen?« fragte er diplomatisch.
Jacqueline deutete auf einen Zeitungsausschnitt. »Die Internationale Konferenz der Autoren von historischen Liebesromanen. Das war die einzige, die ich finden konnte. Die ABA war bereits im letzten Monat, und die ALA findet in Birmingham statt. Und nach Birmingham kriegen mich keine zehn Pferde.«
»Die Autoren von historischen Liebesromanen«, wiederholte James. »Ich verstehe ... Hast du in letzter Zeit denn historische Romane gelesen?«
»Nein, in letzter Zeit nicht. Aber in meiner Jugend habe ich sie verschlungen. Beispielsweise Der Gefangene von Zenda, Vom Winde verweht, Amber.«
»Soso. Amber.«
»Das ist doch kein schlechtes Buch«, sagte Jacqueline.
»Nein.«
»Was ist denn mit dir?« Jacqueline blickte ihn mißtrauisch an. »Du machst dich über mich lustig, James. Ich kenne doch dieses Grinsen.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob die IRS dir das abkauft, das ist es. In Universitätsbibliotheken findet man selten Romane. Insbesondere Liebesromane.«
»Dann werde ich eben einen schreiben«, sagte Jacqueline. »Eigentlich gar keine üble Idee. Irgend jemand hat mir erzählt, daß sich diese Bücher momentan sehr gut verkaufen.«
»Oh, natürlich. Ganz bestimmt sogar ... Nun, das klingt wirklich nach einer hervorragenden Idee. Laß mich mal überlegen; zwei Wochen New York, am vierten Juli bist du dann wieder zurück; vor dem Labor Day solltest du dein Manuskript allerdings fertiggestellt haben.«
»Deine Oberlehrermentalität kannst du dir schenken«, erwiderte Jacqueline schnippisch. »Ich bin mir bewußt, daß es nicht einfach ist, ein Buch zu verfassen. Aber mit viel Fleiß ...«
»Ich bin sicher, du könntest es schaffen.« James musterte sie einen Augenblick lang und nickte dann. »Ja, könntest du. Wann reist du ab?«
Er brachte sie nach Omaha. Auf ihrer Fahrt dorthin plauderten sie über dienstliche Angelegenheiten und über das Wetter, trotzdem ließ sich Jacqueline von James' Freundlichkeit nicht beirren. Er war nach wie vor gekränkt, daß er sie nicht begleiten durfte. Typisch Mann, dachte sie insgeheim. Ihr Selbstbewußtsein war so schwach ausgeprägt, und ständig nahmen sie alles persönlich.
James machte keinerlei Anspielung auf seine verletzten Gefühle, fuhr jedoch so langsam, daß Jacqueline schon befürchtete, ihr Flugzeug zu verpassen. Als sie ihn darauf ansprach, erwiderte er leichtherzig: »Ach, wir haben noch so viel Zeit«, und tatsächlich erreichten sie den Schalter wenige Sekunden bevor die Lautsprecher den letzten Aufruf für den Flug 576 durchgaben.
»Hab' doch gesagt, wir sind pünktlich«, sagte James. »Mach dir ein paar schöne Tage. Hier, noch ein kleines Abschiedsgeschenk.«
Jacqueline nahm das eingewickelte Päckchen. »Bücher? Wie aufmerksam von dir, James.«
»Du hast doch gesagt, daß du in letzter Zeit keinen historischen Liebesroman gelesen hast. Das hier sind zwei der absoluten Verkaufsrenner – wurde mir zumindest gesagt.« Gedankenversunken griff James nach ihrer Hand. Er lächelte. Es war jedoch eher ein breites, durchtriebenes Grinsen, das seine untere Gesichtshälfte völlig ausfüllte.
Und so kam es, daß Jacqueline Kirby, stellvertretende Bibliotheksleiterin am Coldwater College, Doktor der Literaturwissenschaften und Magister Artium, Dozentin und erklärte Intellektuelle, in den Besitz zweier Bücher mit den Titeln Sklave der Wollust und Glutrote Blume der Liebe gelangte.
*
Entgegen der weitverbreiteten Meinung sind Bibliothekarinnen auf gar keinen Fall weltfremde, zimperliche alte Jungfern. Und Universitätsbibliothekarinnen sind dem, was allgemein als Kultur bezeichnet wird, auch keineswegs unaufgeschlossen. Sie haben die gleichen Probleme und Empfindungen wie jeder Normalsterbliche, und man kann sie ohne weiteres auch gebannt vor dem Fernsehschirm oder vertieft in eine Ausgabe des Playgirl antreffen. Es war reiner Zufall, daß Jacqueline von den neuesten und heißesten Modeerscheinungen des Literaturbetriebs keine Ahnung hatte. »Ich kaufe keine Bücher in Supermärkten«, lautete ihre Argumentation. »In Supermärkten kaufe ich Obst und Toilettenpapier.« Sie kaufte ohnehin nur selten Bücher. Eine Bibliothekarin braucht weder in Supermärkten noch sonst irgendwo Bücher zu kaufen. Bücher sind die eine Annehmlichkeit, die Bibliothekare im Überfluß haben.
Aufgrund ihres kleines Schwipses las Jacqueline schließlich mit wachsender Begeisterung weiter und bemerkte weder, daß sich die Wolkendecke zunehmend lichtete, noch die sehnsüchtigen Blicke der Stewardeß, die in ihrer Vorfreude auf den Sklaven der Wollust gelegentlich an ihr vorüberstreifte. Die Stewardeß war ebenfalls in ihrer Nähe, als Jacqueline den Titel Glutrote Blume der Liebe schloß. Als sie deren erwartungsvollen Blick bemerkte, lächelte sie, und die Stewardeß eilte zu ihr.
»Kann ich irgend etwas für Sie tun, Madam?«
Jacqueline überlegte. »Ich glaube, ich brauche keinen Scotch mehr. Aber setzen Sie sich doch zu mir, wenn Sie einen Augenblick Zeit haben.«
»O nein, ich darf mich jetzt nicht hinsetzen. Wir landen in einer halben Stunde.«
»Ich habe den Sklaven der Wollust zu Ende gelesen. Und dieses hier auch. Möchten Sie sie beide?«
»Oh, vielen Dank. Sind Sie sicher, daß Sie sie nicht ...«
»Ganz sicher«, erwiderte Jacqueline entschieden.
»Das hier habe ich auch noch nicht gelesen.« Die Stewardeß betrachtete den Einband von Glutrote Blume der Liebe. »Valerie Fitzgerald – sie ist gut, aber nicht so gut wie Valerie Vanderbilt. Natürlich ist Valerie Valentine meine absolute Lieblingsautorin. Finden Sie sie nicht auch phantastisch?«
»Ich kenne sie gar nicht«, sagte Jacqueline, überwältigt von dieser Inflation des Namens Valerie.
»Oh, Sie müssen sie lesen. Sie ist einfach die Größte. Sie wird als Ehrengast an der Konferenz teilnehmen. Ich würde so gern hingehen, aber leider muß ich arbeiten. Vielleicht kann ich kurz nach Manhattan reinfahren und mir einen Vortrag anhören.«
»Ich werde teilnehmen«, sagte Jacqueline.
»Wirklich? Sie Glückliche. Oh, aber – ich wußte ja gar nicht – sind Sie Schriftstellerin? Unter welchem Pseudonym schreiben Sie denn?«
»Ich habe bislang noch nichts veröffentlicht«, erklärte Jacqueline. »Ich beabsichtige, mich Valerie von Hentzau zu nennen.«
»Das ist ein toller Name.«
»Finde ich auch.«
»Sie sehen aus wie eine Autorin«, versicherte ihr die junge Frau. »Ich meine, Sie sehen aus, als könnten Sie eine attraktive Persönlichkeit darstellen, wenn Sie ... ich meine ...«
»Ich schreibe für ein älteres Lesepublikum«, sagte Jacqueline in ernstem Tonfall. »Manche von uns erinnern sich noch an die Liebesromanzen aus der Vergangenheit. Und es ist mein ehrgeiziges Ziel, diese Augenblicke für diejenigen festzuhalten, die heute aufgrund ihrer Altersschwäche nicht mehr in der Lage sind, so etwas noch selbst zu erleben.«
Darauf gab es keine plausible Antwort, und Jacqueline hatte auch keine erwartet. Unsicher lächelnd zog sich die Stewardeß zurück, wobei sie die Bücher fest an ihren Busen gedrückt hielt. Jacqueline lehnte sich zurück und kramte in ihrer Handtasche. Aus deren unerschöpflichen Tiefen zauberte sie ein Exemplar von Das Ende der Liebe hervor und hoffte, daß der vielversprechende Titel ihr Gemüt sämtlicher Wollust enthob. Als der Pilot ihre baldige Landung ankündigte, trat allerdings ein hoffnungsfroher Glanz in ihre Augen. Die Konferenz versprach ein ausgesprochenes Vergnügen zu werden. Sie konnte es kaum erwarten.
*
Als der Flughafen-Bus durch den dichten Verkehr in Richtung Stadt fuhr, blickte Jacqueline voll verträumter Nostalgie aus dem Fenster. Es war mittlerweile drei Jahre her, seit sie die Ostküste zugunsten des züchtigen Charmes von Amerikas Hinterland verlassen hatte. Für diese Entscheidung hatten eine Reihe sinnvoller Gründe gesprochen – die Chance, die Stelle der liebenswert senilen Bibliotheksleiterin am Coldwater College zu übernehmen (die allen Versprechungen zum Trotz allerdings immer noch dort arbeitete); die hohen Lebenshaltungskosten an der Ostküste; und die Nähe von Jacquelines Kindern, die zwar jetzt erwachsen und theoretisch unabhängig waren, sich aber immer noch viel zu oft und ungefragt in die Angelegenheiten ihrer geliebten alten Mutter einmischten und deren Finanzen, Liebesleben und Kühlschrank überwachten. Wenn sie sie besuchten, befanden sie sich fast immer in Begleitung von Mitgliedern des anderen Geschlechts, und Jacqueline begann sich innerlich gegen zukünftige Großmuttergefühle zu sträuben. Wenn es soweit war, und das wäre sicherlich früher oder später der Fall, wollte sie mindestens tausend Meilen entfernt sein. Sie hatte eigentlich nichts gegen Großmütter oder Babys im allgemeinen, trotzdem schien ihr Distanz eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme, und es wäre vermutlich auffällig gewesen, wenn sie mit ihrem Fortgehen bis zum Eintritt des Ernstfalles gewartet hätte. Augenblicklich hatte sie jedoch das Gefühl, in die Heimat zurückgekehrt zu sein.
Die meisten Passagiere stiegen am Grand Central Station aus. Jacqueline schnupperte voller Zufriedenheit die kohlenmonoxydhaltige Luft, atmete tief ein, schnappte sich ihren Koffer und ging los. Am Spätnachmittag war es ohnehin zwecklos, nach einem Taxi Ausschau zu halten. Außerdem lag ihr Hotel an der 53. Straße, nur etwa eine Viertelstunde Fußweg entfernt.
Als sie die Fifth erreicht hatte, war sie bereits wieder in ihren alten Fußgängertrott verfallen – sie schlängelte sich gekonnt durch die Menschenmenge und überquerte die Straßen auch bei Rot, solange der Verkehr noch anhielt. Überflüssig zu erwähnen, daß diese Fähigkeit absolute Konzentration erfordert und die Einwohner Manhattans von den Touristen unterscheidbar macht. Letztgenannte steuern verwirrt und abgeschlagen auf die Schaufenster zu, wo sie wenigstens nach einer Seite hin vor den Menschenmassen geschützt sind.
Jacqueline war ebenfalls versucht, sich die Auslagen anzuschauen, insbesondere die der Buchhandlungen; Coldwaters einzige Einkaufsstraße besaß keine vergleichbare Anziehungskraft. Aber sie blieb standhaft. Sie hatte kaum noch Zeit zum Einchecken und Umkleiden, bevor sie an der Eröffnungsveranstaltung der Konferenz teilnahm – einem formellen Mittagessen, während dessen der »geheimnisvolle Ehrengast« vorgestellt werden würde.
Es war ihr nicht gelungen, ein Zimmer im Harrison Hotel zu buchen, in dem die Veranstaltung stattfand, doch ihr Hotel lag praktisch direkt gegenüber. Außerdem bot es »Sonderkonditionen« und damit erheblich günstigere Preise. Das Zimmer war absolut amerikanischer Standard: zwei Doppelbetten, geschmacklose Tapeten sowie eine fest installierte Leselampe am Bett, die es beinahe unmöglich machte, dort ein Buch zu lesen. Die Aussicht aus dem fünfunddreißigsten Stock gab den Blick auf den Central Park und die umliegenden Wolkenkratzer frei. Der Park ließ Jacqueline kalt; Natur hatte sie in Nebraska genug. Doch sie nahm sich einen Augenblick Zeit, um ihren Blick über die riesigen Gebäude schweifen zu lassen und sich den Luxus vorzustellen, den diese verkörperten – Luxus, wie sie ihn schon seit langem nicht mehr erlebt hatte. Saks und Altman's und ›Lord and Taylor‹ – nicht, daß sie es sich etwa hätte leisten können, dort oder überhaupt irgendwo im Umkreis der Park und Lexington ihre Garderobe einzukaufen, aber selbst ein Schaufensterbummel war immer noch reizvoller als die Schnäppchenläden in der Fußgängerzone von Coldwater. Die Museen – Guggenheim, Cloisters, Metropolitan – im Met waren soeben die neue ägyptische Abteilung und der Amerikanische Flügel eröffnet worden, und außerdem wollte sie sich eine Ausstellung in der Abteilung für Kostümdesign ansehen. Aber der Mensch lebt nicht ausschließlich von Museumsbesuchen, und Jacquelines Interessen waren ohnehin vielseitig. Sie würde in der Stadt eine ganze Reihe von Freunden besuchen müssen, um sich über die angesagtesten Plätze – Nachtclubs, Cafés und Bistros – zu informieren, denn in dieser Hinsicht änderte sich der Geschmack schnell, und sie war sich darüber im klaren, daß ihre früheren Lieblingskneipen vermutlich gar nicht mehr existierten. Selbst die nette Schwulenbar auf der 79. Straße, wo sie so viele Freunde gefunden hatte ...
Seufzend wandte sie sich vom Fenster ab und begann mit dem Auspacken. Nach der Hälfte der Lektüre von Sklave der Wollust hatte sie bereits der Verdacht beschlichen, daß ihre Garderobe dem Grundtenor der Veranstaltung nicht gerecht wurde. In ihrem Koffer befand sich weder eine Rüschen- noch eine durchsichtige Bluse – allerdings auch nicht in ihrem Kleiderschrank in Nebraska. Im Augenblick mußte ein schmalgeschnittener Hosenanzug aus Leinen reichen. Sie ließ die beiden oberen Knöpfe ihrer Bluse offen, bürstete ihr Haar, bis es glänzte, und griff nach ihrer Tasche.
Obwohl Jacqueline davon überzeugt war, daß ihre Handtaschen nicht größer waren als die einiger anderer Frauen, waren sie zweifellos größer als die der meisten Frauen. Sie neigten dazu, sich gefährlich auszubeulen, und niemand, einschließlich Jacqueline, wußte genau, was sich wirklich darin befand. Das Kollegium am C.C. hatte Jacquelines Taschen immer mißtrauisch betrachtet, bis sie am Tag der Abschlußfeierlichkeiten einen Schirm, einen Regenmantel und ein Paar Gummistiefel daraus hervorzauberte. Bis auf die Tatsache, daß der Wetterbericht für jenen Tag wolkenlosen Himmel und keinerlei Eintrübung vorhergesagt hatte, war das an sich nichts Überwältigendes. Allerdings fanden die Feierlichkeiten im Freien statt, und als der Himmel seine Schleusen schließlich doch noch öffnete, war Jacqueline die einzige Teilnehmerin, die darauf vorbereitet war.
Abgesehen von diesen Vorzügen war eine große Handtasche, wenn es darauf ankam, auch eine wirkungsvolle Verteidigungswaffe. In dieser letztgenannten Funktion setzte sie Jacqueline ein, als sie sich ihren Weg vom Hotel durch die Menge bahnte. Der Verkehr auf der Sixth Avenue war schon Straßenzüge weiter zum Erliegen gekommen, und der Geräuschpegel war höher als sonst zur Mittagszeit in Manhattan.
Die Ampel schaltete gerade auf Grün, als Jacqueline die Straßenecke erreichte, und die frustrierten Fahrer überschrien sich gegenseitig mit ihren Beschimpfungen. Hupkonzerte und schrilles Gekeife von allen Seiten. Ein Taxi bedrängte die Stoßstange des vor ihm stehenden Wagens; dessen Fahrerin, eine ältere Dame mit reizenden weißen Löckchen, blickte verdutzt aus dem Fenster und setzte sich lautstark zur Wehr. Jacqueline entging, was sie sagte, dem Taxifahrer jedoch offensichtlich nicht, denn er fluchte in höflichstem Spanisch. Jacqueline hatte verschiedentlich den Eindruck, daß ihr manche Schimpfworte überhaupt nicht geläufig waren. Jedenfalls war der Taxifahrer mit einer beeindruckend schrillen Stimme gesegnet.
Das Problem schien die Querstraße zu sein. Die Kreuzung wurde von zwei absolut ungewöhnlichen Fahrzeugen blockiert. Beides waren Cabriolets eines Baujahrs, das auf Amerikas Straßen nur noch selten anzutreffen ist. Und beide leuchteten auffällig in Pink.
Von dem zweiten Wagen konnte Jacqueline nur die Karosserie erkennen, doch auf die Insassen des ersten Fahrzeugs hatte sie einen guten Blick. Der Fahrer war offensichtlich ein gebürtiger New Yorker; ungerührt von den Beschimpfungen um ihn herum, starrte er arrogant und gelangweilt geradeaus. Die weiteren Mitreisenden waren weniger blasiert. Von einer der Frauen war lediglich ihre messingfarbene Perücke zu erkennen. Sie saß so eingesunken auf ihrem Platz, wie es das Fahrzeug zuließ. Die andere Frau war rothaarig, von unbestimmbarem Alter und bemerkenswerter Fülle. Verärgerung oder Sonnenbrand hatten ihrem Gesicht einen ungesunden Rotton verliehen, der einen schauderhaften Kontrast zu ihrem rosafarbenen Hütchen, dem rosafarbenen Kleid und ebensolchen Handschuhen bot.
Der dritte Insasse des Fahrzeugs ... Jacqueline stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können. In diesem Augenblick erhob sich der junge Mann und präsentierte seine volle Schönheit: ein weißes Hemd mit Rüschenärmeln, das er bis zum Bauchnabel geöffnet trug, dazu ein roter Kummerbund aus Seide und ein schwarzer, dunkelrot gefütterter Umhang. Dessen Zobelbesatz schwang nach hinten, als er beide Arme durch die Luft schwenkte, um sein Publikum zu begrüßen, das daraufhin in Begeisterungsstürme ausbrach. Einige der Beteiligten lachten, andere stöhnten, und sämtliche Taxifahrer fluchten. Irgend jemand in der näheren Umgebung von Jacquelines linkem Ellbogen seufzte tief und hauchte »sexy«.
Jacqueline blickte zu Boden. Wenn sie Absätze trug, war sie knapp einen Meter achtzig groß, und das schmachtende Mädchen war gut und gerne fünfzehn Zentimeter kleiner als sie. Als sie Jacquelines Blick bemerkte, kicherte sie und zuckte die Schultern.
»Wer ist das?« fragte Jacqueline unüberhörbar.
»Wer weiß das schon? Er ist jedenfalls großartig. Vermutlich einer dieser Romanverfasser.« Sie deutete auf das Hotel an der gegenüberliegenden Ecke.
»Natürlich«, sagte Jacqueline belustigt. »Rudolph Rassendyll, Zorro, Edmond Dantes ... Die Romantik ist einfach unschlagbar.«
»Hä?«
»Jedenfalls ein Adonis«, stellte Jacqueline fest.
Das Sonnenlicht schimmerte auf dem schwarzen Brusthaar des jungen Mannes. Das Cabriolet machte einen Satz nach vorn, und er setzte sich ruckartig. Sein Gesicht war von einem breiten Grinsen überzogen.
Jacqueline entschied, daß sie sich besser auch auf den Weg machte. Falls die Insassen der pinkfarbenen Wagen besagte Ehrengäste waren, würde die Veranstaltung vermutlich ohnehin nicht pünktlich beginnen, aber sie wollte sich einen guten Platz sichern. Völlig problemlos überquerte sie die Sixth Avenue – kein einziges Fahrzeug war in Bewegung –, doch bevor sie das Hotel betrat, riskierte sie noch einen letzten Blick auf den Autokorso. Der hatte sich mittlerweile weit genug nach vorn geschoben, daß sie auch den zweiten Wagen hervorragend sehen konnte. Dabei handelte es sich um ein altes Cadillac-Cabriolet mit überdimensionalen Heckflossen, das sich in tadellosem Zustand befand. Sein Besitzer, der vermutlich zu der abgehobenen und auserlesenen Gruppe von Oldtimer-Sammlern zählte, wäre über seinen gegenwärtigen Zustand allerdings entsetzt gewesen. Es war geschmückt wie die Festwagen zum Erntedankfest – oder, noch eher, anläßlich einer Parade zum Valentinstag. Vom Kühlergrill bis zur Heckflosse war weiße Baumwollspitze um das Fahrzeug drapiert. Ein vergoldeter Amor ersetzte das ursprüngliche Markenzeichen. Auf der Fahrertür prangte ein Abzeichen in Form eines Wappens: goldene Herzpaare, gekrönt von einem Diadem und umrahmt von weiteren vergoldeten Amorfiguren.
Drei Personen befanden sich auf dem Rücksitz. Einer von ihnen war ein glatzköpfiger Mann mittleren Alters. Sein Gesicht war ebenso nichtssagend und desinteressiert wie das der vorderen Insassen. Die zweite war eine grauhaarige Frau, die wie eine ganz normale Hausfrau wirkte. Die dritte ...
Schönheit ist Geschmacksache und bleibt dem Auge des Betrachters überlassen. Wahre Schönheit ist seltener zu finden als Diamanten und deshalb bemerkenswerter. Kaum einer unter den berühmten Bühnen- und Filmschönheiten verdient diese Auszeichnung; Make-up, Beleuchtung und vor allem die Umtriebigkeit von Presseagenten und Werbefirmen erzeugen ein falsches Bild, das nichts mit wirklicher Schönheit zu tun hat.
Das Mädchen indem pinkfarbenen Cabriolet war schön. Sie saß zwischen den beiden älteren Leuten und wirkte wie eine Rose in einem Zucchinibeet. Sie hatte einfach alles – ein apartes Gesicht, zarte Haut und ansprechende Gesichtszüge. Ihr Haar, das ihr in sanften Wellen über die Schultern fiel, war weder gelb noch blond oder platinfarben, sondern von einem natürlichen Kupferton und schimmerte wie feinste Seide. Ihr Gesicht war herzförmig mit zart gerundeten Wangen und einem kleinen, energischen Kinn. Sie trug eine tief ausgeschnittene, reinweiße Bluse beziehungsweise ein Kleid – Jacqueline konnte lediglich ihren Oberkörper erkennen – mit einem weichen Spitzenkragen, der ihren schlanken Hals umschmeichelte, und ihre entblößten Arme waren so makellos wie die einer griechischen Aphrodite-Statue. Trotzdem war ihre Schönheit nicht klassisch zu nennen. Die rosigen Wangen und ihre Körperrundungen erinnerten eher an die gemalten Schönheiten von Boucher und Fragonard.
Der Korso hatte sich erneut einige Zentimeter vorwärts geschoben. Die Schreie der Zuschauer hatten sich zu einem Geräuschpegel gesteigert, der normalerweise nur von manchen Rock- oder Punkgruppen erzielt wird. Ein rotgesichtiger Polizist stürzte sich in die Menge und wurde von den Taxifahrern überrannt, die ihre Fahrzeuge verlassen hatten und sich den Cabriolets näherten. Widerwillig wandte sich Jacqueline ab. Ein in der Empfangshalle des Hotels installierter Veranstaltungsplan dirigierte sie ins Zwischengeschoß, wo die Anmeldung zur Konferenz der Autoren von historischen Liebesromanen stattfand. Hier stieß Jacqueline auf einen Überschwang in Pink und Weiß, aus Girlanden und Papierherzen und weiteren vergoldeten Amor-Figuren. Gegenüber dem Anmeldetresen, der mit pinkfarbenem Kreppapier dekoriert war und von drei mißmutig blickenden Frauen in pinkfarbenen Kittelkleidern flankiert wurde, befanden sich mehrere Ausstellungsstände mit diversen Verlagsreihen wie »Kerzenscheinromantik«, »Unerfüllte Liebe« und »Mondenschein-Liebesromanzen«. Die Mondenschein-Titel hatten sich offensichtlich auf die Valeries spezialisiert; Jacqueline fielen mehrere Exemplare von Sklave der Wollust sowie ein Stapel mit Büchern auf; der den von der Stewardeß bevorzugten Autorennamen trug – Valerie Valentine. Während sie die Dekoration bestaunte, wurde Jacqueline von einem schnurrbärtigen Mann in Anzug und Weste mit den Worten angesprochen: »Suchen Sie einen Agenten, Schätzchen? Ich vertrete ...«
Jacqueline nahm seine Karte. Schließlich konnte man ja nie wissen.
Ein weiterer Stand, der in einiger Entfernung von den Verlagsauslagen aufgebaut war, strahlte den hausbackenen Charme eines Heimwerkerwettbewerbs aus. Pinkfarbene und weiße Kreppapierrüschen umrahmten einen wackligen Tisch mit einer Flagge, auf die jemand dilettantisch den Namen der Organisation gedruckt hatte. Es las sich etwa wie »Walentine-Werehrer von Amerika«, und Jacqueline fragte sich, welches der um den Stand versammelten jungen Mädchen wohl die Künstlerin gewesen war. Sie schienen ein überaus repräsentatives Bild ihrer Altersgruppe abzugeben; einige waren schlank und hübsch, andere wiederum pummelig und nichtssagend, und die meisten von ihnen hatten Zahnspangen, Akne oder beides.
Jacqueline schlenderte mit ihrem Formular entlang des Anmeldetresens. »Fans?« fragte sie und deutete auf die Walentine-Werehrer.
Eine der Mitarbeiterinnen blickte von den Schecks auf, die sie gerade sortierte. Jacquelines gediegene Erscheinung schien sie zu beeindrucken, denn sie sagte entschuldigend: »Ich versichere Ihnen, daß sie keinesfalls repräsentativ für unsere Leserschaft sind. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären die gar nicht hier. Man hätte sie dazu zwingen sollen, Eintrittskarten zu kaufen, wie jeder andere auch.«
Ihre etwas nachsichtigere Kollegin meinte: »Die meisten von ihnen haben doch kein Geld. Du weißt doch, was Mrs. Foster über Fans gesagt hat: Halt sie dir vom Leib, aber halt sie in deiner Nähe. Ja, Miss? Sind Sie Autorin oder Verlegerin?«
Jacqueline überlegte. Vermutlich standen als Alternativen die Kategorien »Fan« oder »Sonstige« zur Wahl. Beide sagten ihr nicht zu. »Autorin«, sagte sie und erhielt ein Blanko-Namensschild, ein Programmheft sowie einen Stapel Eintrittskarten für die unterschiedlichen Tagungsveranstaltungen. Dann kramte sie einen Stift aus ihrer Handtasche, trug in das herzförmige, knallrote Namensschild J. Kirby ein und steckte es an ihrer Jacke fest.
Die Dekoration der Automobile und des Zwischengeschosses hätten sie für den Ballsaal, in dem das Mittagessen stattfinden sollte, wappnen müssen, trotzdem war Jacqueline für Sekundenbruchteile überwältigt. Wie festgewurzelt im Türrahmen stehend, schaute sie sich fasziniert um. Es waren nicht so sehr die Herzen und die Papiergirlanden oder die kitschigen Amorfigürchen; daran hatte sie sich mittlerweile gewöhnt. Es waren die Luftballons – Hunderte mit Helium gefüllter Ballons, die in pinkfarbenen, roten, weißen und violetten Trauben an allen erdenklichen Punkten befestigt waren oder frei durch den Raum schwebten. Jacqueline räumte einen pinkfarbenen Ballon aus dem Weg und trat ein.
Die meisten Plätze waren bereits besetzt, was sie nicht überraschte, da es bereits 12.30 Uhr war und das Essen um ein Uhr beginnen sollte. An der Kopfseite des Saals befand sich auf einer mit rotem Samt und (selbstverständlich) mit pinkfarbenen Papierherzen dekorierten Erhöhung ein Tisch, der für die Vortragenden und den geheimnisvollen Ehrengast reserviert war. An den umliegenden Tischen war kein einziger freier Platz mehr, doch Jacqueline entdeckte einen Stuhl, auf dem lediglich eine Nerzjacke und eine Handtasche lagen. Sie ging darauf zu und sprach die Teilnehmerin auf dem Nachbarstuhl an.
»Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, das ist mein Platz.«
Wie sie es erwartet hatte, war der Stuhl überhaupt nicht besetzt. Mit einer Unverfrorenheit konfrontiert, die der ihren in nichts nachstand, resignierte die Besitzerin der Nerzjacke mit giftigem Blick und murmelte lediglich: »Ach, wirklich!« Jacqueline erwiderte diesen Blick. Die Frau trug ihr rotes Autorennamensschild an einem Dekolleté, das Schultern freigab, die sie der Öffentlichkeit besser vorenthalten hätte. Ihr Kleid war aus pinkfarbenem Chiffon und mit riesigen roten Rosen bedruckt. Ihre Gesichtszüge erinnerten Jacqueline an einen unfeinen Vergleich aus dem Mittelwesten, der sich auf das Hinterteil eines Pferdes bezieht.
Jacqueline glitt auf den freien Stuhl, legte ihre Handtasche unter den Tisch, stellte ihre Füße darauf und öffnete ihr Programmheft. Ihre Lektüre wurde von einer ängstlichen Stimme unterbrochen, die sie leise fragte: »Wissen Sie, ob man hier rauchen darf?«
Gedankenversunken wandte sich Jacqueline der Sprecherin zu, die links von ihr saß. Das Mädchen war höchstens achtzehn. Weiches braunes Haar umschmeichelte ihr kindlich-unbefangenes Gesicht. Auf ihrer von Sommersprossen übersäten Stupsnase saß eine Hornbrille, hinter der sie ein Paar sanfter blauer Augen versteckte. Ihr blaues Kleid war langärmelig mit hochgeschlossenem Kragen. Jacqueline, eine eifrige Sammlerin von Versandhauskatalogen, hatte genau dieses Kleid schon einmal abgebildet gesehen. Der Begleittext hatte der zukünftigen Trägerin garantiert, daß sie »durch und durch wie eine Dame« aussehen würde. In diesem Fall zumindest traf die Behauptung zu.
»Ich sehe keinerlei Hinweis, der das untersagt«, meinte Jacqueline.
»Aber es gibt hier keine Aschenbecher.«
Es gab auch weit und breit keine Kellner. Jacqueline zerrte ihre Tasche vom Boden hoch. Nachdem sie eine Weile darin herumgewühlt hatte, zog sie eine angelaufene Messingdose daraus hervor und entfernte deren Deckel. »Nehmen Sie einfach die hier.«
»Oh, aber ...«
»Man kann sie ohne weiteres als Aschenbecher benutzen«, erklärte Jacqueline. »Ich trage sie immer noch mit mir herum, obwohl ich mir das Rauchen abgewöhnt habe.«
»Oh, ich wollte Ihnen gerade ...«
»Danke.« Jacqueline griff nach den Zigaretten. »Ich höre jeden Monat einmal mit dem Rauchen auf«, gab sie zu.
Ihre neue Freundin blickte interessiert auf ihr Namensschild. »Tut mir leid, aber ich habe noch keines Ihrer Bücher gelesen. Oh, aber vermutlich schreiben Sie unter Pseudonym.«
»Nein.« Jacqueline inhalierte tief. »Ich bin keine Schriftstellerin.«
»Aber Ihr Namensschild ...«
»Ich habe gelogen.«
»Oh!«
»Sie würden sicherlich nie lügen, oder?« Das Namensschild des Mädchens war ebenfalls rot. Ihr Name lautete Susan Moberley. »Ich habe aber auch noch nichts von Ihnen gelesen«, sagte Jacqueline. »Es sei denn, Sie sind Valerie Vanderbilt.«
»Schön wär's. Sie ist ein Verkaufsschlager. Ich bin lediglich ein Neuling in der Branche. Mein erstes Buch erscheint in diesem Herbst.«
»Danach werde ich selbstverständlich Ausschau halten. Wie lautet denn der Titel?«
»Ich wollte es eigentlich Das unselige Komplott nennen. Schauplatz der Handlung ist England unter der Herrschaft Richards des Zweiten, deshalb habe ich den Titel abgeleitet von ...«
»Ich kenne die Rede.«
»Oh. Nun, jedenfalls fand meine Lektorin, daß das kein guter Titel sei. Sie plädiert für Verbotene Liebesnacht.«
»Verstehe.«
Ihre nichtssagende Äußerung ließ Sues sommersprossige Wangen erröten. »Es ist aber nicht so ein Buch«, meinte sie aufgebracht.
»Wie viele Vergewaltigungen?«
»Zwei. Aber die sind wirklich nicht ...«
»Irgendwas mit Sodomie?« fragte Jacqueline. »Oder Inzest? Sadomasochistische Orgien, Peitschen, Ketten, Gruppensex?«
Sues Gesicht war dunkelrot angelaufen und entsprach der Farbe des Ballons, der soeben auf dem Tisch gelandet war. Jacqueline tat das Mädchen leid. »Sie müssen es sehr nötig haben«, sagte sie mit mitfühlender Stimme.
»Ich weiß nicht, wieso Sie denken ...«
»Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt, Susan Moberley?«
»Ich bin Lehrerin an der Hauptschule.«
»Hab' ich mir gedacht. Woher kommen Sie? Iowa? Kansas?«
»Aus einer kleinen Stadt in Nebraska. Sagt Ihnen mit Sicherheit nichts.«
»Darauf würde ich nicht wetten«, erwiderte Jacqueline verdrossen.
»Ihr Ostküstler meint immer, daß die Leute aus meinem Landstrich der USA Ignoranten sind. Wir sind genauso vertraut mit ...«
»Sodomie, Inzest und Peitschen. Zweifellos sind Sie das. Aber Sie scheinen mir über ein vernünftiges Maß an Geschmack und Intelligenz zu verfügen. Stört Sie das Bild einer Frau als williges Opfer, wie es in Büchern dieses Genres dargestellt wird, denn nicht?«
Ehe Susan antworten konnte, meinte die Dame im Nerz, die ihr Gespräch belauscht hatte, entschieden: »Jetzt muß ich Ihnen voll und ganz zustimmen. Ich lasse nie zu, daß meine Heldinnen ausgenutzt werden. Sie sind unabhängige, sexuell befreite Frauen, die ihr Leben selbst bestimmen.«
Eine angeregte Diskussion folgte. Alle umsitzenden Autorinnen stimmten der Sprecherin grundsätzlich zu. Ihre Heldinnen waren alle unabhängig und sexuell befreit. Sie räumten allerdings ein, daß weniger angesehene Autoren manchmal auf diese Schiene verfielen.
Jacqueline war zuwenig vertraut mit dem Genre, als daß sie hätte einschätzen können, ob das der Wahrheit entsprach, doch sie hörte verschiedentlich Äußerungen wie »ich meine, sie ist zu uneinsichtig«. Von der Diskussion schließlich gelangweilt, hörte sie nicht mehr zu und vergnügte sich statt dessen damit, die aufgrund des schwindenden Heliums langsam auf die Tische herabsinkenden Ballons anzustupsen.
»Ich verhungere«, murmelte Sue. »Was meinen Sie, wann das Essen endlich serviert wird?«
»Keine Ahnung.« Jacqueline griff in ihre Tasche. »Möchten Sie die Hälfte meines Müsliriegels?«
Während sie kauten, fügte Jacqueline hinzu: »Ich schätze, der geheimnisvolle Ehrengast ist aufgehalten worden. Als ich ankam, herrschte draußen das reinste Verkehrschaos. Der Auslöser schienen zwei pinkfarbene Cabriolets zu sein.«
Die Dame im Nerz kicherte boshaft. »Typisch für Hattie. Sie hat vermutlich versäumt, sich die Zusage der Polizei geben zu lassen, daß der Verkehr für ihre alberne Prozession gestoppt wird.«
»Das würde Hattie nie versäumen«, meinte eine andere Frau, die Jacqueline gegenübersaß. »Sie hat sicherlich darum gebeten und wurde abgewiesen. Sinnvollerweise. Deshalb ist sie einfach ohne Genehmigung losgefahren. Sinnvollerweise.«
»Wer ist denn diese Hattie?« wollte Jacqueline wissen.
»Sie kennen Hattie nicht? Meine Liebe, Sie haben wirklich keine Ahnung vom Literaturbetrieb. Hattie hat diese Konferenz organisiert. Sie ist die internationale Präsidentin der Autoren von historischen Liebesromanen.«
»Ich bitte vielmals um Verzeihung«, sagte Jacqueline zerknirscht. »Das war mir nicht geläufig. Ist das denn alles, womit sie ihren Lebensunterhalt bestreitet – mit der Organisation von Konferenzen?«
Ihre Informantin ereiferte sich wie eine der Hexen in Macbeth. »Hattie ist Literaturagentin, Schätzchen. Die Literaturagentin. Alle Bestsellerautoren dieses Genres kommen aus ihrem Stall – Vanderbilt, Valentine und Victor von Damm – restlos alle. Das verschafft ihr eine Monopolstellung.«
»Wirklich?« Jacquelines Neugier war echt. Das Umfeld nichtakademischer Publikationen war ihr bislang unbekannt, und sie interessierte sich für fast alles.
»Lassen Sie sich das einmal durch den Kopf gehen, Schätzchen. Nicht nur einen der großen Namen – nein, alle. Wenn ein Verleger auf diesem Sektor Geld verdienen will, muß er sich mit Hattie auseinandersetzen, und sie ist eine ausgekochte Vertragspartnerin. Das heißt, sie kann sich ihre neuen Autoren gezielt aussuchen. Die meisten von ihnen würden morden, nur um von ihr vertreten zu werden. Alberne Trottel.«
Das Namensschild der Sprecherin war pinkfarben – eindeutig die Farbe, die den Agenten unter den Gästen vorbehalten war, wie man von der tief empfundenen, persönlichen Bitterkeit in der Stimme der Frau ableiten konnte.
Die Dame im Nerz, die im Laufe der Tirade ihrer Tischnachbarin Anzeichen von Bestürzung gezeigt hatte, rief in aufgebrachtem Tonfall: »Alle großen Namen, Pat? Wirklich alle?«
»Was? Oh ... oh, nein. Nicht alle.« Die Agentin hatte ihre Emotionen schließlich wieder unter Kontrolle. »Also ... meine Damen, Sie kennen doch sicherlich alle die berühmte Rosalind Roman – meine Klientin.«
»Liebste Pat ... Hattie ist wirklich nicht die einzig bedeutende Literaturagentin, meine Damen.«
Eine unangenehme Gesprächspause entstand. Dann sprachen plötzlich alle gleichzeitig. Mitten in dem Lärm zischelte Sue aus einem Mundwinkel heraus: »Aber Rosalind gehört zu denen, die morden würden, um in Hatties Stall überwechseln zu können.«
Dann ertönte ein Trompetenakkord, der in einem schnöden Mißton endete, da jemand das Band zu früh abgestellt hatte. Ein Samtvorhang hinter der Erhöhung wurde aufgeschoben, und die grauhaarige Dame, die Jacqueline zusammen mit dem hübschen jungen Mädchen im Wagen aufgefallen war, marschierte herein. Verhaltener und eher spöttischer Jubel begrüßte sie. Vielleicht begrüßten die Gäste das bevorstehende Auftragen des Essens ebensosehr wie das Auftauchen der Präsidentin der Autoren von historischen Liebesromanen.
Sie sah aus wie eine Allerweltstante Hattie – wohlwollendes Lächeln, zwinkernde Augen hinter ihren Brillengläsern und ein riesiger, mütterlicher Busen. Einzelne Strähnen kringelten sich aus ihrem unordentlichen grauen Haarknoten hervor. Mit ihrem säuselnden Virginia-Akzent hieß sie die Gäste willkommen, hoffte, daß sie noch nicht verhungert waren, lachte herzlich über ihren eigenen Witz und stellte die Ehrengäste vor, die einer nach dem anderen hinter dem Samtvorhang hervortraten und unter Hatties Lobesbezeugungen ihre Plätze einnahmen. Der brustbehaarte Held im schwarzen Umhang stellte sich als Victor von Damm heraus. Ihm folgten Emerald Fitzroy, Autorin von Dämmerstunde der erwachenden Liebe – der Rotschopf –, und schließlich Valerie Vanderbilt. Jacqueline hatte nicht damit gerechnet, daß die Autorin von Sklave der Wollust schüchtern war, aber Valerie schien es offenbar zu sein; sie hielt ihren Kopf mit der messingfarbenen Perücke gesenkt, während sie sich auf dem ihr von Victor zurechtgerückten Stuhl niederließ.
Eine nervöse Gesprächspause entstand, die lediglich vom Knurren leerer Mägen ausgefüllt wurde. »Und jetzt ist der Augenblick gekommen, auf den Sie alle mit Spannung gewartet haben«, rief Hattie. »Unser geheimnisumwitterter Gast. Erraten Sie, wer es ist? Wir haben ein solches Glück, Mädels! Hier ist sie – die Königin der Liebe in Person – die bekannteste, attraktivste und begabteste Schriftstellerin historischer Liebesromane weltweit – Valerie Valentine!«
Eigentlich hatte Jacqueline eher auf den Augenblick gewartet, in dem etwas Eßbares serviert wurde, aber nicht alle Gäste waren so zynisch wie sie. Stürmischer Beifall begrüßte den Auftritt des hübschen jungen Mädchens mit dem rotgoldenen Haar. In einem kostbaren weißen Organdy-Kleid glitt sie am Arm eines großen, nicht unbedingt attraktiven Mannes mit weißer Krawatte und Frack auf die Erhöhung. Er half ihr auf den thronartigen Sessel unmittelbar neben Hatties Platz und setzte sich auf die andere Seite.
Hattie griff nach dem Mikrophon, doch ihre Kommentare wurden von einem Heer hereinrauschender Kellner überstimmt. Sie waren bereits spät dran und wollten ihren langweiligen Job endlich hinter sich bringen. Die Speisen wurden auf den Tisch geknallt, Wein in Gläser gekippt, und Hattie sank zurück auf ihren Stuhl.
Das Menü entsprach dem klassischen Damenlunch – Chicken à la King, ein kaltes Röllchen pro Gast sowie zusammengefallene Kopfsalatblätter mit Fertigsauce. Das Dessert war die absolute Krönung – herzförmige Törtchen mit vier geeisten Erdbeeren, die verschämt aus einer Schicht synthetisch wirkender Schlagsahne hervorlugten. Dann gingen die Kellner mit Tee- und Kaffeekannen auf die Tische los, und die Gäste, die zwar gesättigt, aber nicht zufrieden waren, wandten ihre Aufmerksamkeit schließlich der intellektuellen Erbauung zu.
»Wer ist denn der Mann neben Valerie ... gütiger Himmel«, sagte Jacqueline andächtig. »Wie können Sie sie eigentlich auseinanderhalten?«
»Die Valerie-Vanderbilt-Fangemeinde nennt sie VV«, erklärte Sue. »Valentine benutzt ihren Nachnamen. Und das ist ihr Geliebter, der Graf von Devonshire.«
»Der Graf von Devonshire ist vierundachtzig und seit sechzig Jahren glücklich verheiratet mit einer Cousine der Königin.«
»Tatsächlich?«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung«, sagte Jacqueline. »Aber ich verwette meinen letzten Dollar, daß diese Person nichts mit der britischen Aristokratie zu tun hat.«
»Vielleicht ist er auch der Graf von Devonbrook. Irgend etwas in der Art.«
»Gütiger Himmel«, wiederholte Jacqueline.
»Es ist ziemlich schauderhaft hier, finden Sie nicht?«
»Schauderhaft?« Jacqueline fischte einen geschrumpften Ballon aus ihrer Kaffeetasse. »Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so prächtig amüsiert.«
*
Die sich an das Mittagessen anschließenden Vorträge waren glücklicherweise kurz; wie Hattie fröhlich zugab, lagen sie ein kleines bißchen hinter dem Zeitplan zurück. Sie mußte nur noch ein paar winzige Kleinigkeiten darlegen ...
Klischee jagte Klischee, und alles bezog sich in erster Linie auf die Verfasser der Romantik. »Wer weiß es besser als wir, daß die Liebe alles besiegt?« flötete Hattie.
Jacqueline langweilte sich zu Tode. Nicht unbedingt leise bemerkte sie: »Ach, welch eine Versuchung ist die Liebe.«
»Nur die Liebe allein«, zwitscherte Hattie. »Und manchmal auch der Alkohol«, fügte Jacqueline hinzu.. »Das ist von einem wenig bekannten Dichter namens Charles Dibdon. Er hat alles gesagt ...«
»Pst«, zischte die Dame im Nerz verärgert. Sue kicherte.
Jacqueline ließ sich nicht einschüchtern. Hatties »Die Liebe ist himmlisch und der Himmel voller Liebe« veranlaßte sie zu »Die Liebe ist wie die Masern; sie kann uns nur einmal erwischen, aber je älter wir sind, um so schlimmer erwischt sie uns«. »Jeder auf dieser Welt braucht die Liebe«, beharrte Hattie, woraufhin Jacqueline kopfschüttelnd Brotkrumen von ihrem Teller aufpickte. »Ich nicht. Lassen Sie mich davon verschont ... denn ich habe die Liebe satt. Vollkommen satt.«
»Sie müssen Englischlehrerin sein«, sagte Susan, während sich Hattie unter Beifall auf ihren Platz zurücksinken ließ.
»Bibliothekarin«, meinte Jacqueline nachdenklich. Während des Essens hatte sie das merkwürdige Verhalten von Valerie Vanderbilt zunehmend verwirrt. Obgleich letztere ihr Gesicht dicht über ihren Teller gebeugt hielt, schaute sie gelegentlich auf, wenn sie die Gabel zum Mund führte, und ihre Gesichtszüge kamen Jacqueline irgendwie bekannt vor. In Gedanken ließ sie alle bekannten Persönlichkeiten sowie ihre früheren Freundschaften an sich vorüberziehen, bis sie plötzlich eine Verbindung herstellte. Aber das war sicherlich unmöglich ... Als hätte sie übersinnliche Wahrnehmungskräfte, blickte VV plötzlich in ihre Richtung. Der Ausdruck äußerster Panik auf ihrem Gesicht überzeugte Jacqueline davon, daß sie sich nicht geirrt hatte.
Während die Kellner Geschirr und Gläser abräumten, zogen sich die Ehrengäste zurück. VV stürmte auf den Samtvorhang zu, doch ihre Hoffnung auf einen raschen Abgang wurde von Hattie vereitelt, deren stämmige Gestalt zunächst den Durchgang versperrte. Jacqueline verabschiedete sich von Sue, dann nahm sie die Verfolgung auf.
W bemerkte, daß sie auf sie zukam, und versuchte, ihr zu entkommen. Jacqueline schnitt der Schriftstellerin den Weg ab und zwang sie in eine Ecke.
»Jean. Wie lange ist das nun schon her? Aber ich würde dich überall erkennen!«
»Sie irren sich«, stammelte VV unter ihrer Perücke hervor. »Mein Name ist ...«
»Jean Frascatti, Jahrgangsstufe ... Nun, auch egal. Ich habe sicherlich genausowenig Lust wie du, mich an das Jahr zu erinnern. Heißt du immer noch Frascatti, oder hast du ...«
»Pst! Laß meinen Namen aus dem Spiel!«
Es bedurfte schon eines scharfen Blickes, die Ähnlichkeit mit der mittlerweile zwanzig Jahre älteren und stark geschminkten Frau herzustellen. Jeans Gesicht wirkte beinahe jugendlicher als in Jacquelines Erinnerung, und der leuchtendrote Lippenstift betonte einen Mund, der früher einmal ganz anders ausgesehen hatte. Aber sie waren Freundinnen gewesen, und auch wenn Jean ihr äußeres Erscheinungsbild verändert hatte, hatte sich an ihren Verhaltensweisen nichts geändert, und diese prägen einen Menschen doch wesentlich stärker als optische Merkmale
»In Ordnung«, sagte Jacqueline. »Wenn du es so haben willst. ... Es war nett, dich wiederzusehen.«
»Warte.« Eine Hand krallte sich an ihrem Ärmel fest. »Gütiger Himmel, daß ausgerechnet du von allen Menschen ... Was machst du hier?«
»Ich bin dafür bekannt, daß ich so gut wie überall auftauche«, sagte Jacqueline ungerührt. »Was machst du denn hier? Bist du wirklich ...«
»Ja. Warum sollte ich das abstreiten?« Das klang ziemlich frustriert.
»Dafür gibt es keinen ersichtlichen Grund. Ich schätze, daß niemand deinen richtigen Namen kennt.«
»Den muß auch keiner kennen.« Jean versagte die Stimme. »Versprichst du's mir? Daß du es niemandem erzählst?«
»Sicher, wenn du es nicht willst.«
»Du mußt es mir schwören. Schwöre bei ... bei Van Johnson.«
Jacqueline mußte lachen. »Den hatte ich fast vergessen.«
»Du hattest dich schrecklich in ihn verknallt.«
»Schnee von gestern ... Nun ja. Ich schwöre bei Van Johnson. Ich nehme an, daß du aufgrund der gegebenen Umstände – ich habe keine Ahnung, welche das auch immer sein mögen – nicht möchtest, daß ich dich erneut anspreche.«
»Nein. Doch. Warte eine Sekunde.«
Jacqueline wartete. Einen Augenblick später meinte Valerie-Jean: »Wenn ich dir sage, daß du verschwinden sollst, machst du das. Nicht wahr?«
»Selbstverständlich.«
»Aber ich würde mich gern mit dir unterhalten. O Gott, ich muß unbedingt mit einem Menschen reden.«
»Schön.«
»Aber nicht hier. Ich muß irgendeinem entsetzlichen Vortrag beiwohnen.«
»Dann mach einen Vorschlag.«
»Nach dem Vortrag. Wir treffen uns ... o Gott!« Mit einem Aufschrei wandte sie sich ab und stürmte auf ihren viel zu hohen Absätzen davon.
Jacqueline drehte sich um, um den Auslöser ihres überstürzten Aufbruchs in Erfahrung zu bringen.
Eine Frau im abgetragenen Tweedkostüm stand in ihrer Nähe. Sie war eine beeindruckende Erscheinung – groß und kräftig, mit grimmigen Gesichtszügen und den Anzeichen eines Damenbarts –, doch ihr drohend gezückter Filzstift schien sicherlich nicht so furchteinflößend, daß er Jean in die Flucht geschlagen hätte. Dann fiel es Jacqueline schlagartig ein. Die Schultertasche der Frau war ebenso groß wie die ihre, und sie nahm gerade ein Notizbuch heraus. »Journalistin« hätte ihr auf die Stirn geschrieben sein können.
»Welche Valerie sind Sie denn?« wollte die schnurrbärtige Dame wissen und deutete mit dem Stift auf Jacqueline.
»Bislang noch gar keine. Wenn ich einen Roman schreibe, beabsichtige ich, mich Valerie von Hentzau zu nennen.«
»Nicht übel.« Die Frau bleckte ihre Zähne. »Dann ist Ihr Namensschild ...«
»Ich habe gelogen.«
»Korrekt.«
Jacqueline betrachtete das Namensschild ihres Gegenübers. Zum ersten Mal kam ihr ein Name bekannt vor. »D. Duberstein. Sind Sie Dubretta Duberstein? Die Kolumnistin?«
»So nennt man mich unter anderem auch.« Dubrettas scharfe dunkle Augen taxierten suchend die Umgebung ab. »Haben Sie nicht eben mit Valerie Vanderbilt gesprochen?«
»Ich bin ein großer Fan von ihr«, murmelte Jacqueline.
»Ach, tatsächlich? Wie lustig. Nach ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen, schienen Sie sie eher eines Verbrechens bezichtigt zu haben.«
»Sie scheint ziemlich schüchtern zu sein.«
»Sie verbirgt irgend etwas. Das können Sie mir glauben. Ich frage mich ...«
Jacqueline lief neben ihr her und versuchte, sich ihr in den Weg zu stellen. »Ich bin auch ein Fan von Ihnen«, sagte sie. »Ich lese Ihre Kolumne.«
»Wie oft?«
»Alle Jubeljahre einmal.«
»Das habe ich mir gedacht.« Die andere Frau lachte laut und herzlich. »Sie wirken viel zu intelligent, als daß Sie auf meinen Blödsinn reinfielen.«
»Ich erinnere mich an einen Fall, den Sie aufdeckten«, sagte Jacqueline. »Liegt schon einige Jahre zurück. Sexuelle Belästigung im Bürgermeisteramt.«
»Ach, diese Geschichte. Dafür hätte man mich beinahe gefeuert. Meine Leser erwarten Skandalgeschichten von Prominenten.«
»Es war eine hervorragende Serie. Man hätte Sie für einen Pulitzer nominieren sollen.«