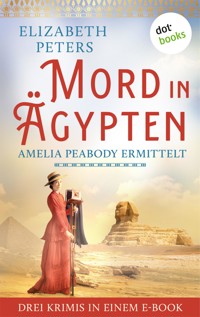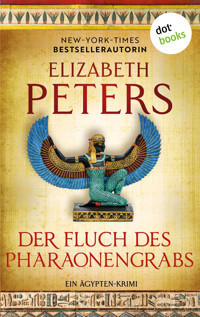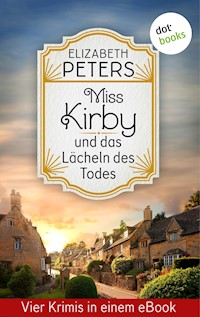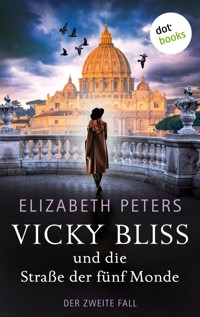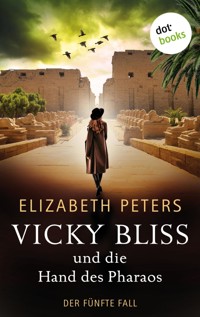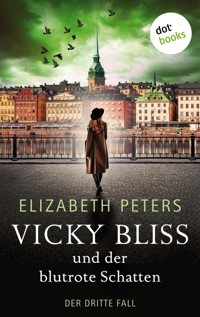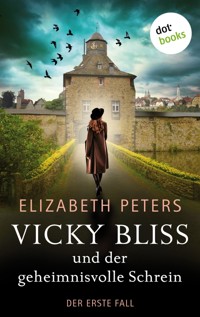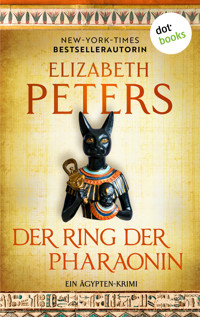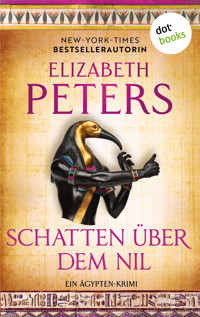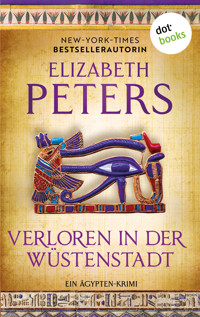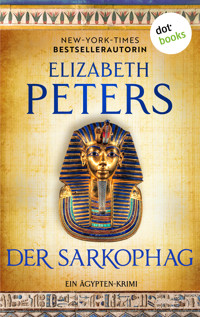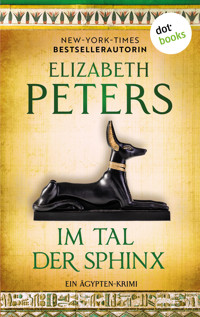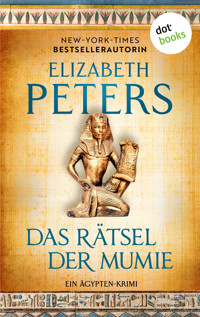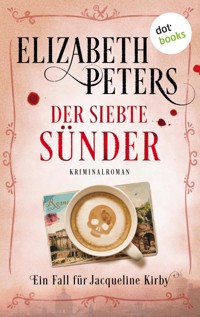Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jacqueline Kirby
- Sprache: Deutsch
Der Tod lädt zum Kostümfest ein: Der witzige Kriminalroman »Der letzte Maskenball« von Elizabeth Peters jetzt als eBook bei dotbooks. Ein rauschendes Kostümfest zu Ehren des berüchtigten Königs Richard III.? Kunstexpertin Jacqueline Kirby folgt der Einladung auf einen englischen Landsitz, um sich Hals über Kopf in das wilde Treiben zu stürzen. Doch einige scheinen nicht mit Spaß, sondern mit mörderischen Absichten bei der Sache zu sein! Jacqueline hat schon bald den Verdacht, dass unter den Gästen fanatische Anhänger des Killer-Königs ihr Unwesen treiben. Ihr Ziel: Seinen blutbefleckten Namen für die Geschichtsschreibung reinzuwaschen – koste es, was es wolle. Kann Jacqueline ihnen das Handwerk legen, bevor die ersten Köpfe rollen? »Eine großartige Erzählerin!« Mary Higgins Clark »Niemand ist besser darin, mit brennenden Fackeln zu jonglieren, während sie auf einem hohen Drahtseil tanzt als Elizabeth Peters.« Chicago Tribune Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Krimi-Highlight »Der letzte Maskenball« – Band 2 der erfolgreichen Krimireihe um die Hobby-Detektivin Jacqueline Kirby von Elizabeth Peters. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Lesetipps
Über dieses Buch:
Ein rauschendes Kostümfest zu Ehren des berüchtigten Königs Richard III.? Kunstexpertin Jacqueline Kirby folgt der Einladung auf einen englischen Landsitz, um sich Hals über Kopf in das wilde Treiben zu stürzen. Doch einige scheinen nicht mit Spaß, sondern mit mörderischen Absichten bei der Sache zu sein! Jacqueline hat schon bald den Verdacht, dass unter den Gästen fanatische Anhänger des Killer-Königs ihr Unwesen treiben. Ihr Ziel: Seinen blutbefleckten Namen für die Geschichtsschreibung reinzuwaschen – koste es, was es wolle. Kann Jacqueline ihnen das Handwerk legen, bevor die ersten Köpfe rollen?
»Eine großartige Erzählerin!« Mary Higgins Clark
»Niemand ist besser darin, mit brennenden Fackeln zu jonglieren, während sie auf einem hohen Drahtseil tanzt als Elizabeth Peters.« Chicago Tribune
Über die Autorin:
Hinter der US-amerikanischen Bestsellerautorin Elizabeth Peters steht Barbara Louise Gross Mertz (1927–2013), die auch unter dem Pseudonym Barbara Michaels erfolgreich Krimis und Thriller schrieb. Die Autorin promovierte an der University of Chicago in Ägyptologie. So haben auch ihre über 20 Kriminalromane, für die sie zahlreiche Preise gewann, meist einen historischen Hintergrund.
Die Kriminalromanreihe um Jacqueline Kirby bei dotbooks umfasst: »Der siebte Sünder: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 1« »Der letzte Maskenball: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 2« »Ein preisgekrönter Mord: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 3« »Ein todsicherer Bestseller: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 4«
Ebenfalls bei dotbooks erscheint ihre Krimireihe um die abgebrühte Meisterdetektivin Vicky Bliss: »Vicky Bliss und der geheimnisvolle Schrein – Der erste Fall« »Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde – Der zweite Fall« »Vicky Bliss und der blutrote Schatten – Der dritte Fall« »Vicky Bliss und der versunkene Schatz – Der vierte Fall« »Vicky Bliss und die Hand des Pharaos – Der fünfte Fall«
***
eBook-Neuausgabe Februar 2019
Dieses Buch erschien bereits 1985 unter dem Titel »Tödliches Spiel« bei Heyne und 1998 unter dem Titel »Der letzte Maskenball« bei Econ.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1974 by Elizabeth Peters
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1974 unter dem Titel »The Murders of Richard III« bei Mysterious Press.
Copyright © der deutschen Ausgabe 1985 by Heyne Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Published by Arrangement with BARBARA G. MERTZ REVOCABLE TRUST
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Rashad Ashur, Olga Nikonova, aekikuis und Richard Peterson
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-443-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der letzte Maskenball« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Peters
Der letzte Maskenball
Ein Fall für Jacqueline Kirby
Aus dem Amerikanischen von Ursula Walther
dotbooks.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Lesetipps
Für Margeeine liebe Freundin und Gefährtinbei den mühseligen Recherchen über Richard
Kapitel 1
Es war das Porträt eines Mannes. Eine Reinigung hatte kürzlich die ganze Pracht der Farben zutage gefördert: der Hintergrund in glühendem Rot, das Karmesin der Rubine in dem juwelenbesetzten Kragen und auf der Hutbrosche, das Gold der Stickerei am Wams, das unter der aufklaffenden Robe zu sehen war, und an den geschlitzten Ärmeln. Dennoch war der Gesamteindruck düster, fast melancholisch. Schulterlanges, braunes Haar umrahmte das hagere Gesicht. Es war nicht das Gesicht eines jungen Mannes, obwohl das Modell knapp dreißig Jahre alt gewesen war, als es gemalt wurde. Falten durchsetzten den verkniffenen Mund und bildeten tiefe Furchen zwischen den dicht zusammenstehenden Augen, deren Blick sich nicht auf den Betrachter, sondern auf eine innere Vision richtete. Welche Gedanken ihn auch immer bewegten, sie konnten nicht erfreulich gewesen sein.
Das Porträt übte auf einige Menschen eine seltsame Wirkung aus. Thomas Carter war einer von ihnen. Er hatte es schon unzählige Male betrachtet; genaugenommen hatten sich die Gesichtszüge des porträtierten Mannes tiefer in sein Gedächtnis eingeprägt als die seines eigenen Vaters, der voller Erbitterung in Peoria, Illinois, sein achtes Jahrzehnt durchlebte. Thomas konnte sich den beinahe hypnotischen Zauber, den das gemalte Gesicht ausstrahlte, nicht erklären, aber er hoffte inständig, daß es denselben Effekt auf seine Begleiterin hatte. Private Gründe nährten seinen Wunsch, daß Jacqueline Kirby an Richard III., dem einstmaligen König von England, der vor fast fünfhundert Jahren einen grausigen Tod auf dem Schlachtfeld erlitten hatte, Interesse entwickelte.
Thomas hatte sich seit dem Tag, an dem er die Bibliothekarin Jacqueline Kirby in der Universität im Osten Amerikas kennengelernt hatte, kaum verändert. Inzwischen durchzogen ein paar mehr graue Fäden sein Haar, doch sie waren in dem Hellblond kaum zu sehen. Sein weiter blauer Pullover verbarg geschickt die Neigung zur Körperfülle. Thomas war ein ganz ordentlicher Golfer und ein guter Tennisspieler, aber er war auch ein leidenschaftlicher Amateurkoch, und dieses Hobby hinterließ deutliche Spuren an seiner Figur. Der blaue Pullover und die abgetragene Tweedhose waren britischer Herkunft, Thomas hingegen nicht, obwohl er gegenwärtig Vorlesungen an einer der ältesten Universitäten Englands hielt.
Sein langes Junggesellendasein hatte unausweichlich Anlaß zu Gerüchten gegeben. Thomas wußte davon, aber es störte ihn nicht; im Grunde gab er den Gerüchten sogar neue Nahrung, indem er so gut wie nichts über seine persönlichen Angelegenheiten verlauten ließ. Obgleich er, hätte man ihn darauf angesprochen, die Vermutungen ungehalten zurückgewiesen hätte, war er ein ziemlich altmodischer Mann mit der Überzeugung, daß ein Gentleman nicht mit seinen Eroberungen prahlen durfte. Doch in Wahrheit sah er seinen Ruf als äußerst nützliche taktische Waffe an. Die Munkeleien wiegten die Damenwelt in Sicherheit und machten sie unvorsichtig.
Weder dieser Trick noch irgend etwas anderes konnte Thomas jedoch bei seinen Attacken auf Jacqueline unterstützen. Er hatte die Verfolgung aufgenommen, gleich nachdem er sie zum erstenmal halb versteckt hinter dem Pult in der Bibliothek gesehen hatte, wo sie jedem, der hereinkam, mit demselben finsteren Blick durch die Brille entgegengeschaut hatte. Thomas waren sofort die smaragdgrünen Augen hinter den Brillengläsern und das dichte kupferfarbene Haar aufgefallen, das sie zu einem strengen Knoten zusammengefaßt trug. Er erahnte sogar ziemlich akkurat ihre Körpermaße unter dem Wollkostüm. Das Jobangebot aus England beendete sein Werben, noch bevor es richtig begonnen hatte. Trotzdem waren er und Jacqueline Freunde geworden, und Thomas schätzte Jacquelines wachen, unorthodoxen Verstand und ihren sonderbaren Humor ebensosehr wie ihre anderen durchaus ansprechenden Attribute. Als Jacqueline ihm schrieb, daß sie einen Teil des Sommers in England verbringen würde, antwortete er ihr begeistert und bot ihr seine Dienste als Führer durch London an. Zu dieser Zeit hatte er noch keine Hintergedanken gehabt. Allerdings hatte sich seither etwas ergeben, und er hatte sie aus einem ganz bestimmten Grund hierher geführt. Die National Portrait Gallen stand, obwohl sie eine von Londons bekannten Touristenattraktionen war, nicht gerade ganz oben auf Jacquelines Liste der Dinge, die sie sich anschauen wollte. Thomas warf ihr einen unbehaglichen Blick zu. Falls sie seine eigenmächtige Entscheidung nicht guthieß, würde sie ihm das unmißverständlich und in unsanften Tönen klarmachen.
Jacqueline betrachtete das Porträt mit starrem Blick. Ihre Hornbrille saß hoch oben auf der Nase, aber den Rest ihres Arbeitskostüms hatte sie zu Hause gelassen. Sie trug ein kurzes, enganliegendes Kleid in ihrem Lieblingsgrün; die kurzen Ärmel und der tiefe Ausschnitt ließen eine bewundernswert sonnengebräunte Haut frei. Strähnen des kupferfarbenen Haars ringelten sich über ihren Ohren und an den Schläfen. Sie fing an zu reden, ohne den Kopf zu drehen. Ihre Stimme konnte man, wie es Thomas erwartet hatte, beim besten Willen nicht als sanft bezeichnen.
»Der Tower von London«, sagte sie. »Westminster Abbey. Buckingham Palace. Ich bin nur ein kleines Mädchen vom Lande, das noch nie zuvor im Ausland war. Was mache ich hier eigentlich? Ich will den Wachwechsel sehen. Ich will Tee trinken, echten englischen Tee in einem echten Londoner Teashop. Ich will ...«
»Du hast gerade erst zu Mittag gegessen«, fiel ihr Thomas entrüstet ins Wort. »Bei Simpson's an der Themse. Du hattest ein äußerst opulentes Mittagessen. Denkst du denn überhaupt nicht an deine Linie?«
Statt etwas darauf zu erwidern, schaute Jacqueline ihn aus den Augenwinkeln an und heftete den Blick auf seine Taille. Instinktiv zog Thomas den Bauch ein, und Jacqueline setzte ihren düsteren Monolog fort.
»Es würde mir nicht einmal etwas ausmachen, mir Porträts anzuschauen. Elisabeth die Erste. Karl der Zweite ... Ich schwärme für Karl den Zweiten. Er war sehr sexy. Ich könnte auch Keats und Byron und Shelley ohne Probleme in Betracht ziehen. Aber was bekomme ich zu sehen? Ein schlechtes Porträt – wenn es überhaupt ein Porträt ist und nicht das Phantasieprodukt eines Malers aus dem siebzehnten Jahrhundert –, das einen berüchtigten Schurken aus dem Mittelalter darstellen soll. Den alten Buckligen höchstpersönlich.«
»Alter Buckliger!« Thomas war aufgebracht. »Sieh ihn dir an. Erkennst du irgend etwas, was an seinem Rücken nicht stimmen könnte?«
Jacqueline studierte das Gemälde noch einmal, und Thomas atmete erleichtert auf, als die Brille auf ihrer schmalen Nase ein Stückchen tiefer rutschte. Die Brille war ein Barometer für Jacquelines Stimmungen. Wenn sie sich für etwas interessierte oder sich ernsthafte Gedanken machte, vergaß sie, die Brille wieder an ihren Platz zu schieben. In besonders emotionalen Momenten saß sie bedenklich locker ganz vorn auf der Nasenspitze.
»Nein«, gestand Jacqueline schließlich. »An den Schultern ist unter Umständen ein vager Hinweis auf eine Deformation zu vermuten – die eine scheint höher zu sein als die andere. Aber das könnte am Unvermögen des Malers liegen. Richard der Dritte war ganz bestimmt nicht bucklig. Er sieht sogar gut aus – auf seine schwermütige Art. Es ist doch ein zeitgenössisches Gemälde, oder?«
Thomas musterte sie argwöhnisch. Sie betrachtete nach wie vor das Porträt von Richard III. mit unvoreingenommener Aufmerksamkeit, aber Thomas ließ sich davon nicht täuschen. Kunstgeschichte gehörte zu Jacquelines Spezialgebieten.
»Nein. Es ist etwa 1580 entstanden. Wie die meisten anderen Porträts von Richard ist es wahrscheinlich eine Kopie von einem inzwischen verlorengegangenen Original. Das einzige Bild von ihm, das zeitgenössisch sein könnte, befindet sich in der königlichen Sammlung. Als es vor kurzem mit Hilfe von Röntgenstrahlen untersucht wurde, fanden die Experten heraus, daß Teile übermalt wurden. Ursprünglich war die rechte Schulter genauso hoch wie die linke, außerdem waren die Augen nicht so schlitzartig und standen nicht so eng zusammen.«
Jacqueline zog die Augenbrauen hoch. Sie würde es nie zugeben, aber Thomas wußte, daß er ihr Interesse geweckt hatte.
»Retuschiert, um ihn bucklig und wie einen schielenden, gemeinen Schuft aussehen zu lassen? Das legt die Vermutung nahe, daß das Original ein zeitgenössisches Gemälde und zu schmeichelhaft für den Geschmack von Richards Feinden war. Mal sehen ... wenn ich meine Geschichtsstunden noch richtig in Erinnerung habe, dann war Richards Nachfolger Heinrich der Siebte, der erste der Tudor-Könige und der letzte Erbe des Hauses Lancaster. Richard gehörte dem Geschlecht der Yorks an. Heinrich riß die Krone an sich, nachdem er Richard bei der Schlacht von Bosworth besiegt und getötet hatte ...«
»Heinrich Tudor hat nie jemanden bei einem fairen Kampf getötet«, warf Thomas verächtlich ein. »In Bosworth nahm er Reißaus, als Richard von einem Dutzend Männer niedergemetzelt wurde. Heinrich wollte Richards guten Namen zerstören. Er hatte keinen rechtlichen Anspruch auf den Thron, und kaum jemand unterstützte ihn. Er hätte die Schlacht von Bosworth verloren, wenn seine verwitwete Mutter nicht so schlau gewesen wäre, einen der mächtigsten Adligen des Königreichs zu heiraten. Lord Stanley und sein Bruder marschierten als Richards Vasallen auf das Schlachtfeld von Bosworth, umzingelten ihn und griffen ihn heimtückisch an. Die einzige Möglichkeit, wie Heinrich seine Machtergreifung rechtfertigen konnte, war, Richard als Usurpator und Tyrannen hinzustellen. Andernfalls hätte man ihn als Thronräuber und Rebellen gegen den rechtmäßigen König angesehen. Heinrich spann die Tudor-Legende vom niederträchtigen König Richard. Er schrieb buchstäblich die Geschichte um. Er ...«
»Er war nicht sexy«, sagte Jacqueline in bedauerndem Tonfall.
Sie war zum nächsten Gemälde gegangen; Thomas gesellte sich zu ihr, und sie sahen sich gemeinsam das Porträt von Heinrich VII. an.
»Habgierige Hände, ein Mund wie eine Stahlfalle und verschlagene, mißtrauische Gesichtszüge.« Sie wandte sich dem nächsten Porträt zu. »Und wer ist diese affektierte, puppengesichtige blonde Lady?«
»Heinrichs Königin, Elisabeth von York. Seine Ehe mit ihr vereinte die Häuser Lancaster und York und beendete die Rosenkriege. Sie war Richards Nichte, die Tochter seines älteren Bruders Eduard des Vierten. Ihn siehst du hier auf diesem Gemälde. Er gilt als der hübscheste König, den England je hatte – einsachtzig groß, blond, und er hatte immer ein Herz für die Ladies.«
»Er sieht nicht sehr sexy aus«, stellte Jacqueline fest, während sie das flache, teigige Gesicht von Eduard IV. kritisch beäugte.
»Sexy – zum Teufel damit. Wenn ich gewußt hätte, daß du unter historischer Nekrophilie leidest, hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dich hierher zu bringen. Können wir gehen?«
»O nein. Du hast mich hergeschleppt, und ich gehe nicht, bevor ich nicht alle meine Helden gesehen habe. Keats, Shelley – und natürlich König Karl den Zweiten. Wo ist er? ›Here's a health unto his Majesty ...‹«
«Ich hatte ganz vergessen, daß du die bedauerliche Gewohnheit hast, in den seltsamsten Augenblicken Lieder zu singen. Jacqueline ...«
Es kostete Thomas mehr als eine Stunde, Jacqueline aus der Galerie zu bugsieren. Erst mußte sie das Porträt von Karl II. bewundern, und jede aus der langen Reihe seiner offiziellen Mätressen erntete einen bissigen Kommentar. Jacqueline fand sie alle zu fett. Als Thomas sie schließlich durch die Tür nach draußen schubste, herrschte bereits dichter Nachmittagsverkehr auf dem Trafalgar Square, und Jacqueline behauptete steif und fest, sie würde umkommen vor Hunger.
»Kein Wunder, daß ich England so liebe«; erklärte sie einige Zeit später, als sie die meisten der mit Creme gefüllten süßen Brötchen, die auf einer Platte serviert worden waren, vertilgt hatte. »Die Leute hier essen so oft. Morgentee, Frühstück, zweites Frühstück, Lunch, Nachmittagstee ...«
»Ich glaube nicht, daß ich mir dich auf die Dauer leisten könnte«, seufzte Thomas.
»Ich weiß, daß du es nicht kannst.« Jacqueline bedachte ihn mit einem Blick, der ihn für einen Moment sprachlos machte. Sie schob entschlossen die Brille an ihren Platz und betrachtete ihn ernst. »Also schön, Thomas. Ich weiß, daß du etwas im Schilde führst. Erst lädst du mich zu einem Wochenende aufs Land zu Leuten ein, die ich noch nie im Leben gesehen habe, dann überschüttest du mich mit Informationen über eine der verworrensten Perioden in der englischen Geschichte. Da muß ein Zusammenhang bestehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, welcher. Komm schon; ich sehe doch, daß du dich danach verzehrst, mir eine Vorlesung zu halten. Ich kenne diesen finsteren Klassenzimmer-Blick.«
»Ich habe nicht die Absicht, dir eine Vorlesung zu halten«, entgegnete Thomas unsicher. »Wieviel weißt du über ...«
Er hielt inne und starrte Jacqueline an. Sie war auf ihrem Stuhl zur Seite gerutscht und griff nach unten. Die Hand unter dem Tisch war nicht zu sehen, aber sie schien fieberhaft nach etwas zu suchen.
»Um Himmels willen«, brauste Thomas auf. »Was suchst du? Wenn es Zigaretten sind, kaufe ich dir welche. In dieser voluminösen Handtasche findest du ohnehin nie etwas. Oder ist es deine Aktentasche? Egal, ich dachte, du hättest das Rauchen aufgegeben.« Jacqueline richtete sich wieder auf. In einer Hand hielt sie ein Knäuel mit weißem Garn, in der anderen ein Metallschiffchen. Thomas sah ihr mit offenem Mund zu, wie sie das Garn mit eigenartigen Schlingen um die Finger wickelte.
»Ich hab's neunmal aufgegeben, seit du mich das letzte Mal gesehen hast. Ich habe mit Knüpfarbeiten angefangen, um es mir ein zehntes Mal abzugewöhnen. Erst wollte ich es mit Stricken versuchen, aber das hat nicht funktioniert; jedesmal, wenn ich in die Handtasche griff, habe ich mich mit einer Stricknadel in die Finger gestochen.«
»Ich schätze, das da wird auch nicht funktionieren«, sagte Thomas. »Entschuldige, daß ich es erwähne, aber deine Finger werden blau. Ich glaube, du hast den Faden zu fest gewickelt.«
Jacqueline legte das Schiffchen weg und entwirrte Faden und Finger.
»Thomas, du läßt dich zu leicht ablenken. Wenn ich Klimmzüge am Kronleuchter gemacht hätte, wäre es dir nicht im Traum eingefallen, deinen Vortrag abzubrechen. Ich höre dir zu. Wieviel weiß ich über was?«
Mit einiger Mühe riß sich Thomas von dem Kampf zwischen Jacqueline und ihrer Handarbeit los.
»Ich wäre nicht überrascht, wenn du so was machen würdest. Klimmzüge, meine ich ... Wieviel weißt du über Richard den Dritten?«
Jacqueline verzog das Gesicht zu einer abscheulichen, gemeinen Fratze und sagte aus dem Mundwinkel mit dem Akzent eines Kino-Gangsters: »›Ich bin entschlossen, einen Schurken zu entlarven/Und ich hasse die müßigen Vergnügungen der Zeit! ‹«
»Oh, vergiß Shakespeare«, sagte Thomas. »Sein König Richard der Dritte basiert auf den Machwerken der Tudor-Geschichtsschreiber, und sie haben Richard verleumdet, um sich bei Heinrich dem Siebten einzuschmeicheln. Shakespeares Version ist großes Theater, aber sie basiert nicht auf gesicherten historischen Fakten. Versuchen wir es mit einer anderen Frage. Wieviel weißt du über die Rosenkriege?«
»Ein bißchen was über alles, aber nicht genug«, gestand Jacqueline. »Ich bin Bibliothekarin, schon vergessen? Oh ...« Der letzte Laut klang wie ein tiefes Stöhnen. Vorsichtig befreite sie ihre anschwellenden Finger von dem verwickelten Faden, knüllte die Handarbeit zusammen und warf sie in ihre Handtasche zurück. Der Fehlversuch hatte ihr die Laune verdorben. Streitlustig fuhr sie fort: »Ich hab' sie nie verstanden, diese Rosenkriege. Ich glaube, kein Mensch versteht die Rosenkriege. Ich will sie auch gar nicht verstehen ... die Rosenkriege. Die Häuser Lancaster und York – die rote Rose und die weiße – kämpften um den Thron. Darum ging's bei den Rosenkriegen. Mehr weiß ich nicht darüber, und mehr brauche ich auch nicht zu wissen.«
»Gut, gut«, sagte Thomas beschwichtigend. »Der letzte der Lancaster-Könige war Heinrich der Sechste – nicht zu verwechseln mit Heinrich dem Siebten, dem, ersten der Tudors. Heinrich der Sechste war ein netter, unfähiger Trottel – halb Heiliger, halb Geistesgestörter. Sein erfolgreicher York-Rivale war Eduard der Vierte, der hübsche große Blonde, dessen Zeitgenossinnen ihn sexy fanden, auch wenn du es nicht tust. Eduard wurde Heinrich den Sechsten los, und Heinrichs Sohn und ein paar andere, die hätten eingreifen können, richteten sich behaglich ein, um das Leben zu genießen und Eduard alles weitere zu überlassen. Eduards größter Fehler war, daß er sich mit einer Witwe namens Elisabeth Woodville vermählte. Alle Welt war schockiert über die Heirat mit einer Bürgerlichen; das Volk und besonders die Adeligen nahmen es Eduard übel, daß er Englands Position nicht mit einer Verbindung zu einer fremden Prinzessin stärkte. Elisabeth hatte zwei Söhne aus erster Ehe und eine Menge Brüder und Schwestern. Die Woodville-Verwandtschaft war ein gieriger Haufen, und Elisabeth verhalf ihnen tatkräftig zum Aufstieg. Sprosse aus den vornehmsten Familien Englands wurden gezwungen, die Geschwister der Königin zu heiraten; ganz England war empört über die Hochzeit eines zwanzigjährigen Woodville mit der achtzig Jahre alten Herzoginwitwe von Norfolk. Eduard zeugte eine ganze Horde Kinder mit seiner schönen Frau – zwei Söhne und eine Reihe Töchter. Die älteste Tochter hieß auch Elisabeth.«
»Diese Leute haben alle dieselben Namen«, murrte Jacqueline. »Eduard, Elisabeth, Heinrich. Kannst du sie nicht der besseren Übersicht wegen Ethelbert oder Francisco oder irgendwie sonst nennen?«
»Das kann ich nicht«, versetzte Thomas kühl. »Weil sie eben nicht so heißen. Hör auf zu meckern und konzentriere dich lieber.«
Jacqueline nahm sich ein Gurkensandwich. Sie tranken in der Lounge eines der würdigen alten Hotels von London den echten englischen Tee, den sie gefordert hatte. Das Klimpern des Silberbestecks und das Klappern des Geschirrs war nicht lauter als das gedämpfte Stimmengemurmel der anderen Gäste.
»Eduard der Vierte«, fuhr Thomas fort. »Der York-König – Richards Bruder. Hast du das verstanden? Gut. Eduard starb früh mit nur vierzig Jahren, erschöpft nach einem ausschweifenden Leben. Er hinterließ zwei Söhne. Der ältere wurde nach dem Tod des Vaters Eduard der Fünfte ...« Er ignorierte Jacquelines Grimasse und setzte unbarmherzig hinzu: »Ja, noch ein Eduard. Er war noch ein Kind – zwölf Jahre alt und zu jung, um allein zu regieren. Ein Protektorat wurde notwendig, und der geeignetste Kandidat für die Rolle des Protektors war der einzige Onkel väterlicherseits, der jüngere Bruder Eduard des Vierten – ein brillanter Soldat, ein erstklassiger Verwalter, ein hingebungsvoller Ehemann und Vater für seinen kleinen Sohn, ein loyaler, aufrechter, beliebter Mann – Richard Herzog von Gloucester.«
»Ein dreifach Hoch und Trommelwirbel«, sagte Jacqueline. »Menschenskind, Thomas, nicht auszudenken, daß wir all die Jahre eine ganz falsche Vorstellung von Richard dem Dritten hatten. Er war ein feiner Kerl. Ich staune, daß man ihn nicht heiliggesprochen hat. Ein geliebter Ehemann, ein rührender Vater, ein bewundernswerter Bruder ... auch ein liebevoller Onkel?«
»Du hast eine Zunge wie eine Viper.«
»Danke. Sieh mal, Thomas, was ist es, das die Leute – wenn überhaupt – über Richard den Dritten wissen? Er war der böse Onkel par excellence. Er erstickte seine Neffen – die beiden kleinen Prinzen im Tower – und riß den Thron an sich, der ihnen, als den Erben des letzten Königs, rechtmäßig zustand.«
»Das hat er nicht getan!« schrie Thomas.
Die anderen Gäste drehten ihre Köpfe nach ihm um. Ein Kellner ließ eine Gabel fallen.
Thomas duckte sich ein bißchen und wurde rot.
»Verdammt, Jacqueline, das ist der faszinierendste ungelöste Mordfall der Geschichte. Es gibt keinen Beweis. Weißt du das? Absolut keinen wie auch immer gearteten Beweis, daß Richard diese Kinder getötet hat. Nur Gerüchte und Verleumdungen auf der einen Seite ...«
»Und auf der anderen?«
»Richards Charakter. Das andernfalls unerklärliche Verhalten der anderen Beteiligten. Schlicht gesunder Menschenverstand.«
»Ich würde nicht gerade behaupten, daß Richards Charakter ...«
»Ich meine seinen wahren Charakter, nicht den, den die Tudor-Historiker ihm angedichtet haben. Alles, was über Richards Taten bekannt ist, zeichnet ein Bild von einem durch und durch integren, freundlichen und couragierten Mann. Mit achtzehn Jahren befehligte er Armeen, und er führte sie gut. Er verwaltete die nördlichen Provinzen für seinen Bruder, den König, und gewann die dauerhafte Loyalität der Bevölkerung für das Haus York durch seine Anständigkeit und sein Bestreben, den einfachen Menschen zu ihrem Recht gegen die habgierigen Adeligen zu verhelfen. Er unterstützte die schönen Künste. Er war tief religiös. Was sein persönliches Leben betrifft – oh, er zeugte ein paar Bastarde, jeder Mann tat das in diesen Zeiten, aber nachdem er geheiratet hatte – ein Mädchen, das er seit Kindertagen kannte –, blieb er seiner Frau treu, solange sie lebte, und er weinte um sie, als sie starb. Der Tod seines kleinen Sohnes stürzte ihn in tiefe Trauer. In einer Epoche, in der Verrat und Mißgunst herrschten, blieb er immer seinem Bruder, König Eduard dem Vierten, treu ergeben. Es gab noch einen dritten Bruder, den Herzog von Clarence, der versuchte, eigene Ansprüche auf den Thron geltend zu machen, und sogar die Waffen gegen Eduard den Vierten erhob. Richard überredete Clarence, ›in den Schoß der Familie‹ zurückzukehren, und als Eduard schließlich in Wut über Clarence' Komplotte geriet und seine Exekution anordnete, war Richard der einzige, der für Clarence eintrat.«
»Da hab' ich aber etwas ganz anderes gehört«, warf Jacqueline nüchtern ein, bevor sie herzhaft in das letzte Sandwich biß.
»Du hast die Tudor-Legende gehört – die erfundene Geschichte von Richard dem Scheusal. Als Thomas More die Biographie von Richard während der Regentschaft von Heinrich dem Achten niederschrieb, wurde Richard aller Verbrechen außer Brandstiftung und dem Handel mit öffentlichen Ämtern beschuldigt. Laut More brachte Richard Heinrich den Sechsten und Heinrichs Sohn, seine eigene Frau und seinen Bruder, den Herzog von Clarence, kaltblütig um. Er hat seine Neffen unschädlich gemacht, den Thron an sich gerissen und einige Adlige enthauptet, die sich gegen ihn stellten.
Moderne Historiker räumen ein, daß die meisten Anschuldigungen gegen Richard jeder Grundlage entbehrten. Er ließ einige Adlige hinrichten, darunter waren auch Verwandte der Woodville-Königin. Er sagte, sie hätten ihm nach dem Leben getrachtet, und es besteht kein Grund, an dieser Aussage zu zweifeln. Wenn Richard Menschen tötete, dann bei hellem Tageslicht, mit einer Menge Zeugen, und er machte nicht viel Federlesens mit seinen Gegnern. Aber die beiden kleinen Prinzen sind einfach ... sang- und klanglos verschwunden.«
»Äußerst interessant. Aber was hat das alles mit dieser mysteriösen Wochenendparty zu tun? Du tust so geheimnisvoll, und ich verstehe nicht ...«
»Dazu komme ich noch. Sieh den Kellner nicht so sehnsüchtig an; ich habe nicht vor, noch etwas zu essen zu bestellen – du hast schon genug für zwei vertilgt. Paß auf. Ich versuche nicht nur, Dir Nachhilfe in der Geschichte Englands zu erteilen – all das steht in Zusammenhang mit einem aktuellen Problem.
Kehren wir also zurück zu der Zeit kurz nach dem Tod von Eduard dem Vierten. Richard hielt sich im Norden auf, in seinem Lieblingsschloß in Middleham. Der neue junge König hatte seinen eigenen Hof in Wales. Als ihn die Nachricht vom Tod seines Vaters erreichte, brach er in Begleitung seiner Woodville-Onkel – die Königin stellte sicher, daß ihre Brüder die Kontrolle über den Thronerben behielten – und einer Eskorte von tausend Männern nach London auf. Richard, der sich nach Süden auf den Weg machte, um an den Begräbnisfeierlichkeiten teilzunehmen, hatte nur sechshundert Mann bei sich. Offensichtlich rechnete er nicht mit Schwierigkeiten.
Aber irgendwie bekam er auf seiner Reise Wind davon, daß die Woodvilles planten, die Macht zu ergreifen und ihn als Protektor auszuschalten. Vielleicht hatten sie sogar vor, ihn zu töten. Eigentlich hätten sie das tun müssen – Richard hatte die Unterstützung und den legalen Anspruch, was ihnen fehlte, und er gehörte nicht zu den Männern, die auch die andere Wange hinhielten.
Zwei Männer warnten Richard vor der Gefahr. Einer von ihnen war Lord Hastings, der alte Freund und Trinkkumpan seines Bruders. Der andere war der Herzog von Buckingham, der selbst von königlicher Herkunft und gezwungen worden war, eine der Schwestern der Woodville-Königin zu heiraten.
Richard ritt wie der Blitz. Er holte das Gefolge des neuen Königs ein, nahm die Woodville-Verwandten des Jungen fest und begleitete den kleinen Eduard selbst nach London. Die Königin bat überstürzt die Kirche um Asyl und nahm ihre anderen Kinder mit an ihren Zufluchtsort. Später konnte sie dazu bewogen werden, den jüngeren Sohn zum neuen König zu schicken. Die beiden Kinder wurden in den königlichen Gemächern im Tower untergebracht – dort wohnten traditionsgemäß die Thronprätendenten vor ihrer Krönung. Bis zu diesem Zeitpunkt war Richards Verhalten untadelig und aufrecht.«
»Richard der Aufrechte«, murmelte Jacqueline.
Thomas tat, als hätte er den Kommentar nicht gehört. »Dann, Mitte Juni 1483, brach die Hölle los. England war verblüfft zu hören, daß Eduard der Vierte nie rechtmäßig mit Elisabeth Woodville verheiratet war. Er hatte einer anderen Lady vertraglich die Ehe versprochen, und zur damaligen Zeit war ein schriftliches Eheversprechen so bindend wie eine Hochzeitszeremonie. Das hieß also, daß alle Kinder Eduard des Vierten illegitim waren und daß der junge Eduard der Fünfte kein Recht auf den Thron hatte.
Die Tudor-Historiker behaupten, Richard habe die Geschichte mit dem Eheversprechen erfunden, aber alles spricht dafür, daß sie wahr ist. Der Mann, der das Geheimnis lüftete, konnte wirklich nicht im Verdacht stehen, Richards anrüchiger Speichellecker zu sein; er war einer der großen Prälaten von England, der Bischof von Bath und Wells. Das Parlament jedenfalls erklärte Eduards Ehe mit Elisabeth Woodville für ungültig und erließ ein formelles Dekret, Titulus Regius, in dem Richards Thronanspruch festgeschrieben wurde. Seine beiden Brüder waren tot; Clarence' Kinder waren von der Thronfolge ausgeschlossen, weil ihr Vater als Verräter hingerichtet worden war, und da Eduards Kinder allem Anschein nach mit Fug und Recht als unehelich betrachtet werden konnten, war Richard der rechtmäßige Erbe der Krone.«
»Oh, dann ist ja alles gut«, meldete sich Jacqueline zu Wort. »Wenn die Jungs Bastarde waren, hatte Richard jedes Recht, sie abzumurksen.«
»Verdammt, er hat sie nicht abgemurkst!« Thomas spürte, wie ihm die Hitze ins Gesicht stieg. Er rang mühsam um Fassung. »Die Kinder wurden gesehen, als sie im Tower zusammen spielten – im Sommer 1483. Abgesehen von ein paar fragwürdigen Einträgen in den offiziellen königlichen Büchern war dies das letzte Mal, daß jemand etwas von ihnen gesehen oder gehört hat.
1485, also zwei Jahre später, kam Heinrich Tudor nach England. Dank des Verrats der Stanleys wurde Richard in Bosworth getötet, und der Tudor wurde König Heinrich der Siebte.
Was hättest du an Heinrichs Stelle getan? Du sitzt auf einem wackligen Thron in einem Land, in dem unterschwellig Rebellion brodelt. Deine Ansprüche auf den Thron basieren auf der Herkunft deiner Mutter, dem Abkömmling eines illegitimen Kindes, das der jüngere Bruder eines Königs gezeugt hat. Es gibt etwa ein Dutzend Männer, die mehr Recht auf die Krone haben als du. Dein Vorgänger ist tot, aber längst nicht vergessen, besonders nicht im Norden von England. Du hegst die Absicht, deinen Anspruch zu stärken, indem du die junge Elisabeth, Richards Nichte, heiratest, aber eine Menge Leute halten sie für einen Bastard; und falls sie doch von ehelicher Geburt sein sollte, dann sind ihre Brüder – wenn sie noch am Leben sind – die rechtmäßigen Thronerben. Gerüchte waren aufgekommen, daß die Jungs erstickt worden seien, aber kein Mensch wußte genau, was wirklich mit ihnen geschehen war.
Wenn du Heinrich gewesen wärst, hättest du sicherlich als allererstes versucht, die Wahrheit über die Prinzen herauszufinden. Du hättest freien Zugang zum Tower von London. Du würdest nach den bedauernswerten kleinen Leichen suchen und die Dienerschaft befragen, die dort beschäftigt war, als die Kinder angeblich umgebracht wurden. Der Tower ist ein riesiges Fort und voller Menschen – Diener, Wächter, Reinemachefrauen, Köche, Beamte ... Dutzende von Menschen mußten wissen, was passiert war. Man kann nicht zwei Staatsgefangene eliminieren, ohne daß jemand etwas von ihrem Verschwinden bemerkt.
Heinrich hat nichts dergleichen getan. Ich glaube, er konnte nicht, weil die Jungs noch am Leben waren, als Heinrich 1485 nach London kam. Aber sie blieben nicht am Leben, nicht mehr lange.«
Jacqueline knabberte an einem Butterbrot. »Dann hat also jemand den Mord gestanden, wie?« erkundigte sie sich zaghaft.
»Ja – ein Mann namens Sir James Tyrrell. Zwanzig Jahre später, nachdem er wegen eines anderen Verbrechens in den Kerker geworfen wurde. Das Geständnis wurde nie öffentlich kundgegeben. Erst nach Tyrrells Hinrichtung wegen dieses anderen Verbrechens wurde etwas davon laut. Die Version, die in Sir Thomas Mores Biographie von Richard nachzulesen ist, steckt voller Widersprüche, falschen Angaben und glatten Lügen. Sie ist ein Gespinst von offensichtlichen ...«
Er brach ab und betrachtete Jacqueline argwöhnisch. Sie starrte ihn über ihre Brille hinweg an, und Thomas fluchte im stillen, obwohl das eigentlich gar nicht seine Art war.
»Du wußtest das alles schon längst! Du hast einmal gesagt, daß du jeden Krimi, der je gedruckt wurde, gelesen hast ... Natürlich wußtest du es. Du hast The Daughter of Time gelesen.«
»Klar.«
»Warum hast du das nicht gleich gesagt?«
»Ich liiieeebe es, dich reden zu hören«, flötete Jacqueline.
»Manchmal könnte ich dich umbringen.«
»Ich habe alle Krimis von Josephine Tey gelesen«, sagte Jacqueline. »The Daughter of Time ist absolut brillant. Aber es ist ein Roman, kein ernstzunehmendes historisches Werk. Das Buch ist weit davon entfernt, unvoreingenommen zu sein.«
»Was hast du sonst noch gelesen?« fragte Thomas resigniert.
Jacqueline streckte die Hand nach dem letzten Brötchen aus. »Einmal Bibliothekarin, immer Bibliothekarin«, sagte sie und nahm einen kleinen Bissen. »Wenn ich historische Romane lese, schlage ich immer nach, was Wirklichkeit und was Fiktion ist. Teys Quelle war einer von Richards Fürsprechern, und sie ist genauso parteiisch wie die Tudor-Historiker, sie steht nur auf der anderen Seite – der heilige Richard der Dritte, ein liebevoller, friedfertiger, zahmer Mann. Ich habe einige historische Romane über Richard gelesen«, fügte sie hinzu und nahm das letzte Stück des Brötchens zwischen ihre weißen Zähne. »In den meisten wird er als empfindsamer Märtyrer dargestellt, der seine sensiblen Hände ringt und schluchzt. Ich bezweifle allerdings, daß er oft geweint hat.«
»Du bist wirklich ...«
»Reden wir über dieses Wochenende«, unterbrach ihn Jacqueline; sie schielte bedauernd die Krümel auf ihrem leeren Teller an und setzte hinzu: »Ich nehme an, die Party hat etwas mit deinem Helden zu tun. Was ist es? Eine Zusammenkunft irgendeiner Organisation? Es gibt eine Gruppe, die sich die größte Mühe gibt, Richard zu rehabilitieren. Sie nennen sich Ricardianer – nicht zu verwechseln mit den Anhängern des Volkswirtschaftlers David Ricardo. Sie setzen an den Jahrestagen der Schlacht von Bosworth In-Memoriam-Notizen in die Times.«
Der hintergründige Tonfall, in dem Jacqueline diese harmlose Bemerkung äußerte, reizte Thomas – er kniff verärgert die Augen zusammen, aber dann gewann doch sein Humor die Oberhand, und er lächelte schüchtern.
»Es gibt einige Gruppen, die an Richard dem Dritten interessiert sind. Ich schätze, unsere ist die fanatischste von allen.«
»Ist ja reizend.«
»Du brauchst nicht sarkastisch zu werden.«
»Ich bin nicht sarkastisch. Es gibt kein besseres Ventil für aggressive Instinkte, als sich vehement für eine unorthodoxe Sache einzusetzen. Ich selbst«, erklärte Jacqueline stolz, »bin Mitglied bei den Freunden von Jerome.«
Sie beobachtete eine Weile, wie Thomas sein umfassendes Gedächtnis durchforstete und nach einer historischen Figur namens Jerome suchte, dann fuhr sie fort: »Jerome ist ein Ort, nicht eine Person. Es ist eine wundervolle Geisterstadt in Arizona. Sie steht über einer verlassenen Mine, und wenn wir nichts unternehmen, bricht sie ein und rutscht in ...«
»Das ist noch verrückter als unsere Organisation.«
»Eine Eigenschaft von exzentrischen Vereinen ist ihr Mangel an Sympathie für andere exzentrische Vereine. Erzähl mir von Richards Freunden.«
»Nenn uns nicht so. So heißt eine ältere Organisation, von der wir uns losgesagt haben, als sie Sir Richards Unehelichkeit verleugnete.«
Jacqueline beförderte ihre Handarbeit wieder zutage und studierte das fertige Stück einige Sekunden, ehe sie den Blick auf Thomas richtete. »Sag das noch mal, Thomas. Ganz langsam.«
»Unser Gründer und Präsident ist Sir Richard Weldon«, erklärte Thomas unbeirrt. »Er behauptet, ein Nachfahre von einem der illegitimen Kinder Richard des Dritten zu sein. Die Richard-der-Dritte-Gesellschaft würde das niemals akzeptieren, trotz der Dokumente ...«
»Thomas!«
»Na ja, es könnte stimmen. Richard hatte etliche uneheliche Kinder; jeder hatte uneheliche Kinder zur damaligen Zeit.«
»Das zerstreut all meine Zweifel. Du führst mich in Versuchung«, sagte Jacqueline nachdenklich. »Ich würde ihn gern kennenlernen, diesen Richard ... Weldon. Das ist doch nicht der vom Kaufhaus, oder?«
»Kaufhaus oder nicht. Die Weldons sind über ganz England verstreut. Aber du wirst Sir Richard mögen«, fügte Thomas scheinbar ohne Zusammenhang hinzu. »Er ist ein netter Kerl, trotz seiner fixen Idee. Die Wochenendparty findet in seinem Haus in Yorkshire statt. Es ist eine außerordentliche Zusammenkunft des Gesellschaftsvorstands. Gewöhnlich treffen wir uns an Richards Geburtstag – am zweiten Oktober.«
»Er war Waage«, stellte Jacqueline interessiert fest. »Das spricht für euch. Waagen sind ausgeglichene Persönlichkeiten und nicht für Leidenschafts- oder Jähzornausbrüche prädestiniert. Sie haben Sinn für das Schöne, lieben die Gerechtigkeit ...«
»Hör auf damit!«
Jacqueline grinste. Dann wurde sie ernst und schüttelte den Kopf. »Thomas, ich würde wirklich gern mit zu diesem Treffen gehen, aber ich glaube, ich kann es nicht einrichten. Ich hatte vor, Anfang nächster Woche zurück nach Hause zu fahren.«
»Was zwingt dich dazu? Das College hat Ferien bis Mitte September. Du machst dir doch keine Sorgen um deine Brut? Deine Kinder sind alt genug, um weitere vierzehn Tage ohne dich zu überstehen.«
»Oh, sie wären begeistert, wenn ich für immer und ewig fortbleiben würde. Sie haben mein Auto, meinen Fernseher, meinen Kühlschrank und, wie's aussieht, mein Bankkonto zur freien Verfügung. Wahrscheinlich feiern sie nächtliche Orgien.«
»So schlimm können sie gar nicht sein.«
»O doch, das können sie. Wie auch immer –« Jacqueline strahlte –, »sie schaffen es, daß ich nichts davon mitbekomme. Bis jetzt haben sie ihre Leichen verbuddelt und ihre Angelegenheiten selbst geklärt.«
»Du bist eine verdammt außergewöhnliche Mutter. Ich weiß nicht, wie sie mit dir fertig werden. Jacqueline, du mußt einfach mitkommen. Ich rechne fest mit dir.«
»Es ist nicht höflich, Leuten, die einen nicht eingeladen haben, einen Besuch abzustatten. Ich wurde dazu erzogen, mich wie eine Lady zu benehmen.«
»Ich habe Sir Richard bereits gesagt, daß du kommst. Er ist entzückt.«
»Ach, du hast mich angekündigt, ja?«
»Sei nicht so feindselig. Du hast mich noch nicht gefragt, wieso diese Zusammenkunft etwas Besonderes ist.«
»Warum«, sagte Jacqueline in demselben eisigen Ton, »ist die Zusammenkunft etwas Besonderes?«
»Wir haben den Brief gefunden. Den Brief, den Elisabeth von York, Richards Nichte, geschrieben hat.«
Die Eröffnung hatte die erwünschte Wirkung. Jacquelines kalter Blick wurde sanfter. »Du machst Witze.«
»Nein.«
»Der Brief, in dem das Mädchen gesteht, daß sie ihren Onkel liebt und ihn heiraten möchte? Daß sie wünschte, die Königin würde sich mit dem Sterben beeilen? Daß Richard ihre ...«
»›... einzige Freude und der Lenker dieser Welt ist‹«, ergänzte Thomas selbstzufrieden. »Genau diesen Brief meine ich.«
»Das Mädchen war bei Hofe«, überlegte Jacqueline laut. »Ihre Mutter erlaubte ihr und den anderen Prinzessinnen, das Kirchenasyl nach Richards Krönung zu verlassen. Er erklärte sich bereit, für ihren Unterhalt zu sorgen und sie nicht zu einer unpassenden Ehe zu zwingen. Aber der Brief ist von zweifelhafter Herkunft, Thomas. Ich erinnere mich; einer von Richards frühesten Verteidigern hat ihn im siebzehnten Jahrhundert zitiert ...«
»Buck.«
»Ja, Buck. Er sagte, er hätte das Original gesehen, den Brief in Elisabeths Handschrift. Aber dann ist das Dokument verschwunden. Die meisten Experten sind der Ansicht, daß es nie existiert hat. Denn wenn es diesen Brief gegeben hätte ...«
»Mhm«, machte Thomas. »Wenn es ihn gibt, dann spricht er Richard von einer Verleumdung der Tudors frei – nämlich von der, daß er versucht hat, seine Nichte zu einer inzestuösen Ehe mit ihm zu zwingen, um seinen Thronanspruch zu festigen.«
»Ja, ich erinnere mich. Dieser Teil der Geschichte hat mich stutzig gemacht – das Weihnachtsfest bei Hofe, zu dem Königin Anne und die junge Elisabeth in demselben Kleid erschienen.«
»Der gesamte Hofstaat war hellstens entsetzt. Es war ein ausgesprochen geschmackloser Auftritt. Die Königin litt an Schwindsucht und stand auf der Schwelle des Todes – die Ärmste muß wie ein ausgezehrtes Gespenst neben dem gesunden, strahlenden jungen Mädchen ausgesehen haben. Natürlich beschuldigte man später Richard, sich das ausgedacht zu haben.«
»So etwas würde einem Mann nie und nimmer einfallen. Das ist die List einer Frau. Die Idee der Königin war es sicher nicht; sie hätte einer anderen Frau niemals ein Kleid gegeben, das so aussieht wie ihres, besonders nicht einer Frau, die jünger und hübscher ist. Als ich das las, dachte ich, daß es Elisabeths Einfall gewesen sein mußte – sie hat das Kleid kopieren lassen.«
»Ausgezeichnet«, rief Thomas anerkennend. »Darauf bin ich noch gar nicht gekommen, aber es erhärtet meine Theorie. Bestimmt ging das Gerücht um, daß Richard die Absicht hegte, das Mädchen zu heiraten. Als Richard davon hörte, dementierte er entschieden in aller Öffentlichkeit. Von seinem Standpunkt aus betrachtet wäre das ein ausgesprochen törichter Schachzug gewesen. Das Mädchen war unehelich, eine Bürgerliche, seine eigene Nichte, eine von den verhaßten Woodvilles. Durch eine solche Verbindung konnte er alles verlieren und nichts gewinnen.
Nein, ich bin überzeugt, Elisabeth hat diese Gerüchte selbst in die Welt gesetzt. Wunschdenken. Richard war nur zehn Jahre älter als sie, und die Königin lag praktisch schon auf dem Sterbebett ...«
Jacqueline schüttelte heftig den Kopf. »Nein, Thomas, das ist zuviel. Angenommen, das Mädchen war tatsächlich so ehrgeizig, angenommen, sie war verliebt in ihren Onkel – selbst dann ...«
Thomas beendete den Satz für sie: »... ist es unvorstellbar, daß sie den Mörder ihrer Brüder heiraten wollte. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist schwierig genug zu erklären, wieso die alte Königin die Tochter unter Richards Obhut geben konnte, nachdem er ihre Söhne ruchlos gemeuchelt hatte. Sie nahm eine Apanage von ihm an, drängte sogar ihren Sohn aus erster Ehe, der ins Ausland geflohen war, in einem Brief, nach England zurückzukehren, weil Richard ihn gut behandeln würde.«
Jacqueline schüttelte immer noch den Kopf. »Vielleicht wußten die beiden Elisabeth' – Mutter und Tochter Woodville – nicht, daß die beiden kleinen Prinzen bereits tot waren. Das Datum, Thomas. Welches Datum trägt der Brief?«
»Das Argument zieht nicht. Der Brief wurde wahrscheinlich im Januar oder Februar 1485 geschrieben – eineinhalb Jahre nachdem die Jungs angeblich ermordet worden waren. Ganz England soll zu diesem Zeitpunkt angeblich die Rückkehr des frommen Heinrich Tudor erfleht haben, damit er sie von dem Ungeheuer befreite. Du kannst nicht beides haben. Entweder war die Meucheltat bekannt – und in diesem Fall mußte auch die Familie der kleinen Prinzen davon wissen –, oder die Jungs waren noch am Leben, und die Anschuldigungen sind nichts als bösartige Lügen, die Heinrichs Helfershelfer verbreitet haben. Politpropaganda ist keine moderne Erfindung, weißt du.«
»Hmm.« Jacqueline erkannte seine Logik an, indem sie nicht dagegen argumentierte. »Der Brief würde deine zweite Alternative untermauern. Er ist kein absoluter Beweis, aber ... lieber Himmel, Thomas, er ist ein wichtiges Dokument! Und eure kleine Gesellschaft sitzt auf dem Brief wie eine brütende Glucke. Wer hat ihn gefunden? Wo wurde er gefunden? Wurde seine Provenienz überprüft? Haben ihn namhafte Experten begutachtet?«
»Eine Expertin wird ihn begutachten.«
Er hatte selten erlebt, daß Jacqueline der Schreck in die Glieder fuhr, doch jetzt schnappte sie entsetzt nach Luft und starrte ihn an, als könnte sie ihren Ohren nicht trauen.
»Etwa ich? Ist das der Grund für die Einladung? Thomas, ich bin nicht ...«
»Du hast einen Kurs gemacht und weißt, wie man Manuskripte überprüft, oder nicht?«