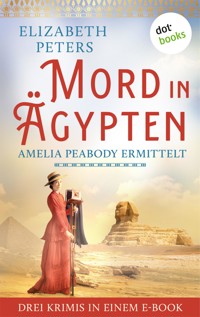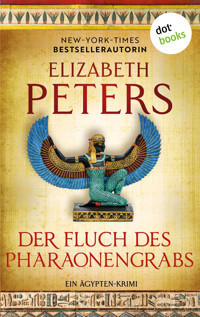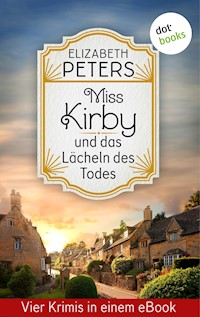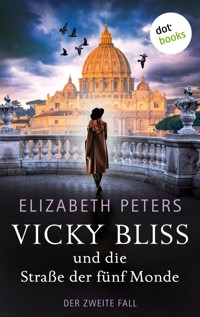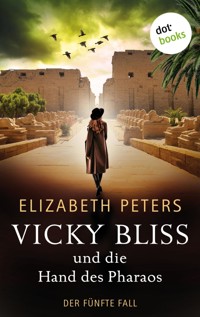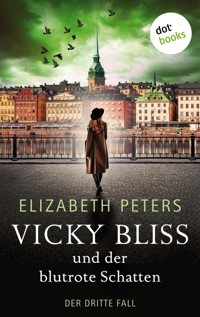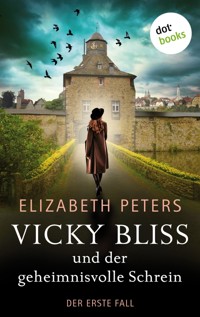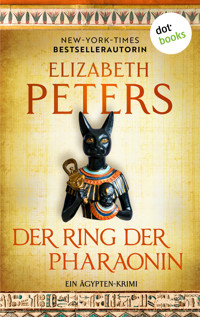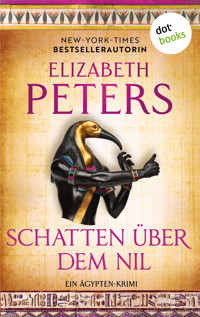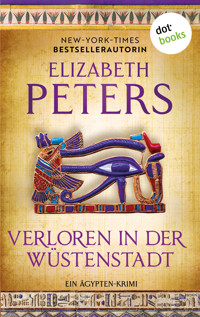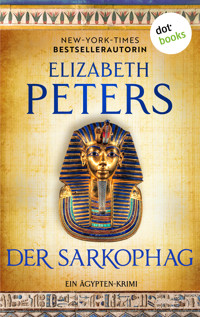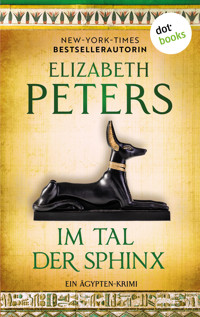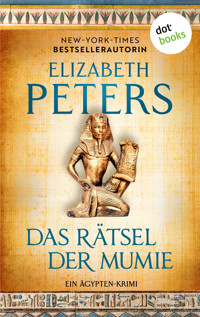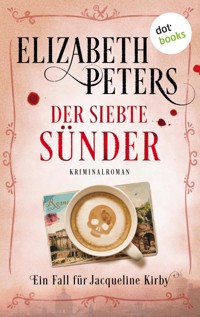Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jacqueline Kirby
- Sprache: Deutsch
Der Tod lauert im Kleingedruckten: Der humorvolle Kriminalroman »Ein todsicherer Bestseller« von Elizabeth Peters jetzt als eBook bei dotbooks. Endlich: Nach einer langen Trockenphase erhält Schriftstellerin Jacqueline Kirby wieder einen Auftrag. Und was für einen! Sie soll die Fortsetzung zu einem Bestseller der berühmten Kathleen Darcy schreiben, die vor Jahren spurlos verschwand und mittlerweile für tot erklärt wurde. Jacqueline ist ganz aus dem Häuschen – erst vor Freude, dann vor Schreck, als sie plötzlich einen Drohbrief erhält … mit Kathleens Unterschrift! Immer mehr beschleicht sie der Verdacht, dass Kathleens Familie ein dunkles Geheimnis verbirgt, das nun auch Jacquelines Leben in tödliche Gefahr bringt … »Spannend, subtil und witzig – Elizabeth Peters in Höchstform!« Mary Higgins Clark »Ein ausgezeichnetes Lesevergnügen.« Washington Post Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Krimi-Highlight »Ein todsicherer Bestseller« – Band 3 der erfolgreichen Krimireihe um die Hobby-Detektivin Jacqueline Kirby von Elizabeth Peters. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Lesetipps
Über dieses Buch:
Endlich: Nach einer langen Trockenphase erhält Schriftstellerin Jacqueline Kirby wieder einen Auftrag. Und was für einen! Sie soll die Fortsetzung zu einem Bestseller der berühmten Kathleen Darcy schreiben, die vor Jahren spurlos verschwand und mittlerweile für tot erklärt wurde. Jacqueline ist ganz aus dem Häuschen – erst vor Freude, dann vor Schreck, als sie plötzlich einen Drohbrief erhält… mit Kathleens Unterschrift! Immer mehr beschleicht sie der Verdacht, dass Kathleens Familie ein dunkles Geheimnis verbirgt, das nun auch Jacquelines Leben in tödliche Gefahr bringt …
»Spannend, subtil und witzig – Elizabeth Peters in Höchstform!« Mary Higgins Clark
»Ein ausgezeichnetes Lesevergnügen.« Washington Post
Über die Autorin:
Hinter der US-amerikanischen Bestsellerautorin Elizabeth Peters steht Barbara Louise Gross Mertz (1927–2013), die auch unter dem Pseudonym Barbara Michaels erfolgreich Krimis und Thriller schrieb. Die Autorin promovierte an der University of Chicago in Ägyptologie. So haben auch ihre über 20 Kriminalromane, für die sie zahlreiche Preise gewann, meist einen historischen Hintergrund.
Die Kriminalromanreihe um Jacqueline Kirby bei dotbooks umfasst: »Der siebte Sünder: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 1« »Der letzte Maskenball: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 2« »Ein preisgekrönter Mord: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 3« »Ein todsicherer Bestseller: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 4«
Ebenfalls bei dotbooks erscheint ihre Krimireihe um die abgebrühte Meisterdetektivin Vicky Bliss: »Vicky Bliss und der geheimnisvolle Schrein – Der erste Fall« »Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde – Der zweite Fall« »Vicky Bliss und der blutrote Schatten – Der dritte Fall« »Vicky Bliss und der versunkene Schatz – Der vierte Fall« »Vicky Bliss und die Hand des Pharaos – Der fünfte Fall«
***
eBook-Neuausgabe Februar 2019
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1989 by Barbara Mertz
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1989 unter dem Titel »Naked once more« bei Warner Books Inc., New York
Copyright © der deutschen Ausgabe 1996 by Econ Verlag München – Düsseldorf GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Published by Arrangement with BARBARA G. MERTZ REVOCABLE TRUST
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Rashad Ashur, Olga Nikonova, aekikuis und Volodymyr Nikitenko
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-445-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ein todsicherer Bestseller« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Peters
Ein todsicherer Bestseller
Ein Fall für Jacqueline Kirby
Aus dem Amerikanischen von Angelika Naujokat
dotbooks.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Lesetipps
Für Pansy – sie weiß, wer sie ist,und bald wird es die ganze Welt wissen.
Kapitel 1
Überall in Amerika gibt es diese seltsamen kleinen Straßen, die ins Nichts führen. Sie schlängeln sich einsame Hügel hinauf und durch düstere Wälder, sind voller Schlaglöcher und gefährlich schmal, im Winter mit einer glatten Eisschicht überzogen, im Sommer von Unkraut bedeckt. Und sie enden abrupt und ohne ersichtlichen Grund irgendwo ganz weit draußen, weit weg von jeglicher menschlichen Behausung. Gelegentlich findet sich ein Hinweis auf ihre ehemalige Funktion: eine verrostete Bierdose, ein Stück Plastik, verstreute Backsteine eines schon vor langer Zeit verlassenen Hauses.
Am Ende einer solchen Straße wurde Kathleen Darcys Wagen gefunden. Die Suchtrupps benötigten beinahe eine Woche, um ihn zu finden, da es keinen vernünftigen Grund gab, warum sie – oder sonst irgend jemand – sich dorthin begeben haben sollte. Die tagelang andauernden Regenfälle hatten alle Spuren verwischt und der Vegetation zu einem plötzlichen Ausbruch verholfen, wie er für einen Frühling im Süden des Landes charakteristisch ist. Die Suchtrupps schwärmten von dem verlassenen Fahrzeug aus, fluchten über giftiges Efeu und über Dornensträucher, die so hart wie Stacheldraht waren, und hielten ängstlich nach Schwarzbären und tollwütigen Waschbären Ausschau. Sie fanden genau das, womit sie gerechnet hatten, nämlich nichts. An den überwucherten Abhängen der Berge, die von Höhlen und aufgegebenen Minenschächten durchlöchert waren, konnte eine Leiche jahrelang liegen, ohne entdeckt zu werden – zumindest nicht von Menschen. In der Gegend gab es Schwarzbären und Luchse, Füchse und wilde Hunde. Und Bussarde. Nicht weit entfernt von einer Lichtung rauschte weißschäumendes Wasser auf dem Weg zum Fluß über Felsbrocken hinweg. Die Regenfälle hatten es derart anschwellen lassen, daß es durchaus noch schwerere Objekte als den Körper einer schlanken Frau hätte mit sich tragen können.
Möglicherweise hatte sie irgend etwas unternommen, um sicherzustellen, daß sie niemals gefunden wurde. Unter den Papieren, die man in ihrer Handtasche entdeckt hatte, war etwas, das als eine Art Abschiedsbrief verstanden werden konnte. »Sah aus wie ein Gedicht«, sagte einer der Männer, die sich an der Suche nach ihr beteiligt hatten, zu seinen aufmerksam lauschenden Zuhörern in der »Elite-Bar«. »Es war ihre Schrift, aber der Sheriff sagt, daß sie es nicht selbst verfaßt hat. Sie hat es von irgend jemandem abgeschrieben. Auf jeden Fall waren einige Fremdworte drin. Vielleicht Griechisch.«
»Eher Lateinisch«, warf ein etwas beleseneres Mitglied seiner Zuhörerschaft ein.
»Lateinisch, Griechisch, zum Teufel noch mal, ist eh alles Chinesisch für mich.« Der Erzähler kicherte. »Sollte wohl bedeuten, daß sie Angst vorm Sterben hatte.«
»Ich kenne niemanden, der verrückt danach ist«, erwiderte der Belesene trocken. »Aber ich hätte an ihrer Stelle nicht so viel Zeit damit vertrödelt, darüber nachzudenken. Wieviel hat sie wohl mit ihrem Buch gemacht – eine Million oder zwei Mille?«
Der andere Mann zuckte die Schultern, rülpste und verkündete dann seine Version eines Nachrufs auf Kathleen Darcy: »Sie war eine seltsame Frau.«
Ein ähnlicher Gedanke durchfuhr Christopher Dawley, als er beobachtete, wie sich seine Klientin auf den Tisch zubewegte, den er (wenn auch nur äußerst widerwillig) in der »Tauern on the Green« reserviert hatte. Chris haßte diesen Laden. Jacqueline Kirby liebte ihn jedoch, und Chris wäre ihren Wünschen auch dann nachgekommen, wenn es sich nicht, wie in diesem Falle, um seine Lieblingsklientin gehandelt hätte. Er war schließlich nicht nur Literaturagent, sondern auch ein Gentleman. (Im Gegensatz zur anderslautenden Meinung, die einige Autoren vertreten mögen, kommt es durchaus häufig vor, daß sich diese beiden Kategorien überschneiden.)
Schriftsteller klagen ständig – und in manchen Fällen auch gerechtfertigterweise – über ihre schlechte Bezahlung. Die übliche Vergütung eines Literaturagenten beträgt zehn Prozent von dieser Bezahlung – mit anderen Worten: sehr wenig. Aber zehn Prozent von Jacqueline, der Autorin von zwei Romanen, die Bestseller geworden waren, bedeutete immerhin eine nette kleine Summe. Das war einer der Gründe, warum sie Chris' Lieblingsklientin war.
Manchmal glaubte er, daß dies der einzige Grund war. Sie besaß eine Reihe von Eigenschaften, die ihn zur Raserei brachten. Zum Beispiel die Art und Weise, wie sie sich kleidete. Chris war ein zurückhaltender Mann mit konservativen Gewohnheiten und einem entsprechenden Geschmack, was seine Kleidung anging, und er bevorzugte es, nicht aufzufallen. In aller Öffentlichkeit mit Jacqueline aufzutauchen war jedoch eine Garantie dafür, zum Mittelpunkt des Interesses zu werden.
Heute hatte sie sich in einer solch extravaganten Weise gekleidet, wie er es noch nie zuvor an ihr gesehen hatte – und das wollte schon etwas heißen. Der Mantel, der sie vom Hals bis zu den Fußknöcheln einhüllte, war ein wundersames Gemisch aus schillernden Meerestönen. Grün und Blau, blasse Lavendelfarben und Eisgrau wurden überlagert von Federn, Pailletten, Stickereien und einigen anderen, nicht näher identifizierbaren Dingen. Und der Hut! Seit sie die Bestsellerliste der Times erklommen hatte, war Jacqueline, was Hüte betraf, schier übergeschnappt. Dieses purpurfarbene Modell hier hatte einen zwanzig Zentimeter breiten Rand und war mit Lavendel und Pflaumen verziert, die den Hut so weit nach unten drückten, daß er beinahe über die dunklen Gläser rutschte, die wiederum das obere Drittel von Jacquelines Gesicht verdeckten. Sie trug passende purpurfarbene Handschuhe und jede Menge klimpernder Armreifen. Vermutliche weitere Extravaganzen wurden von Hut und Mantel verhüllt. In der freundlichen, ländlichen Atmosphäre des Gartenzimmers sah sie so deplaziert aus wie eine ... Chris fiel kein passender Vergleich ein. Schließlich war er Literaturagent, kein Schriftsteller.
Die dunklen Gläser und der Hut schienen Jacquelines Sehvermögen zu beeinträchtigen, aber sie schaffte es schließlich doch stolpernd bis zu seinem Tisch. Der Wirt, auf dessen Gesicht Faszination und Bestürzung miteinander rangen, schob ihr einen Stuhl zurecht und zog sich dann zurück. Jacqueline schaute unter dem Hutrand hervor. Ein bezauberndes Lächeln umspielte ihren breiten Mund.
»Liiiebling!«
»Hör schon auf.« Chris nahm wieder Platz. Er hatte eigentlich beabsichtigt, ihr einen kleinen Kuß auf die Wange zu geben, wie es in der Branche so üblich war, aber die Gefahr, sich im Mantel zu verfangen – vom Hut gar nicht zu reden –, hatte ihn von dieser Idee wieder abgebracht. »Ich hasse es, wenn du Theater spielst«, fügte er brummig hinzu. »Wer bist du denn heute? Jackie Kennedy, Joan Collins, Michael Jackson ...?«
»Das verletzt mich jetzt aber wirklich, Chris!« Jacqueline preßte eine purpurfarbene Hand gegen ihren wogenden Busen. »Du weißt doch, daß ich meinen eigenen, unverwechselbaren Stil habe – und ausgesprochen gute Gründe dafür!«
Mit einer anmutigen Bewegung ließ sie den Mantel von ihren Schultern gleiten. Er fiel wie ein schillernder Regenbogen über die Rückenlehne ihres Stuhls und ergoß sich über den mit Rosen gemusterten Teppichboden, bevor sie ihn zusammenraffte und ein wenig unter ihren Stuhl schob. Ihr Kleid war vergleichsweise dezent: purpurfarbener Seidencrêpe, der so drapiert war, daß er ihren bewundernswerten Körper betonte. Sie hatte sich mit einer Kollektion von Goldketten geschmückt, die der Mitgift einer reichen Ubangi-Jungfrau alle Ehre gemacht hätten.
Sonnenlicht strömte durch die riesigen Fenster und spiegelte sich in den glänzenden Schmuckstücken wider. Chris wandte seine Augen ab. »Ich weiß. Du hast es mir gesagt. ›Die einzige Möglichkeit, in diesem Geschäft meinen Verstand zu behalten, ist, mich zumindest über seine absurden Seiten und über mich selbst lustig zu machen.‹ Aber das ist nicht der einzige Grund: Du hast Spaß daran!«
»Natürlich habe ich das.« Jacqueline schob den Hut mit einer energischen Handbewegung nach hinten und gab den Blick auf ihr Gesicht frei.
Es war ein Gesicht, das in ruhigem Zustand beinahe streng wirkte. Das Kinn war fein gerundet, stand aber hervor. Der breite, bewegliche Mund konnte so rätselhaft lächeln wie eine alte griechische Göttin, sich aber auch durchaus zu einem Ausdruck gnadenloser Unnachgiebigkeit verziehen. Der größte Teil ihres Haares war noch unter dem Hut versteckt, aber Chris hatte bereits einige Male die Gelegenheit gehabt, seine bronzefarbene Fülle zu bewundern. Er wußte nicht, ob die Farbe echt war.
Gerade umspielte dieses rätselhafte Lächeln ihre Lippen, und ihre grünen Augen leuchteten wie Smaragde, ein sicheres Indiz dafür, daß sie sich über irgend etwas amüsierte – sei es über sich selbst oder über jemand anderen. »Ich muß mich allerdings vor meinen aufdringlichen Fans schützen. Es ist soooo anstrengend, berühmt zu sein!«
Sie hatten diese. Unterhaltung bereits einige Male geführt. Chris wußte nicht, warum er sich überhaupt noch die Mühe machte, sich zu wiederholen. »Das ist allein deine Schuld. Hättest du dich in der Today Show nicht derartig zur Schau gestellt und diese ungeheuerlichen Dinge im People-Interview gesagt und –«
»Du warst doch derjenige, der darauf bestanden hat, daß ich all diese Interviews gebe«, unterbrach ihn Jacqueline.
»Es gehört mit zu deiner Arbeit«, murmelte Chris.
»Was?« Jacqueline lehnte sich vor. »Ich kann dich nicht verstehen.«
»Aber ich kann dich verstehen, genau wie alle anderen hier im Raum. Ich habe nur wiederholt, was ich dir schon hundertmal gepredigt habe, nämlich daß PR ein Teil deiner Arbeit ist. Das weißt du, und wenn ich sehe, mit wieviel Elan du darangehst, könnte man fast glauben, daß es dir Spaß macht. Also wirf mir nicht diesen Märtyrerblick zu.«
»Aber ich finde es nicht gut, daß PR ein Teil meiner Arbeit ist! Nathaniel Hawthorne ist auch nicht von besessenen Fans verfolgt worden. Emerson ist niemals in einer Talkshow aufgetreten und Louisa May Alcott –«
Dies war eine neue Variante des alten Themas, und Chris ließ sich von der Freude am Diskutieren mitreißen. »Twain und Dickens haben Vorträge gehalten, und Alcott wurde von ihren Fans belagert. Erinnerst du dich noch an die Szene in Jo's Boys, in der sie vorgab, das Hausmädchen zu sein, um einer aufdringlichen Familie zu entkommen, die in ihr Arbeitszimmer eingedrungen war?«
»Ich erinnere mich sehr wohl.« Jacqueline grinste über das ganze Gesicht. »Aber ich dachte, Männer würden niemals Alcott lesen.«
»Meine literarischen Kenntnisse sind größer, als du dir vorstellen kannst«, erwiderte Chris. »Ich habe sogar Laura Ingalls Wilder gelesen.«
Ein Kellner umkreiste vorsichtig den Hut und stellte zwei Gläser mit klirrenden Eiswürfeln und einer klaren, frostigen Flüssigkeit vor sie auf den Tisch. Jacqueline hob ihr Glas und tat einen langen Schluck.
»Fühlst du dich jetzt besser?«
»Ja, viel besser. Aber ehrlich, Chris, diese PR-Geschichte ist ein wenig aus den Fugen geraten. Du hast doch den Plan für die Tour gesehen, die sie letzten Herbst für mich arrangiert haben – jeder noch so klitzekleine Buchladen von Los Angeles bis Maine, jede Lokalzeitung, jede Radio- und Fernsehstation im kleinsten Kaff war dabei ... Ich werde niemals den Diskjockey in Centerville, Iowa, vergessen, der mich ›Alte‹ nannte und andeutete, daß ein Tête-à-tête im Hinterhof mit ihm und seiner Drogensammlung mir neue Einblicke in die sexuellen Gewohnheiten des Cro-Magnon geben würde.«
Chris' Augen weiteten sich. »Das hast du mir ja nie erzählt.«
»Ich versuche dich zu schonen, wo ich nur kann.« Jacqueline tätschelte seine Hand.
»Und, hast du?«
»Habe ich was? Also wirklich, Chris.« Ihre Wimpern, die mit etwas Dunklem und Glänzendem überzogen waren, senkten sich über ihre Augen, und sie sagte verträumt: »Er war niedlich. Auch wenn er das g in Cro-Magnon aussprach.«
»Jacqueline, hast du –«
»Natürlich nicht. Ich bemühe mich nur – trotz all deiner Unterbrechungen –, dir klarzumachen, daß das Geschäft mit der Schriftstellerei heutzutage eigentlich nichts mehr für Schriftsteller ist, sondern für Unterhaltungskünstler. Was ist nur aus der zurückgezogen lebenden Autorin geworden, die bei Kerzenlicht und nur von Schatten umgeben in ihrem Elfenbeinturm Poetisches aufs Papier kritzelt?«
»So etwas hat es nie ... Nun ja, Emily Dickinson, natürlich, aber die –«
»Schreiben ist doch eher etwas für introvertierte Menschen! Wenn du Leute magst, wirst du doch angeblich kein Schriftsteller, sondern Schauspieler oder Krankenschwester oder Versicherungsagentin oder –«
»Schon gut, schon gut.« Chris signalisierte dem Kellner. Er hatte den Eindruck, daß Jacqueline sich kaum Zeit genommen hatte, Atem zu holen, geschweige denn einen weiteren Schluck ihres Martinis zu kosten. Aber rätselhafterweise war ihr Glas leer. Er fuhr fort. »Theoretisch liegst du nicht falsch. Aber was du sagst, hat nichts mit der wirklichen Welt zu tun. Es ist nun einmal so, und dein Nörgeln wird daran auch nichts ändern.«
»Irrelevant, willst du sagen«, entgegnete Jacqueline nachdenklich. »Oder irrevelant, wie mein Enk – wie einer meiner jungen Freunde zu sagen pflegt.«
Sie nippte vornehm an ihrem zweiten Drink, und Chris grübelte über das Wort nach, das ihr beinahe entschlüpft wäre. Enkel? Jacqueline redete endlos über alles, außer über ihr Privatleben. Wahrscheinlich hatte es einmal einen Mr. Kirby gegeben oder auch einen Professor oder Dr. Kirby. Aber niemand schien zu wissen, was aus dem Mann geworden war. Jacqueline sprach niemals über ihn. Sie hatte Kinder – mehr als eins, aber wie viele genau? Fragen, die darauf abzielten, ihr diese Information zu entlocken, blieben unbeantwortet.
Nachdem ihr erstes Buch die Bestsellerlisten erklommen hatte und sie aufgrund ihrer Auftritte in Talkshows zu einer kleinen Berühmtheit geworden war, hatten sich verschiedene unternehmungslustige Klatschspaltenreporter, die wegen Jacquelines hartnäckigen Schweigens einen möglichen Skandal witterten, daran gemacht, ihre Familie aufzuspüren. Das einzige, was dabei zutage kam, war eine Universität im Mittleren Westen, an der angeblich ihr Sohn eingeschrieben war. Nachdem der Reporter, der diese Fährte verfolgte, von einer hübschen jungen Frau im Sekretariat die Auskunft erhielt, daß ein Mr. Kirby in der Tat zu den Studenten zähle, wurde er zu einem Raum geführt, in dem sich sieben oder acht – oder auch zwölf oder dreizehn, irgendwann hatte er aufgehört zu zählen – lächelnde junge Männer befanden, die alle behaupteten, der Sohn von Jacqueline Kirby zu sein. Sie hatten alle verschiedene Vornamen – wie beispielsweise Peregrine, Radcliffe, Percival, Agrivaine oder Willoughby –, und das Interview verwandelte sich schnell in ein Durcheinander aus Behauptungen und Gegenbehauptungen, Verleugnungen und Beleidigungen und endete schließlich in einem Handgemenge.
Weitere Nachforschungen ergaben, daß es sich bei dem einzigen echten Kirby, der an dieser Universität eingeschrieben war, um einen neununddreißigjährigen Doktoranden handelte, der offenbar orientalischer Abstammung war.
Chris hatte sich über diese Geschichte köstlich amüsiert, aber als er zu Jacquelines Privatleben befragt wurde, antwortete er wahrheitsgemäß, daß er auch nicht mehr wisse als alle anderen. Er wollte auch nicht mehr wissen. Es gehörte zu seinem Job, die empfindlichen Nerven seiner Klienten zu beruhigen, ihre empfindlichen Egos aufzubauen und ihnen auszureden, katastrophale Versprechen zu geben, die ihre Zeit und ihr Geld betrafen. Er sah sich jedoch nicht verpflichtet, den Psychiater zu spielen – oder den Rechtsanwalt. Trotz all ihrer Fehler hatte Jacqueline ihn niemals um drei Uhr nachts geweckt und mit Selbstmord gedroht oder verlangt, daß er sie aus dem Knast hole. Er war damit zufrieden, daß er nicht mehr wußte, als nötig war. Während er seine Begleiterin jetzt betrachtete, wie sie umgeben von ihrem Mantel dasaß und aussah wie ein Pfau, der ein Rad schlägt, konnte er sie sich einfach nicht als Großmutter vorstellen.
Die Ankunft des Kellners, der ihnen die Menükarten reichte, lenkte Jacqueline für einen Augenblick ab. Nachdem sie jedoch einen dritten Drink abgelehnt und sich für einen Salat entschieden hatte, kehrte sie zum Thema zurück – wie eine Katze, die sich ausgiebig dem Verspeisen einer toten Maus widmet, dachte Chris mit einem Schaudern.
»Es ist wirklich nicht irrelevant, Chris. Diese Treibjagd setzt mir zu. Es macht keinen Spaß mehr. Ich gebe zu, daß das mal anders war, ich habe es genossen, mich in Szene zu setzen, in die Kamera zu grinsen und mir kleine, ätzende Bonmots auszudenken.«
»Von denen du viele von Dorothy Parker geklaut hast.«
»Das weißt du, und ich weiß es auch, aber die meisten Zuschauer haben noch nie von ihr – oder von irgendeinem anderen Autor gehört, wenn er nicht gerade auf den Bestsellerlisten steht. Die Leute lesen nicht, Chris. Selbst Leute im Verlagsgeschäft tun das nicht. Ich weiß, ich übertreibe. Ich nehme an, es gibt nicht mehr als drei Verleger, die damit angeben, daß sie niemals Romane lesen. Aber ...« Sie preßte ihre Hände gegen die Schläfen. »Ich muß eine Zeitlang weg von alldem. Ich muß raus aus New York und eine Weile nichts weiter als einen Blick auf meinen eigenen Nabel oder in meine eigene Seele tun. Wahrscheinlich das letztere, da es vom ästhetischen Standpunkt aus betrachtet sicherlich zufriedenstellender ist.«
»Mmmmm.«
»Chris!«
Ihre erhobene Stimme ließ ihn zusammenzucken. »Was?«
»Irgend etwas bedrückt dich«, verkündete Jacqueline. »Du windest dich schon die ganze Zeit wie ein Schuljunge, den sein schlechtes Gewissen quält, und weichst meinem Blick aus.«
»Nun ja ...«
»Habe ich etwas Falsches gesagt?« Sie rollte genervt mit den Augen und verzog das Gesicht, aber die Sorge in ihrer Stimme war aufrichtig.
»Nein. Das heißt, ja. Was ich sagen will ...« Chris atmete einmal tief durch. »Was du gerade gesagt hast, traf so ziemlich ins Schwarze, obwohl es gar nicht beabsichtigt war. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich habe auch keine Lust mehr auf diese Treibjagd. Ich ziehe mich zurück. Setze mich zur Ruhe.«
Jacqueline wurde kreidebleich. Sie starrte ihn so lange mit geöffnetem Mund an, daß es Chris wie eine Ewigkeit vorkam. Dann begann sie zu schreien.
Es war kein sehr lauter oder sehr langer Schrei, aber er war schrill genug, um die Leute an den anderen Tischen zu veranlassen, ihre Köpfe zu drehen. Jacquelines Hände flogen zu ihrer Kehle hinauf. »O Gott! O Gott! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Das kannst du mir nicht antun, Chris. Nach all diesen Jahren – nach allem, was wir uns bedeutet haben ...« Sie sackte nach vorne, die Pflaumen auf Halbmast.
Chris räusperte sich. »Jaqueline ... »
Jacqueline setzte sich wieder aufrecht hin. Ihre Augen blitzten vor Lachen – aber es war noch etwas anderes in ihnen. Dieser Anblick berührte Chris und ließ seinen Zorn über ihre absurde Vorstellung ein wenig verrauchen. »Du hast Roquefort auf deinen Federn«, bemerkte er und tupfte mit seiner Serviette an ihr herum.
»Ich habe dich wirklich sehr gern, Chris«, murmelte Jacqueline. »Es tut mir leid, aber ich konnte nicht widerstehen. Du hast so betroffen dreingeblickt, daß ich schon dachte, du würdest demnächst wegen Betrugs hinter Gitter wandern oder mir deine bevorstehende Hochzeit beichten oder sonst etwas wirklich Ernstes. Du hast dir doch keine Gedanken gemacht, oder? Du hast doch wohl nicht geglaubt, daß ich dir eine Szene machen würde?«
»Machst du das etwa nicht?«
»Nur eine ganz klitzekleine. Und wenn du ehrlich bist, wärst du am Boden zerstört gewesen, wenn ich deine Entscheidung nur kühl zur Kenntnis genommen hätte.«
»Ich dachte, du würdest versuchen, es mir auszureden.«
»Soll ich?«
Chris schüttelte den Kopf. »Ich renoviere seit über einem Jahr dieses Haus in Maine, und jetzt ist es endlich fertig. Genau wie ich. Ich möchte auf einem Felsen sitzen und einige Jahre nachdenken, ab und zu fischen und Ski laufen, mich meinen Hobbys widmen –«
»Lockenten schnitzen.« Jacquelines Stimme klang verdächtig bemüht, einen ernsten Tonfall beizubehalten.
»Das ist eine Kunst«, beharrte Chris. »Eine wirkliche Kunst. Lockenten sind bei Sammlern heißbegehrt –«
»Das glaube ich dir ja, mein Schatz. Ich bin sicher, daß du hervorragende Enten schnitzt.« Der Anflug von Spott verschwand aus ihrem Blick, und sie sagte mit sanfter Stimme: »Ich werde dich schrecklich vermissen, Chris. Ich möchte bezweifeln, daß ich jemals einen anderen Agenten mit einer solch seltenen Kombination aus Intelligenz, Humor und Integrität finden werde. Ich würde tatsächlich versuchen, es dir auszureden, wenn ich nicht eine solch hohe Meinung von dir hätte. Aber da das nun einmal so ist, bleibt mir nichts weiter übrig, als mich für dich zu freuen.« Sie schüttelte den Kopf »Großer Gott, das klingt ja wirklich so, als hättest du mir deine Hochzeitsabsichten eröffnet. Als nächstes breche ich wahrscheinlich in Tränen aus.«
Chris sagte nichts. Jacqueline blickte ihn forschend an. »Chris, du erinnerst mich an eine Katze, die das Goldfischglas ausgeräubert hat. Du gewiefter Hund, du, sag mir nur nicht, daß es da irgendwo eine unbekannte Verehrerin gibt?«
»Sie leitet die Bibliothek des Ortes.«
Aus irgendeinem Grund fanden sie das beide ausgesprochen amüsant. Die Spannung verflüchtigte sich, als beide in lautes Gelächter ausbrachen.
»Du hast einen guten Geschmack«, bemerkte Jacqueline, während sie vorsichtig über ihre verkrusteten Wimpern tupfte. »Als ehemalige Bibliothekarin darf ich dir versichern, daß es im ganzen Land keine besseren Frauen gibt. Und wenn du mich nicht zur Hochzeit einlädst, werde ich trotzdem kommen und etwas wundervoll Gräßliches mitbringen. Wie wäre es mit einem viktorianischen Nachttopf? Aber Chris – nun mal Spaß beiseite und alles Gute für dich –, was soll ich nur tuuuuun?«
Das letzte Wort klang wie das Jammern einer Sirene. Jacqueline war wieder die alte.
»Wenn du möchtest, werde ich mich auch weiterhin um deine beiden ersten Bücher kümmern. Es wird noch einige Zeit um die Autorintantiemen, die Verkäufe im Ausland und so weiter gehen.«
»Danke.«
»Meine zehn Prozent werden Dank genug sein.«
Sie lächelten sich voller Verständnis und in aller Freundschaft an. Chris fuhr fort: »Fast alle Agenten in New York wären bereit, einen Mord zu begehen, um dich auf ihrer Liste zu haben. Du kannst im Grunde wählen. Ich empfehle dir, einige zu einem Gespräch zu bitten.«
»Wie ich es gemacht habe, als ich dich engagierte?«
Chris mußte unwillkürlich lächeln. Damals, als sie ihn angerufen und verkündet hatte, daß sie auf der Suche nach einem Agenten sei und ihn zu einem Gespräch bitten wolle, hatte er noch nie zuvor von einer Jacqueline Kirby gehört. Die kühle Unverschämtheit ihrer Bitte war atemberaubend. Unveröffentlichte Autoren baten Agenten nicht zu einem Gespräch, sie flehten diese gottgleichen Kreaturen vielmehr an, einmal einen Blick auf ihre Manuskripte zu werfen. Chris hatte damals gerade begonnen, ihr dies zu erklären, als ihn die damenhafte Stimme am anderen Ende der Leitung unterbrach.
»Ich habe mit Hattie Foster zusammengearbeitet. Ich darf doch wohl davon ausgehen, daß sie Ihnen bekannt ist?«
Chris mußte zugeben, daß die Annahme berechtigt war. Hattie Foster war allen in der Branche bekannt und wurde von allen aufrichtig gehaßt – von den Agentenkollegen, den Lektoren und, den Verlegern. Und auch bei den Autoren, die sie schlecht vertreten und angeblich betrogen hatte, war sie nicht besonders beliebt. Anfang des Jahres war sie in einen Skandal verwickelt gewesen, der die Verlagswelt erschüttert und Hatties ohnehin schon schlechten Ruf noch weiter besudelt hatte. Ein Mordfall, der von einem Detective der Mordkommission namens O'Brien gelöst worden war unter Mithilfe einer Frau namens ...
Chris schürzte seine Lippen zu einem stummen Pfeifen. Kein Wunder, daß ihm der Name der Anruferin so vertraut vorgekommen war. »Ich kenne sie«, erwiderte er vorsichtig.
»Sagen Sie nichts, sagen Sie nichts! Stups, stups, zwinker, zwinker.«
»Was?« Chris nahm den Hörer vom Ohr und starrte ihn an.
»Entschuldigen Sie, ich komme wieder einmal völlig vom Thema ab. Hattie hat mein Manuskript an Last Forlorn Hope of Love geschickt, die ein Angebot dafür gemacht haben.« Sie nannte ihm einen Betrag, der seine Augenbrauen in die Höhe wandern ließ. »Ich für meinen Teil glaube allerdings, daß das Buch ein größeres Publikum verdient hat. Außerdem fühle ich mich bei Hattie nicht gut aufgehoben. Ich habe mich deshalb entschlossen, sie zu verlassen und mir einen anderen Agenten zu suchen.«
»Aber ...« Chris suchte nach einer höflichen Antwort. Er fand keine. »Aber, Miss – hm – Ms. – hm – Mrs. Kirby, das können Sie nicht tun. Ich kann einer Kollegin doch keine Autorin wegnehmen. Besonders nicht Hattie Foster.«
»Aber ich selbst habe mich zu diesem Schritt entschlossen.« Dieser Feststellung folgte ein Geräusch, als wenn Zähne aufeinanderschlagen.
Und sie setzte ihr Vorhaben in die Tat um. Nachdem Chris die ersten fünfzig Seiten ihres Manuskriptes gelesen hatte, das noch am selben Nachmittag von einem Boten gebracht wurde, rief er Hattie an, die ihm versicherte, daß sie nicht im Traum daran denke, bei einer Klientin, die mit ihr nicht zufrieden war, auf ihr vertragliches Recht zu pochen und wünschte ihnen beiden viel Glück. Ein solches Verhalten sah Hattie ganz und gar nicht ähnlich, so daß Chris zu der Schlußfolgerung gekommen war, Jacqueline müsse etwas gegen sie in der Hand haben. Aber er hatte niemals eine Frage in diese Richtung gestellt, und er war bis heute nicht daran interessiert, die Hintergründe zu erfahren.
»Irgendwelche Namen?« erkundigte sich Jacqueline jetzt, und Chris löste sich von der Erinnerung, um sich wieder der Gegenwart zu widmen.
Sie diskutierten eine Weile die Angelegenheit – die Vor- und Nachteile verschiedener Kollegen, die brennende Frage, ob große Agenturen den unabhängigen vorzuziehen seien –, aber Chris wurde zunehmend bewußt, daß Jacqueline nicht mit ganzem Herzen bei der Sache war.
»Ich weiß nicht, ob ich einen anderen Agenten möchte«, brummte sie schließlich, während sie die Dessertkarte studierte.
»Oh, nun gib dir schon einen Ruck, nimm ruhig den Schokoladenkuchen.«
»Das hatte ich sowieso vor. Du hast mich doch noch nie über irgendwelche Diäten schwatzen hören, oder?« Sie gab ihm keine Gelegenheit, zu antworten. »Das ist nicht der Grund, warum ich brummig bin. Ich bin durcheinander. Ich werde bestimmt nicht versuchen, dir deine Entscheidung auszureden, ganz sicher nicht, aber ich hasse die Vorstellung, jemand anders suchen zu müssen. Ich habe das eine Mal Glück gehabt, wie kann ich da hoffen, daß es ein zweites Mal gutgeht?«
Dieses Kompliment kam derart spröde über ihre Lippen, daß es wirklich aufrichtig gemeint sein mußte. Chris strahlte. »Verlaß dich nicht auf dein Glück. Benutze deinen Verstand.«
»Ich weiß nicht einmal, ob ich überhaupt noch schreiben möchte.«
»Nonsens.« Chris wandte sich an den Kellner. »Zwei Kaffee. Und einmal für die Dame das ›Tödliche Vergnügen‹.«
Jacqueline lehnte sich zurück und betrachtete ihre beringten Hände. »Ich habe das erste Buch aus Spaß geschrieben. All diese Liebesromane ... Ich konnte einfach nicht glauben, daß so ein Zeug wirklich veröffentlicht wurde ... Ich war sehr erstaunt, daß mein Buch so gut ankam.«
»Ich auch.« Dieses freimütige Eingeständnis brachte Chris einen bösen Blick aus den grünen Augen seiner Klientin ein. Er versuchte, es wiedergutzumachen. »Niemand weiß, was einen Bestseller ausmacht, Jacqueline. Dein Buch war – verglichen mit anderen seiner Art – gut und ausgesprochen lesbar. Das zweite war noch stärker, professioneller. Wenn du dich weiterhin entwickelst –«
»Aber ich möchte nicht weitermachen. Ich hasse diese verdammten Bücher.« Der Kellner schob Jacqueline den Kuchen vor die Nase und zog sich dann hastig zurück. Sie betrachtete mit düsterer Miene die dunkle Glasur. »Oh, mach dir keine Sorgen, ich leide nicht unter Größenwahn. Ich möchte keine große Li-tra-tur verfassen oder den Pulitzerpreis gewinnen. Die sogenannten Experten tun meine Romane vielleicht als ›Populäre Unterhaltung‹ ab, aber sie ist entschieden schwieriger zu schreiben als dieser ganze Bekenntnis-Kram, der das Leben scheibchenweise liefert. ›Populäre Unterhaltung‹ ist heutzutage die einzige Form der Prosaliteratur, die überhaupt noch Handlung hat. Ich mag es, wenn ein Buch eine Handlung hat. Ich mag es, wenn es einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Ich bin stolz auf das, was ich tue, und ich habe kein Verlangen, etwas anderes zu lesen oder zu schreiben. Aber Liebesromane? Gott steh uns bei! Seit der Jahrhundertwende sind nicht mehr als ein halbes Dutzend guter historischer Liebesromane geschrieben worden, wenn man Dorothy Dunnetts sechsbändige Familiensaga als ein Werk rechnet. Vom Winde verweht, Vergangene Zeiten, Katherine, Amber, Nackt im Eis ... Bist du gerade zusammengezuckt, Chris? Warum denn?«
»Ich bin nicht zusammengezuckt, es war ... nichts.«
Jacqueline war zu sehr in ihrem Kummer verstrickt, um noch einmal nachzufragen. »Nun, vielleicht ist Nackt im Eis gar kein historischer Roman. Es ist eine einzigartige Mischung aus Phantasie und Tatsachen, eine Erwachsenenversion von Der Herr der Ringe,ein literarischer Clan der Höhlenbären, ein pleistozänes Vom Winde verweht. Aber weißt du, was all diese Bücher gemeinsam haben – abgesehen davon, daß sie Bestseller sind? Nicht ein einziges Organ des Körpers ist erregt, hart oder pulsiert! Ehrlich Chris, wenn ich auch nur noch eine einzige sogenannte Liebesszene schreiben muß, bekomme ich einen Lachanfall, und ich schwöre dir, ich werde nicht mehr aufhören können. Drei oder vier Tage später wird man mich lachend über die Schreibmaschine gebeugt finden und mich mit einem Krankenwagen abtransportieren, und während man mich wegträgt ... Chris, du zuckst schon wieder! Ich habe es genau gesehen.«
»Was möchtest du denn schreiben?«
»Ein lustiges Buch«, erwiderte Jacqueline ohne zu zögern. »Eine verrückte Farce, ein teuflisch witziges, bissig humoriges Werk wie Schwarzes Unheil oder Kalter Trost. Oder vielleicht einen Fantasy-Roman.« Ihre Augenlider, Lippen und Federn senkten sich nachdenklich. »Einen netten Fantasy-Roman. Oder einen Krimi. Ich habe schon oft gedacht, daß ich mal einen entzückenden Thriller schreiben sollte. Ich habe eine Freundin ...«
Chris zuckte nicht zusammen. Er krümmte sich. Eine der unangenehmen Seiten an der »Klientin« Jacqueline war, daß sie ›Freundinnen‹ hatte, die ihr von Zeit zu Zeit Flausen in den Kopf setzten, die einen Agenten in den Wahnsinn trieben. (»Willst du etwa sagen, daß dir dein Agent noch nichts von Tiffany geschickt hat? Liebling, alle Bestseller-Autoren bekommen kleine Schmuckstücke von Tiffany.«) Einer dieser Freundinnen war es auch zu verdanken, daß Jacqueline eine solch unheilige Leidenschaft für die »Tavern on the Green« entwickelt hatte.
Er lauschte ihr geduldig mit zusammengepreßten Lippen, während Jacqueline weiter drauflosschwatzte und von ihrer Freundin Catriona erzählte, einer bekannten Krimiautorin, die Jacqueline für absolut fähig hielt, einen spannenden Kriminalroman zu verfassen, wenn sie nur wollte. Schließlich sagte er: »Ich bin sicher, daß du das könntest. Natürlich würdest du dabei nicht besonders viel Geld machen.«
»Oh.« Jacqueline dachte einen Moment über diese Bemerkung nach und nickte dann zögernd. »Catriona erwähnte schon, daß man mit Krimis nicht viel verdient.«
»Erfolgreichen Krimiautoren wie deiner Freundin geht es nicht schlecht. Aber sie bleiben nicht sechs Monate an der Spitze der Bestsellerliste der Times.«
Jacquelines smaragdgrüne Augen verengten sich, und Chris fügte hastig hinzu: »Mir ist bewußt, daß es Ausnahmen gibt. Ich weise dich lediglich darauf hin, daß es äußerst dumm wäre, eine sichere Sache für eine fragwürdige aufzugeben.«
»Aber Chris, ich sagte doch, wenn ich noch einmal die Worte ›umwerfend attraktiv‹ oder ›erregte Männlichkeit‹ schreiben muß –« Chris unterbrach sie dieses Mal nicht. Jacqueline hörte von allein auf und atmete tief ein. »Ich wußte, daß da noch etwas anderes war. Was? Was ist es?«
»Wie würde es dir gefallen, die Fortsetzung zu Nackt im Eis zu schreiben?«
Jacquelines angehaltener Atem entlud sich in einem unfeinen Prusten, das die Kanten des Papierdeckchens unter ihrem »Tödlichen Vergnügen« zum Flattern brachte. »Das ist alles? Deshalb bist du so ... Gott sei Dank! Ich dachte schon, du würdest mir eröffnen, daß du nur noch ein Jahr zu leben hast oder ...« Ihre Stimme stieg plötzlich zu einem hohen Quietschen auf. »Was war das? Hast du etwa gesagt ... ich ... Fortsetzung ... Nackt ...?«
»Du, Fortsetzung, Nackt.«
Er ließ seine Worte wirken und fragte sich, ob er den Kellner rufen sollte, um Champagner zu bestellen. Der Moment verdiente, in Erinnerung behalten zu werden: Es war das erste und einzige Mal seit sie sich kannten, daß Jacqueline sprachlos war.
Er war sich bewußt, daß er Jacqueline erst gar nicht erklären mußte, welch kostbarer Schatz dieser Auftrag sein würde. Wenn es im letzten Jahrzehnt überhaupt ein Buch gab, das nicht nur der lesenden Öffentlichkeit bekannt war, sondern auch solchen Leuten, die ihre Lippen bewegen mußten, wenn sie den Aufdruck einer Cornflakes-Packung entziffern wollten, dann war es Nackt im Eis. Chris war von diesem Erfolg zwar beeindruckt gewesen, aber er hatte sich nichts aus dem Buch gemacht. Die Mischung aus Fantasy, Prähistorie und Romanze hatte seinen Geschmack nicht getroffen. Aber vier Millionen Menschen hatte es so gut gefallen, daß sie es als Hardcover kauften, und die anderen, die kaum lesen konnten, waren von der Miniserie begeistert gewesen, die zwei junge Schauspieler zu Stars gemacht hatte. Der tragische Tod von Morgan Meredith und Jed Devereaux, die kurz nach der Ausstrahlung des Films bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen waren, hatte sie unsterblich gemacht. Und das Verschwinden der Autorin hatte in der Öffentlichkeit ein überwältigendes Interesse gefunden, das wochenlang anhielt.
Jacqueline saß bewegungslos und mit glasigen Augen da. Chris stupste sie an. »Nun übertreib es aber nicht, Jacqueline. Die Gerüchte sind dir doch sicher bekannt. Es ist jetzt sechs Wochen her, seit das Gericht Kathleen Darcy offiziell für tot erklärt hat. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat. Alle Beweise deuteten darauf hin, daß sie vor sieben Jahren Selbstmord begangen hat, aber du weißt ja, wie die Justiz arbeitet: wie die Mühlen Gottes.«
Jacqueline starrte weiter vor sich hin. Vielleicht war es dieser halb schwachsinnige Blick, der Chris veranlaßte, fortzufahren. »Sie war eine eigenartige Frau. Wie auch immer, sie ist jedenfalls tot – vor dem Gesetz und auch de facto –, und ihr Vermögen ist an ihre Erben gegangen. Und eine Fortsetzung ist geplant, das steht nun fest.«
»Ich?« keuchte Jacqueline erneut. »Fortsetzung? Nackt?«
»Warum nicht? Allwissend wie du bist, muß dir doch bekannt sein, daß Kathleen Darcy ein weiteres Buch geplant hatte, möglicherweise sogar eine Trilogie. Du hast erst zwei Bücher geschrieben, die aber derselben Gattung angehören, und sie waren ebenfalls außergewöhnlich erfolgreich. Die Konkurrenz wird stark sein, aber das einzige, was gegen dich sprechen könnte, ist, daß Booton Stokes, Kathleens Agent, eine seiner eigenen Autorinnen oder Autoren bevorzugt. Er wird kaum nachgeben wollen, aber er wird es müssen. Und wo du gerade auf der Suche nach einem neuen Agenten bist –«
»Nein.«
»Was?« Nun war es an Chris, zu starren.
»Nein. Nein, Chris. Ich werde mir einen neuen Agenten suchen, aber ich werde nicht die Fortsetzung zu Nackt im Eis schreiben. Ich liebe dieses Buch. Ich habe es zwanzigmal gelesen. Laß jemand anderen die Fortsetzung verhunzen. Ich werde es jedenfalls nicht sein.«
Kapitel 2
»Bitte-nehmen-Sie-Platz. Mr.-Stokes-wird-Sie-empfangen, sobald-sein-Terminkalender-es-erlaubt.« Die Empfangsdame ratterte den Standardsatz mit monotoner Stimme herunter, ohne von ihrer Zeitschrift aufzublicken. Jacqueline antwortete nichts darauf und ging auch nicht weg. Sie ließ einfach ihre Gegenwart wie einen durchdringenden, unangenehmen Geruch wirken. Nach kurzer Zeit begann die Empfangsdame unruhig hin und her zu rutschen und blickte auf Jacquelines Gesichtsausdruck, den man als wohlwollend bezeichnen konnte, veränderte sich nicht, aber das Mädchen schluckte und hob nervös ihre Hand, um über ihr messingblondes Haar zu streichen.
»Ähem – Mr. Stokes ist heute ein wenig spät dran, Ma'am. Eine Art Notfall, wissen Sie.«
Als Frau mit realistischem Verstand akzeptierte Jacqueline die ein wenig stammelnd vorgetragene Erklärung in dem Sinne, in dem sie vorgetragen worden war. Schließlich konnte man die Manieren eines vergangenen Zeitalters wohl kaum von einer jungen Frau erwarten, deren Fingernägel in schillernder Malvenfarbe angemalt waren. Sie nickte freundlich und setzte sich auf den zuvor angebotenen Platz.
Obwohl sie ein wenig irritiert war, daß man sie bei einer Verabredung warten ließ, die sie bereits vor über einer Woche getroffen hatte (mit welcher Art von Notfällen hatten es Agenten wohl zu tun, unheilbare Schreibblockaden?), war sie ganz froh, einige Minuten zur Verfügung zu haben, um ihre Gedanken zu ordnen und dabei die Inneneinrichtung des Raums zu betrachten.
Die Stühle erinnerten in Farbe und Form an überreife Auberginen. Sie waren unbequem niedrig und mit einem kratzigen Baumwollstoff bezogen. Der Schreibtisch der Empfangsdame bestand aus einer imitierten Rokoko-Konstruktion und war mit Perlmuttintarsien und Messing überladen. Das gleiche galt für die Empfangsdame selbst, von den Perlmuttintarsien einmal abgesehen. Ein Großteil an ihr war falsch, inklusive – wie Jacqueline vermutete – der beiden Zwillingsgipfel, die sich gegen den Seidenstoff ihrer Bluse preßten ... Jacqueline ermahnte sich. Liebesromane hatten eine überaus durchdringende und widernatürliche Wirkung auf die Vergleiche, die einem in den Sinn kamen. So Gott und Mr. Stokes es wollten, würde ihr nächster Roman keine einzige bebende oder pulsierende Erhebung enthalten. Kathleen Darcy hatte ihre erotischen Effekte – und es gab viele in ihrem Buch – ohne solch rohe Techniken erzielt. Eine weniger selbstbewußte Frau wäre an diesem Punkt ihrer Überlegungen vor Scham in den Boden versunken. Jacqueline schämte sich nie, aber das unangenehme Gefühl, das sie seit der Vereinbarung dieses Treffens nicht mehr losgelassen hatte, schwoll in einem Maße an, das dem Hochwasser tragenden Rubicon alle Ehre gemacht hätte. Es war noch nicht zu spät: Sie hatte einen Nebenfluß dieses Stromes überquert, als sie den Termin für dieses Treffen vereinbarte. Aber der eigentliche Fluß lag noch vor ihr. Sie konnte noch zurück, selbst jetzt noch.
Chris hatte sich bemüht, es ihr auszureden. »Ich muß verrückt gewesen sein, einen solchen Vorschlag zu machen. Im Unterbewußtsein habe ich wohl fest damit gerechnet, daß du ablehnen würdest. Hast du überhaupt eine Vorstellung, worauf du dich da einläßt?«
Er hatte sich dann die Mühe gemacht, sie aufzuklären. Aber Jacqueline hatte alle seine Warnungen beiseite gewischt. Niemand kam besser mit PR-Arbeit zurecht als sie. Sie besaß genug Ego, um den widrigen Winden der Verleumdung, die ihr zweifellos entgegenschlagen würden – egal, wie gut ihr Buch auch sein mochte –, zu widerstehen. Was die Leser und Kritiker wollten, war ein weiteres Nackt im Eis, aber es war für jeden anderen unmöglich – Kathleen Darcy eingeschlossen –, ein solches Buch noch einmal zu schreiben. Es stimmte, daß die Meinung der anderen sie nicht verunsichern konnte. Ihre eigene Meinung hatte da allerdings größere Macht. Beharrlich meldete sie sich zu Wort: Würde sie den Anforderungen überhaupt gewachsen sein, die sie an sich stellte? Die Antwort war ein deprimierendes »Vielleicht nicht«. Sie hatte keine Illusionen, was ihr Talent betraf Es war ein nettes, kleines Talent, mehr als angemessen für die Zwecke, für die sie es einsetzte. Aber diese Fortsetzung zu schreiben, bedurfte mehr als des Talents, das sie gegenwärtig besaß. Zum Teufel damit, dachte Jacqueline, als Autorin mußte sie sich einfach neuen Herausforderungen stellen ... wofür war ein Agent schließlich da?
Gründe treten selten einzeln auf und sind auch selten einfach zu erläutern. Entscheidungen reifen heran, indem man eine Vielzahl von positiven und negativen Faktoren gegeneinander abwägt. Ein Faktor, der Jacquelines Meinungsänderung fraglos beeinflußt hatte, war die Zahl und die Auswahl der anderen Kandidaten, ihrer Rivalen. Die Neuigkeit war erst vor einer knappen Woche bekanntgegeben worden, und schon gab es eine lange Reihe von Freiwilligen. Weil Nackt in der Literatur nur schwer einzuordnen war, meldeten sich die unterschiedlichsten Autoren: Fantasy-Autoren, Verfasser von historischen Romanen, Liebesromanschriftsteller und auch Bestsellerautoren. Unter ihnen waren Jack Carter, Autor von Rote Flagge, Rotes Blut (der Geschichte von einer sowjetischen Verschwörung, deren Ziel es ist, einen Anschlag auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu verüben, der aber von einer wunderschönen russischen Agentin vereitelt wird, die sich in ihren gutaussehenden Gegenspieler vom CIA verliebt), und Franklin Dubois, der sich auf perverse Sexpraktiken in der Wall Street spezialisiert hatte. Aber der Name, der Jacqueline in Rage versetzt und den Ausschlag für ihren Entschluß gegeben hatte, lautete Brunnhilde Karlsdottir.
Bis zu Jacquelines Erstlingsroman war Brunnhilde die unumstrittene Königin der »Wilden-Mieder-Ripper« gewesen – wobei sich »wild« nicht auf die Qualität oder den Inhalt ihrer Bücher bezog, sondern auf die historischen Zeiträume, auf die sie sich spezialisiert hatte. England im frühen Mittelalter, Gallien in der Eisenzeit, welches Land auch immer in der Bronzezeit: Da fühlte Brunnhilde sich zu Hause. Ihre wahre Stärke aber waren die Wikinger. Der Grund mochte darin liegen, daß sie selbst einer der kräftigeren Vertreterinnen dieses Volksstammes glich.
Brunnhilde war auf dem Kongreß, wo Jacqueline zum ersten Mal mit den unzähligen Königinnen der Romanze zusammentraf, nicht erschienen. Die Veranstalter hatten nämlich den Preis für den »besten Liebesroman, angesiedelt im sechsten Jahrhundert« einer anderen Autorin verliehen. Erst nachdem Jacquelines erster Roman Brunnhilde von der Bestsellerliste der Times verdrängt hatte, waren die beiden sich begegnet. Es war jedoch nicht die berufliche Rivalität, die die Fehde zwischen ihnen entfacht hatte. Es war Haß auf den ersten Blick – rein und stark wie Äthylalkohol. Ehe sie nun also zusehen mußte, wie Brunnhilde Nackt im Eis besudelte, schwor sich Jacqueline, daß sie Booton Stokes lieber fünfundzwanzig Prozent geben und/oder mit ihm ins Bett gehen würde.
Sie studierte die unzähligen Photographien von Stokes, die die Wände vor seinem Büro zierten. Booton mit Liz Taylor, mit Mr. T, mit dem Quarterback vom Superbowl des letzten Jahres (»Autor« von Gemetzel beim Superbowl), mit einem ehemaligen Mitarbeiter des Weißen Hauses, dessen Klatschbuch sich eine halbe Million Mal verkauft hatte. Die Liste der Autoren, die Stokes unter Vertrag hatte, war zweifellos beeindruckend – in finanzieller wie auch in literarischer Hinsicht. Und das hatte er allein Kathleen Darcy zu verdanken. Sie war seine erste wichtige Klientin gewesen, sein erster Bestseller. Ihr Erfolg hatte andere Schriftsteller zu seiner Agentur geführt.
Jaquelines Augen ruhten auf dem vierzig mal sechsundvierzig Zentimeter großen Photo, das Stokes mit seiner bekanntesten Klientin zeigte. Um den Rahmen war ein Stück breiten, schwarzen Samts gewunden, und auf dem Tisch darunter stand eine schmale Vase mit einer einzelnen weißen Seidenrose. Kathleen schien unter der Last von Stokes' Arm auf ihren Schultern zusammenzusinken. Ihr Kopf reichte kaum bis an seine Schulter, und ihre Augen waren groß und unschuldig. Sie sah viel jünger aus, als sie tatsächlich war. Bei Erscheinen von Nackt im Eis war sie achtundzwanzig gewesen.
Jaqueline ließ ihren Blick auf ihrem Gesicht ruhen. Kathleen schien ein wenig überwältigt von dem Trubel um sie herum, und doch verriet ihr Gesicht trotz seiner Reserviertheit sowohl Stärke als auch Humor. Ihre Lippen waren fest, ihre Augen blickten gelassen. Wer hätte gedacht, daß sie zwei Jahre später tot sein würde, und das möglicherweise sogar durch eigene Hand?
Jacqueline konnte es sich nur schwerlich vorstellen. Und das war der ausschlaggebende Grund, warum sie die Herausforderung annehmen wollte, die sie anfangs abgelehnt hatte.
Sie wäre die erste, die zugab, daß Neugierde ihre herausragende Eigenschaft war. Aber was – so pflegte sie gewöhnlich zu fragen – war daran so schlimm? Die Frage war allerdings rein rhetorischer Natur, denn sie gab niemandem die Chance, darauf zu antworten, sondern fuhr für gewöhnlich fort: »Neugierde hat Kolumbus dazu gebracht, den Ozean in diesen klapprigen, kleinen Schiffen zu überqueren. Neugierde stand am Anfang jeder großen wissenschaftlichen Entdeckung. Ohne Neugierde würden wir alle noch in Höhlen hocken, uns kratzen und rohes Fleisch essen. Wenn es keine Neugier gäbe, dann –«
An dieser Stelle wurde sie gewöhnlich von irgend jemandem unterbrochen, was sie auch zuließ, da sie ihrer Ansicht nach ihren Standpunkt deutlich gemacht hatte.
Sie hatte sich immer sehr für Kathleen Darcys Tod interessiert – um es einmal milde auszudrücken. Wie so viele von Kathleens Lesern war sie nicht nur von dem Buch, sondern auch von seiner Autorin fasziniert. Warum sollte eine junge Frau, die gesund und überaus talentiert war, ihr Leben beenden wollen? Und wenn sie es nicht getan hatte, was war dann mit ihr geschehen? Diese Frage ließ Jacqueline schon seit Jahren nicht mehr los. Sie hatte zwar deshalb keine schlaflosen Nächte – es gab nur wenige Dinge, die eine solche Wirkung auf sie hatten –, aber es war eine unerledigte Angelegenheit in dem vollgestopften Lagerhaus, das ihr Gedächtnis darstellte. Da sie nicht nur neugierig, sondern auch ein ausgesprochen rational denkender Mensch war, hatte sie immer gewußt, daß ihre Chancen, dieses Rätsel zu lösen, denkbar gering waren. Aber andererseits hatte es auch keinen rationalen Grund dafür gegeben, daß sie jemals die Gelegenheit erhalten würde, in Kathleens Papieren und ihrer Vergangenheit herumzuwühlen. Es war nun aber eine unwiderstehliche Versuchung, der sie nicht widerstehen konnte.
Ihr Blick wanderte von Kathleens Gesicht zu dem Mann, der neben ihr stand. Stokes war damals schlanker und durchtrainierter gewesen und hatte, abgesehen von seinen gerissen blickenden, engstehenden Augen, nicht schlecht ausgesehen. Auf späteren Photos zeigte sich ein Bauchansatz und mindestens ein zusätzliches Kinn. Sein dichtes, lockiges Haar hatte sich allerdings gehalten. Zumindest war das Jacquelines stille Hoffnung. Perücken fand sie im Bett einfach abstoßend. Wenn erst einmal die Zeit gekommen war ...
Apropos Zeit ... Sie erhob sich. »Ich kann unmöglich länger warten«, verkündete sie. »Richten Sie Mr. Stokes aus –«
Wie aufs Stichwort öffnete sich die Tür zu Stokes Büro. Womit auch immer er beschäftigt gewesen sein mochte, Stokes hatte auf jeden Fall einige Zeit damit verbracht, sich herzurichten. Niemand sah wie die Hollywood-Version eines rührigen Literaturagenten aus, ohne daran zu arbeiten. Er hatte seine Hemdsärmel bis über die haarigen Handgelenke hochgerollt, seine schwere Seidenkrawatte saß ein klein wenig schief, und eine einzelne Haarlocke fiel ihm auf jungenhafte Weise in die Stirn. In einer Hand hielt er einen Federhalter, in der anderen eine Hornbrille. Er winkte Jacqueline mit beiden Händen zu und entblößte zwei Reihen blendendweißer Zähne.
»Mrs. Kirby! Meine tiefste, aufrichtigste Entschuldigung! Ich falle demütig vor Ihnen auf die Knie.«
»Aber nicht doch! Machen Sie sich wegen mir keine Umstände! Ich bitte Sie.« Jacqueline entblößte ihre eigenen Zähne, die ebenso weiß und ebenso groß waren. Aber im Gegensatz zu Stokes Dentalapparat verdankten sie ihre Vollkommenheit der Natur und nicht der Kunst irgendeines Zahnarztes.
»Treten Sie doch ein«, sagte Stokes. »Kaffee? Tee? Nehmen Sie diesen Stuhl, er ist am bequemsten. Ich war gerade am Telefon – London –, diese Briten sind ja so redselig ...«
Sie nahm Platz, kreuzte sittsam ihre Fußknöchel und balancierte ihre Handtasche auf den Knien. Stokes beäugte das Objekt mit einiger Neugier. Wie alle ihre Handtaschen war auch diese unerhört groß und derartig voll, daß sie wie ein hochschwangeres Schwein aussah.
Stokes setzte seine Brille auf. Sie gab seinem verbindlichen Gesichtsausdruck einen dringend notwendigen Anflug von Intellektualität und vergrößerte seine Augen auf eine beinahe normale Größe. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie geschmeichelt ich mich fühlte, von Ihnen zu hören«, versicherte er ihr. »Ich muß Chris unbedingt noch anrufen und mich bei ihm für seine Empfehlung bedanken. Wir werden den lieben, alten Burschen vermissen! Er ist einer der glitzernden Sterne in unserer Branche. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, er ist ein strahlender Planet dort oben am Firmament, dessen Integrität auf uns alle herabstrahlt.«
»Ich werde es ihm ausrichten.«
»Sie werden ihn auch vermissen, das ist mir klar. Aber ich bin sicher, daß wir ein Verhältnis zueinander entwickeln werden, das ebenso stark ist und womöglich sogar noch – hm –«
»Lukrativer«, schlug Jacqueline vor.
»Genau.« Stokes lächelte. »Sie sind eine Dame von beachtlichem Scharfsinn, Mrs. Kirby. Wir müssen nicht erst lange um den heißen Brei herumreden, nicht wahr? Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich diese Unterhaltung aufzeichne?«
»Überhaupt nicht.« Jacquelines Knie begannen taub zu werden. Sie setzte ihre Handtasche auf den Boden, öffnete sie und zog ein Taschentuch hervor. Das Klicken ihres eigenen Kassettenrecorders wurde durch ihr vornehmes Schneufen überdeckt.
Dank ihrer beachtlichen Erfahrung in diesen Angelegenheiten war ihr bereits klar, daß sie keine schmerzlichen Opfer bringen mußte, um Stokes Wohlwollen zu erlangen. Er war klug genug zu wissen, daß sich Geschäft und Vergnügen nicht gut miteinander vertrugen, und er schien eher minderjährige, blonde Püppchen zu bevorzugen, deren Oberweiten ihren IQ übertrafen. Sie war auch nicht ernsthaft entschlossen gewesen, ein solches Opfer zu bringen, ebensowenig, wie sie ernsthaft eine fünfundzwanzigprozentige Provision ins Auge gefaßt hatte. Aber während sie wie zwei Fischweiber feilschten, begann sie zu fürchten, daß sie möglicherweise eine Zahl schlucken mußte, die beinahe ebenso absurd war. Sie einigten sich schließlich auf fünfzehn Prozent, was akzeptabel war.
»Wunderbar«, sagte Stokes fröhlich. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Woran arbeiten Sie im Augenblick, meine liebe Jackie? Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich Sie Jackie nenne?«
»Ja.«
»Äh –«
»Niemand nennt mich Jackie.«
»Oh.«
»Ich spiele mit der Idee zu einem Roman über das alte Ägypten«, sagte Jacqueline. Das war nicht vollkommen gelogen; »spielen« war eine treffende Bezeichnung für ihre Ideen, die sie in bezug auf das Thema »altes Ägypten« hatte. »Aber natürlich höre ich mir gerne Ihre Vorschläge an.«
Stoke ließ sich von ihrer scheinbaren Offenheit nicht täuschen, und genau das sollte er auch nicht. Keiner von ihnen hatte Nackt im Eis erwähnt. Aus irgendwelchen Gründen, die wenig Sinn ergaben, war jeder entschlossen, den anderen dazu zu bringen, zuerst damit anzufangen. Stokes war der erste, der nachgab.
»Ich hatte sowieso vor, Chris demnächst wegen eines Projektes anzusprechen, das sich kürzlich ergeben hat. Vielleicht haben Sie schon irgendwelche Gerüchte darüber gehört.«
Jacqueline lag eine verneinende Bemerkung auf der Zunge, aber plötzlich überfiel sie ein unerwarteter Widerwillen und ließ sie stumm bleiben. Sie war diese sinnlosen Spielchen leid. »Ich habe die Gerüchte gehört«, erwiderte sie deshalb ohne Umschweife. »Ich würde nichts lieber tun, als die Fortsetzung zu Nackt in Angriff zu nehmen. Ich bin nicht sicher, ob es mir gelänge, aber ich würde mein Bestes geben, und ich denke, daß ich ebenso qualifiziert bin wie gewisse andere Leute, deren Namen ich in diesem Zusammenhang gehört habe.«
»Ihr Name war einer der ersten, der fiel«, versicherte ihr Stokes. »Aber natürlich gibt es da noch andere, und die Entscheidung liegt nicht ausschließlich bei mir. Ich werde mich eingehend mit Kathleens bedauernswerten Erben beraten – ihrer Mutter, ihrem Halbbruder und ihren Halbschwestern. Es gibt gewisse Bedingungen, die ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht preisgeben kann, aber ich darf Ihnen bereits verraten, daß Mr. St. John Darcy und seine Verwandten beabsichtigen, in Frage kommende Kandidatinnen zu einem Gespräch zu bitten.«
Jacqueline hob ihre Augenbrauen in die Höhe. »Mr. St. John? Ist das ein echter aristokratischer Name?«
»Das möchte ich bezweifeln«, entgegnete Stoke. »Sein Name war auch nicht Darcy, bis er ihn offiziell ändern ließ. Er ist Kathleens Halbbruder.«
»Ich verstehe.« Jacqueline dachte das zumindest. Nur einem Mann ohne einen bekannten Namen oder eine besondere Position wäre soviel daran gelegen, mit dem hart erarbeiteten Ruhm seiner Schwester in Verbindung gebracht zu werden.
»Kathleens Mutter hat ihren Namen ebenfalls geändert«, fuhr Stokes fort. »Sie war dreimal verheiratet, müssen Sie wissen. Kathleens Vater war ihr zweiter Ehemann. Ihr dritter ... Nun, es gehört sich nicht, schlecht über die Toten zu sprechen, deshalb lassen Sie uns lediglich sagen, daß sie ihn nicht gerade in freundlicher Erinnerung hat.«
»Zumindest vereinfacht es die Dinge«, erwiderte Jacqueline. »Was ist mit den Kindern aus der dritten Ehe? Zwei sind es, glaube ich, nicht wahr? Sind es nicht beides Töchter?«
»Ganz recht. Sie haben den Namen ihres Vaters behalten, aber eine von ihnen ist inzwischen verheiratet. Sie scheinen einiges über die Familie zu wissen.«
»Und über das Buch. Ich habe es mindestens ein dutzendmal gelesen.«
»Hervorragend. Etwas sollte Ihnen klar sein, Jacqueline ...« Er verstummte. Als er keine negative Reaktion bemerkte, fuhr er ermutigt fort. »Meine liebe Jacqueline, es darf auch nicht der leiseste Anflug eines Interessenkonfliktes entstehen. Ich war Kathleens Agent, und die Erben haben mich beauftragt, den Nachlaß zu verwalten. Sollte einer der Autoren oder Autorinnen, die ich unter Vertrag habe, ausgewählt werden, so wird er oder sie nicht von mir persönlich vertreten werden, sondern von einer meiner Assistentinnen. Wären Sie damit einverstanden?«
»Ich denke schon. Es käme darauf an, welche Ihrer Assistentinnen es wäre.«
»Natürlich. In Ihrem Fall ...« Stokes dachte einen Augenblick nach oder tat zumindest so. »Es gibt da eine junge Frau, mit der Sie, wie ich denke, gut zusammenarbeiten werden. Jung aber fähig. Sie hat eine großartige Zukunft vor sich, da bin ich sicher. Soll ich sie hereinrufen, damit Sie sie kennenlernen können?«
Ohne auf eine Antwort zu warten, drückte er auf einen Knopf. Die Tür öffnete sich daraufhin derartig schnell, daß Jacqueline den Verdacht nicht los wurde, die junge Frau habe nur darauf gewartet, gerufen zu werden. Stokes war sich wohl verdammt sicher gewesen, daß er sie unter Vertrag nehmen würde.
Das Mädchen war sicherlich kein Püppchen. Ihr Haar war so hellblond, daß es beinahe grau aussah, und es war straff aus dem Gesicht gekämmt und im Nacken zu einem formlosen Knäuel zusammengebunden. Sie machte den Eindruck eines verblichenen Sepiadrucks – bleiche Wangen und Lippen, graue Augen, die Brauen und Wimpern so blaß, daß sie praktisch unsichtbar waren. Ihr khakifarbenes Kleid war viel zu weit, es hing deprimierend von ihren gebeugten Schultern herab und schlabberte ihr um die Knöchel, als sie ins Zimmer hineingeschlichen kam.
»Sarah Saunders, Jacqueline Kirby«, sagte Stokes, ohne sich aus seinem Sessel zu erheben. »Sarah ist über die Situation unterrichtet, Jacqueline. Wir haben nach Ihrem Anruf, bei dem Sie um eine Verabredung baten, alles ausführlich besprochen. Natürlich zunächst einmal rein hypothetisch, das versteht sich von selbst, ohne irgendeine Verpflichtung ...«
Sarah Saunders stand mit geschlossenen Füßen da, die Hände ineinandergeklammert vor ihrer vermutlichen Taille, die sich bei all der Formlosigkeit nicht ausmachen ließ. »Es wäre eine Ehre für mich, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Ms. Kirby«, murmelte sie. »Ich habe Ihre Bücher gelesen, und ich halte sie für brillant.«
»Vielen Dank«, erwiderte Jacqueline mürrisch. Falls dies ein Hinweis auf ihren literarischen Geschmack sein sollte, waren die Aussichten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ziemlich düster.
Stokes entließ seine Assistentin mit einer knappen Handbewegung. »Es gibt keinen Grund, jetzt schon Details zu besprechen, da wir noch sehr weit von einer endgültigen Entscheidung entfernt sind. Das wäre alles, Sarah.«
Die farblosen Lippen des Mädchens zuckten, aber es kam kein Laut heraus. Sie schlich zur Tür zurück.
In den letzten Minuten hatte Jacqueline laute Stimmen vernommen, die vom Vorzimmer hereindrangen. Eine erhob sich jetzt mit einem durchdringenden, schrillen Schrei über die andere, und die Tür wurde aufgestoßen. Sie traf Sarah Saunders an der Schulter. Sie stolperte zurück, prallte gegen die Wand und setzte sich mit einem lauten Plumps auf den Boden. Niemand beachtete die bedauernswerte junge Frau auch nur im geringsten, denn im Türrahmen stand eine furchterregende Gestalt, die heftig keuchte und vor Wut zu zerplatzen drohte.
Brunnhilde hätte sich selbst möglicherweise als »beeindruckend in ihrem Zorn« charakterisiert. Oder sie hätte sich – und hatte sich auch tatsächlich – als vollbusig und üppig und sinnlich bezeichnet. Jacqueline dagegen, die nüchterne Prosa bevorzugte, hatte einmal das Wort »fett« gebraucht. Seither war die schwelende Fehde offen entbrannt.
Brunnhilde hatte sich in eines dieser pseudo-altertümlichen Gewänder gehüllt, die sie bevorzugte, mit viel Spitze und der Andeutung eines Brustpanzers. Es bestand eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen ihr und ihren geliebten Wikingern, die sie stets als starke, muskulöse He-Men in Hörnerhelmen beschrieb. Wikinger hatten in Wahrheit keine Hörnerhelme getragen. Nachdem Jacqueline diese Tatsache einmal in einem Interview erwähnt hatte, war ihr Verhältnis zueinander nicht unbedingt besser geworden.
Die glühenden Augen des Neuankömmlings richteten sich auf Jacqueline, die mit einem geschmackvollen, limonengrünen Seidenkostüm bekleidet war, das ihre Augen smaragdgrün und ihr Gewicht mindestens zehn Pfund leichter erscheinen ließ. »Sie!« kreischte Brunnhilde und vollführte einige fahrige Wikingergesten.
Jacqueline betrachtete sie prüfend. »Haben Sie auch einen Termin, liebste Brunnhilde?«
Brunnhilde lachte wie verrückt. »Sie verschwenden nur ihre Zeit, Kirby. Machen Sie sich erst gar nicht die Mühe, sich bei Stokes einzuschmeicheln. Sie werden dieses Buch niemals schreiben. Es gehört mir. Mir allein.«
»Sie haben Wimperntusche und Lippenstift auf Ihrem Kleid«, sagte Jacqueline in fürsorglichem Tonfall. »Lassen Sie mich Ihnen ein Taschentuch reichen, meine Liebe. Sie sollten immer eins bei sich tragen, statt sich mit dem Ärmel durch das Gesicht zu wischen. Füllige Leute schwitzen immer sehr schnell, das sollten Sie wissen.« Brunnhildes Finger krümmten sich, wanden sich wie fleischige, weiße Würmer. Jacquelines Augen schlossen sich zu schmalen Schlitzen. »Das würde ich an Ihrer Stelle lassen«, sagte sie.
Brunnhilde dachte einen Augenblick nach und beschloß tatsächlich, es zu lassen. Statt dessen fuchtelte sie mit ihrem kräftigen Arm in der Gegend herum und stieß dabei eine Vase von einem nahestehenden Tisch. Sarah, die sich gerade aufgerappelt hatte, bekam das meiste Wasser ab, und ein Dutzend Teerosen flogen ihr gegen die Brust. Tropfend ging sie hinter der Tür in Deckung.
»Sie werden dieses Buch niemals bekommen, Jacqueline Kirby«, böllerte Brunnhilde. »Ich werde Sie vorher mit meinen bloßen Händen erwürgen und dich auch, Stokes, du schleimige, hinterhältige Schlange!« Sie stürmte durch die Tür hinaus, und ihr Weg durch das andere Büro wurde von dumpfen Schlägen und Klirren begleitet, da diverse Gegenstände zu Bruch gehen mußten.
»Reichlich abgedroschene Phrasen«, murmelte Jacqueline. »Ich fürchte, das ist leider nur allzu typisch für den literarischen Stil der lieben Brunnhilde. Ist alles in Ordnung, Ms. Saunders?«
Hinter der Tür ertönte ein bejahender Quiekser. Jacqueline wandte sich Stokes zu, der so tief in seinen Sessel gerutscht war, daß nur noch sein Kopf zu sehen war.
»Ich werde mich jetzt auf den Weg machen, Boots. Es macht Ihnen doch nichts aus, wenn ich Sie Boots nenne, oder?«
Stokes Oberkörper kam langsam wieder zum Vorschein. Auf seiner Stirn glänzten Schweißperlen, aber er brachte ein Lächeln zustande. »Doch, in der Tat. Das heißt, ich wollte sagen, nicht im geringsten. Ich werde mich mit Ihnen in Verbindung setzen, Jaqueline. Wir sollten uns bald einmal zum Mittagessen treffen. Um zu feiern ... um zu feiern.«