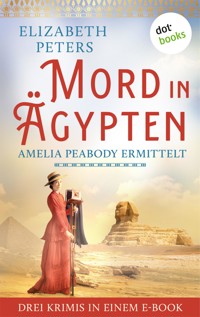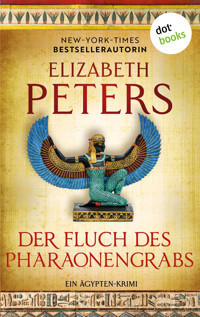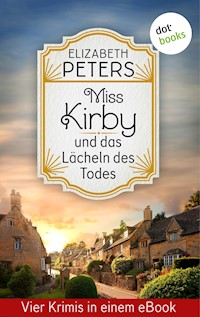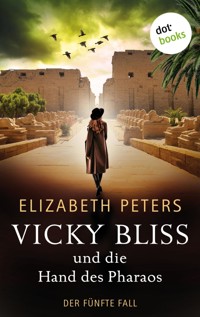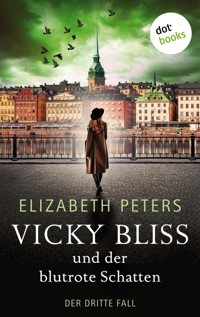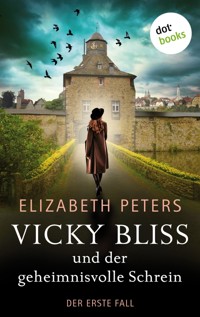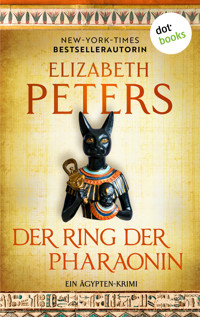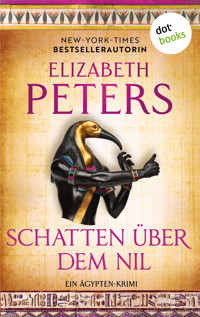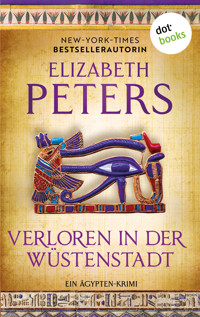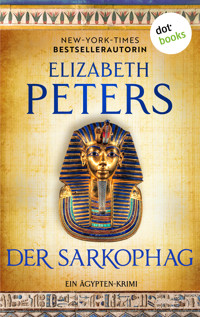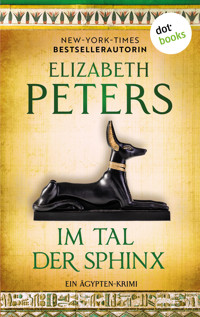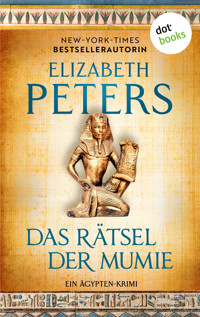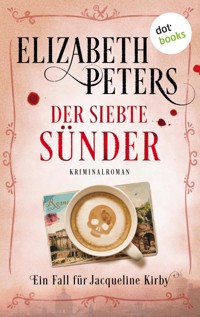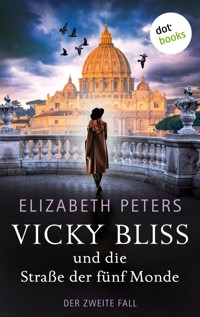
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Vicky Bliss
- Sprache: Deutsch
Eine Villa mit dunklen Geheimnissen: Der packende Kriminalroman »Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde« von Elizabeth Peters als eBook bei dotbooks. Ein rätselhafter Kunstraub – eine Spur, die mitten ins Herz der Gefahr führt … Als bei einem Toten der Talisman Karls des Großen gefunden wird, ist die Kunsthistorikerin Vicky Bliss fassungslos. Wie kam der Obdachlose in den Besitz des wertvollen Artefakts, das doch hochsicher verwahrt in einem Münchner Museum ruhen sollte? Oder handelt es sich um eine perfekte Fälschung? Den einzigen Hinweis liefert ein Zettel, den der Tote bei sich trug – und der Vicky geradewegs nach Rom führt, zur Villa eines italienischen Grafen. Deren Bewohner scheinen nicht nur äußerst charmant, sondern auch überaus zwielichtig – allen voran der geheimnisvolle John Smythe, der Vicky mit seinen dunklen Blicken überallhin zu folgen scheint … »Niemand ist besser darin, mit brennenden Fackeln zu jonglieren, während sie auf einem hohen Drahtseil tanzt als Elizabeth Peters.« Chicago Tribune Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Krimi-Highlight »Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde« von Elizabeth Peters – Band 2 der Bestseller-Reihe um die Kunsthistorikerin mit dem Gespür für mörderische Fälle. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein rätselhafter Kunstraub – eine Spur, die mitten ins Herz der Gefahr führt … Als bei einem Toten der Talisman Karls des Großen gefunden wird, ist die Kunsthistorikerin Vicky Bliss fassungslos. Wie kam der Obdachlose in den Besitz des wertvollen Artefakts, das doch hochsicher verwahrt in einem Münchner Museum ruhen sollte? Oder handelt es sich um eine perfekte Fälschung? Den einzigen Hinweis liefert ein Zettel, den der Tote bei sich trug – und der Vicky geradewegs nach Rom führt, zur Villa eines italienischen Grafen. Deren Bewohner scheinen nicht nur äußerst charmant, sondern auch überaus zwielichtig – allen voran der geheimnisvolle John Smythe, der Vicky mit seinen dunklen Blicken überallhin zu folgen scheint …
»Niemand ist besser darin, mit brennenden Fackeln zu jonglieren, während sie auf einem hohen Drahtseil tanzt als Elizabeth Peters.« Chicago Tribune
Über die Autorin:
Hinter der US-amerikanischen Bestsellerautorin Elizabeth Peters steht Barbara Louise Gross Mertz (1927–2013), die auch unter dem Pseudonym Barbara Michaels erfolgreich Krimis und Thriller schrieb. Die Autorin promovierte an der University of Chicago in Ägyptologie. So haben auch ihre über 20 Kriminalromane, für die sie zahlreiche Preise gewann, meist einen historischen Hintergrund.
Die Krimireihe um Vicky Bliss bei dotbooks umfasst: »Vicky Bliss und der geheimnisvolle Schrein – Der erste Fall« »Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde – Der zweite Fall« »Vicky Bliss und der blutrote Schatten – Der dritte Fall« »Vicky Bliss und der versunkene Schatz – Der vierte Fall« »Vicky Bliss und die Hand des Pharaos – Der fünfte Fall«
Ebenfalls bei dotbooks erscheint die Krimireihe um die abgebrühte Meisterdetektivin Jacqueline Kirby: »Der siebte Sünder: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 1« »Der letzte Maskenball: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 2« »Ein preisgekrönter Mord: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 3« »Ein todsicherer Bestseller: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 4«
Unter dem Pseudonym Barbara Michaels veröffentlichte sie bei dotbooks die folgenden Romantic-Suspense-Romane:»Das Geheimnis von Marshall Manor«»Die Villa der Schatten«»Das Geheimnis der Juwelenvilla«»Die Frauen von Maidenwood«»Das dunkle Herz der Villa«»Das Haus des Schweigens«»Das Geheimnis von Tregella Castle«»Die Töchter von King’s Island«
Sowie ihre historischen Liebesromane: »Abbey Manor – Gefangene der Liebe«»Wilde Manor – Im Sturm der Zeit«»Villa Tarconti – Lied der Leidenschaft«»Grayhaven Manor – Das Leuchten der Sehnsucht«
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2018
Dieses Buch erschien bereits 1998 unter dem Titel »Die Straße der fünf Monde« bei Econ.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1978 by Elizabeth Peters
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1978 unter dem Titel »Street of the Five Moons«.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 bei Econ Verlag GmbH, Düsseldorf und München
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Published by Arrangement with BARBARA G. MERTZ REVOCABLE TRUST
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock Evannovostro / faestock / StaniG / Kokorina Mariia / Luciano Mortila LGM / stockphoto mania
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-279-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Peters
Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Stefanie Mierswa
dotbooks.
Für Sara und Dave und all die anderen Davidsons in Liebe
Eins
I
Ich saß gerade am Schreibtisch und manikürte meine Fingernägel, als die Tür aufging und der Spion hereinschlich. Er trug einen dieser Trenchcoats mit allen möglichen Taschen, Paffen und Schulterklappen. Er hatte den Kragen so weit hochgeschlagen, daß er fast die Krempe des bis über die Augenbrauen heruntergezogenen Hutes berührte. Seine rechte Hand steckte in der gewölbten Manteltasche.
»Guten Morgen, Herr Professor«, begrüßte ich ihn. »Wie geht's?«
Obwohl ich Amerikanerin bin, weiß ich natürlich, daß wie geht's kein ordentliches Deutsch ist. Es wird nur gern von Amerikanern benutzt, so wie Chop Suey. Eigentlich ist mein Deutsch hervorragend, aber Herr Professor Doktor Schmidt fand es ganz amüsant, daß ich mich umgangssprachlich ausdrückte. Er hat sowieso eine merkwürdige Art von Humor. Schmidt ist mein Chef im Nationalmuseum, und wenn er alle Sinne beieinander hat, ist er einer der besten Mittelalterforscher überhaupt. Gelegentlich scheinen jedoch einige seiner Sinne auszusetzen. Er ist ein verhinderter Romantiker. In Wirklichkeit möchte er ein Musketier sein, mit Stiefeln und einem Schwert, das so lang ist wie er selbst, oder ein Pirat oder – wie in diesem Fall – ein Spion.
Er nahm schwungvoll den Hut ab und warf mir einen verschmitzten Blick zu. Wenn ich ihn so sehe, könnte ich mich kringeln vor Lachen. Sein Gesicht bringt einfach keinen anderen Ausdruck zustande als ein breites, gutmütiges Weihnachtsmanngrinsen. Er versucht immer, nur eine Augenbraue zu heben, hat aber die Muskeln nicht unter Kontrolle, so daß beide nach oben gehen. Dann zwinkert er mit seinen blauen Augen und spitzt den Mund wie ein Cherub.
»How goes it, babe?« fragte er mit einem Akzent, der so überdeutlich war wie Goethes, wenn er Englisch gesprochen hätte – was durchaus sein könnte, soweit ich weiß. Aber das ist nicht mein Gebiet. Mein Fachbereich ist Europa im Mittelalter, Nebenfach Kunstgeschichte. Darin bin ich ziemlich gut. Jetzt kann ich ja zugeben, daß ich den Job im Münchner Museum durch ein gewisses Maß an – na, sagen wir höflichem Drängen bekommen habe. Professor Schmidt und ich hatten uns kennengelernt, als er gerade unter dem Einfluß eines seiner Alter ego stand – ein welterfahrener, gebildeter Gauner wie Arsene Lupin. Wir suchten beide nach einem verschwundenen Kunstobjekt, und einige der Aktivitäten des guten Doktors in dieser Hinsicht wären seinen Wissenschaftler-Kollegen sicher nicht ganz lupenrein vorgekommen. Nein, erpreßt habe ich ihn nicht – zumindest nicht ganz –, und jetzt, da ich den Job schon fast ein Jahr ausübte, war Schmidt der erste, der zugab, daß ich mein Geld wert war. Er hatte noch nicht mal etwas dagegen, daß ich während der Bürozeit an meinem Roman arbeitete, solange ich dringende Angelegenheiten zuerst erledigte. Und seien wir ehrlich – in der mittelalterlichen Geschichte gibt es nur wenig Fälle, in denen ein Wettlauf mit der Zeit vonnöten ist.
Professor Schmidts Blick fiel auf den Stapel Manuskriptseiten zu meiner Rechten.
»Wie geht's mit dem Buch voran?« erkundigte er sich. »Konnte die Heldin aus dem Bordell flüchten?«
»Es ist kein Bordell«, erklärte ich zum fünften oder sechsten Mal. Schmidt ist irgendwie besessen von Bordells – von literarischen, versteht sich. »Es ist ein Harem. Ein türkischer Harem, in der Alhambra.«
»Die Alhambra war nicht in ...«
»Ich weiß, ich weiß. Aber der Leser wird es nicht wissen. Sie sind einfach zu sehr auf Authentizität bedacht, Herr Professor. Deshalb können Sie auch keinen Schundroman schreiben, so wie ich. Obwohl ich im Moment nicht weiterkomme. Es gibt einfach schon zu viele Trivialromane über Türken und Harems. Ich versuche, die Begierde an sich herauszustellen. Das ist gar nicht so leicht.«
Professor Schmidt dachte über dieses Problem nach. Seine Vorstellung von Begierde an sich interessierte mich nicht unbedingt, deshalb sagte ich schnell: »Aber ich zerstreue Sie, Herr Professor. Weshalb wollten Sie mich sprechen?«
»Ach ja.« Schmidt setzte wieder seinen verschmitzten Blick auf. Er zog die Hand aus der Tasche.
Natürlich kam kein Revolver zum Vorschein. Ich hatte auch keinen erwartet. Statt dessen rechnete ich mit einem Apfel oder einer Handvoll Bonbons. Schmidts Schmerbauch ist auf seine unheilbare Naschsucht zurückzuführen. Doch als ich sah, was er hervorzog und mit seinen Wurstfingern vorsichtig umklammerte, verschlug es mir den Atem.
Lassen Sie sich dadurch nicht in die Irre führen. Dies ist nicht eins dieser Bücher, in denen die Heldin ständig loskreischt, in Ohnmacht fällt oder den Atem anhält. Ich falle nicht so schnell in Ohnmacht, und es gibt nicht viel, was mich wirklich überrascht. Das liegt nicht am Alter (ich bin immer noch auf der richtigen Seite der Dreißig), aber meine unvorteilhaften körperlichen Eigenheiten haben mir so manche Erfahrung beschert.
Ganz ehrlich, ich meine es vollkommen ernst, wenn ich meine Figur als unvorteilhaft bezeichne. Ich bin zu groß, fast ein Meter achtzig. Außerdem habe ich von meinen skandinavischen Vorfahren einen kräftigen, kurvenreichen Körper geerbt, dazu dunkelblaue Augen und dichtes, blondes Haar. Ich habe kein Übergewicht, also ist besagter Körper an den angeblich richtigen Stellen schlank. Was mich betrifft, so sind es die falschen Stellen. All ihr häßlichen Entlein da draußen, faßt euch ein Herz – ihr seid besser dran, als ihr denkt. Wenn euch die Leute mögen, dann mögen sie das, was eigentlich von Bedeutung ist; das, was auch noch da ist, wenn sich Falten und der Speck der mittleren Jahre breitgemacht haben – eure Intelligenz, eure Persönlichkeit und euer Sinn für Humor. Wenn die Leute mich sehen, glauben sie, sie hätten ein 3D-Playmate vor sich. Niemand nimmt mich ernst. Als ich noch jünger war, wollte ich immer klein und niedlich sein. Inzwischen wäre ich gern flachbrüstig und kurzsichtig. Das würde mich weitaus weniger Nerven kosten.
Tut mir leid wegen dieser Tirade. Aber es ist nicht leicht, die Leute davon zu überzeugen, daß man etwas im Kopf hat, wenn sie nur Kurven und wallendes Haar wahrnehmen. Ebenso schwierig ist es für eine Frau wie mich, einen Job zu bekommen. Intellektuelle Frauen mißtrauen mir auf Anhieb. Intellektuelle Männer unterscheiden sich nicht von anderen Männern. Sie stellen mich zwar ein, aber mit den gleichen Hintergedanken. Deshalb war ich auch so begeistert, als ich Professor Schmidt traf. Der Gute ist wirklich so unschuldig, wie er aussieht. Er hält mich für blitzgescheit. Wenn er ein Meter fünfundneunzig groß und dreißig Jahre jünger wäre, würde ich ihn auf der Stelle heiraten.
So stand er da in seiner Spionverkleidung, streckte die Hand aus und strahlte mich an. Der Gegenstand auf seinem Handteller glitzerte und funkelte, als ob auch er lachte.
Es war ein sehr schöner Anhänger aus Gold, reich verziert mit filigranen Spiralen und Blattformen. Zwei winzig kleine kniende Frauen aus Gold trugen die stabile Öse, die einmal eine Kette gehalten hatte. Der schwere Goldrand war mit grünen, roten und perlweißen Steinen in Filigranrahmen besetzt. In der Mitte saß ein riesiger, azurblauer Stein, der so durchscheinend war wie Wasser in einem Kristalldoma. Dieser hatte einen Einschluß im Innern, der aussah wie ein kleines, grob herausgearbeitetes Kreuz.
Ein ungeschulter Betrachter hätte diese Steine für unregelmäßige, grobgeschliffene Glasklötze halten können. Aber zum Glück bin ich kein ungeschulter Betrachter.
»Der Talisman von Karl dem Großen«, stellte ich fest »Hey, Schmidt, alter Junge, legen Sie ihn lieber wieder zurück. Sie können sowieso nicht damit entkommen. Irgend jemand wird bemerken, daß er weg ist.«
»Sie glauben, ich habe ihn gestohlen?« Schmidts Grinsen wurde noch breiter. »Aber wie habe ich ihn aus dem Glaskasten nehmen können, ohne die Alarmanlage auszulösen?«
Das war eine gute Frage. Das Museum besitzt eine prachtvolle Sammlung antiker Schmuckstücke, die in einem extra dafür angefertigten Ausstellungsraum aufbewahrt wird – ein einziger riesiger Tresor. Er ist nachts verschlossen und wird am Tag ständig von drei Wärtern bewacht. Die Alarmanlage ist so feinfühlig, daß die Sirene schon schrillt, wenn man vor einem der Kästen nur zu heftig atmet. Obwohl Schmidt einer der Museumsdirektoren war, hatte weder er noch jemand anders die Befugnis, eins der historischen Schmuckstücke aus dem Ausstellungskasten zu nehmen, ohne von zwei anderen hohen Tieren des Museums und einer Armee von Sicherheitsleuten begleitet zu werden.
»Ich geb's auf«, sagte ich. »Ich habe keine Ahnung, wie Sie ihn herausbekommen haben, aber legen Sie ihn um Himmels willen zurück. Sie haben wegen Ihrer seltsamen Art von Humor schon öfter Schwierigkeiten bekommen, und wenn das jetzt rauskommt ...«
»No, no.« Er schüttelte reumütig den Kopf und wurde ernst, als er sah, daß ich mir wirklich Sorgen machte. »Ich habe ihn nicht aus dem Glaskasten genommen. Er stammt überhaupt nicht aus dem Museum. Er wurde gestern abend in der Jackentasche eines Toten gefunden, und zwar in einer Gasse in der Nähe des ›Alten Peter‹.«
Mein Gehirn war mit diesen neuen Informationen einige Sekunden lang beschäftigt.
»Dann ist dies nicht die echte Brosche«, stellte ich fest.
»But no. Wie könnte sie auch? Ich versichere Ihnen, daß uns ein Diebstahl des echten Talismans nicht entgangen wäre. Es ist eine Fälschung. Aber was für eine, dear Vicky!«
Ich nahm den Anhänger aus seiner Hand. Obwohl ich wußte, daß es sich nicht um den echten handelte, berührte ich ihn behutsam und achtungsvoll. Je genauer ich ihn untersuchte, desto mehr wuchs mein Erstaunen. Ich mußte Schmidt einfach glauben, daß dies nicht der echte Talisman war, aber er sah zweifellos gut aus, selbst für mein geschultes Auge.
Die Goldschmiedearbeit war hervorragend, jeder winzige Filigranfaden war mit meisterhaftem Geschick geformt und angebracht worden. Und was die Steine betraf; so hätte selbst ein Experte ohne die komplizierten Gerätschaften seines Metiers nicht mit Sicherheit sagen können, ob es sich um Fälschungen handelte. Der Originalanhänger stammt aus dem neunten Jahrhundert, als moderne Techniken der Edelsteinfacettierung noch lange nicht entwickelt waren. Die Rubine, Smaragde und Perlen auf dem Goldrand waren grob poliert und rundgeschliffen – »Cabochon« lautet der Fachausdruck. Die einzigen Edelsteine, die heute in diesem antiken Stil geschliffen werden, sind Sternrubine und Sternsaphire. Die gewölbte Form bringt die sternförmige Lichtbrechung im Innern gut zur Geltung. Der im Cabochon-Stil geschliffene Saphir in der Mitte dieses Anhängers schimmerte sanft, glühte jedoch nicht mit dem Feuer eines facettierten Steins. Ich wußte, daß ich nicht einen, sondern zwei Saphire vor mir hatte, die jeweils mit der Rückseite zueinander lagen, und daß der Einschluß in der Mitte kein »Stern« oder ein natürlicher Makel war, sondern ein Splitter des echten Kreuzes Christi, welcher das Schmuckstück zu einem äußerst kostbaren Reliquiar oder eben einem Talisman machte.
»Könnte mich echt täuschen«, sagte ich und legte den Anhänger auf meine Schreibtischkladde. »Kommen Sie schon, Schmidt, sagen Sie's mir. Wer war dieser Typ, in dessen Tasche der Anhänger gefunden wurde?«
»Ein Penner«, entgegnete Schmidt und winkte ab.
»Ein was?«
»Ein Penner, ein Landstreicher, ein Trinker«, wiederholte er ungeduldig.
»Ach so.«
»Er hatte kein Geld, keinen Ausweis und keinerlei Papiere bei sich. Nur das hier war in eine versteckte Tasche seines Anzugs eingenäht.«
»Wie ist er gestorben?«
»Nicht durch Gewalteinwirkung«, sagte Schmidt offensichtlich enttäuscht. »Er hatte keine Wunden. Vielleicht durch Gift oder Drogen, Heroin – horses sagt man wohl. Oder billigen Fusel, hooch, oder ...«
»Lassen Sie's gut sein«, unterbrach ich ihn. Wenn Schmidt erst mal zu spekulieren anfängt und dann auch noch vermeintliche amerikanische Slangausdrücke benutzt, ist er kaum noch zu stoppen. »Wirklich, Schmidt, das ist ja faszinierend. Ich nehme an, die Polizei hat Sie benachrichtigt. Woher wußten sie denn, daß dies eine Fälschung eines unserer Stücke ist?«
»Sie dachten, es sei unser Schmuckstück«, entgegnete Schmidt. »Sie sind schon kultiviert, unsere Polizisten. Einer von ihnen besucht häufig das Museum und hat das Stück wiedererkannt. Heute morgen mußte ich dann aufs Präsidium.«
»Sie haben bestimmt einen Schock bekommen, als Sie ihn gesehen haben«, sagte ich mitfühlend. »Mit Ihrem schwachem Herzen und so.«
Schmidt verdrehte dramatisch die Augen und faßte sich an die Brust.
»Das war ein schrecklicher Moment! Mir war natürlich klar, daß es nicht unser Anhänger sein konnte, aber war dieser hier nun der falsche oder derjenige in unserer Schatzkammer? Bis unsere Experten beide untersucht hatten, bin ich tausend Tode gestorben.«
»Ich könnte mich trotzdem davon täuschen lassen. Sind Sie sich ganz sicher?«
»Sagen Sie so was nicht, nicht mal im Scherz! Nein, dies hier ist die Fälschung. Aber was für eine! Das Gold ist echt. Die Steine sind nicht aus Glas, sondern aus modernem Kunststoff. Sie haben sicherlich von diesen imitierten Rubinen, Smaragden und Saphiren gehört? Einige sind solch exzellente Nachahmungen, daß man nur mit Hilfe ausgeklügeltster Instrumente feststellen kann, daß sie nicht echt sind. Und die Qualität dieses ...«
»Ich verstehe nicht, warum Sie so aufgeregt sind«, sagte ich, denn er tupfte sich den kahlen Kopf ab, und seine babyblauen Augen waren vor Kummer ganz klein. »Irgendein exzentrischer Sammler wollte anscheinend eine Nachbildung des Anhängers von Karl dem Großen. Eine gute Nachbildung, nicht einen dieser Abgüsse, die die Museen heutzutage verkaufen. Die Verwendung von echtem Gold ist vielleicht etwas sonderbar, aber der Rahmen ist hohl. Und ich glaube kaum, daß das benutzte Edelmetall mehr als ein paar hundert Dollar wert ist. Also was ist das Problem?«
»Und ich dachte, Sie würden es verstehen!« Schmidt starrte mich an. »Sie sind doch eine gescheite Frau. Aber Juwelen sind natürlich nicht Ihr Spezialgebiet. Solche Schwierigkeiten, solche Kosten auf sich zu nehmen, um ein Schmuckstück wie dieses zu kopieren ... Es gibt nur ein paar Goldschmiede auf der Welt, die zu einer solchen Arbeit fähig sind. Sie haben es nicht nötig, von Fälschungen zu leben. Sie ist ... zu billig und gleichzeitig zu kostspielig, diese Kopie. Verstehen Sie?«
Als er es mir so erklärte, verstand ich es. Ich nickte nachdenklich und schaute mir das entzückende Ding auf dem Schreibtisch genauer an.
Die meisten Frauen haben eine Schwäche für Juwelen. Der einzige Grund, weshalb Männer sie nicht haben, ist, weil es aus der Mode gekommen ist. In früheren Jahrhunderten trugen Männer ebensoviel Schmuck mit ebensoviel Eitelkeit wie Frauen. Ich konnte es nachvollziehen, wenn jemand eine Nachbildung des Talismans nur besitzen wollte, um sie als Schmuck zu verwenden. Ich selbst hätte auch gern eine getragen. Aber wer immer eine Kopie nur so zum Spaß wollte, würde sich nicht die Mühe machen, ein dermaßen teures Material zu verwenden, und auch nicht einem solch begabten Goldschmied die notwendige, extrem hohe Geldsumme bezahlen. Außerdem gab es da noch einen weiteren Punkt, den Schmidt gar nicht erwähnt hatte: Um das Schmuckstück mit einer solchen Präzision nachzubilden, müßte sich ein Designer jedes noch so kleine Detail des Originals genau ansehen. Niemand hatte bei der Museumsleitung um Erlaubnis gebeten, dies tun zu dürfen, ansonsten hätte Schmidt darüber Bescheid gewußt. Folglich mußte jemand viele Stunden damit zugebracht haben, Fotografien und Beschreibungen zu studieren, vielleicht sogar das Museum zu besuchen. Warum hätte er all dies heimlich tun sollen, wenn er einen ehrlichen Zweck verfolgte?
»Sie glauben, eine Gangsterbande plant einen Raub«, sagte ich. »Daß die echten Schmuckstücke durch Nachbildungen ersetzt werden sollen.«
»Diese Möglichkeit müssen wir in Betracht ziehen«, antwortete Schmidt. »Wir können ein solches Vorhaben nicht ausschließen.«
»Ja, natürlich. Sie haben recht. Ich habe schon Filme darüber gesehen ...«
»Das passiert leider nicht nur im Fernsehen«, sagte Schmidt düster und wischte sich mit dem Taschentuch über die Stirn. »Das Problem perfekter Fälschungen haben wir von jeher. Als die Menschen anfingen, schöne Dinge zu sammeln, zu Hause oder in Museen, begannen auch die Betrüger und Fälscher ihr schändliches Werk. Vicky, wir müssen die Sache klären. Wir müssen sicher sein. Wenn es eine harmlose Erklärung gibt – okay. Aber wenn nicht, dann ist für jedes Museum, für jeden Sammler auf der Welt ein solch geschickter Kunsthandwerker eine Gefahr. Mal angenommen, daß so ein Austausch durchgeführt wird. Dann brauchen wir möglicherweise Jahre, um herauszufinden, daß unser Objekt nicht das echte ist. Eine Kopie, die so gut ist wie diese, erfordert mehr als einen flüchtigen Blick.«
»Das stimmt.« Ich berührte den Saphir in der Mitte des Anhängers mit dem Finger. Er fühlte sich kühl und glatt an. Es fiel mir schwer zu glauben, daß dieses Ding nicht echt war. »Was werden wir also unternehmen?«
»Nicht wir. Sie.« Schmidts rosiges Gesicht drückte wieder seine übliche gute Laune aus. »Die Polizei hat natürlich schon die Ermittlungen aufgenommen. Aber sie sind in einem dead stop gelandet – heißt das ›Sackgasse‹ auf englisch?«
»Sie meinen dead end.«
»Ach so, jaja. Der Tote, bei dem der Anhänger gefunden wurde, ist nicht identifiziert. Seine Beschreibung und seine Fingerabdrücke sind Interpol nicht bekannt. Unsere Polizei ist wirklich großartig, aber ihr Handlungsspielraum ist begrenzt. Also wende ich mich an die Lady, deren Fachkenntnis und Phantasie dem großen englischen Sherlock Holmes gleichkommen. Ich wende mich an meine Vicky! Finden Sie diesen Mann für mich, diesen unbekannten Schöpfer herrlicher Nachbildungen. Sie haben so etwas schließlich schon mal gemacht.«
Seine blauen Augen glühten wie der Cabochon-Stein in dem Talisman.
Bescheidenheit gehört nicht unbedingt zu meinen Tugenden, aber diese naive Bitte machte mich untypischerweise verlegen. Sicher, ich hatte schon einmal mäßigen Erfolg als eine Art geschichtsbewanderter Detektiv gehabt, allerdings nur deshalb, weil die Lösung des Falles von einem gewissen Maß an Spezialwissen abhing, welches ich zufällig besaß. Ich bin Historikerin, keine Kriminologin, und wenn es sich hierbei um einen Fall von Kunstfälschung im großen Stil handelte, wären die Fähigkeiten der letztgenannten wahrscheinlich hilfreicher als die der ersten.
Na ja ... Wieder wurde mein Blick auf den riesigen, mattblau schimmernden Saphir gelenkt. Eine Fälschung? Er sah so erschreckend echt aus. Dieser Stein hatte etwas Hypnotisches an sich, ebenso die Bitte, die Schmidt an mich gerichtet hatte. Meine Arbeit im Museum war zwar angenehm, aber ziemlich langweilig. Selbst mit meinem pornographischen Roman kam ich nicht von der Stelle. Und wir hatten Mai, den Monat, in dem Gefühle meistens die Vernunft besiegen.
»Nun«, sagte ich. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und legte die Fingerkuppen aneinander. (An welchen literarischen Detektiv erinnerte mich diese Geste? An Sherlock Holmes? Schmidt stellte einen prima Watson dar.) »Nun, Wat... äh, ich meine Schmidt, ich bin geneigt, diesen Fall zu übernehmen.«
II
Der Polizeibeamte ähnelte Eric von Stroheim, den ich in der »Late, Late Show« zu Hause in Cleveland gesehen hatte, nur trug er kein Monokel. Wahrscheinlich sind sie aus der Mode. Immerhin küßte er meine Hand. Ich lasse mir gerne die Hand küssen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum amerikanische Männer das nicht auch tun, denn damit kann man selbst Feministinnen wie mich für sich einnehmen.
Ich hatte nicht erwartet, daß man mir die Hand küßt, dafür aber etwas mehr Interesse. Normalerweise stehen die Leute ja auf Blondinen. Ich trug einen engen Pullover und einen Rock, dazu das Haar lose über die Schultern. Es war mir egal, was Herr Feder über meine Intelligenz dachte, ich wollte nur soviel Information wie möglich aus ihm herausbekommen.
Allerdings konnte er mir nicht viel sagen. Die üblichen Ermittlungen hatten nichts ergeben. Der Tote war der Polizei einfach nicht bekannt.
»Das muß nicht bedeuten, daß er kein Krimineller ist«, erklärte Feder und rieb an seinen dichten, grauen Augenbrauen. »Es bedeutet nur, daß er uns oder Interpol nicht bekannt ist. Er könnte auch in irgendeinem anderen Land schon einmal verhaftet worden sein.«
»Haben Sie es in den Staaten versucht?« fragte ich, lehnte mich in meinem Stuhl zurück und holte tief Luft.
»Wie bitte?« Feders Blick richtete sich nur zögernd wieder auf mein Gesicht. »Ach – verzeihen Sie, Fräulein Doktor ... Nein, das haben wir nicht. Schließlich hat der Mann kein Verbrechen begangen – außer zu sterben.«
»Die Museumsleitung ist ziemlich besorgt.«
»Ja, ich weiß. Und dennoch, Fräulein Doktor, gibt es wirklich einen Anlaß zu einem konkreten Verdacht? Wie alle Polizeidienststellen heutzutage sind auch wir hoffnungslos überlastet. Wir haben genug damit zu tun, Verbrechen aufzuklären, die wirklich begangen wurden. Wieso sollten wir Zeit und Geld in eine vage Theorie investieren? Wenn das Museum auf eigene Faust recherchieren möchte, garantieren wir unsere vollste Unterstützung, aber ich sehe nicht ganz ... das heißt, ich möchte keinesfalls Ihre Urteilskraft anzweifeln, Fräulein Doktor, aber ...«
»Oh, ich habe nicht vor, irgendwelche Verbrecher in dunklen Gassen zu verfolgen«, entgegnete ich. Bei dieser Vorstellung mußten wir beide herzlich lachen. Herr Feder hatte große, weiße, gleichmäßige Zähne. »Aber«, fuhr ich fort, »der Fall hat mich neugierig gemacht. Ich wollte sowieso gerade Urlaub nehmen, und Herr Professor Schmidt meinte, ich könnte einigen Hinweisen in eigener Sache nachgehen. Vielleicht kann ich ja etwas herausfinden. Ob ich wohl ... ich würde mir gern die Leiche ansehen.«
Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee kam. Ich bin zwar nicht zimperlich, aber auch nicht gerade ein Fan von Leichen. Mir fiel nur einfach nichts Besseres ein. Ich hatte keinen anderen Hinweis.
Als ich in dem weißen, sauberen, sterilen Raum des Münchner Leichenschauhauses stand, bereute ich meinen forschen Vorschlag schon wieder. Es war der Geruch, der mir zusetzte: der Gestank von Karbolsäure, der einen anderen, intensiveren Geruch nicht völlig übertünchte. Als das Laken aufgedeckt wurde und ich in das starre, leblose Gesicht blickte, fühlte ich mich nicht allzu gut. Wahrscheinlich erinnerte es mich an meine eigene Sterblichkeit. Ansonsten hatte das Gesicht nichts Grausiges an sich.
Der Mann war mittleren Alters gewesen, obgleich die Gesichtszüge nun durch den Tod weicher und weniger ausgeprägt schienen. Er hatte buschige, schwarze Augenbrauen und dichtes, graumeliertes, schwarzes Haar. Er war braungebrannt oder von Natur aus dunkelhäutig. Seine Lippen wirkten ungewöhnlich groß und voll. Die Augen waren geschlossen.
»Danke«, murmelte ich und wandte mich ab.
Auf dem Weg zu seinem Büro bot Feder mir ein Glas Brandy an. So aufgewühlt hatte mich der Anblick zwar nicht, aber ich wollte nicht seinen Glauben an die Zartheit des schwachen Geschlechts erschüttern. Außerdem mag ich Brandy.
»Er sieht aus wie ein Latino«, bemerkte ich und nippte an meinem Glas. Kein schlechtes Zeug.
»Ja, Sie haben recht.« Feder lehnte sich zurück und balancierte das Glas zwischen seinen überraschend grazilen Fingern. »Vielleicht ein Spanier oder Italiener. Schade, daß wir ihn nicht identifizieren konnten.«
»Das scheint doch verdächtig zu sein.«
»Nicht unbedingt. Der Mann lag schon seit Stunden in dieser Gasse, wer weiß, wie lang. Möglich, daß ihn irgendein Gelegenheitsdieb ausgeraubt hat. Falls er eine Brieftasche oder einen Geldbeutel bei sich trug, hat sie jemand des Geldes wegen gestohlen. Die Papiere hätte er natürlich in dieser Brieftasche aufbewahrt. Und ein gültiger Personalausweis kommt den Kriminellen immer gelegen.«
»Ja, natürlich«, stimmte ich zu. »Ein Dieb hätte das Schmuckstück übersehen, da es in seine Kleidung eingenäht war.«
»Das nehmen wir an. Er hatte noch ein paar Kleinigkeiten in den Taschen; Dinge, mit denen sich ein Dieb nicht aufhalten würde. Ein Taschentuch, Schlüssel ...«
»Schlüssel? Schlüssel zu was?«
Feder zuckte demonstrativ mit den Schultern.
»Woher sollen wir das wissen, Fräulein Doktor? Es waren keine Autoschlüssel. Wenn er eine Wohnung hat, Gott weiß, wo sie ist. Wir haben bei den Hotels der Stadt nachgeforscht, allerdings ohne Erfolg. Möglicherweise ist er aber auch erst gestern in München angekommen und hat sich noch kein Hotelzimmer genommen. Möchten Sie den Inhalt seiner Taschen sehen?«
»Das sollte ich wohl«, antwortete ich mißmutig.
Nicht, daß ich mir etwas davon versprach. Ich wollte nur keinen möglichen Anhaltspunkt übersehen. Ich konnte schließlich nicht wissen, daß sich in dieser armseligen Sammlung der entscheidende Hinweis verbarg.
Es war ein zusammengefaltetes Stückchen Papier. Es gab noch einige weitere Schnipsel, Quittungen irgendwelcher Geschäfte über kleinere Summen, keine über zehn Mark. Aber dieser spezielle Papierfetzen war keine Quittung, sondern eine Seite, die aus einem billigen Notizbuch herausgerissen worden war. Darauf stand die Zahl Siebenunddreißig – die Sieben mit dem Querstrich, den Europäer benutzen, um sie von der Eins zu unterscheiden – sowie ein paar seltsame Zeichen, die abgeschnittenen Fingernägeln ähnelten. Sie sahen aus wie folgt:
Ich saß da und starrte diese geheimnisvollen Hieroglyphen an, bis Herrn Feders Stimme meine fruchtlosen Überlegungen unterbrach.
»Eine Art Puzzle«, stellte er beiläufig fest. »Ich sehe keinen Sinn darin. Außerdem gibt es verschlüsselte Botschaften doch nur in Kriminalromanen, oder etwa nicht?«
»Wie wahr, wie wahr«, sagte ich.
Herr Feder lachte. »Vielleicht ist es die Adresse seiner Maniküre.«
»Waren seine Fingernägel manikürt?« fragte ich eifrig.
»Aber nein, ganz und gar nicht.« Herr Feder sah mich vorwurfsvoll an. »Ich habe mir nur einen kleinen Scherz erlaubt, Fräulein Doktor.«
»Oh.« Ich kicherte. »Die Adresse seiner Maniküre ... Sehr geistreich, Herr Feder.«
Ich hätte ihn nicht ermutigen sollen. Er lud mich zum Abendessen ein und – als ich sagte, ich sei zu beschäftigt – zum Mittagessen am nächsten Tag. Also erzählte ich ihm, ich würde die Stadt verlassen. Normalerweise gehe ich mit solchen Angelegenheiten etwas subtiler um, aber ich wollte ihn nicht vollends entmutigen. Wer weiß, vielleicht konnte ich seine Hilfe noch brauchen, wenn der Fall eine überraschende Wendung nehmen würde. Obwohl zu diesem Zeitpunkt von einem Fall gar keine Rede sein konnte, geschweige denn von einer Wendung.
Es war ein wundervoller Frühlingstag, etwas kühl, aber der Himmel war blau und klar, mit dicken, weißen Wolken, die die Form der Zwiebelkuppeln der Frauenkirche nachahmten. Ich hätte wieder an die Arbeit gehen sollen – ich mußte ein paar Kleinigkeiten regeln, falls ich wirklich Sherlock Holmes spielen sollte –, aber was hatte es für einen Sinn, etwas zu regeln, wenn ich nicht wußte, wohin ich mich wenden sollte. Und ich konnte Professor Schmidt nicht unter die Augen treten. Er erwartete sicher, daß ich nach meinem Besuch bei der Polizei alle möglichen tollen Spuren verfolgte.
Ich spazierte in Richtung ›Alter Peter‹ und lief eine Zeitlang in den angrenzenden Straßen herum. Eigentlich war es reine Zeitverschwendung. Ich wußte nicht, in welcher der schmalen Gassen in der Umgebung die Leiche gefunden worden war. Und selbst wenn, was hätte es gebracht, mir die leere Stelle anzusehen? Die Polizei hatte die Gegend vermutlich gründlich untersucht.
Ich ging über den Viktualienmarkt und sah mir die Buden mit frischem Obst und Gemüse und die wundervollen Blumenstände an. An diesem Morgen gab es eine farbenprächtige Palette bunter Frühlingsblumen – gelbe Narzissensträuße und eine Fülle von Flieder und Hyazinthen in Rosa und sattem Blau verströmten einen süßlichen Duft. Schließlich gelangte ich in die Kaufingerstraße, eine meiner Lieblingsstraßen, weil ich so gerne Schaufensterbummel mache. Dabei gibt man wenigstens kein Geld aus. Ich betrachtete interessiert die Auslagen, doch beim Weitergehen fiel mein Blick auf etwas auf der anderen Straßenseite.
Es war nur ein Reklameschild für die Lufthansa. »Rom!« stand da über einem riesigen Foto der Spanischen Treppe, die von Körben mit rosafarbenen und weißen Azaleen gesäumt war. »Rom sehen und leben! Sechs Flüge jeden Tag.«
Alle Puzzleteile fügten sich plötzlich zusammen, so wie es manchmal geschieht, wenn man sie eine Weile liegenläßt. Die dunkle Gesichtsfarbe und das südländische Aussehen des Toten; Herr Feders nicht ernst gemeinter Vorschlag, daß die geheime Botschaft eine Adresse bezeichnen könnte; all die Antiquitäten, Kostbarkeiten und Juwelen, die die ganze Angelegenheit so bedeutsam machten.
Ich hatte schon daran gedacht, meinen Urlaub in Rom zu verbringen, und mich gefragt, woher ich das Geld nehmen sollte. Es gab eine ganz bestimmte Gegend, die ich in aller Ruhe erkunden wollte – in der Nähe des Tiber, wo Berninis windumwehte Engel die Brücke bewachen, die zur Engelsburg führt. Eine Gegend mit engen, gewundenen Gäßchen und hohen, bedrohlich wirkenden Häusern. Die Via dei Coronari ist das Paradies der Antiquitätenliebhaber. Und nicht weit entfernt von der Via dei Coronari befindet sich eine Straße mit dem Namen Via delle Cinque Lune – die Straße der fünf Monde.
Es war nur so ein Gefühl. Ich konnte es noch nicht einmal eine Theorie nennen. Aber die fünf gekrümmten Zeichen könnten tatsächlich Mondsicheln darstellen; und sicherlich war es mehr als ein Zufall, daß ausgerechnet dieser Teil von Rom auf Antiquitäten besonders kostbarer Art spezialisiert war.
Auf jeden Fall konnte es nicht schaden, sich die Nummer 37 der Via delle Cinque Lune mal anzuschauen. Ich drehte mich um, ging zum Museum zurück und plante einen kleinen Diebstahl.
Wenn ich mich anstrenge, kann ich eine ganz gute Rednerin sein. Wobei Professor Schmidt allerdings auch ungewöhnlich gutgläubig ist. Manchmal mache ich mir wirklich Sorgen um ihn. Zum Glück ist er bei anderen Leuten vorsichtiger als bei mir. Er hielt meine Interpretation der geheimnisvollen Zeichen für absolut spitze. »Aber natürlich«, rief er aus, nachdem ich es ihm erklärt hatte. »Genau das ist es! Was könnte es sonst bedeuten?«
Na ja, ich konnte mir ein Dutzend anderer Möglichkeiten vorstellen. Komisch, daß Schmidt, der in seinem eigenen Fachgebiet so ein messerscharfer Analytiker ist, nicht den Unterschied zwischen einer Tatsache und einer vagen Theorie erkennen kann, sobald es um etwas anderes als mittelalterliche Geschichte geht. Aber vermutlich sind viele Experten so. Der Himmel weiß, daß sie ebenso oft auf Spiritisten und Hochstapler hereinfallen wie Leute mit weniger Verstand.
Also bekam ich ab sofort Urlaub und dazu ein nettes kleines Spesenkonto. Ich hatte keine Ahnung, wie Schmidt diese Ausgaben vor seinen Kollegen rechtfertigen wollte, aber das war schließlich nicht mein Problem. Ich löste den Scheck ein, den er mir gab, rief am Flughafen an, buchte einen Flug und eilte dann nach Hause, um zu packen. Mein Reisepaß war in Ordnung, also mußte ich mir nur noch überlegen, wo ich in Rom wohnen wollte.
Ich brauchte nicht lange zu überlegen. Leute, die eine Spesenabrechnung machen, übernachten nicht in Pensionen oder Jugendherbergen. Das sah nicht gut aus. Ich hielt es für meine Pflicht gegenüber meinem Arbeitgeber, ein Zimmer im teuersten Hotel der Stadt zu buchen.
III
Vielleicht gibt es schönere Städte als Rom an einem strahlenden Maimorgen, aber ich glaube nicht, daß sie mich jemals so faszinieren werden. Die Spanische Treppe sah aus wie auf dem Werbeplakat in München; die unzähligen Blumen an den Seiten wirkten wie ein rosa-weißer Wasserfall. Die Touristen verdarben den Anblick natürlich ein wenig – der Künstler hatte sie auf dem Plakat wohlweislich weggelassen –, aber mich störten sie nicht. Sie verliehen der Szene eine Art unbekümmerte Respektlosigkeit, die so typisch ist für Rom. »Eklektisch« ist der passende Ausdruck für diese Stadt. Von jedem ist ein bißchen da: üppig-verschwenderische, barocke Springbrunnen neben reliefverzierten Säulen aus der Kaiserzeit; ein modernes Stadion mit lauter Stahlträgern und Beton neben einer gewundenen, dunklen Straße, in der sich Raffael sicher zu Hause gefühlt hätte. Wie ein weites, grünes Band zwischen all dem wirken die Bäume und Pflanzen: Schirmtannen und Zypressen, Palmen, Stechpalmen und Oleander; lachsfarbene Geranien und blaue Bleiwurz, die Balkone und Dachterrassen schmücken.
Zum Mittagessen war es noch zu früh, deshalb ließ ich mich in einem Straßencafé nieder, bestellte Campari mit Soda und beobachtete die vorbeiziehenden Menschenmengen.
Ich saß gerade eine Minute, als sich ein gutaussehender junger Mann zu mir setzte, mich anlächelte wie ein Engel von Fra Angelico und mir ein äußerst unanständiges Angebot auf italienisch machte.
Ich lächelte zurück und machte ein ebenso unanständiges Angebot in gleichfalls fließendem Italienisch, allerdings mit einer besseren Aussprache. (Der römische Akzent klingt grauenhaft; die übrigen Italiener machen sich häufig darüber lustig.)
Der Gesichtsausdruck des Jungen wirkte absolut grotesk. Er hatte damit gerechnet, daß ich nur sein zuckersüßes Lächeln verstehen würde. Ich erklärte ihm, daß ich auf meinen Freund wartete, der ein Meter achtundneunzig groß und ein Profifußballer sei.
Der Junge verschwand. Ich schlug meinen Reiseführer auf und gab vor zu lesen. In Wirklichkeit sah ich mir den Stadtplan an und dachte über mein weiteres Vorgehen nach.
In Süditalien sind die Geschäfte zwischen zwölf Uhr mittags und vier Uhr nachmittags geschlossen. Dann öffnen sie wieder und haben auf bis abends um sieben oder acht. Während dieser süßen Abendstunden, wenn die Hitze des Tages langsam schwindet und die Schatten länger werden, sind die Straßen voller Menschen. Ich hatte noch genügend Zeit, mir die Via delle Cinque Lune und vor allem die Nummer 37 auf subtile, unauffällige Weise anzusehen.
Während ich meinen Weg fortsetzte, fiel mir ein, daß ein bestimmter Aspekt dieses Plans nicht so einfach sein würde, wie ich es mir vorgestellt hatte. Genaugenommen bin ich nämlich nicht unauffällig. Vor allem bin ich einen halben Kopf größer als die meisten – männlichen und weiblichen – Römer; aus dieser Masse kleiner, dunkler Menschen ragte ich heraus wie ein wandelnder Obelisk. Mir wurde mehr und mehr bewußt, daß ich irgendeine Verkleidung brauchte.
Ich empfand mich als noch auffälliger, nachdem ich die Via del Corso überquert hatte und in das wirre Netz kleiner Gäßchen um das Pantheon und die Piazza Navona herum eingetaucht war. Hier gibt es keine Bürgersteige, außer auf den großen Hauptverkehrsstraßen und Corsos. Die Häuserfassaden reichen bis ans Straßenpflaster, das an einigen Stellen so schmal ist, daß die Fußgänger sich flach gegen eine Häuserwand drücken müssen, um einen Fiat vorbeizulassen. Auf jeder noch so winzigen Piazza finden sich ein oder zwei Cafés, deren Tische und Stühle nur unzulänglich durch große Topfpflanzen vom Verkehr geschützt werden.
Ich schlenderte die Via dei Coronari entlang und spähte in die Schaufenster. Man konnte die ausgestellten Waren nicht besonders gut erkennen, denn es waren keine hellerleuchteten Spiegelglasfenster wie in amerikanischen Geschäften. Doch die dunklen, staubigen Innenräume dieser Läden hielten so manchen Schatz bereit. Eine wurmstichige, aber auf seltsame Art betörende Heiligenfigur aus Holz, die wohl aus einer ausgeplünderten Kirche stammte und größer war als ein Mensch; zwei riesige Armleuchter aus vergoldetem Silber; Meißner Porzellan; körperlose, vergoldete Barockcherubinen; ein trübes, rissiges Triptychon mit Szenen aus dem Leben irgendeiner jungfräulichen Heiligen ...
Wenn ich nicht danach gesucht hätte, wäre ich an der Via delle Cinque Lune vorbeigelaufen. In diesen Durchgang hätte selbst ein Fiat nur zusammengequetscht hineingepaßt, doch die Läden zur Rechten und zur Linken sahen noch dunkler und teurer aus als die auf der Via dei Coronari. In einem der Schaufenster entdeckte ich ein besticktes chinesisches Festgewand, das ich mir genauer ansah. Ein verborgenes Licht brachte die schimmernden Goldfäden zur Geltung, die die Formen bernsteinfarbener und zitronengelber Chrysanthemen und eines blaugrünen Pfauenschwanzes beschrieben. Es muß die Robe eines hohen Beamten gewesen sein. Ich hatte mal eine, die nicht annähernd so schön war wie diese, im Victoria and Albert Museum in London gesehen.
Die Hausnummer über der Ladentür war 37.
Ich ging langsam weiter, blickte in andere Schaufenster und war unsinnigerweise zufrieden mit mir selbst. Die Nummer 37 entpuppte sich tatsächlich als Antiquitätengeschäft. Dies war zwar nur eine schwache Bestätigung meiner diffusen Theorie, aber im Moment war ich für jede Ermutigung dankbar.
Die Straße machte einen Bogen und mündete in einen ebenso schmalen Durchgang, der Via della Stellata hieß. Am anderen Ende dieser zweiten Straße konnte ich ein Fünkchen Sonnenlicht und ein Stück eines Springbrunnens erkennen. Es war Berninis »Vier-Ströme-Brunnen« auf der Piazza Navona.
Ich lese eher selten Kriminalromane. Als leichte Lektüre ziehe ich schlechte historische Romane mit sinnlichen Heldinnen und verwegenen Helden vor, in denen haufenweise Säbelkämpfe und Verführungen vorkommen. Aber in einigen der Krimis, die ich gelesen hatte, brachen die Helden – und die Bösewichte – oft irgendwo ein. Meistens stürmten sie den Hintereingang über eine schmale Gasse, die praktischerweise genau hinter dem Haus lag, das sie durchsuchen wollten.
Hinter der Via delle Cinque Lune gab es keine solche Gasse.
Die Straße stellte noch nicht einmal eine Seite eines Vierecks dar. Wie schon erwähnt, machte sie einen Bogen. Vielleicht hatte der Laden nur einen Eingang. Wenn man sich den Müll anschaute, der neben der Tür aufgehäuft war, so schien diese Annahme sehr wahrscheinlich.
Ich kehrte um und spazierte die Straße der fünf Monde noch einmal entlang. Diesmal blieb ich nicht stehen, um mir die Mandarinenrobe anzusehen, sondern lenkte meine Aufmerksamkeit auf das Haus. In dezenten, schwarzen Buchstaben war ein Name über die Tür gemalt worden: A. Fergamo. Er sagte mir nichts. Aber ich sah noch etwas anderes, das ich vorher nicht bemerkt hatte – eine spaltförmige Öffnung auf der einen Seite des Hauses, die so schmal war, daß die Sonne die Finsternis darin nicht durchdringen konnte.
Auf dem Weg zurück zum Hotel erledigte ich verschiedene Einkäufe. Ich nahm alles mit auf mein Zimmer und machte mich frisch. Dann setzte ich mich in den Speisesaal und bestellte die Spezialität des Hauses und eine Flasche Frascati. Alles ging auf Professor Schmidt. Also brachte ich einen Toast auf ihn aus, während ich meinen Wein trank.
Ich verließ das Hotel gegen zehn. Zum Einbrechen war es noch zu früh, aber ich wollte nicht länger warten, um keine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Selbst in Rom gehen brave Mädchen um zwei Uhr nachts nicht allein aus. Die Straßen waren noch immer voller Menschen. Sie schienen alle paarweise unterwegs zu sein, wie siamesische Zwillinge, selbst die Touristen mittleren Alters. Die älteren Damen Arm in Arm mit ihren dickbäuchigen, kahl werdenden Begleitern sahen wirklich reizend aus. Rom an einem Frühlingsabend ... Ich mußte mir ins Gedächtnis zurückrufen, daß ich mich wegen wichtigerer Angelegenheiten hier aufhielt.
Ich verschwand im ersten dunklen Hauseingang und legte meine Tarnung an. Sie war nicht besonders ausgeklügelt, nur ein dunkler Regenmantel, eine Sonnenbrille und ein marineblaues Tuch, das ich fest um mein Haar band. Dazu trug ich Turnschuhe und eine braune Freizeithose. Mehr brauchte ich nicht – nur noch einen gebeugten, schlurfenden Gang und einen mürrischen Blick mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Jetzt belästigte mich niemand mehr.
Fast drei Stunden lang durchstreifte ich die Straßen von Rom. Während ich so umherlief, gingen langsam die Lichter aus. Ladentüren wurden verschlossen, Jalousien herabgelassen. Als es von den unzähligen Kirchtürmen Mitternacht schlug, befand ich mich gerade auf dem Lungotevere Sangello, einem der breiten Boulevards, die dem kurvenreichen Lauf des Tibers folgen. Ich stand lange am Fluß, die Ellbogen auf die steinerne Brüstung gelehnt, und schaute hinab in die dunklen Wellen, in denen sich die Umrisse des Petersdoms und der Engelsburg spiegelten. Die Laternen der Via della Conciliazione führten kerzengerade auf die kreisrunde Piazza vor der Peterskirche zu, und der riesige Dom verdeckte ein rundes Stück Himmel.
Rom ist eine pulsierende Stadt. Hier werden nicht um Mitternacht die Bürgersteige hochgeklappt. Aber in einigen Gegenden herrscht mehr Treiben als in anderen, und das Antiquitätenviertel war schon um zehn Uhr ruhig. Als ich mich endlich von dem bezaubernden Blick losriß, waren die meisten Straßen verlassen.
Gut, daß ich diesen Teil der Stadt bereits bei Tag besucht hatte, sonst hätte ich den Weg kaum wiedergefunden. Nachdem ich die belebten Boulevards am Tiber verlassen hatte, fühlte ich mich wie in einer anderen Welt. Dieser Teil Roms hat sich äußerlich seit Jahrhunderten nicht verändert, und Straßenlaternen gibt es hier auch nicht. Ich hatte eine Taschenlampe bei meinen Einkäufen am Nachmittag erstanden, wollte sie aber nicht benutzen.