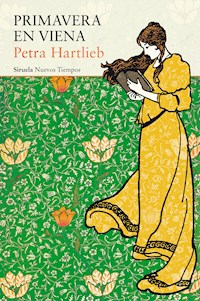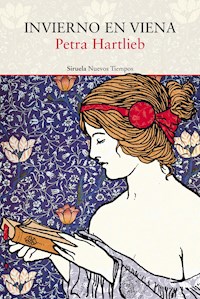9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Buchhandlung, ein berühmter Dichter und ein verschneiter Wiener Winter Ein junger Mann hatte von innen die Ladentür geöffnet und reichte Marie die Hand. Sie fasste sie, ohne darüber nachzudenken, und trat in das Buchgeschäft. «Ich möchte gern ein Buch abholen, bitt schön», sagte sie. «Äh, wie bitte?» Er starrte sie mit großen Augen an. «Ein Buch. Hier gibt es doch Bücher, oder?» «Entschuldigen Sie, gnädiges Fräulein. Sie … haben mich nur gerade stark an jemanden erinnert … Wie ist denn der Name?» «Marie Haidinger.» Der Mann drehte sich um und bückte sich. «Ich habe keine Bestellung unter diesem Namen, es tut mir leid.» Er tauchte wieder am Tresen auf. «Nein, ich habe auch nichts bestellt, ich hole nur etwas ab. Es ist für den Herrn Doktor, ich meine, den Herrn Doktor Arthur Schnitzler. Ich bin das neue Kindermädchen.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Petra Hartlieb
Ein Winter in Wien
Über dieses Buch
Eine Buchhandlung, ein berühmter Dichter und ein verschneiter Wiener Winter
Ein junger Mann hatte von innen die Ladentür geöffnet und reichte Marie die Hand. Sie fasste sie, ohne darüber nachzudenken, und trat in das Buchgeschäft.
«Ich möchte gern ein Buch abholen, bitt schön», sagte sie.
«Äh, wie bitte?» Er starrte sie mit großen Augen an.
«Ein Buch. Hier gibt es doch Bücher, oder?»
«Entschuldigen Sie, gnädiges Fräulein. Sie … haben mich nur gerade stark an jemanden erinnert … Wie ist denn der Name?»
«Marie Haidinger.»
Der Mann drehte sich um und bückte sich. «Ich habe keine Bestellung unter diesem Namen, es tut mir leid.» Er tauchte wieder am Tresen auf.
«Nein, ich habe auch nichts bestellt, ich hole nur etwas ab. Es ist für den Herrn Doktor, ich meine, den Herrn Doktor Arthur Schnitzler. Ich bin das neue Kindermädchen.»
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Die Zeilen auf S. 38/39 stammen aus: Arthur Schnitzler, Das weite Land, 3. Akt
Das Gedicht auf S. 61 ist entnommen aus: Rainer Maria Rilke, Mir zur Feier. Gedichte. Georg Heinrich Meyer Verlag, Berlin 1899
Einbandgestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Einbandabbildung bomg/shutterstock.com
ISBN 978-3-644-31551-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Emma, Jan und Oliver und meine Oma Johanna Haidinger.
Es hatte die ganze Nacht geschneit. Dicke Flocken, ununterbrochen. Als Maries Wecker klingelte, war es dunkel, doch die Dunkelheit war anders als sonst, irgendwie gedämpfter, weicher. Kein Geräusch war zu hören. In ihrer kleinen Kammer war es kalt und klamm, und sie beschloss, noch fünf Minuten unter dem warmen Federbett liegen zu bleiben.
Fast war sie wieder eingenickt, da hörte sie Lili im Nebenzimmer vor sich hin plappern. Rasch sprang Marie aus dem Bett, zog ihren dünnen Morgenmantel über und trat ins Kinderzimmer. Lili stand in ihrem Bettchen, ihr Gesicht strahlte, als sie Marie sah, und sie streckte ihr die dicken Ärmchen entgegen. Marie hob sie rasch hoch, die Kleine drückte sich an sie. «Pst, sei schön still. Vater und Mutter schlafen noch und der Heini auch.»
Marie nahm das Kind mit in ihre Kammer, setzte es auf ihr schmales, hartes Bett und stopfte die Decke rundum fest. Dann erst begann sie, sich anzukleiden. Das machten sie jeden Morgen so, es war ein kleines Ritual zwischen ihnen, und die Zweijährige liebte es anscheinend. Ganz still saß Lili auf dem Bett und beobachtete mit großen Augen, wie Marie das Nachthemd auszog, in die Unterwäsche schlüpfte – wobei sie selbstverständlich dem Kind den Rücken zuwandte –, Wollstrümpfe am Strumpfgürtel befestigte, schließlich ihr einziges warmes Kleid anzog und darüber die Schürze band.
Als sie runterkamen, brannte der Kamin schon, und warme Milch stand auf dem Herd. Marie setzte das Kind ins Laufställchen und drückte ihm die Flasche in die Hand.
«Bleib schön da, ich weck den Heini.»
Marie hörte Lilis Schmatzen bis in den ersten Stock. «Ja, wo ist denn mein kleiner Schatz, hast du deine Milch schon? Schön trinken!» Anna, die Köchin, war ins Wohnzimmer gekommen und plapperte mit Lili.
In Heinrichs Zimmer war es noch dunkel. Marie knipste die Lampe auf dem Schreibpult an und betrachtete kurz die Eisblumen am Fenster. Der Junge lag zusammengerollt unter der Decke, lediglich sein brauner Haarschopf ragte heraus. Das Bett würde bald zu klein für ihn sein. Marie berührte ihn kurz an der Schulter, der Bub grunzte nur.
«Heini! Aufwachen. Du musst aufstehen, in die Schule gehen. Und schau mal, es hat geschneit!»
«Wirklich? Lass sehen!»
Heinrich sprang aus dem Bett, beinahe hätte er Marie umgerannt. Seit Wochen wartete der Junge sehnsüchtig auf den Wintereinbruch, immer wieder strich er um den Schlitten, den er im Sommer zu seinem neunten Geburtstag bekommen hatte. Und nun schneite es endlich, wie durch ein Wunder. Am Tag zuvor war Heini gegen halb acht schlafen gegangen, hatte sich artig von seinen Eltern verabschiedet, Hände und Gesicht gewaschen und sich von Marie die Decke feststecken lassen. Zehn Minuten wollte er noch in seinem Indianerroman lesen, doch als Marie kurz darauf ins Zimmer trat, war er schon eingeschlafen. Dann erst hatte es zu schneien begonnen.
Heinrich rannte zum Fenster, stieß es auf, sofort wirbelte eine Schneewolke ins Zimmer, und der Junge lehnte sich weit hinaus.
«Heinrich! Pass doch auf! Was machst du denn? Du fällst gleich aus dem Fenster. Außerdem wirst du dir einen Schnupfen zuziehen, wenn du hier im Schlafanzug in der Kälte stehst.»
So schnell hatte Heinrich sich noch nie angekleidet, in Windeseile schlüpfte er in seine Hosen aus dickem Leinen, zog ein Hemd an und drüber einen dunkelblauen Wollpullover.
«Darf ich raus?», rief er laut, als er bereits die Holztreppe hinunterpolterte. Marie hatte Mühe, ihn einzuholen.
«Pst, Heini, still! Deine Eltern schlafen noch. Du sollst leise sein, der Vater hat wieder die halbe Nacht gearbeitet.»
«Dafür ist es jetzt zu spät.» Der Doktor stand in einem langen weinroten Schlafrock auf dem oberen Treppenabsatz und sah Marie streng an.
«Guten Morgen, Herr Doktor. Verzeihen Sie, ich konnte ihn nicht halten. Wo er sich so über den Schnee freut.»
«Ja, ja, ist ja gut. Dann sagen Sie Sophie, sie möge mir Kaffee bringen.»
«Sehr wohl, Herr Doktor.»
Heinrich war schon in seine Stiefel gesprungen und in den Garten gerannt. Fast bis zu den Knien reichte ihm der pulvrige Schnee, und er tollte herum wie ein junger Hund.
«Heinrich, es reicht jetzt! Du kommst sofort herein, frühstücken, auf der Stelle!»
Marie fühlte sich nicht wohl, wenn sie streng sein musste, schließlich war sie selbst noch so jung. Bis vor kurzem hatte sie auch solchen Unfug gemacht, und nun sollte sie diese beiden Kinder erziehen, noch dazu unter der Aufsicht der Eltern. Wobei der Doktor ja milder war als die gnädige Frau, die besonders vor Heinrich sehr bestimmt auftrat. Marie hatte großen Respekt vor ihr. Die gnädige Frau war nur wenige Jahre älter als sie, tat aber so, als wäre sie weiß Gott wie erfahren. Und dass sie aussah und sich kleidete wie eine ältliche Dame, machte die Sache nicht besser. Marie hatte das Gefühl, sie könne sie nicht leiden.
Schon damals beim Einstellungsgespräch, als Marie mit den Herrschaften im Salon gesessen und der Herr Doktor ihr Dienstbuch studiert hatte, hatte seine Frau sie lediglich abschätzig angesehen. Marie bekam die Stelle, denn die Familie brauchte rasch Ersatz. Hedi, die Kinderfrau, die seit fünf Jahren bei ihnen gelebt hatte, hatte gekündigt. Sie wollte heiraten und blieb noch genau zwei Wochen, um Marie anzulernen.
Der Herr Doktor hatte Marie vorerst zur Probe angestellt und ihr erklärt, sie habe sich ausschließlich um die Kinder zu kümmern. Er ersuchte sie, mit den beiden nicht in ihrem breiten Dialekt zu sprechen. «Das lernen Sie ganz schnell, mein Kind», hatte er gemeint, und seine um zwanzig Jahre jüngere Frau hatte ihn nur zweifelnd angesehen.
Schon als sie vor drei Monaten zum Vorstellungsgespräch mit der Tramway nach Währing gefahren und den Weg von der Station zur angegebenen Adresse gelaufen war, hatte sie sich ausgemalt, wie es wäre, hier zu wohnen. Die schönen großen Häuser, überall Bäume und Gärten – es war ein ganz anderes Wien als das, das sie bisher kannte.
Maries letzte Stelle war bei einer Bankiersfamilie in der Tuchlauben gewesen. Mittendrin in der riesigen Stadt hatte sie gewohnt, und alles fühlte sich zu eng und zu laut an. Sie war eine einfache Küchenhilfe, gerade sechzehn geworden, und man hatte ihr eine Kammer neben der Küche zugewiesen, in der es zugig und eiskalt war, obwohl das Fenster zum dunklen Lichthof winzig war. Die Köchin hatte sie getriezt und gequält, Marie durfte den ganzen Tag die Küche nicht verlassen, nicht zum Einkaufen und schon gar nicht, um den Herrschaften aufzutragen. «Das kannst du nicht, du dummer Trampel, da draußen verläufst du dich nur, und die Herrschaften sind sehr vornehm, du schüttest die Suppe aus, und dann kündigen sie dir», hatte die verhärmte Frau Mayerhofer gesagt, die sich viel darauf einbildete, schon seit zwanzig Jahren für «ihre» Familie zu kochen. Marie bekam die spärlichen Reste zu essen, sie hatte ständig Hunger, und nur selten gelang es ihr, ein Stück Brot oder ein paar Kartoffeln an Frau Mayerhofer vorbei in ihre Kammer zu schmuggeln.
In der Familie gab es drei Kinder, das jüngste, Clara, war erst ein halbes Jahr alt, und als die Kinderfrau von einem Tag auf den anderen kündigte, kam Maries Gelegenheit. Man fand so rasch keinen Ersatz, die Dame des Hauses hatte schwache Nerven, und so wurde der Nachwuchs in Maries Obhut gegeben. Sie zog aus der Kammer in ein Zimmerchen neben der Kinderstube.
Auch wenn die kleine Clara keine Nacht durchschlief und der vierjährige Johannes ein schwieriges, kränkliches Kind war, ging Marie die Arbeit leicht von der Hand. Sie schlief mit offener Tür zu den Kindern, trug das Baby oft stundenlang in ihrer Kammer auf und ab, aß gemeinsam mit den dreien und kam jeden Tag raus an die frische Luft. Die Kleine im Kinderwagen, daneben Johannes und die zehnjährige Anna, so machten sie ihren Spaziergang, erkundeten die Stadt, besuchten einen der schönen Parks. Stephansdom, Hofburg, die großen Museen – Marie liebte diese Bauten. Sie gaben ihr das Gefühl, Teil einer bedeutenden Geschichte zu sein.
Sie war glücklich und hoffte, ihr Leben werde nun so weitergehen, zumindest ein paar Jahre, doch dann passierte das Unglück. Die Mutter verstarb kurz nach Weihnachten, und Maries Dienstherr beschloss, die Kinder zu seinen Eltern nach Telfs in Tirol zu schicken. Er konnte ihren Anblick nicht ertragen, wollte sie nicht mehr um sich haben. Die Kinder wurden über Nacht von der Großmutter abgeholt, und Marie war von einem Tag auf den anderen ihre Stelle los. Vorsichtig fragte sie an, ob sie die Arbeit als Küchenhilfe wieder aufnehmen könne, doch die Köchin lachte sie nur aus. «Du hast wohl geglaubt, du bist was Besseres! Hast mich nur hochmütig ang’schaut, wenn du mit den Gschrappn vorbei bist. Das hast jetzt davon, in meine Küche kommst nicht mehr.»
Von einer Nacht auf die andere stand Marie auf der Straße, immerhin hatte der Bankier ihr noch den Lohn für den ganzen Monat ausbezahlt, doch das würde nicht lange reichen. Nicht nur einmal lehnte sie am Brückengeländer, blickte in den Donaukanal und dachte darüber nach, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Was sollte sie tun? Sie war gerade mal achtzehn Jahre alt, hatte nichts und niemanden. In ihr Elternhaus konnte sie nicht zurück, der Vater hätte sie sofort rausgeworfen.
Als sie wieder einmal auf das dunkle Wasser des Kanals starrte, spürte sie eine Hand auf ihrer Schulter. «Wehe, du springst da rein, Kinderl. Nicht, wenn ich hier grad vorbeikomm. Dann müsst ich ja versuchen, dich zu retten, und das wär der Tod für meine Knochen.»
Josephine war nur zehn Jahre älter als Marie, sah aber aus wie eine alte Frau, die schon viel im Leben gesehen hatte. Sie nahm Marie mit in eine Branntweinstube, stellte ihr einen heißen Tee mit Rum vor die Nase und hörte sich Maries Geschichte an. Anscheinend löste der Alkohol ihre Zunge, denn Marie erzählte einfach alles. Vom Vater und von der Großmutter, vom Bauernhof, auf den sie als Magd gekommen war, von ihrer Stelle als Küchenhilfe und der glücklichen Zeit mit den Kindern in der Tuchlauben. Immer wieder tropften ihre Tränen in den Tee, und Josephine hielt ihr alle paar Minuten ihr schmutziges Taschentuch hin.
«Na ja, das ist alles nicht lustig, aber weißt du was? Du bist nicht die Einzige mit einem schweren Leben. Wo kämen wir denn da hin, wenn alle ins Wasser gehen würden? Du bist jung und gesund, kannst sogar lesen und schreiben. Wir finden schon was für dich.»
Als Marie sich ausgeweint hatte, schob Josephine sie wieder in den kalten Abend, lief mit ihr ein paar Minuten durch die verwinkelten Gassen des zweiten Bezirks und brachte sie in eine winzige Kammer, in der eine Matratze mit dünner Decke auf dem Boden lag.
«Du schläfst dich jetzt erst mal aus, ich muss arbeiten gehen. Rühr dich hier nicht von der Stelle und mach keinem auf, bis ich wiederkomme! Hast du das verstanden? Vor allem nicht dem dreckigen Poldi von gegenüber. Wenn der gesoffen hat, schlägt er immer an meine Tür. Also, niemandem aufmachen!»
Marie fiel augenblicklich in einen tiefen Schlaf, und als Josephine wiederkam, wusste sie nicht, ob sie zwei oder zwanzig Stunden geschlafen hatte. Es war wohl ziemlich lange gewesen, denn Josephine hatte inzwischen sowohl ein Bett als auch eine Arbeit für Marie aufgetrieben.
Nun war sie Bettgeherin in einer vor Dreck starrenden Wohnung in der Leopoldstadt, das hieß, sie schlief tagsüber ein paar Stunden in einem Bett, das nachts ein anderer benützte. Wenn es dunkel wurde, stand sie auf, versuchte, sich am Waschbecken auf dem Gang notdürftig zu reinigen, und lief dann eineinhalb Stunden in Richtung Ottakring, wo sie in einem Wirtshaus als Abwäscherin arbeitete.
Sie hasste die Arbeit, hasste die Wirtsleute und hatte Angst vor den betrunkenen Männern, die – kaum steckte sie den Kopf aus der Küche – ihr nachstellten und sie mit zotigen Witzen in Bedrängnis brachten. Der einzige Lichtblick war Josephine, die hier schon lange als Kellnerin arbeitete und wusste, wie man mit den weinseligen Gästen umging. Sie ließ sich nichts gefallen, hatte ein Auge auf Marie und passte auf, dass dem Mädchen niemand zu nahe kam.
«Du bist so jung, du musst auf deine Ehre achtgeben. Sie ist das Einzige, was du hast. Und wenn du in anderen Umständen bist, kann ich dir auch nicht mehr helfen.»
Josephine steckte ihr regelmäßig einen Teil des Trinkgeldes zu, und irgendwann einmal riet sie Marie, zu einer Arbeitsvermittlung zu gehen und sich um eine Stelle als Dienstmädchen zu bewerben. Das sei ihre Möglichkeit, dem Elend zu entkommen, es gebe zwar auch grässliche Familien, die Dienstpersonal suchten, aber vielleicht habe sie ja Glück. Immerhin hatte der Bankier aus der Tuchlauben Marie ein erstklassiges Zeugnis geschrieben, in dem er betonte, wie gut Marie mit Kindern umgehen könne. Dieses Stück Papier hütete Marie wie ihren Augapfel, es konnte der einzige Weg in eine bessere Zukunft sein.
Und dann, nach unzähligen Vorstellungsgesprächen – Marie war viele Kilometer durch Wien gelaufen, denn das Geld für all die Straßenbahnfahrten hatte sie nicht –, saß sie bei der Familie in der Sternwartestraße und wusste, wenn es diesmal wieder nicht klappte, würde sie aufgeben. Sie konnte nicht mehr gehen, sie konnte keinen weiteren Winter in der eiskalten Wohnung verbringen, sie konnte das Wirtshaus und die betrunkenen Männer nicht länger ertragen. Und dann sagte der Herr Doktor ganz unerwartet: «Na gut, wir wollen es versuchen mit Ihnen, auch wenn Sie mir sehr jung erscheinen. Ich nehme Sie auf Probe. Hedi wird Ihnen in den nächsten zwei Wochen alles zeigen, bis dahin werden sich Lili und Heinrich an Sie gewöhnt haben. Wann können Sie anfangen?»
«Sofort», flüsterte Marie. «Also morgen?»
Einen Tag später packte Marie ihre wenigen Sachen zu einem Bündel und löste mit ihrem letzten Geld einen Fahrschein für die Straßenbahnlinie E2. Sie stieg am Aumannplatz aus und ging langsam die Türkenschanzstraße hoch. Immer wieder blieb sie stehen, betrachtete die Häuser und großen Bäume. Cottage hieß das Viertel, Marie hatte mal davon gehört. Hier wohnten die wohlhabenden Familien, denen es in der Stadt zu eng war. Backsteinfassaden, große Fenster, Gärten, die Straßen von Bäumen gesäumt: In dieser Gegend mit der guten Luft würde sie nun leben. Marie konnte ihr Glück kaum fassen.
Nach dem ersten Klingeln öffnete sich die Haustür, und eine junge, mürrisch blickende Frau streckte den Kopf heraus.
«Ja, bitte?»
«Grüß Gott. Ich bin die Marie Haidinger. Ich trete meine Stelle als Kindermädchen hier an.»
Die Frau öffnete die Tür einen Spalt und sah Marie misstrauisch an.
«Ah, du bist das! Na, herzlich willkommen.» Bei dem Wort «herzlich» zog sie die Mundwinkel nach unten und ließ Marie widerwillig in den kleinen Vorraum treten. «Aber die Herrschaften sind gar nicht da. Du kannst heute nicht anfangen.»
Es war ein ungewöhnlich heißer Morgen für Mitte September, Marie war von der steilen Straße außer Atem und verschwitzt. Sie nahm ihren Hut ab und stand unschlüssig im Vorraum, als eine Tür aufging und ihr eine beleibte ältere Dame entgegenblickte.
«Ah, du musst das neue Mädchen sein, nur herein! Ich bin die Anna, seit zehn Jahren bin ich die Köchin und Haushälterin der Familie. Jetzt komm schon, was stehst hier so zaghaft rum? Und du, Sophie, schau nicht so bös. Hast du die Betten schon gemacht?»
Das Mädchen verschwand in den oberen Stock, und so schnell konnte Marie gar nicht schauen, da saß sie schon in einer hellen Küche, vor sich ein Glas Limonade und ein Stück Kuchen. Sie trank einen Schluck und glaubte, im Paradies zu sein.
«Jetzt sei nicht so gschamig. Hungern muss bei uns keiner, dafür sorge ich. Iss den Kuchen, oder magst lieber ein Butterbrot?»
«Nein, nein. Der Kuchen ist sehr gut. Wo sind denn die Kinder?»
«Na, der Heinrich ist in der Schule, und die Kleine ist mit der Hedi im Park spazieren. Die kommen bald zum Mittagessen.»
«Und die Herrschaften?»
«Die sind ein paar Tage an den Semmering gefahren. Weißt du, der Doktor hat’s mit den Ohren. Immer Schmerzen, und dann hört er angeblich immer so ein Geräusch, und überhaupt tut er schon schlecht hören, obwohl er ja noch nicht mal fünfzig ist. Und da meinte die gnädige Frau, die Luftveränderung würde ihm guttun.»
«Ich hab beim Vorstellungsgespräch gar nicht gefragt, was sie sind, die Herrschaften.»
«Also, der Herr Doktor, der ist ein studierter Doktor, aber als Doktor arbeitet er nicht mehr. Der ist ein berühmter Schriftsteller. Hast du den Namen noch nie gehört?»
Marie schüttelte beschämt den Kopf.
«Na woher auch! Im Theater wirst wohl noch nie gewesen sein.»
«Nein, war ich noch nie. Aber ich kann lesen.»
«Freilich kannst du lesen. Sonst hätten dich die Herrschaften ja auch nicht genommen. Der Kleinen musst du ständig was vorlesen.»
«Und die gnädige Frau?»
«Ja, die … die möchte eigentlich Sängerin sein, aber ich sag dir, so richtig gut singt sie nicht. Das merken alle, nur sie selber nicht, und deswegen hat sie oft recht schlechte Laune.»
«Und das Mädchen, das mir die Tür aufgemacht hat?»
«Das ist die Sophie. Ein dummes Ding, sie ist seit einem halben Jahr im Haus.»
«Warum ist sie so unfreundlich?»
«Ach, das legt sich schon. Sie wär selber gern Kindermädchen, aber sie kann nicht mal lesen. So etwas duldet der Herr Doktor nicht. Komm, ich zeig dir das Haus.»
Anna führte sie durch alle Zimmer, und Marie war beeindruckt. Im Wohnzimmer stand ein Flügel, die Kinder hatten jedes ein eigenes Zimmer, daneben war eine kleine Kammer.
«Hier wirst du schlafen, direkt neben Lilis Zimmer. Die Hedi ist ja noch ein paar Tage da, damit die Kinder sich an dich gewöhnen können. Bis dahin schläfst du mit Sophie in der Kammer hinter der Küche.»
Marie trat langsam über die Türschwelle und blickte sich um. An der Seite gegenüber dem Fenster stand ein schmales Bett, das mit blütenweißer Wäsche überzogen war. Keine dünne, alte Decke, nein, wenn der Blick sie nicht trog, war das ein richtiges Federbett. Auf dem Nachtkästchen stand eine Vase mit ein paar Blumen, vor dem offenen Fenster wehte ein heller Vorhang, durch den man einen Blick auf die großen Bäume erhaschen konnte. Wie konnte das möglich sein? Womit hatte sie so viel Glück verdient? Marie stiegen die Tränen in die Augen.
Zu Hause bei ihren Eltern hatten ihre drei Schwestern und sie sich mit zwei schmalen Schlafstätten begnügen müssen, sie teilte sich mit ihrer großen Schwester Magda ein Bett. Die Decken waren dünn, im Winter legte ihnen die Mutter einen mit Stroh gefüllten Bezug obendrauf. Nur selten wurde das Bettzeug gewechselt, und mehrmals in der Nacht wurde sie von den Tritten ihrer Schwester oder von lästigen Wanzenbissen geweckt. Doch zumindest fühlte sie sich sicher, damals in dem winzigen Zimmerchen. Der Vater betrat die Schlafkammer der Töchter nie, der Bruder war auf der anderen Seite des Hofes in einem Extrazimmer untergebracht.
Als der Vater Marie mit zwölf auf einen fremden Hof zum Arbeiten schickte, war Marie fassungslos: Der Schlafraum der Mägde und Knechte lag direkt über dem Heuschober, eine mit einer wackeligen Leiter zu erreichende Schlafstätte für alle gemeinsam! Dünne Strohmatten, ein graues Laken als Decke, so lagen sie Körper an Körper, in der Erntezeit schon mal fünfzehn Leute. Zum Glück war sie nach der schweren Arbeit immer so müde, dass sie trotzdem meistens sofort einschlief.
Als sie ein wenig älter war, kam ein neuer Knecht auf den Hof, und die älteren Mägde warnten sie: Der Hubert sei einer, der sich gerne nachts auf fremde Matten verirre. Von da an war Marie immer auf der Hut. Eines Nachts – sie war gerade erschöpft in den Schlaf gesunken – erwachte sie von einem Geräusch, und als sie sich leise aufsetzte und ihre Augen sich an das Mondlicht gewöhnt hatten, da sah sie Hubert auf der Matte von Rosa liegen, er machte seltsame Bewegungen, und Marie hörte ein unterdrücktes Schluchzen. Rosa war erst vor ein paar Wochen neu auf den Hof gekommen, sie war jünger als Marie, fast noch ein Kind, mit langen Zöpfen und Sommersprossen.
Marie bekam Angst. Sie wusste zwar nicht genau, was da vor sich ging, aber dass es nicht rechtens war, das begriff sie. Sie stand auf und schlich sich näher an die beiden heran, da sah sie in Rosas vor Schreck weit aufgerissene Augen. Hubert hatte ihr die Hand über den Mund gelegt. Als er Marie bemerkte, ließ er nur kurz von Rosa ab und zischte ihr zu: «Na, Mädel, das gefällt dir. Morgen bist du dran.»
Marie lief zurück zu ihrem Lager, packte die wenigen Habseligkeiten in einen kleinen Beutel und verließ bei Morgengrauen den Hof, nachdem sie in der Küche noch ein Stück Brot und eine Wurst gestohlen hatte. Lieber würde sie auf der Landstraße sterben, als hier zu bleiben.
«Träumst du?» Anna schloss mit einer kräftigen Bewegung das Fenster und schob Marie aus dem Zimmer.
«Nein, nein. Es ist nur so … so schön.»