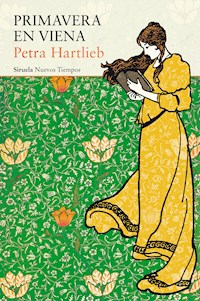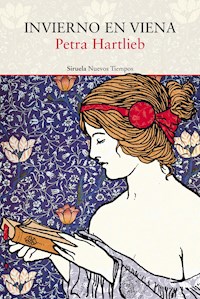9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wien 1916. In den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs beginnen schwierige Jahre für den Wiener Buchhändler Oskar Novak und seine Frau Marie. Eine Verletzung erspart Oskar eine Rückkehr an die Front, doch Marie ahnt, dass er Dinge erlebt hat, die er wohl nie wieder vergessen wird. Hunger und Not prägen das Wien dieser Jahre, und die kleine Buchhandlung in der Währinger Straße wirft nicht genügend ab. Als die schlimmste Not gelindert ist, wartet das Schicksal 1919 mit einer neuen Prüfung auf: Die Spanische Grippe grassiert in Wien. Erst der Beginn des neuen Jahrzehnts bringt endlich wieder Licht in Maries und Oskars Leben. 1920 wird der kleine Paul geboren, und die Kunden kehren in die Buchhandlung zurück. Und mit der freigeistigen Freundin Fanni Gold kommt der Glanz der 1920er-Jahre: Nächtliche Theater- und Kaffeehausbesuche bringen Abwechslung. Doch was hat es mit diesen Frauenversammlungen auf sich, zu denen Fanni sie mitnehmen will? Ein Wahlrecht für Frauen – soll sich Marie ihrer Freundin in diesem Kampf anschließen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
WIEN, 1916
Die letzten Jahre des Ersten Weltkriegs sind eine harte Zeit für den Wiener Buchhändler Oskar Nowak und seine Frau Marie. Doch der Beginn des neuen Jahrzehnts bringt endlich wieder Licht in das Leben des Paares. 1920 kehren die Kunden in die Buchhandlung zurück, und mit der freigeistigen Freundin Fanni bekommen die 1920er-Jahre ihren berühmten goldenen Glanz: Nächtliche Kaffeehausbesuche und Theatervorstellungen eröffnen Marie eine unbekannte Welt.
Doch was hat es mit diesen Frauenversammlungen auf sich, zu denen Fanni sie mitnehmen will? Ein Wahlrecht für Frauen? Soll sich Marie ihrer Freundin in diesem Kampf anschließen?
© Pamela Rußmann/pamelarussmann.at
PETRA HARTLIEB wurde 1967 in München geboren und ist in Oberösterreich aufgewachsen. Sie studierte Psychologie und Geschichte und arbeitete danach als Pressereferentin und Literaturkritikerin in Wien und Hamburg. 2004 übernahm sie eine Wiener Traditionsbuchhandlung im Stadtteil Währing, heute »Hartliebs Bücher«. Davon erzählt ihr 2014 bei DuMont erschienenes Buch ›Meine wundervolle Buchhandlung‹. In ›Wenn es Frühling wird in Wien‹, ›Sommer in Wien‹ und ›Herbst in Wien‹ spielt ebendiese Buchhandlung erneut eine zentrale Rolle.
petra hartlieb
HERBSTINWIEN
ROMAN
Von Petra Hartlieb sind bei DuMont außerdem erschienen:
Meine wundervolle Buchhandlung
Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung
Wenn es Frühling wird in Wien
Sommer in Wien
Mit Dank an Hugo Gold für die medizinische Beratung
eBook 2021
© 2021 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildungen: © depositphotos/bomg11/100ker
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7112-4
www.dumont-buchverlag.de
Für Klaus Hartlieb (1941–2021)
1931
IN EINER HALBEN STUNDE würde das Museum schließen, doch es sah nicht so aus, als könnte irgendjemand den kleinen Paul dazu bewegen, den Heimweg anzutreten.
»Nur noch einmal zum Kaiman, Mama! Bitte. Und die Lanzenotter muss ich mir auch noch mal anschauen«, bettelte er und war schon wieder weg.
»Aber Lotti ist schon so müde, schau mal. Sie kann fast nicht mehr gehen.«
Charlotte hatte sich auf die Stufen gesetzt und rieb sich die Augen. Sie sah aus, als würde sie gleich einschlafen, doch das schien ihren älteren Bruder kaum zu beeindrucken, er war inzwischen verschwunden, lediglich sein Haarschopf tauchte immer wieder einmal kurz zwischen den Schaukästen aus Glas auf.
Seit Wochen sprach Paul nur noch vom Regenwald. Im Februar hatte ihn Fanni zu einem Lichtbildvortrag in die Urania mitgenommen, bei dem der Leiter der Costa-Rica-Forschungsexpedition Bilder und kurze Filme gezeigt hatte. Seitdem wollte Paul nur noch eines: Urwaldforscher werden. Er versuchte, im Blumentopf am Küchenfenster Ameisen zu füttern, in der Hoffnung, dass sie zur Größe von Urwaldameisen anwachsen würden. Bei ihren Spaziergängen im Türkenschanzpark beobachtete er stundenlang die einheimischen Vögel – um zu üben, wie er behauptete; und seit er fünf war, war Robinson Crusoe seine persönliche Bibel. Und einen Monat zuvor hatte Paul seinen Vater täglich um einen großen Tieratlas aus der Buchhandlung angebettelt, bis der ihm einen mitgebracht hatte. Nun las der Elfjährige jeden Abend darin, bis ihm die Augen zufielen.
Marie lehnte erschöpft an der großen Marmorwand neben ihrer kleinen Tochter. Sie fand Pauls Begeisterungsfähigkeit ja schön, aber ehrlich gesagt hatte sie nach drei Stunden mehr als genug von Kolibris, Spinnen, Echsen und unzähligen Orchideen, auch wenn sie noch so schön bunt und exotisch waren.
»Mama, ich hab Hunger«, quengelte Charlotte, »und die Füße tun mir weh. Trägst du mich heim?«
»Lotti! Ich kann dich nicht mehr tragen. Du bist doch schon viel zu schwer. Du kannst gut selber gehen.«
»Ja, aber ich will jetzt nach Hause. Ich bin müde. Was gibt es zu essen?«
»Wir haben noch Kartoffelgulasch von gestern, das wärmen wir auf.«
»Ich will aber kein Kartoffelgulasch. Außerdem haben wir gestern schon die ganzen Würstel rausgegessen.«
»Was anderes hab ich nicht. Und jetzt hör auf zu jammern, du bist kein Baby mehr. Du bist doch schon fast ein Schulkind.«
»Was ist denn hier los? Hat unsere kleine Urwaldforscherin einen Schwächeanfall?« Fanni zog das Mädchen an den Händen hoch und setzte sie sich auf die Hüfte.
»Schau mal, Mama, die Tante Fanni ist stark. Die kann mich tragen.«
»Ja, ich bin stark wie der Bär da oben.«
»Den mag ich nicht. Vor dem fürcht ich mich.«
Marie war das erste Mal mit Paul und Lotti im Naturhistorischen Museum, und sie war mindestens so beeindruckt wie die Kinder. Sie hatten ganz oben im ersten Ausstellungsraum begonnen und waren alle erschrocken, als sie dem ausgestopften Bären mit dem offenen Maul gegenüberstanden. Lotte versteckte sich hinter den Rockschößen ihrer Mutter und war nur mit Mühe wieder hervorzulocken. Doch durch die Aussicht auf die Elefanten in einem der hinteren Räume ließ sie sich dazu bewegen, rasch am Bären vorbeizulaufen. Wölfe, Schakale, Füchse, unzählige Tiere, deren Namen Marie noch nie zuvor gehört hatte, starrten ihnen aus den Glasvitrinen entgegen, und die Kinder waren fasziniert vom Zebra und der riesigen Giraffe. Und dann führte sie Pauls Begeisterung in die Sonderausstellung »Costa-Rica-Expedition«, in der sie gefühlte Stunden Hunderte Kolibris, riesige Spinnen und Geckos in allen Größen und Farben betrachteten.
Wie lange war das her, dass sie mit Oskar im Schönbrunner Tiergarten gewesen war? Fast zwanzig Jahre, unglaublich, wie schnell die Zeit verging! Es kam ihr vor, als wäre es gestern gewesen, als sie mit den ihr anvertrauten Kindern der Familie Schnitzler vor dem Affengehege gestanden hatte und gar nicht glauben konnte, dass es solche Tiere gab! Damals hatte sie das erste Mal darüber nachgedacht, wie groß die Welt doch war. Und nun war sie hier mit ihren eigenen Kindern, und ihr elfjähriger Sohn träumte davon, auf einen anderen Kontinent zu reisen.
»Ich hab jetzt aber Hunger.«
»Das haben wir bereits gehört. Ihr holt jetzt eure Mäntel, ich such den Paul, und dann lad ich euch zum Schnitzelessen ein.« Fanni stellte das Kind wieder auf den Boden.
»Aber das geht nicht! Und außerdem haben wir noch Kartoffelgulasch daheim.«
»Natürlich geht das. Und das schmeckt aufgewärmt nach zwei Tagen sowieso viel besser. Auf geht’s.«
Die Aussicht auf ein Kalbsschnitzel lockte sogar Paul endlich weg von den Schaukästen, und sie zogen sich die Mäntel an.
Auch bei Lotti waren die Lebensgeister wiedererwacht, und sie sprang munter vor den beiden Frauen her, Paul ging zwischen Fanni und Marie und zählte mit vor Aufregung roten Wangen nahezu alle Tiere auf, die er sich gemerkt hatte. »Und Mama: Hast du die Fledermäuse gesehen? Die ganz großen? Und die Blattschneideameisen? Weißt du, dass auf jedem Blattstück, das eine Ameise trägt, auch noch eine kleine sitzt, die sie verteidigt?«
»Nein, das wusste ich nicht.«
»Ich werde Urwaldforscher! Ganz bestimmt. Und dann fahr ich nach Costa Rica und finde eine Tierart, die noch keiner kennt.«
»Ja, das machst du. Dafür musst du aber in der Schule recht fleißig sein.«
»Bin ich doch eh. Hab nur gute Noten dieses Jahr.«
Marie und Oskar waren recht stolz auf ihren klugen Gymnasiasten. Schon als kleines Kind hatte er lieber in Atlanten geblättert, als sich Geschichten vorlesen zu lassen, und die Bücher, die sein großer Bruder Friedrich verschlang, sortierte der kleine Paul nach Farben oder ordnete sie in Gruppen, um die Anzahl besser ausrechnen zu können. Und so hatten sie im letzten Jahr große Anstrengungen unternommen, um den Bub aufs Gymnasium zu schicken, obwohl die Zeiten nicht gerade rosig waren. Zum Glück wollte der mittlerweile siebzehnjährige Friedrich nichts anderes, als in der Buchhandlung zu arbeiten, so sparten sie einen Angestellten, und inzwischen war er Oskar eine große Hilfe.
Nur mit Mühe fand die kleine Gruppe im Meissl & Schadn noch einen Tisch, an dem sie alle Platz hatten. Lotti bestellte beim Oberkellner selbstbewusst ein »Wiener Schnitzel und einen Hollersaft, bitte schön«, als er die Speisekarten brachte.
»Sei nicht immer so vorlaut«, wies Marie sie zurecht. »Und setz dich ordentlich hin.«
Inzwischen war es Marie nicht mehr unangenehm, wenn sie als Frau ohne Begleitung in ein Gasthaus oder Kaffeehaus ging. Früher hatte sie ständig das Gefühl gehabt, die Männer würden sie anblicken und überlegen, ob sie wohl anständig sei oder noch zu haben. Fanni hingegen besuchte immer schon Kaffeehäuser, Restaurants und Theater, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, und hatte viel Energie aufgewendet, um Marie diese Schüchternheit auszutreiben. Irgendwann gewöhnte Marie sich daran, ja, sie genoss es und betrat die Räume erhobenen Hauptes und selbstbewusst. Und auch die Lokale hatten sich inzwischen an die neuen Zeiten gewöhnt und bewirteten auch Frauen, die allein unterwegs waren. Lediglich das Sacher war in dieser Beziehung immer noch recht altmodisch und vertrat die Ansicht, dass Frauen ohne männliche Begleitung den guten Sitten widersprachen.
Sie bestellten Schnitzel mit Kartoffelsalat, Fanni orderte ein Glas Wein und wollte Marie überreden, auch eines zu trinken.
»Nein danke. Für mich keinen Wein. Ich trinke lieber Wasser.«
»Aber warum? Ein Glas schadet doch nichts.«
Alkohol in der Öffentlichkeit, das ging für Marie dann doch zu weit. Essen zu gehen im Gasthaus, in einer Zeit, in der überall alles knapp war, fand sie ohnehin schon fast unerhört.
»Ich kann aber nichts dazuzahlen zum Essen«, sagte Marie leise, nachdem sie rasch ihr Budget für den Rest des Monats überschlagen hatte.
»Das weiß ich doch. Ich lade euch ein.«
»Aber bei euch in der Buchhandlung ist doch auch nicht viel los. Ihr müsst auch sparen, oder?«
»Noch nagen wir nicht am Hungertuch. Und der Verlag geht immer noch erstaunlich gut. Wir haben gerade den Auftrag für ein Schulbuch bekommen. Außerdem muss man die Feste feiern, wie sie fallen. Wer weiß, wie lange das noch geht.«
Marie schüttelte den Kopf: »Manchmal versteh ich dich nicht.«
»Das macht nichts! Du liebst mich ja trotzdem«, grinste Fanni sie an und nahm einen Schluck aus dem Weinglas. »Mmh, sehr gut. Magst du mal kosten?«
Marie nippte kurz und stellte es rasch zurück. »Und was liest du gerade?«
»Fabian. Von Erich Kästner.«
»Erich Kästner kenne ich auch!« Lotti warf fast ihr Holundersaftglas um. »Der Papa liest uns jeden Abend Pünktchen und Anton vor. Ich liebe es!« Das kleine Mädchen zog das Wort »liebe« theatralisch in die Länge und reckte dabei die Arme nach oben. Marie und Fanni lachten. »Ich glaube, du wirst mal Schauspielerin«, sagte Fanni und strich dem Mädchen über die dunklen Locken.
»Manchmal erinnert sie mich an die Lili.« Marie schaute ihre kleine Tochter versonnen an, doch eigentlich ging der Blick durch sie hindurch, und sie sah in ihren Gedanken die kleine Lili Schnitzler, wie sie sich im elterlichen Salon in Pose warf und Gedichte aufsagte.
»Wer ist die Lili?« Nun hob sogar Paul den Kopf von seiner Costa-Rica-Broschüre.
»Ein kleines Mädchen, auf das ich mal aufgepasst habe.«
»Hatte sie keine Mama?« Lotte runzelte die Stirn, sie schien scharf nachzudenken.
»Natürlich hatte sie eine Mama! Warum denn nicht?«
»Ja, aber warum hast du dann auf sie aufgepasst? Wo sie doch eh eine Mama hatte?«
»Weißt du, das war eine ganz feine Familie. Und Herr und Frau Schnitzler hatten immer recht viel zu tun. Die sind ins Theater gegangen und auf Reisen und hatten ständig Besuch. Da brauchten die jemanden, der auf die Kinder geschaut hat.«
»Kinder?« Pauls Neugier war geweckt.
»Ja, die Lili hatte auch einen Bruder. Den Heinrich, den haben alle Heini genannt, und der war damals so alt, wie du jetzt bist.«
»Und wo sind die Kinder jetzt?«
»Der Heinrich ist schon groß. Ich glaube, er arbeitet fürs Theater.«
»Und die Lili?«
»Die Lili lebt leider nicht mehr.« Marie fiel es schwer, das auszusprechen, doch sie hatte sich geschworen, ihre Kinder niemals anzulügen.
»Aber warum nicht? Die war doch keine alte Frau?« Lotti sah sie bestürzt an.
»Nein, sie war fast noch ein Kind«, seufzte Marie und strich ihrer kleinen Tochter übers unordentliche Haar. »Manchmal ist das einfach so. Da müssen auch junge Menschen sterben. Aber zum Glück nicht so oft. Brauchst keine Angst haben, mein Herz.«
»Eh nicht.« Zum Glück wurden die riesigen Schnitzel serviert, und Lottis Aufmerksamkeit richtete sich auf ihren Teller. So frech und wagemutig sie war, der Gedanke, dass plötzlich jemand nicht mehr da sein konnte, verstörte sie zutiefst. Regelmäßig fragte sie beim Zubettgehen, ob die Mama eh nicht sterben werde oder der Papa oder einer ihrer Brüder. Und dann wollte sie Rosas Foto anschauen, und immer wieder fragte sie nach ihr, stellte sich vor, wie es wäre mit ihr zu spielen, ohne natürlich mit einzurechnen, dass die kleine Rosa auf dem Foto mittlerweile älter wäre als sie, würde sie noch am Leben sein.
Mai 1915
NACH FÜNF MONATEN an der Front kam Oskar mit einer Schussverletzung zurück nach Wien. Von seinem kurzen Leben als Soldat erzählte er kaum, doch Marie ahnte, dass er Dinge erlebt hatte, die er wohl nie wieder vergessen würde. Zwei Wochen lang war er in der Wiener Secession untergebracht, die gleich zu Kriegsbeginn in ein Reserve-Spital umgewandelt worden war. Als Marie ihn besuchte, erkannte sie Oskar nur mit Mühe unter all den blassen Männern in den Betten des großen Krankensaals. Sein Gesicht war grau und eingefallen, und obwohl er augenscheinlich versuchte, nicht allzu bedrückt zur wirken, bemerkte Marie, wie deprimiert und ausgezehrt er war.
»Wir wollten doch immer hierhergehen und die Ausstellung anschauen. Das haben wir nicht geschafft. Nun sind wir da, kannst dir den Beethovenfries anschauen.«
»Ich will aber dich anschauen, der Fries interessiert mich nicht«, sagte Marie und setzte sich an den Rand des Bettes. »Wie geht es dir?«
»Es geht schon. Ich glaube, sie entlassen mich bald. Die brauchen das Bett für schlimmere Fälle.«
Und tatsächlich, ein paar Tage später kam er nach Hause, doch seit seiner Rückkehr aus dem Hospital war er nicht mehr der Mann, in den sie sich verliebt hatte. Oft war er in sich gekehrt, dann wieder rastlos, saß tagelang schweigend in der Buchhandlung, in die sich ohnehin selten ein Kunde verirrte, und flüchtete sich in seine geliebten Bücher. An manchen Tagen verschwand er von einem Augenblick zum anderen, ohne ein Wort, ließ Marie mit dem kleinen Fritzi allein im Geschäft und lief stundenlang durch den Wienerwald. Wenn er zurückkam, streifte er seine staubigen Schuhe ab und ging wortlos ins Bett. Es war eine Zeit, in der Marie schier verzweifelte. Verzweifelte über sein Leid und sein Unvermögen, sich ihr anzuvertrauen. Das war nicht das, was Marie sich unter Ehe und Partnerschaft vorstellte. Hatten sie sich nicht erst vor Kurzem geschworen, füreinander da zu sein, in guten wie in schlechten Tagen? So stolz war sie immer gewesen, dass Oskar und sie nicht nur Mann und Frau waren, sondern auch beste Freunde, die sich alles – oder fast alles – erzählen konnten. Und nicht so eine sprach- und lieblose Zweckgemeinschaft führten, wie sie es aus ihrem Elternhaus kannte.
Als sie beide wieder einmal erschöpft nebeneinander im Bett lagen – Oskar rückte immer so weit wie möglich an die Bettkante, platzte es aus ihr heraus. »So geht das nicht weiter. Du musst mit mir reden! Ich halt das nicht mehr aus. So können wir nicht weiterleben.«
Er schwieg und starrte in die Dunkelheit.
»Hast du mich verstanden? Ich weiß, es ist schwer für dich. Aber für mich auch. Wie stellst du dir das denn vor?«
»Ich weiß, Marie. Es ist schwer. Aber ich kann dir nicht erzählen, was ich da alles gesehen habe.«
»Du musst aber!«
»Das kann ich nicht.«
»Du musst aber reden. Erstens, weil es für dich gut ist. Aber auch, weil ich deine Frau bin und immer für dich da sein will. Wenn du mir aber nichts erzählst, dann kann ich das nicht.«
Und dann fing Oskar stockend an zu reden, ganz langsam, Satz für Satz, manchmal wurde seine Stimme so leise, dass Marie ihn kaum verstand. Er erzählte von kilometerlangen Gräben, die sie mit ihren Schaufeln ausheben mussten, nur um dann tagelang untätig darin zu liegen. Er versuchte, die Kälte zu beschreiben, die einem die Füße absterben ließ, und den Hunger, der einen von innen aufzufressen schien. Von den Ratten, die zwischen ihnen hin und her liefen und jeden Tag dreister wurden. Von den toten Kameraden, die sie aus den Gräben schleppten und notdürftig verscharrten.
»Und weißt du was? Als mich die Kugel getroffen hat und ich gemerkt hab, dass alles voll Blut ist, da war ich auf einmal richtig froh. Ich hab gedacht, jetzt kann ich sterben und es ist endlich vorbei.«
Marie hielt die ganze Zeit seine Hand und sagte nichts. Doch nach diesem Satz konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten, und endlich rückte Oskar näher an sie heran und beeilte sich zu sagen: »Aber dann hab ich an dich gedacht. An dich und den Kleinen, und da wusste ich, ich darf nicht sterben.« Erschöpft ließ er sich in die Polster sinken, und seine Stimme drang durch die Dunkelheit: »Und ich hab so schrecklich Angst, dass ich wieder zurück an die Front muss, wenn meine Schulter besser ist. Und die ist schon fast gut. Was mach ich nur, wenn sie mich wieder holen? Dann bring ich mich lieber um!«
»Versündige dich nicht! So etwas sagt man nicht. Wir müssen es verhindern.«
»Wie sollen wir das denn verhindern? Die ziehen doch jeden ein. Hast du nicht gehört, jetzt haben sie sogar den Jelinek aus dem dritten Stock geholt. Dabei ist der über fünfzig. Und ganz junge Buben, fast noch Schulkinder.«
»Du müsstest krank sein.« Marie stützte sich auf den Ellbogen und sah ihn nachdenklich an.
»Bin ich aber nicht. Mir geht’s gut. Und der Schulter auch.« Wie um es zu demonstrieren, kreiste er mit dem Arm in der Luft und riss die kleine Nachttischlampe um, die scheppernd zu Boden fiel.
Friedrich, der gleich daneben im Kinderbettchen lag, weinte einmal kurz auf, drehte sich ächzend auf die andere Seite und schlief zum Glück wieder ein.
»Ich werde mir was einfallen lassen«, flüsterte Marie.
»Was denn? Willst du mir einen Finger abschneiden? Oder mich ein bisschen vergiften?«
»Ich werde mit Fanni reden, ihr Vater muss uns helfen.«
»Wie soll der denn helfen?« Oskars Stimme war ganz verzagt.
»Ich weiß es auch nicht. Aber der kennt doch so viele Leute, die Einfluss haben.«
»Ach, du. Ich glaube nicht, dass sein Einfluss so groß ist. Aber ich geh nicht mehr an die Front.« Und plötzlich begann Oskar zu weinen, er schluchzte wie ein kleines Kind, und Marie konnte nichts tun, außer ihn fest im Arm zu halten. Irgendwann beruhigte er sich, und da nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und küsste ihn vorsichtig. Es war der erste richtige Kuss seit Monaten, und zunächst antwortete er nur zögernd, doch dann klammerte er sich wie ein Ertrinkender an sie, schlüpfte unter ihre Decke, und sie liebten sich, wie sie es zuvor noch nie getan hatten. Nicht zaghaft und schüchtern, sondern heftig und mit all ihren Gefühlen, es war, als würde ihrer beider Verzweiflung ein Ventil suchen, über das sie sich entladen konnte. Irgendwann kamen sie zu sich, der kleine Friedrich war nun doch aufgewacht und wimmerte in seinem Bett. Nachdem Marie ihn beruhigt hatte, schliefen Oskar und Marie das erste Mal seit langer Zeit wieder eng aneinandergeschmiegt ein.
Es war zwar nicht alles gut in den nächsten Tagen, aber doch ein bisschen besser. Als sie am Morgen vom fröhlichen Plappern des Kindes geweckt wurden, stand Oskar auf und holte den kleinen Fritz in ihr Bett. Das hatte er seit seiner Rückkehr nicht mehr getan, überhaupt hatte er den Kontakt zu dem Kind auf ein Minimum reduziert. Marie hatte nie etwas gesagt, ihm keine Vorwürfe gemacht, ihn zu nichts gezwungen. Nur manchmal hatte sie ihm das Kind wie beiläufig auf den Schoß gesetzt mit den Worten: »Kannst du ihn kurz halten?« Und dabei natürlich bemerkt, dass Oskar seinen Sohn wie ein Stück Holz steif im Arm hielt. Sie war so unglücklich bei diesem Anblick, dass sie es immer seltener versuchte. Wo war nur die Liebe hin, die ihr Mann diesem Kind am Anfang entgegengebracht hatte? Es war, als hätte er eine Mauer um sich hochgezogen, die niemand überwinden konnte, nicht einmal sein eigener Sohn.
Nun lagen sie um sechs Uhr früh im warmen Bett, zwischen ihnen ihr Kind, das fröhlich mit den Beinen strampelte, als sein Vater es am Bauch kitzelte. Marie spürte das erste Mal seit Langem wieder so etwas wie Zuversicht. An diesem Morgen schmeckte sogar der Haferbrei, den sie wie immer mit viel Wasser zubereitet hatte. Sie gingen gemeinsam in die Buchhandlung und bereiteten alles vor, obwohl auch an diesem Tag nicht viel Kundschaft kommen würde.
Ein paar Tage später wusste Marie es bereits. Ihre Brüste spannten, der Rücken tat weh, und als sie Fritzi fütterte, wurde ihr so übel, dass sie ihn rasch ins Bettchen setzte und auf die Toilette rannte. Sie war verzweifelt. Wie hatte das nur passieren können? Oskar und sie hatten sich monatelang kein einziges Mal berührt oder geküsst. Und dann das eine Mal aus purer Verzweiflung! Das war doch nicht möglich. Der kleine Friedrich war gerade ein Jahr alt, ihr Mann schwermütig und das Land mitten in einem Krieg. Am Anfang hatte es geheißen, der Krieg würde in ein paar Monaten vorbei sein, doch nun war fast ein ganzes Jahr vergangen, und es sah nicht so aus, als wäre ein rasches Ende in Sicht. Was sollte sie da mit einem zweiten Kind anfangen? Wo es auch jederzeit sein konnte, dass Oskar wieder einrücken musste und dann womöglich nie mehr wiederkam. So viele Männer kehrten nicht wieder zurück, von vielen wusste man nicht mal genau, wo sie gestorben waren.
Als Friedrich aufgewacht war, zog sie ihn an, legte ihn in den Kinderwagen und ging rüber in die Buchhandlung auf der anderen Straßenseite.
»Du hast dich aber schick gemacht? Was hast du denn vor?« Marie strich über ihr gutes Kleid und nahm den Hut ab. »Ich … ich wollte die Fanni besuchen. Oder brauchst du mich heute?«
»Nein, nein, geh nur. Ihr habt euch lange nicht gesehen. Ich komme schon allein zurecht.«
»Sicher?«
»Ganz sicher, meine Liebe. Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut werden, wir haben doch uns.« Er kam hinter dem Tresen vor und legte ihr eine Hand auf die Wange. »Danke.«
»Wofür bedankst du dich?«
»Dass du mich gezwungen hast zurückzukommen. Es wird alles wieder gut werden, ich verspreche es dir.«
»Ja, ich weiß.« Marie setzte ihren Hut auf und verließ rasch das Geschäft.
Die Buchhandlung der Familie Gold, direkt am Wiener Graben, war umgeben von anderen Traditionsgeschäften und zehnmal so groß wie ihre kleine Vorstadtbuchhandlung in Währing. Normalerweise waren immer viele Kunden in der Buchhandlung. Auch berühmte Leute kauften bei den Golds ein; Politiker, Schauspieler, Dichter gingen ein und aus. Doch mittlerweile war auch hier der Krieg angekommen, alle hatten weniger Geld, und die, die noch genug hatten, keinen freien Kopf zum Lesen.
Noch vor einem halben Jahr war Marie sich wie ein kleines Mädchen vorgekommen, wenn sie das Geschäft betreten hatte, doch heute schob sie den Kinderwagen selbstbewusst durch die Tür. Die verkaufen auch einfach Bücher, genau wie wir, nur halt ein bisschen mehr, dachte sie und ließ ihren Blick über die Regale wandern.
»Wie kann ich helfen, gnä’ Frau?«
Immer noch war Marie ein wenig irritiert, wenn sie jemand mit »Gnä’ Frau« anredete. Dabei war sie doch eine! Zumindest äußerlich. Das Kleid hatte ihre Nachbarin für sie genäht, aus einem aufgetrennten Kleid der verstorbenen Schwiegermutter. Es war zwar gebraucht, sah aber aus wie neu. Den Hut hatte sie von Fanni zum Geburtstag bekommen. Wahrscheinlich kostete er so viel, wie Marie damals als Kindermädchen in einem Monat verdient hatte. Sie war verheiratet, hatte einen Sohn und betrieb zusammen mit ihrem Mann eine Buchhandlung. Als er an der Front gewesen war, hatte sie den Laden sogar ganz allein geführt. Es war also nur recht, dass der Angestellte im großen Geschäft sie mit »Gnä’ Frau« ansprach.
»Grüß Gott. Ich möchte gerne zu Frau Gold. Ist sie da?«
»Ja, sie ist oben im Büro. Wen darf ich melden?«
»Marie Nowak.«
»Gut, Frau Nowak, ich komme gleich wieder.«
Der Angestellte legte die Bücher, die er gerade in seinen Händen hielt, auf einen Tisch, und Marie unterdrückte den Impuls, den Stapel geradezurücken. Fast musste sie lachen, aus ihr war schon eine richtige Buchhändlerin geworden. Und plötzlich schien es ihr wichtig, dass dieser ältere graue Herr, der hier Bücher hin und her schlichtete, wusste, dass sie nicht einfach nur eine »gnädige Frau« war, sondern eine Kollegin. Sie nahm das oberste in die Hand und strich über den Umschlag.
»Haben Sie ihn schon gelesen?«
»Pardon?« Der Buchhändler hatte sich gerade abgewandt und drehte sich jetzt wieder zu ihr um.
»Na, den neuen Gustav Meyrink? Der Golem? Wie finden Sie ihn denn? Sie sind doch hier Buchhändler, oder?«
»Äh, ja, selbstverständlich. Ich bin gestern Abend damit fertig geworden, und ich muss sagen, na ja, ein bisschen seltsam, fast gruselig. Ich meine, sehr spannend und unheimlich, ich konnte gar nicht aufhören zu lesen.«
»Ja, genauso ging es mir auch. Bemerkenswert ist schon, woher dieser Meyrink seine Fantasie hat. So etwas muss einem erst mal einfallen.«
»Tja, da haben Sie recht.«
»Mein Mann hat gesagt, der war bis vor Kurzem noch Kaufmann, so wie wir, und plötzlich über Nacht wird er zum Schriftsteller?«
Fritzi hatte in seinem Wagen zu weinen begonnen, und Marie nahm ihn auf den Arm. Sofort hörte er auf, blickte sich neugierig um, und der Buchhändler lachte: »Na, das wird wohl der Nachwuchs. Sehen Sie nur, wie interessiert er schaut.«
»Na ja, er ist schließlich ein Buchhändlersohn.« Marie versuchte, ihre Stimme nicht allzu stolz klingen zu lassen, der ältere Kollege lächelte ihr wissend zu und verschwand über die kleine Treppe, die vom hinteren Bereich der Buchhandlung nach oben in die Büroräume führte.
»Meine Liebe! Was machst du denn hier? Und der kleine Fritzi ist auch da.« Fanni eilte die Stiege hinunter, nahm Marie das Kind ab und drückte es an sich. Friedrich grinste sie zahnlos an und griff mit seinen Händchen in ihre Haare.
»Aua, du Unhold«, lachte Fanni. »Hat dir keiner gesagt, dass man so keine jungen Damen rumkriegt?«
»Entschuldige, dass ich dich störe, so mitten unter der Woche. Du hast sicher viel zu tun.«
»Ach, ich freue mich, mein Vater und ich versuchen gerade, uns den katastrophalen Umsatz schönzureden.«
»Ja, bei uns ist auch so wenig los. Wer braucht schon Bücher in Zeiten wie diesen? Ist dein Vater oben?«
»Ja, willst du ihn besuchen? Jetzt bin ich aber beleidigt, ich dachte, du kommst zu mir.«
»Ja, eh. Aber ich glaube, wir brauchen ihn auch.«
»Du bist heute aber geheimnisvoll. Na gut, gehen wir rauf, er freut sich sicher, dich zu sehen.«
Der alte Gold sprang von seinem Schreibtischsessel auf, als die beiden Frauen das Büro betraten. »Welch eine Freude, dich zu sehen, Marie! Wie geht es dir? Dünn bist du geworden, esst ihr genug? Wie geht es Oskar?«
Wie immer, wenn Marie den alten Herrn sah, durchströmte sie ein Gefühl von Wärme. Er war so ein gütiger, lieber Mensch, und ohne seine Hilfe hätte sie die Monate, nachdem Oskar eingezogen worden war, wohl nicht überstanden. Schließlich hatte sie kaum Zeit gehabt, sich einzuarbeiten, und als Oskar fort war, trug sie plötzlich die Verantwortung für das Geschäft. Herr Gold hatte ihr damals einen pensionierten Kollegen vermittelt, der Marie unterstützte – ehrenamtlich, wie er immer betonte –, doch Marie wusste, dass er von der Familie Gold bezahlt wurde. Die Buchhandlung Gold übernahm auch den gesamten Einkauf der neuen Bücher, die dann fix und fertig zu Marie nach Währing geliefert wurden.
»Gut geht’s uns, danke!«
»Na, das klingt aber recht verzagt. Was ist los, kann ich helfen?«
»Du hast uns schon so viel geholfen, Jakob. Ich trau mich gar nicht, dich um noch etwas zu bitten.« Immer noch kam es Marie unerhört vor, den alten Mann mit seinem Vornamen anzusprechen, aber er hatte immer wieder darauf gedrängt und ihr lachend angedroht, nicht mehr mit ihr zu sprechen, wenn sie ihn weiterhin siezte.
»Raus damit, mein Mädchen. Du weißt, ich stehe immer in deiner Schuld. Schließlich warst du es, die mir meine Tochter wieder zurückgebracht hat.«
»Ach, das stimmt doch nicht. Die wäre auch allein wiedergekommen.«
»Da bin ich mir nicht so sicher, oder, Fanni?«
»Ach, die Marie war schon ein guter Grund, wieder ins Leben zurückzukehren.«
Wenn man Fanni so ansah, konnte man sich kaum vorstellen, dass sie noch vor ein paar Monaten in einer Anstalt gewesen war und man nicht genau gewusst hatte, ob sie den Schritt in ein normales Leben wieder schaffen würde. Gut sah sie aus, ihre Augen leuchteten, die Haare sprangen aus ihrem lockeren Zopf, und obwohl sie alle in diesen schlechten Zeiten zu blass und zu dünn waren, sah Fanni lebensfroh aus. Und vor ein paar Wochen hatte sie angedeutet, dass sie sich eventuell verliebt hatte, doch Marie traute sich nicht nachzufragen. Dass Fanni keinen Mann suchte, sondern die Gesellschaft von jungen Damen bevorzugte, war für Marie trotz aller Verbundenheit unvorstellbar.
»Also, Marie, wie kann ich dir helfen?« Jakob deutete auf den einen freien Sessel, doch Marie blieb stehen.
»Also, der Oskar ist ja jetzt schon ein paar Wochen zu Hause.«
»Ja, wie geht es seiner Schulter?«
»Seiner Schulter geht’s gut. Das ist ja das Problem.«
»Wie meinst du das?« Der alte Gold lachte auf.
»Na ja, sie ist so gut wie geheilt, und jetzt hat der Oskar Angst, dass er wieder an die Front muss.«
»Verstehe. Das ist vermutlich auch nicht unrealistisch. Die ziehen alles ein, was zwei Beine hat. Ich kann von Glück reden, dass sie mich alten Zausel nicht holen.«
»Ja, aber er kann nicht mehr an die Front!« Maries Stimme wurde unwillkürlich laut, Jakob und Fanni Gold sahen sie erstaunt an, das Baby auf Fannis Arm begann zu weinen.
Marie nahm ihren Sohn an sich und setzte sich dann doch auf den einzigen Stuhl, der nicht voller Bücher war. »Er hat gesagt, er bringt sich um, wenn er noch einmal einrücken muss. Er geht daran kaputt. Jakob, hilf uns bitte!«
»Wie kann ich denn helfen? Ein alter jüdischer Buchhändler! Wir können ihn ja schließlich nicht verstecken, oder?«
»Nein, aber ich habe gehört, es gibt auch hier kriegswichtige Aufgaben. Im Ministerium? Schreibarbeiten? Archivtätigkeiten? Hast du nicht von irgendwelchen Schriftstellern erzählt, die da arbeiten? Die sind auch nicht alt, oder?«
»Ja, ich habe gehört, dass Stefan Zweig im Kriegsarchiv arbeitet. Und der Hofmannsthal im Kriegsfürsorgeamt.«
»Ja, genau! Das muss doch für einen Buchhändler auch gehen.«
»Ich glaube nicht, meine Liebe. Er müsste untauglich sein.« Jakob Gold stützte seinen Kopf auf und blickte gedankenverloren aus dem Fenster.
»Das ist ja das Problem. Er ist gesund. Die Schulter kann er fast wieder wie vorher bewegen.«
»Wir müssten ihn halt krank machen.« Jakob Gold strich nachdenklich über seinen Bart.
»Jetzt schau nicht so erschrocken, mein Kind. Ich tu ihm schon nichts, deinem Oskar. Aber ich habe gerade eine Idee. Du gehst jetzt mit der Fanni Kaffee trinken, und ich telegrafier meinem Bruder nach Mariazell.« Herr Gold hatte es plötzlich eilig, die beiden aus dem Büro zu bekommen. Sie liefen die Stufen hinunter, den glucksenden Fritz im Arm. Am Treppenabsatz rannten sie fast eine Dame mit ausladenden Hüften um, entschuldigten sich flüchtig, schnappten den Kinderwagen, den Marie neben der Eingangstür stehen gelassen hatte, und traten in die warme Maisonne. Der Graben lag in wunderschönem Licht, es herrschte reges Treiben, und wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man nie geahnt, dass ein paar Hundert Kilometer weiter ein schrecklicher Krieg tobte, in den sie alle verwickelt waren, ja, den sie sogar vom Zaun gebrochen hatten.
»Los, wir gehen ins Café Korb. Ich geb einen Apfelstrudel aus.«
»Lass uns einen kleinen Umweg gehen, dann schläft er vielleicht ein und wir haben Ruhe.«
Und tatsächlich, als die beiden im Kaffeehaus angekommen waren, war Friedrich im Kinderwagen eingeschlafen und sie bestellten Melange und Apfelstrudel.
»Was glaubst du hat er vor, dein Vater?«
»Ich weiß es nicht. Aber es fällt ihm sicher was ein, ganz bestimmt. Mach dir keine Sorgen.«
Marie stocherte mit der Gabel in ihrem Apfelstrudel. Schließlich gab sie sich einen Ruck und sagte: »Das ist aber nicht alles, worüber ich mir Sorgen mache.«
»Was denn noch?«
»Ich glaub, ich bin in anderen Umständen.«
»Nein! Was heißt, du glaubst?«
»Na ja, eigentlich weiß ich es. Ich spür’s halt.«
»Das ist aber kein guter Zeitpunkt.«
»Das weiß ich auch!« Marie erschrak selbst über die Heftigkeit ihrer Stimme. »Entschuldige. Weißt du, wir haben nie … Oskar hat mich gar nicht mehr berührt, so kaputt, wie er war. Nur am Montag, in der Nacht, da haben wir endlich geredet, und er hat geweint und dann haben wir …«
»Montagnacht?« Fanni lachte auf. »Du Dummerchen, Montag, das war ja erst vor vier Tagen, dann kannst du es ja noch gar nicht wissen.«
»Doch, ich spür es. Das war beim Fritzi auch so. Ich hab es sofort gespürt. Gleich am nächsten Tag.«
»Jetzt beruhige dich erst einmal. Das muss gar nichts heißen.«
Marie hatte zu weinen begonnen, und Fanni legte die Arme um sie.
»Ach Liebchen, es wird schon nichts sein. Jetzt wartest du ein, zwei Wochen, und du wirst sehen, dass du dir das nur eingebildet hast. Jetzt iss deinen Strudel.«
Marie ließ sich beruhigen, vielleicht hatte Fanni ja recht und es war gar nichts. Aber wenn sie auf den Teller mit dem Apfelstrudel blickte, zog sich ihr Magen zusammen, und sie legte die Gabel wieder auf den Tisch. Vielleicht hatte sie sich doch nur einen Virus eingefangen.
Ein paar Tage später kam Oskar am Abend vom Geschäft nach Hause und ließ sich erschöpft auf die Küchenbank fallen. »Der Jakob Gold hat mich angerufen, er will am Abend zu uns kommen.«
»Mein Gott, ich hab gar nichts vorbereitet! Wir haben kein Essen für ihn, nur noch die Reste vom Bohneneintopf.«
»Ich weiß, ich hab ihm auch gesagt, dass wir nicht für einen Besuch eingerichtet sind, aber er hat gesagt, es sei wichtig. Da, ich hab noch einen Wecken Brot mitgebracht, den schneiden wir auf, und dann wird’s schon reichen.«
Aber Jakob Gold wollte gar nichts essen. Er setzte sich an den gedeckten Tisch und nahm das Stück Brot, das ihm Marie angeboten hatte, biss aber nicht davon ab, sondern zerbröselte es zwischen seinen Fingern.
»Hört zu. Ihr schließt am Samstag den Laden und fahrt nach Mariazell. Die Zugfahrkarten sind hier.« Er holte ein Kuvert aus seiner Anzuginnentasche und schob es über den Tisch. Marie und Oskar starrten darauf und sagten erst mal nichts. Oskar räusperte sich. »Was machen wir denn in Mariazell?«
»Zunächst werdet ihr euch ein wenig erholen. Ihr geht spazieren, vielleicht sogar ein bisschen wandern. Ihr wohnt wieder im Dachzimmer bei meinem Bruder.«
»Ja, aber warum? Warum sollen wir denn ausgerechnet jetzt nach Mariazell?«
»Am Sonntagabend wirst du dann einen Schwächeanfall haben. Du stürzt in der Wohnung, und mein Bruder bringt dich ins Hospital.«
»Ich versteh gar nichts. Jakob, was ist mit dir? Geht’s dir gut?« Oskar schüttelte den Kopf.