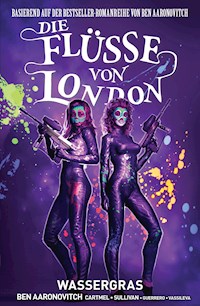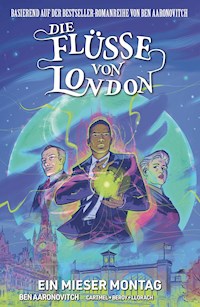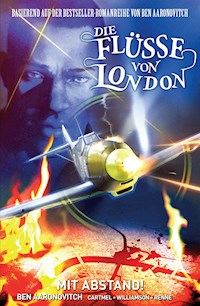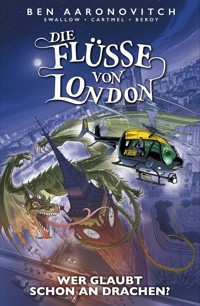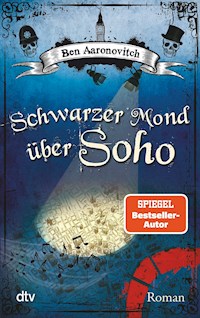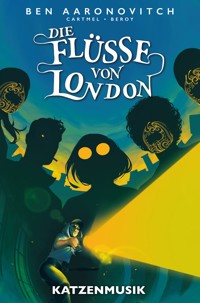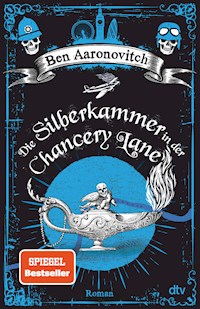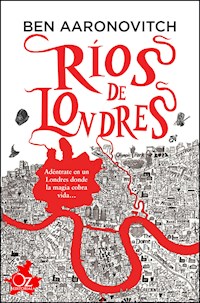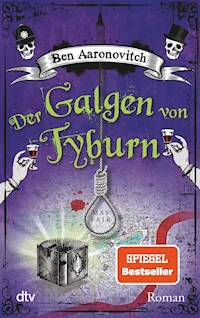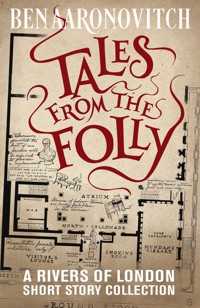Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goyalit
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)
- Sprache: Deutsch
Mord und Magie im Londoner Untergrund Es ist ja nicht so, dass Peter Grant, Zauberer in Ausbildung und Police Constable, nichts für das Pauken von Lateinvokabeln übrighätte – bestimmt nicht! Aber es ist doch immer wieder schön, wenn zur Abwechslung auch mal reelle Polizeiarbeit gefragt ist. Ein Unbekannter wird im U-Bahn-Tunnel nahe der Station Baker Street tot aufgefunden – erstochen, und es deutet alles auf die Anwesenheit von Magie hin. Ein Fall für Peter! Der unbekannte Tote stellt sich als amerikanischer Kunststudent und Sohn eines US-Senators heraus und ehe man »internationale Verwicklungen« sagen kann, hat Peter bereits die FBI-Agentin Kimberley Reynolds mitsamt ihren felsenfesten religiösen Überzeugungen am Hals. Dabei gestalten sich seine Ermittlungen auch so schon gruselig genug, denn in vergessenen Flüssen und viktorianischen Abwasserkanälen hört er ein Wispern von alten Künsten und gequälten Geistern…
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Es ist ja nicht so, dass Peter Grant, Police Constable und Zauberlehrling, nichts für das Pauken von Zaubersprüchen und Lateinvokabeln übrighätte – keineswegs! Aber es ist doch immer wieder schön, wenn zur Abwechslung auch mal handfeste Polizeiarbeit gefragt ist. Ein Unbekannter wird im U-Bahn-Tunnel nahe der Station Baker Street tot aufgefunden – erstochen, und es deutet alles auf die Anwesenheit von Magie hin. Ein Fall für Peter! Der unbekannte Tote stellt sich als amerikanischer Kunststudent und Sohn eines US-Senators heraus, und ehe man ≫internationale Verwicklungen≪ sagen kann, hat Peter bereits die FBI-Agentin Kimberley Reynolds mitsamt ihren felsenfesten religiösen Überzeugungen am Hals. Dabei gestalten sich seine Ermittlungen auch so schon gruselig genug, denn in vergessenen Tunneln und viktorianischen Abwasserkanälen hört er ein Wispern von alten Künsten und gequälten Geistern …
Ben Aaronovitch
Ein Wispernunter Baker Street
Roman
Deutsch von Christine Blum
In Gedenken an Blake Snyder (1957-2009), der nicht nur die Katze, sondern auch den Schriftsteller, die Hypothek und die Karriere rettete.
Und ich spräche zu ihnen, die bebten vor Furcht:»Was ist euer kläglich Geschmier,Was der kunstfert’ge Meißel des Phidias,Der dem Marmor verlieh seine Zier,Gegen dies unser Monster, das Zeiten lang schliefIn den Tiefen von Erde und Stein,Bis wir hoben es frei mit Hurra und JuchheiUnd hämmerten Atem ihm ein?«
Alexander Anderson, The Engine
Sonntag
1Tufnell Park
Im Sommer hatte ich den Fehler begangen, meiner Mum zu erzählen, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiente. Nicht das mit der Polizei – das wusste sie natürlich, sie war ja bei meiner Abschlussfeier in Hendon dabei gewesen. Nein, ich meine, dass ich für die Abteilung der Metropolitan Police arbeitete, die fürs Übernatürliche zuständig ist. Meine Mum hatte sich das als »Hexenjäger« übersetzt – was Vorteile hatte, weil meine Mum, wie die meisten Westafrikaner, Hexenjäger für einen viel anständigeren Beruf hält als Polizist. In einem unvermuteten Anfall von mütterlichem Stolz ließ sie es sich nicht nehmen, sofort all ihren Freunden und Verwandten mein neues Arbeitsgebiet zu schildern – einem Personenkreis, der nach meiner Schätzung mindestens zwanzig Prozent der gegenwärtig in England lebenden Sierra Leoner Auslandsgemeinde umfasst. Darunter fielen auch Adam Kamara, der im selben Sozialwohnblock wohnte wie meine Mum, und seine dreizehnjährige Tochter Abigail. Welche am letzten Sonntag vor Weihnachten beschloss, dass ich mir mal dieses Gespenst anschauen sollte, das sie entdeckt hatte. Den Kontakt zu mir stellte sie her, indem sie meiner Mum so lange auf die Nerven fiel, bis diese nachgab und mich auf dem Handy anrief.
Ich war nicht gerade begeistert, denn der Sonntag ist einer der wenigen Tage, an denen ich morgens nicht am Schießstand trainieren muss, und meine Pläne hatten eigentlich daraus bestanden, gründlich auszuschlafen und mir später im Pub das Fußballspiel anzuschauen.
»Also, wo ist das Gespenst?«, fragte ich, als Abigail die Wohnungstür öffnete.
»Wieso seid ihr zu zweit?«, fragte Abigail. Sie war ein kleines dürres Mädchen gemischter Herkunft, deren helle Haut jetzt im Winter ziemlich fahl war.
»Das ist meine Kollegin Lesley May«, sagte ich.
Abigail starrte Lesley misstrauisch an. »Warum haben Sie ’ne Maske auf?«
»Weil mein Gesicht auseinandergefallen ist«, sagte Lesley.
Abigail überdachte das kurz und nickte dann. »Aha.«
»Also, wo ist es?«, wiederholte ich.
»Es ist ein Er«, sagte Abigail. »In der Schule.«
»Okay, gehen wir.«
»Was, jetzt? Es ist eiskalt!«
»Das haben wir schon gemerkt.« Es war ein trüber grauer Wintertag mit dieser Art fiesem kaltem Wind, der sich durch jede Ritze in der Kleidung bohrt. »Kommst du jetzt oder nicht?«
Sie zog die klassische Dreizehnjährigen-Protestschnute, aber ich war klar im Vorteil, da ich weder ihre Mutter noch ihr Lehrer war. Ich wollte nichts von ihr – ich wollte heim und Fußball schauen.
»Dann halt nicht«, sagte ich und drehte mich um.
»Hey, wartet«, rief sie. »Ich komme ja schon.«
Ich drehte mich wieder zu ihr um und bekam prompt die Tür vor der Nase zugeknallt.
»Sie hat uns nicht hereingebeten«, sagte Lesley.
»Nicht hereingebeten werden« ist eines der Kästchen auf dem »Verdächtiges Verhalten«-Bingozettel, den jeder Polizist im Kopf mit sich herumträgt, zusammen mit »Abnorm riesiger Hund« oder »Hat viel zu schnell ein Alibi zur Hand«. Wer am Ende in allen Kästchen ein Kreuz vorweisen kann, hat gute Aussichten auf einen Besuch in der nächsten Polizeistation – Unkosten werden übernommen.
»Es ist Sonntagmorgen«, sagte ich. »Wahrscheinlich liegt ihr Dad noch im Bett.«
Wir beschlossen, im Auto auf sie zu warten, und vertrieben uns die Zeit damit, die Provianttüten der Überwachungen des letzten Jahres zu sichten. Wir fanden eine unangebrochene Rolle Fruchtgummis, und Lesley hatte mir gerade befohlen, wegzuschauen, damit sie die Maske anheben und sich eines in den Mund stecken konnte, da tippte Abigail ans Fenster.
Wie ich hatte Abigail ihre Haare vom »falschen« Elternteil geerbt, aber während man sie mir, als ich ein Junge war, einfach superkurz abrasierte, wurde Abigail von ihrem Vater reihum zu allen verfügbaren Friseursalons, weiblichen Verwandten und eifrigen Nachbarinnen geschleppt, um das Problem unter Kontrolle zu bekommen. Von Anfang an hatte Abigail sich das Haar nur unter Heulen und Zähneklappern flechten, chemisch glätten oder mit Heizwicklern bearbeiten lassen, aber ihr Dad blieb bei seinem festen Vorsatz, dass sie ihn in der Öffentlichkeit nicht blamieren sollte. Die Sache nahm erst ein Ende, als Abigail mit elf erklärte, sie habe die Nummer des Kinder-Sorgentelefons im Handy gespeichert, und der Nächste, der ihr mit Haarverlängerungen, Glattmachern oder, Gott behüte, einem Bügeleisen zu nahe käme, werde sich vor dem Jugendamt verantworten müssen. Seither trug sie ihren wachsenden Afro in einer Art Kugel auf dem Hinterkopf. Da die nicht in die Kapuze ihrer pinkfarbenen Winterjacke passte, trug sie eine gigantische Rasta-Mütze, mit der sie aussah wie ein rassistisches Klischee aus den Siebzigern. Meine Mum hält Abigails Haare für ein öffentliches Ärgernis, aber immerhin schützte die Kopfbedeckung ihr Gesicht einwandfrei vor dem Nieselregen.
»Was ist mit dem Jaguar passiert?«, fragte Abigail, als ich ihr die hintere Tür aufmachte.
Mein Boss besitzt einen originalen Jaguar Mark 2 mit 3,8-Liter-Hubraum, der, weil ich ihn ein paarmal im Innenhof geparkt hatte, bereits Eingang ins Reich der örtlichen Sagen und Mythen gefunden hatte. Einen Oldtimer dieser Klasse findet selbst die Jugend des digitalen Zeitalters noch cool – der knallorange Ford Focus ST, in dem wir gekommen waren, galt hingegen nur als schlappe Assi-Karre, in einschlägigen Kreisen auch als Asbo bekannt.
»Der ist tabu«, sagte Lesley. »Bis Peter den Polizei-Fahrlehrgang gemacht hat.«
»Weil du neulich den Rettungswagen in der Themse versenkt hast?«, fragte Abigail.
»Ich hab ihn nicht in der Themse versenkt.« Ich lenkte den Asbo auf die Leighton Road und brachte die Rede schnell wieder auf das Gespenst. »Wo in der Schule spukt es denn?«
»Nicht in der Schule. Darunter. Wo die Bahnschienen sind.«
Die Schule, von der sie sprach, war die Gesamtschule Acland Burghley, in der schon zahllose Generationen von Bewohnern des Peckwater Estate geschmachtet hatten, einschließlich meiner Wenigkeit. Wobei »zahllos« nicht ganz stimmt, weil die Schule erst Ende der sechziger Jahre erbaut wurde – also sagen wir mal, vier. Maximal.
Die Schule lag ein Stück den Dartmouth Park Hill hinauf. Entworfen hatte sie offensichtlich ein glühender Bewunderer von Albert Speer – insbesondere von dessen festungstechnischen Monumentalwerken am Atlantikwall. Mit ihren drei Türmen und den dicken Betonwänden war die Schule bestens geeignet als Befestigungsanlage für die strategisch wichtige fünfstrahlige Kreuzung am Tufnell Park, denn von hier aus hätte man jede anstürmende Schwadron der Islingtoner leichten Infanterie mühelos von der Hauptstraße fegen können.
Ich parkte in der Ingestre Road, hinter dem Schulgelände, und wir gingen knirschend den Schotterweg entlang, der zur Fußgängerbrücke über die Eisenbahnlinie führt. Die Linie besteht aus zwei Doppelgleisen, von denen das hangabwärts gelegene Paar mindestens zwei Meter tiefer verläuft als das andere, so dass wir auf der alten Brücke erst mal zwei rutschige Treppenabschnitte überwinden mussten.
Vor uns lag die Betonplattform, die man über die Bahntrasse gebaut hatte, um darauf die Sportanlagen und den Spielplatz der Schule unterzubringen. Die beiden so entstandenen Unterführungen wirkten von der Fußgängerbrücke aus (ganz im Einklang mit der übrigen Architektur) wie die Eingänge zu zwei U-Boot-Bunkern.
Abigail deutete auf den linken Tunnel. »Da unten.«
»Du bist zu den Gleisen runtergeklettert?«, fragte Lesley streng.
»Ich war vorsichtig.«
Das beruhigte weder mich noch Lesley. Bahngleise sind tödlich. Jedes Jahr kommen etwa sechzig Leute zu Tode, weil sie leichtsinnig irgendwelche Bahngleise überqueren. Der einzige Lichtblick dabei ist, dass dafür die BTP – die British Transport Police – zuständig ist und nicht ich.
Ein anständig ausgebildeter Polizist muss, bevor er etwas so Idiotisches tut wie ein Eisenbahngleis zu betreten, geschwind eine Risikoanalyse durchführen. Das korrekte Vorgehen wäre gewesen, qualifizierte Unterstützung von der BTP anzufordern, die sodann – eventuell – das Gleis sperren würde, damit ich und Abigail, Verzeihung: Abigail und ich, in Ruhe auf Gespensterjagd gehen konnten.
Die BTP nicht anzufordern hatte den Nachteil, dass, falls Abigail etwas passierte, meine Karriere zu Ende wäre und, da ihr Vater zum alten Schlag westafrikanischer Patriarchen gehörte, mein Leben wahrscheinlich auch. Sie anzufordern hatte hingegen den Nachteil, dass ich ihnen würde erklären müssen, wonach wir suchten, und mich so zum Objekt allgemeiner Belustigung machen würde. Wie jeder junge Mann seit Anbeginn der Zeit zog ich die tödliche Gefahr der sicheren Blamage vor.
Lesley meinte, wir sollten wenigstens zuerst den Fahrplan konsultieren.
»Es ist Sonntag«, sagte Abigail. »Die machen heute den ganzen Tag Gleisarbeiten.«
»Woher weißt du das?«, wollte Lesley wissen.
»Ich hab nachgeschaut. Warum ist Ihr Gesicht auseinandergefallen?«
»Weil ich den Mund zu weit aufgerissen hab.«
»Wie kommen wir da runter?«, unterbrach ich schnell.
Auf dem billigen Baugrund beidseits der Bahnlinie standen Sozialwohnblocks. Hinter dem Fünfziger-Jahre-Hochhaus auf der Nordseite gab es ein kleines regendurchweichtes Rasenstück mit einem Saum aus Gebüsch. Es grenzte an den Maschendrahtzaun, hinter dem die Schienen lagen. Durch das Gebüsch führte ein Tunnel in Kindergröße zu einem Loch im Zaun. Gebückt folgten wir Abigail hindurch. Lesley kicherte, als mich ein paar klatschnasse Zweige mitten ins Gesicht trafen. Sie blieb kurz hocken und untersuchte das Loch genauer. »Eine Drahtschere war da nicht am Werk. Ich würde sagen, natürlicher Verschleiß, vielleicht Füchse.«
Den Zaun entlang zog sich ein lockerer Bodenbelag aus leeren Chipspackungen und Getränkedosen. Lesley stocherte mit dem Fuß darin herum. »Die Junkies waren noch nicht hier – ich seh keine Nadeln.« Sie blickte Abigail an. »Woher weißt du von dem Loch?«
»Man sieht’s von der Brücke aus.«
Mit möglichst viel Abstand zu den Gleisen gingen wir unter der Fußgängerbrücke hindurch in den Betonschlund unter dem Sportplatz. Die Wände waren bis in Kopfhöhe mit Graffiti überzogen: sorgfältig gemalte Ballonbuchstaben in ausgebleichten Primärfarben, darüber jede Menge schlampig hingekritzelte Tags, ausgeführt mit allem Möglichen, von Sprühdosen bis zu dicken Filzschreibern. Es gab auch ein paar Hakenkreuze, trotzdem glaubte ich nicht, dass es Admiral Dönitz hier gefallen hätte.
Immerhin bot der Tunnel Schutz vor dem Nieselregen. Wegen der flachen Decke und der enormen Größe wirkte er wie eine leer stehende Lagerhalle. Es roch nach Urin, aber zu stechend für Menschen – Füchse wahrscheinlich, dachte ich.
»Wo hast du es gesehen?«, fragte ich.
»Ihn. In der Mitte, wo’s dunkel ist.«
Wo sonst, dachte ich.
Lesley wollte von Abigail wissen, was sie sich dabei gedacht hatte, überhaupt hier reinzugehen.
»Ich hab den Hogwarts-Express gesucht.«
Nicht den echten, wie sie sofort einräumte. Weil, den gab’s ja nur in den Büchern, stimmt’s? Aber ihre Freundin Kara, von deren Wohnung aus man die Gleise sehen konnte, hatte erzählt, dass sie dort ab und zu eine Dampflok sah, von der sie glaubte, es könne die sein, die man verwendet hatte.
»Also, im Film«, sagte Abigail.
»Und warum konntest du sie dir nicht einfach von der Brücke aus anschauen?«, fragte Lesley.
»Sie fährt zu schnell. Ich muss die Räder zählen. Die im Film ist nämlich eine GWR 4900 Klasse 5972 mit 4-6-0-Konfiguration.«
»Ich wusste gar nicht, dass du eine Trainspotterin bist«, sagte ich.
Abigail knuffte mich in den Arm. »Bin ich nicht. Die sammeln doch nur Zahlen. Ich wollte eine Theorie überprüfen.«
»Und, hast du die Lok gesehen?«, fragte Lesley.
»Nein. Nur den Geist. Und deshalb wollte ich, dass Peter mit herkommt.«
Ich fragte, wo sie das Gespenst gesehen habe, und sie zeigte uns die Markierung, die sie gemacht hatte.
»Du bist sicher, dass es genau hier aufgetaucht ist?«
»Er«, sagte Abigail. »Ich hab schon tausendmal gesagt, dass es ein Er ist.«
»Momentan ist er jedenfalls nicht da«, bemerkte ich.
»Natürlich nicht«, sagte sie. »Wenn er die ganze Zeit da wäre, hätte ihn sicher schon mal jemand erwähnt.«
Das war ein gutes Argument, und ich nahm mir vor, die Berichte im Folly durchzugehen, sobald ich zurück war. Neben der Allgemeinen Bibliothek hatte ich dort ein Magazin mit Aktenschränken voller Papiere aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Darunter waren Notizbücher mit handschriftlichen Aufzeichnungen über Geistererscheinungen – es sah fast so aus, als wäre Ghostspotting ein Lieblingshobby der heranwachsenden Zauberschüler von anno dazumal gewesen.
»Hast du ein Foto gemacht?«, fragte Lesley.
»Ich hatte mein Handy ja schon in der Hand, wegen dem Zug«, sagte Abigail. »Aber als mir einfiel, dass ich ein Foto machen könnte, war er schon wieder weg.«
»Spürst du was?«, fragte Lesley mich.
Als ich die Stelle betrat, wo das Gespenst gestanden hatte, wehte mich ein kalter Luftzug an, und durch den Mix aus Fuchsurin und nassem Beton drangen ein Hauch von Propan oder Butan, ein fieses Kichern und das tiefe Wummern eines sehr großen Dieselmotors.
Wo Magie gewirkt wurde, hinterlässt sie Spuren. Unser Fachausdruck dafür ist Vestigia. In Stein wird sie am besten gespeichert, in Lebewesen am schlechtesten. Beton ist fast so gut wie Stein, trotzdem sind die Spuren häufig schwach und kaum von den Produkten der eigenen Fantasie zu unterscheiden. Das eine vom anderen zu trennen ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man sich aneignen muss, wenn man zaubern lernen will. Die Kälte kam vermutlich vom Wetter, das fiese Kichern – eingebildet oder real – von Abigail. Der Propangeruch und das Motorgedröhn deuteten auf die übliche Tragödie hin.
»Und?«, fragte Lesley. Was Vestigia angeht, bin ich besser als sie, und nicht nur deshalb, weil ich schon länger in Ausbildung bin.
»Hier ist was«, sagte ich. »Willst du ein Licht machen?«
Lesley entfernte den Akku aus ihrem Handy und wies Abigail an, das Gleiche zu tun. Als diese zögerte, sagte ich: »Mikrochips, auf denen Saft ist, werden durch Magie zerstört. Wenn du nicht willst, musst du nicht. Es ist dein Handy.«
Abigail zog das letztjährige Ericsson-Modell hervor, ließ es mit geübter Leichtigkeit aufschnappen und nahm den Akku heraus. Ich nickte Lesley zu – mein Handy besitzt eine manuelle Sicherung, die ich mit Hilfe eines meiner Cousins angebracht habe, der schon mit zwölf Handys auseinandergenommen hat.
Lesley streckte die Hand aus, sprach das Zauberwort, und über ihrer offenen Handfläche erschien eine etwa golfballgroße Lichtkugel. Das Zauberwort lautete in diesem Fall Lux, und die gebräuchliche Bezeichnung für den Zauber ist Werlicht – es ist der erste Zauber, der einem beigebracht wird. Lesleys Werlicht leuchtete perlweiß und warf weiche Schatten an die Betonwände des Tunnels.
»Krass!«, rief Abigail. »Ihr könnt echt zaubern.«
»Da ist er«, sagte Lesley.
An der Wand erschien ein junger Mann. Er war weiß, um die zwanzig und hatte eine hochgegelte, unnatürlich blonde Stachelmähne. Seine Kleidung bestand aus billigen weißen Turnschuhen, Jeans und einer Donkeyjacke. Er hielt eine Spraydose in der Hand, die er in einem sorgfältigen Bogen über den Beton führte. Das Zischen war kaum hörbar, und keine frische Farbe traf die Wand. Als er unterbrach, um die Dose zu schütteln, hörte man das Klappern nur ganz gedämpft.
Lesleys Werlicht wurde schwächer und rötlich.
»Dreh’s ein bisschen auf«, bat ich sie.
Sie konzentrierte sich, und das Werlicht flammte auf, ebbte aber sofort wieder ab. Das Zischen wurde lauter, und jetzt konnte ich sehen, was er sprayte. Er hatte sich ganz schön was vorgenommen – einen Satz, der ganz am Anfang des Tunnels begann.
»Bunt ist das Da …«, las Abigail. »Was soll denn das heißen?«
Ich legte den Finger an die Lippen und wechselte einen Blick mit Lesley, die mir mit einer Geste bedeutete, dass sie den Zauber, falls nötig, den ganzen Tag würde aufrechterhalten können. Nicht dass ich ihr das je erlaubt hätte. Ich zog mein Standard-Polizeinotizbuch aus der Tasche und zückte meinen Kuli.
»Entschuldigen Sie«, sagte ich in meinem besten Polizistenton. »Darf ich Sie kurz etwas fragen?« Den Polizistenton bringen sie einem tatsächlich in Hendon bei. Das Ziel ist, einen Tonfall zu entwickeln, der unfehlbar durch jeglichen Dunst aus Alkohol, blinder Wut oder unbestimmt schlechtem Gewissen dringt, in dem der angesprochene Bürger sich gerade befinden mag.
Der junge Mann ignorierte mich. Er zog eine zweite Spraydose aus der Jackentasche und begann die Konturen eines großen S zu sprühen. Ich versuchte es noch ein paarmal, aber er schien fest entschlossen, zuerst das Wort DASEIN fertigzustellen.
»Heda, Freundchen«, rief Lesley. »Aufhören! Dreh dich um und antworte!«
Das Zischen hörte auf, die Spraydosen verschwanden in den Taschen, und der junge Mann drehte sich um. Er hatte ein scharf geschnittenes bleiches Gesicht, und seine Augen waren hinter einer getönten Ozzy-Osbourne-Brille verborgen.
»Ich bin beschäftigt«, sagte er.
»Das sehen wir«, gab ich zurück und zeigte ihm meinen Dienstausweis. »Wie ist Ihr Name?«
»Macky.« Er wandte sich wieder seiner Arbeit zu. »Ich bin beschäftigt.«
»Womit denn?«, fragte Lesley.
»Ich mach die Welt besser.«
»Ein Gespenst!«, sagte Abigail ungläubig.
»Du hast uns doch hergeschleppt«, versetzte ich.
»Ja, aber beim ersten Mal war er dünner«, sagte sie. »Viel dünner.«
Ich erklärte, dass er aus der Magie, die Lesley erzeugte, Kraft zog. Das führte zu der unvermeidlichen Frage.
»Und was ist Magie?«
»Wissen wir nicht. Es ist keine Form elektromagnetischer Strahlung. Das weiß ich.«
»Vielleicht Hirnströme«, schlug Abigail vor.
»Unwahrscheinlich. Die sind elektrochemischen Ursprungs, und sie müssten sich außerhalb des Kopfes auf irgendeine physikalische Art fortpflanzen.« Ich sollte einfach behaupten, Magie entstünde durch Feenstaub oder Quantenverschränkung (was im Prinzip das Gleiche ist wie Feenstaub, nur mit dem Wort »Quanten« drin).
»Reden wir jetzt mit diesem Typen oder nicht?«, fragte Lesley. »Sonst mache ich das hier jetzt nämlich aus.« Sie ließ das Werlicht auf ihrer Handfläche herumhüpfen.
»He, Macky«, rief ich. »Eine Sekunde Ihrer kostbaren Zeit, ja?«
Macky war wieder an seine Arbeit gegangen. Er konturierte soeben das D von UND.
»Ich bin beschäftigt«, sagte er. »Ich mach die Welt besser.«
»Und auf welche Art wollen Sie das tun?«, fragte ich.
Macky beendete das D zu seiner Zufriedenheit und trat zurück, um sein Werk in Augenschein zu nehmen. Wir alle hatten die ganze Zeit darauf geachtet, so weit wie möglich von den Gleisen wegzubleiben, aber entweder ging Macky gern mal ein Risiko ein, oder (wahrscheinlicher) er dachte schlicht und einfach nicht mehr daran. Ich sah, wie Abigail mit den Lippen die Worte Oh Scheiße formte, als sie erkannte, was passieren würde.
»Ich«, sagte Macky, und dann erwischte ihn der Geisterzug.
Unsichtbar und stumm raste er an uns vorbei, bemerkbar nur durch eine heiße Dieselwolke. Macky wurde von den Gleisen geschleudert und landete verkrümmt genau unter dem S von DASEIN. Man hörte ein Röcheln, sein Bein zuckte noch ein paar Sekunden, dann lag er ganz still. Und begann zu verblassen und mit ihm sein Graffiti.
»Kann ich aufhören?«, fragte Lesley. Das Werlicht war noch immer schwach – die Magie wurde weiter abgezweigt.
»Augenblick noch«, bat ich.
Ein leises Klappern erklang. Als ich zum Tunneleingang blickte, sah ich, wie dort eine verschwommene, durchsichtige Gestalt den Umriss eines B an die Wand sprühte.
Zyklisch wiederkehrend, notierte ich in mein Büchlein, möglicherweise ohne eigenständiges Denken?
Dann sagte ich Lesley, sie könne das Werlicht ausschalten. Macky verschwand. Vorsichtig gegen die Tunnelwand gepresst sah Abigail zu, wie Lesley und ich rasch den Schotterstreifen neben dem Gleis in Augenschein nahmen. Auf halbem Wege zum Eingang zog ich die gesprungenen, schmutzbedeckten Überreste von Mackys Brille aus dem Schotter. Ich behielt sie in der Hand und schloss die Augen. Was Vestigia angeht, sind sowohl Glas als auch Metall unberechenbar, aber ich fing ein paar ganz schwache Takte eines Rock-Gitarrensolos auf.
In mein Büchlein notierte ich eine kurze Beschreibung der Brille – als physischen Beleg für die Existenz des Gespensts – und fragte mich, ob ich sie ins Folly mitnehmen sollte. Würde es eine Auswirkung auf den Geist haben, wenn man etwas, was so eng mit ihm verbunden war, vom Tatort entfernte? Und falls der Geist dadurch zu Schaden käme oder vernichtet würde – spielte das eine Rolle? War ein Geist eine Person?
Ich kenne noch nicht einmal zehn Prozent der Bücher über Geister, die in unserer Bibliothek stehen. Eigentlich habe ich vor allem die Lehrbücher, die Nightingale mir empfohlen hat, gelesen, plus Sachen wie Wolfe und Polidori, über die ich während verschiedener Ermittlungen gestolpert bin. Aus dem, was ich gelesen habe, geht hervor, dass sich die offizielle Einstellung von Magiern zu Geistern über die Jahrhunderte stark verändert hat.
Sir Isaac Newton, der Begründer der modernen Magie, schien sie als ärgerlichen Schönheitsfehler in seinem wohlgeordneten Universum zu betrachten. Im 18. Jahrhundert kam eine wahnwitzige Manie auf, Geister zu klassifizieren wie Pflanzen oder Tiere, und während der Aufklärung entbrannte an ihnen eine bitterernste Diskussion über den freien Willen. Die Viktorianer waren strikt in zwei Lager gespalten. Das eine hielt sie für dringend zu rettende Seelen und das andere für eine Art Verschmutzung der spirituellen Sphäre, die exorziert gehörte. In den 1930er Jahren, als Relativitätstheorie und Quantenphysik die dicken Lederpolster in der Bibliothek des Folly erschütterten, schlug die Spekulation ein wenig über die Stränge, und die armen alten Geister wurden als leicht verfügbare Versuchskaninchen für alle möglichen magischen Experimente eingesetzt – es herrschte die Übereinkunft, sie seien kaum mehr als Grammophonaufnahmen vergangener Leben und besäßen daher etwa den gleichen ethischen Status wie Fruchtfliegen in einem Genlabor.
Da Nightingale dabei gewesen war, hatte ich von ihm mehr darüber wissen wollen, aber er erklärte, er habe sich damals kaum im Folly aufgehalten. Er sei im gesamten britischen Empire unterwegs gewesen, manchmal auch darüber hinaus. Ich hatte ihn gefragt, was er denn gemacht habe.
»Ich erinnere mich, dass ich eine Menge Berichte geschrieben habe. Aber ich war mir nie ganz sicher, zu welchem Zweck.«
Ich persönlich glaubte nicht, dass Geister »Seelen« waren, aber solange ich es nicht sicher wusste, war ich entschlossen, mich innerhalb der Grenzen der ethischen Korrektheit zu bewegen. Ich scharrte eine kleine Vertiefung in den Sand, genau dort, wo Abigail ihre Markierung gemacht hatte, und begrub die Brille darin. Dann notierte ich mir Uhrzeit und Ort, um es in der Akte im Folly zu vermerken. Lesley notierte sich die genaue Lage des Lochs im Zaun, aber ich war derjenige, der die BTP verständigen musste, weil sie offiziell noch krankgeschrieben war.
Wir kauften Abigail ein Twix und eine Dose Cola und nahmen ihr das Versprechen ab, den Gleisen in Zukunft fernzubleiben, Hogwarts-Express hin oder her. Ich hoffte, dass Mackys gespenstisches Dahinscheiden ein Übriges tun würde, um sie davon abzuhalten. Dann brachten wir sie wieder nach Hause und fuhren zurück zum Russell Square.
»Diese Jacke ist ihr zu klein«, sagte Lesley. »Und welches dreizehnjährige Mädchen geht Dampfloks anschauen?«
»Du glaubst, dass sie zu Hause Probleme hat?«
Lesley schob den Zeigefinger unter den Rand ihrer Maske und kratzte sich vorsichtig. »Von wegen hypoallergen, das blöde Ding.«
»Nimm sie doch ab«, schlug ich vor. »Wir sind gleich da.«
»Ich finde, du solltest eine vorsorgliche Meldung beim Jugendamt machen.«
»Hast du deine Zeit schon eingetragen?«, fragte ich.
»Nur weil du ihre Familie kennst, tust du ihr noch lange keinen Gefallen, wenn du das Problem ignorierst.«
»Ich werd mit meiner Mum reden«, versprach ich. »Wie viele Minuten waren es?«
»Fünf.«
»Eher zehn.«
Lesley sollte pro Tag nur eine begrenzte Menge Magie wirken. Das war eine der Bedingungen, unter denen Dr. Walid sie für ausbildungstauglich erklärt hatte. Außerdem musste sie alle Magie, die sie wirkte, notieren und einmal pro Woche in die Klinik tigern und den Kopf ins MRT stecken, damit Dr. Walid ihr Gehirn auf eventuelle Läsionen überprüfen konnte, die auf ein frühes Stadium hyperthaumaturgischer Zersetzung hinwiesen. Der Einsatz von zu viel Magie endet, wenn man Glück hat, in einem massiven Schlaganfall, und wenn man Pech hat, in einem tödlichen Aneurysma. Die Tatsache, dass vor der Erfindung der Magnetresonanztomografie das erste Warnzeichen für zu intensive magische Betätigung darin bestand, dass man tot umfiel, ist einer der Gründe, weshalb Magie nie zum Massenhobby wurde.
»Fünf Minuten«, sagte sie.
Wir einigten uns schließlich auf sechs.
Detective Chief Inspector Thomas Nightingale ist mein Vorgesetzter sowie mein Meister – nur im Sinne unseres Lehrverhältnisses, versteht sich. Sonntagabends treffen wir uns üblicherweise zu einem frühen Dinner im sogenannten Privaten Speisezimmer. Er ist ein winziges bisschen kleiner als ich, schlank, hat braune Haare und graue Augen und sieht aus wie vierzig, ist aber bedeutend älter. Obwohl er sich zum Dinner nicht umzukleiden pflegt, habe ich immer den starken Eindruck, dass er das nur aus Rücksicht auf mich unterlässt.
Es gab chinesisches Schweinefleisch in Pflaumensoße, allerdings schien Molly aus irgendeinem Grund der Meinung zu sein, die optimalen Beilagen dazu seien Yorkshirepudding und gedämpfter, karamellisierter Kohl. Wie üblich zog Lesley es vor, in ihrem Zimmer zu essen. Ich konnte das gut verstehen – es ist nicht leicht, Yorkshirepudding mit Anstand zu essen.
»Für morgen habe ich eine kleine Spritztour aufs Land für Sie geplant«, sagte Nightingale.
»Ach ja?«, fragte ich. »Wohin diesmal?«
»Henley-on-Thames.«
»Was gibt’s denn in Henley?«
»Möglicherweise einen der Little Crocodiles«, sagte Nightingale. »Professor Postmartin hat ein wenig für uns recherchiert und weitere Mitglieder aufgetrieben.«
»Der kann’s also auch nicht lassen, Detektiv zu spielen.«
Wobei Postmartin als Archivar und alter Oxford-Kenner bestens dafür geeignet war, jene Studenten aufzuspüren, von denen wir vermuteten, dass sie illegalerweise in Magie unterrichtet worden waren, die Mitglieder des »Little Crocodiles«-Club. Mindestens zwei von ihnen waren zu ausgewachsenen Magier-Scheißkerlen der schlimmsten Sorte herangereift: Der eine hatte seine aktive Zeit in den sechziger Jahren gehabt, der andere war quicklebendig und auf der Höhe seiner Kunst und hatte im Sommer versucht, mich von einem Dach zu pusten. Da das Haus fünfstöckig gewesen war, hatte ich das persönlich genommen.
»Ich glaube, Postmartin hat sich immer darin gefallen, den Amateurdetektiv zu geben«, sagte Nightingale. »Zumal wenn es hauptsächlich darum geht, sich mit Universitätsklatsch zu befassen. Außer dem Kandidaten in Henley glaubt er, einen weiteren hier in unserer schönen Stadt gefunden zu haben – und zwar im Barbican. Ich möchte, dass Sie sich morgen in Henley umschauen, nach Anzeichen suchen, dass der Mann ein Praktizierender ist, Sie wissen schon. Lesley und ich werden uns den anderen vornehmen.«
Ich wischte den Rest der Pflaumensoße mit meinem letzten Stück Yorkshirepudding auf. »Henley ist aber ganz schön weitab vom Schuss.«
»Umso mehr Grund für Sie, Ihren Horizont zu erweitern. Ich dachte mir, vielleicht würden Sie das gern mit einem seelsorgerischen Besuch bei Beverley Brook verbinden. Soweit ich weiß, lebt sie derzeit an diesem Abschnitt der Themse.«
An oder in der Themse?, fragte ich mich flüchtig. »Hört sich gut an.«
»Das dachte ich mir«, sagte Nightingale.
Erstaunlicherweise besitzt die Metropolitan Police kein Standardformular für Geistererscheinungen, also musste ich mir in Excel selber eines basteln. In alten Zeiten gab es auf jeder Polizeistation einen Katalogisierer – einen Beamten, dessen Aufgabe es war, eine Kartei mit Informationen über die örtlichen Ganoven, alten Fälle, Gerüchte und alles andere zu führen, was die blau uniformierten Streiter für Recht und Ordnung in die Lage versetzen mochte, im entscheidenden Moment die richtige Tür einzutreten. Oder wenigstens eine Tür im richtigen Viertel. In Hendon hat man einen solchen Katalogisierungsraum original belassen – ein staubiges Kämmerchen, dessen vier Wände bis unter die Decke mit Karteikästen ausgekleidet sind. Dieses Kämmerchen zeigt man den Auszubildenden und erzählt ihnen in gedämpftem Ton von den fernen Tagen im letzten Jahrhundert, als man Informationen noch auf Blätter aus Papier niederschrieb. In der heutigen Zeit loggt man sich – so man Zugangsberechtigung hat – in sein AWARE-Terminal ein und ruft CRIS auf, wo Straftaten registriert sind, Crimint + für Verbrechensanalysen, NCALT für Trainingsprogramme oder MERLIN, wo Straftaten an Kindern vermerkt werden, und bekommt innerhalb weniger Sekunden seine Informationen.
Das Folly als offizielle Lagerstätte aller Dinge, über die der rechtschaffene Polizeibeamte nicht gern redet und die er schon gleich gar nicht im elektronischen Datensystem herumschwirren haben will, wo Hinz, Kunz und jeder aufgeweckte Daily-Mail-Reporter sie in die Finger bekommen könnte, erhält seine Informationen auf die altmodische Art – mündlich. Empfänger ist in der Regel Nightingale, der die Meldung (ausnehmend leserlich, sollte ich hinzufügen) auf Papier festhält, welches ich abhefte, nachdem ich die wichtigsten Stichworte auf eine Karteikarte übertragen habe, die in die entsprechende Abteilung des Karteikataloges der Allgemeinen Bibliothek wandert.
Ich meinerseits tippe meine Berichte auf dem Laptop in mein Standardformular ein, drucke sie aus und hefte sie dann in der Bibliothek ab. Nach meiner Schätzung beherbergt die Allgemeine Bibliothek über dreitausend Akten, nicht eingerechnet die unkatalogisiert gebliebenen Ghostspotting-Kladden aus den dreißiger Jahren. Irgendwann würde ich sie alle in eine Datenbank eingeben – vielleicht, indem ich Molly das Tippen beibrachte.
Nachdem der Papierkram erledigt war, widmete ich mich eine halbe Stunde lang (mehr war wirklich nicht zu ertragen) Plinius dem Älteren, dessen Ruhm darauf gründet, dass er die erste Enzyklopädie der Welt schrieb und später etwas zu nahe am Vesuv vorbeischipperte, als der gerade seinen großen Tag hatte. Dann machte ich mit Toby eine Runde um den Russell Square, schaute noch auf ein Pint ins Marquis rein und verzog mich wieder ins Folly und ins Bett.
In einer Einheit, die aus einem Chief Inspector und einem Constable besteht, ist es nicht der Chief Inspector, der nachts Bereitschaftsdienst hat. Nachdem drei meiner Handys aus Versehen magisch durchgeschmort worden waren, schaltete ich mein viertes rigoros aus, wenn ich mich im Folly aufhielt. Das bedeutete aber, dass es im Falle eines Falles Molly war, die unten das Telefon abnahm und mich sodann informierte, indem sie so lange stumm in meinem Türrahmen herumstand, bis ich aus schierem kaltem Grauen aufwachte. Ein Schild »Bitte anklopfen« zeigte ebenso wenig Wirkung wie die Taktik, meine Tür fest abzuschließen und einen Stuhl unter die Klinke zu klemmen. Und ich schwärme für Mollys Kochkunst, aber einmal hätte sie beinahe mich aufgefressen. Deshalb war der Gedanke, dass sie ungeladen in mein Zimmer diffundieren könnte, während ich selig schlummerte, sehr kontraproduktiv für ebendiesen Schlummer. Aus diesem Grund verlegte ich mit Hilfe eines Kurators vom Technikmuseum in einigen Tagen Schufterei ein Koaxialkabel bis hinauf in mein Zimmer.
Wenn die allgewaltige Metropolitan Police meiner speziellen Dienste bedarf, schickt sie nun also ein Signal durch eine verdrillte Kupferleitung an ein Bakelittelephon mit einer elektrischen Glocke, das fünf Jahre vor meinem Dad das Licht der Welt erblickte. Es ist ein bisschen so, als würde man von einem ungewöhnlich musikalischen Presslufthammer geweckt, aber immer noch besser als die Alternative. Lesley nennt es das Batphone.
Es weckte mich kurz nach drei Uhr morgens.
»Aufstehen, Peter«, sagte Detective Inspector Stephanopoulos. »Wird Zeit, dass Sie mal wieder ein bisschen ordentliche Polizeiarbeit leisten.«
Montag
2Baker Street
Was ich wirklich vermisse, sind Kollegen. Verstehen Sie mich nicht falsch, durch meine Stelle im Folly habe ich mindestens zwei Jahre Vorsprung in meiner Ausbildung zum Detective Constable gewonnen, aber da meine Einheit derzeit aus mir, Detective Chief Inspector Nightingale und vielleicht demnächst PC Lesley May besteht, kann ich nicht gerade behaupten, in der Masse unterzugehen. Das sind so Dinge, die man erst dann vermisst, wenn man sie nicht mehr hat – den Geruch der nassen Regenumhänge in der Umkleide, den Ansturm auf die Computer im Internetraum der Constables, wenn freitagmorgens die neuen Jobs ins System gestellt werden, die blöden Witze und das kollektive Gähnen bei der Einsatzbesprechung um sechs Uhr morgens. Dieses Gefühl, dass es viele um dich herum gibt, deren Dasein sich um ungefähr dieselben Dinge dreht wie dein eigenes.
Deshalb war es ein bisschen wie nach Hause zu kommen, als ich das Meer von Blaulichtern vor der U-Bahn-Station Baker Street erblickte. Hinter ihnen ragte als gestrenger Wächter die drei Meter hohe Statue von Sherlock Holmes empor, voll ausgerüstet mit Deerstalker-Kappe und Haschpfeife, der ein Auge darauf haben würde, dass unsere Arbeit auch den höchsten fiktionalen Ansprüchen genüge. Das Metallgitter vor dem U-Bahn-Eingang stand offen, und dahinter hatten sich ein paar PCs von der British Transport Police verschanzt, als hätten sie hier Zuflucht vor Holmes’ unerbittlichem Blick gesucht, aber wahrscheinlich war es eher die Kälte. Nach einem flüchtigen Blick auf meinen Dienstausweis winkten sie mich durch, in der berechtigten Annahme, dass nur ein Polizist so blöd sein konnte, sich in dieser Herrgottsfrühe draußen herumzutreiben.
Ich stieg die Treppe ins Zwischengeschoss mit den Fahrkartenschaltern hinunter. Die automatischen Barrieren standen alle feuerschutzgemäß offen. Ein paar Typen in Signalwesten und schweren Stiefeln standen herum, tranken Kaffee, unterhielten sich und daddelten auf ihren Handys herum. Die routinemäßigen Reparaturarbeiten fanden heute Nacht definitiv nicht statt – wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Die Station Baker Street war 1863 eröffnet worden, aber ausgestattet ist sie mit cremefarbenen Kacheln, Holzverkleidungen und schmiedeeisernen Verzierungen aus den zwanziger Jahren, überwuchert von neuerem Unkraut aus Leitungen, Kabelkästen, Lautsprechern und Überwachungskameras.
Bei einem Kapitalverbrechen ist es selbst an einem so unübersichtlichen Tatort wie einer U-Bahn-Station nicht schwer, die Opfer zu finden. Man hält einfach Ausschau nach der größten Konzentration von Plastik-Schutzoveralls und begibt sich direkt dorthin. Hier war es das ferne Ende von Plattform 3, das aussah, als fände dort eine Milzbrandepidemie statt. Also definitiv Fremdverschulden – so viel Zuwendung bekommt kein Selbstmörder und auch nicht die fünf bis zehn Leute, die es jährlich fertigbringen, sich aus Versehen von einer U-Bahn überfahren zu lassen.
Plattform 3 war nach dem alten Cut-and-Cover-Verfahren gebaut worden, bei dem man ein paar Tausend Navvies – Eisenbahnbauer – einen verdammt tiefen Graben ausheben ließ, am Grund ein paar Gleise verlegte und oben wieder ein Dach drüberbaute. Da man damals noch Dampfloks einsetzte, war die Hälfte der Station nach oben offen, um den Dampf raus- und das Wetter reinzulassen.
Einen Tatort betritt man ganz ähnlich wie einen Club – wer nicht auf der Liste steht, hat beim Türsteher schon verloren. Die Liste war in diesem Fall Teil des Tatortprotokolls, die Rolle des Türstehers hatte ein streng dreinblickender BTP-Constable inne. Ich nannte ihm meinen Namen und Rang, und er schielte den Bahnsteig hinunter, wo eine kleine stämmige Frau mit unvorteilhaftem Bürstenhaarschnitt stand und uns finster anblickte. Das war Miriam Stephanopoulos, ihres Zeichens seit kurzem Detective Inspector, und ich begriff, dass das hier ihr erster Fall in ihrem neuen Rang war. Wir hatten schon einige Male zusammengearbeitet – das war vermutlich der Grund dafür, warum sie zögerte, bevor sie dem Constable zunickte. So bekommt man nämlich auch Zugang zu einem Tatort. Wenn man das Management kennt.
Ich schrieb mich ins Logbuch ein und nahm mir einen der Plastikoveralls, die über der Lehne eines Klappstuhls hingen. Dem Anlass entsprechend gekleidet trat ich dann zu Stephanopoulos hinüber, die Aufsicht über den Beweissicherungsbeamten führte, welcher seinerseits die Spurensicherer beaufsichtigte, die über das äußere Ende des Bahnsteigs wuselten.
»Morgen, Boss. Sie haben angerufen?«
»Peter«, sagte sie. In der Met geht das Gerücht, in einem Einmachglas neben ihrem Bett bewahre sie eine Sammlung menschlicher Testikel auf – Andenken an all die Männer, die so unklug waren, sich auf erheiternde Weise zu Stephanopoulos’ sexueller Orientierung zu äußern. Zudem gibt es Gerüchte, sie besitze jenseits der North Circular Road ein großes Eigenheim, in dem sie mit ihrer Partnerin Hühner züchtet, aber bisher habe ich noch nicht den Mut aufgebracht, sie danach zu fragen.
Der Bursche, der tot am Ende von Plattform 3 lag, hatte wohl einmal ganz gut ausgesehen, aber damit war es vorbei. Er lag auf der Seite, den Kopf auf den ausgestreckten Arm gebettet, mit gekrümmtem Rücken und angezogenen Beinen. Nicht ganz das, was die Pathologen als Embryostellung bezeichnen. Es wirkte eher wie die stabile Seitenlage.
»Wurde er bewegt?«, fragte ich.
»Der Stationsleiter hat ihn so gefunden«, sagte Stephanopoulos.
Seine Kleidung bestand aus modisch gebleichten Jeans und einem marineblauen Jackett über einem schwarzen Kaschmir-Rollkragenpulli. Das Jackett war aus teurem Stoff und saß perfekt – maßgeschneidert. Seltsamerweise trug er dazu ein Paar Doc Martens vom klassischen 1460er-Typ, also Stiefel, keine Schuhe. Sie waren von den Sohlen bis zum dritten Schnürloch schlammverkrustet. Das Leder über der Schmutzgrenze war mattiert, weich, ohne Risse – praktisch brandneu.
Er war weiß, bleiches Gesicht, gerade Nase, kräftiges Kinn. Wie gesagt, wahrscheinlich recht gut aussehend. Sein helles Haar war zu Emofransen geschnitten, die ihm strähnig in die Stirn hingen. Die Augen waren geschlossen.
All diese Details hatten sich Stephanopoulos und ihr Team sicherlich schon notiert. Während ich neben der Leiche in die Hocke ging, wartete ein halbes Dutzend Spurensicherer um mich herum darauf, von allem, was nicht niet- und nagelfest war, eine Probe einzusacken, während ein zweiter Trupp mit Schneidwerkzeugen hinter ihnen systematisch alles, was niet- und nagelfest war, abmontieren würde. Meine Aufgabe war anders geartet.
Ich legte Mundschutz und Schutzbrille an, führte mein Gesicht so nah wie möglich an die Leiche heran, ohne sie zu berühren, und schloss die Augen. An menschlichen Körpern verflüchtigen sich Vestigia sehr schnell, aber Magie, die stark genug ist, um jemanden direkt zu töten – falls das der Fall gewesen sein sollte –, ist auch stark genug, um eine Spur zu hinterlassen.
Mit meinen normalen Sinnen nahm ich Blut, Staub und einen Uringeruch wahr, der diesmal eindeutig nicht von Füchsen stammte. Mit der Leiche verknüpfte Vestigia gab es, soweit ich es beurteilen konnte, keine. Ich zog mich zurück und sah mich nach Stephanopoulos um. Sie runzelte die Stirn.
»Warum haben Sie mich angerufen?«, wollte ich wissen.
»Irgendwas an der Sache hier ist faul«, erwiderte sie. »Ich dachte, ich rufe Sie lieber gleich, sonst muss ich Sie nur später dazuholen.«
Zum Beispiel nach dem Frühstück, wenn ich wach gewesen wäre, dachte ich. Sagte ich aber nicht. Allzeit bereit zu sein ist schließlich so was wie die Grundidee des Polizeidienstes.
»Ich kann nichts finden.«
»Könnten Sie nicht – « Sie machte eine vage Handbewegung.
Wir erklären unseren Kollegen von anderen Einheiten gewöhnlich nicht lang und breit, was wir machen – unter anderem deshalb, weil wir es meistens erst mittendrin improvisieren. Folglich wissen höherrangige Beamte wie Stephanopoulos zwar, dass wir irgendwas tun, haben aber keine klare Vorstellung davon, was.
Ich trat von der Leiche zurück, und die wartenden Spurensicherer schwärmten an mir vorbei und fielen darüber her.
»Wer ist er?«, fragte ich.
»Wissen wir noch nicht. Er hat Stich- und Schnittverletzungen. Die Blutspur kommt aus dem Tunnel. Wir können noch nicht sagen, ob er von jemandem hergeschleppt wurde oder es von selbst geschafft hat.«
Ich blickte den Tunnel entlang. In Cut-and-Cover-Tunneln liegen die Gleise direkt nebeneinander wie bei einer Eisenbahntrasse unter freiem Himmel, was bedeutete, dass beide Richtungen gesperrt werden mussten, bis die Untersuchung abgeschlossen war. »Welche Richtung ist das denn?« Irgendwo im Zwischengeschoss hatte ich die Orientierung verloren.
»Osten«, sagte Stephanopoulos. Also Richtung Innenstadt, Euston und King’s Cross. »Aber es kommt noch schlimmer.« Sie zeigte in den Tunnel, der eine Linkskurve machte. »Gleich hinter der Kurve verlaufen die District und Hammersmith Line, das heißt, wir müssen die komplette Anschlussstelle sperren.«
»Da wird Transport for London ja begeistert sein.«
Stephanopoulos lachte bellend auf. »Sie haben ihre Freude schon geäußert.«
In weniger als drei Stunden fing der normale Tagesbetrieb der U-Bahn an. Wenn die Gleise hier an der Baker Street gesperrt blieben, bedeutete das, dass am Montag der letzten Vorweihnachtswoche das komplette System zusammenbrechen würde.
Aber Stephanopoulos hatte recht – an diesem Tatort war etwas faul. Während ich in den Tunnel hineinblickte, durchzuckte mich etwas – kein Vestigium, sondern etwas Älteres, jener Instinkt, der uns aus der Zeit geblieben ist, als wir gerade von den Bäumen herunter waren und die Politik der starken Hand noch nicht erfunden hatten. Als wir nichts waren als ein Haufen aufrecht gehender Affen in einer Welt voller hochspezialisierter Raubtiere. Zweibeinige Snacks. Diese Warnung, die einem sagt, dass etwas einen beobachtet.
»Soll ich mir den Tunnel mal anschauen?«
»Ich dachte schon, Sie würden nie fragen.«
Die Leute haben seltsame Vorstellungen von Polizisten. Unter anderem scheinen sie zu glauben, dass wir uns munter in jede Gefahr stürzen, ohne auch nur einen Gedanken an die eigene Sicherheit zu verschwenden. Natürlich stimmt es, dass wir genau wie Feuerwehrleute und Soldaten grundsätzlich auf Probleme zurennen statt vor ihnen davon, aber das heißt nicht, dass wir vorher nicht nachdenken würden. Eines der Dinge, die wir durchaus bedenken, ist die Stromschiene, über die die Bahn mit Elektrizität versorgt wird, und wie einfach es ist, sich damit umzubringen. Die Sicherheitsinstruktionen bezüglich dieser segensreichen Erfindung gab mir und den Spurentechnikern ein fröhlich aussehender Sergeant der BTP namens Jaget Kumar. Er gehörte zu der seltenen Sorte Bahnpolizisten, die sich den fünfwöchigen Kurs über Schienensicherheit angetan hatten, der dazu berechtigt, sich sogar auf den Schienen herumzutreiben, wenn sie Strom führen.
»Aber das wollen Sie gar nicht«, sagte Kumar. »Der fundamentale Sicherheitstipp im Umgang mit Stromschienen ist: Bleiben Sie weit weg davon.«
Dann betrat ich mit Kumar den Tunnel, während die Spurensicherer erst mal zurückblieben. Sie waren zwar nicht sicher, was genau ich eigentlich untersuchen wollte, aber der Grundsatz, dass man einen Tatort nicht kontaminieren soll, war ihnen heilig. Außerdem konnten sie auf diese Weise abwarten, ob Kumar und ich einen tödlichen Stromschlag abkriegten oder nicht, bevor sie sich selbst in Gefahr begaben.
Erst als wir außer Hörweite waren, fragte Kumar mich, ob ich wirklich von den Ghostbusters sei.
»Was?«
»ECD 9. Spuk und Poltergeister.«
»Mehr oder weniger«, gab ich zu.
»Stimmt es, dass Sie«, er zögerte und suchte nach einem seriösen Ausdruck, »ungewöhnliche Phänomene untersuchen?«
»Für UFOs und Entführung durch Außerirdische sind wir nicht zuständig«, sagte ich, weil das üblicherweise die nächste Frage ist.
»Ah, wer macht das dann?«
Ich schielte ihn von der Seite an und merkte, dass er mich verarschen wollte. »Können wir vielleicht bei der Sache bleiben?«
Es war nicht schwer, der Blutspur zu folgen. »Er hat sich immer an der Seite gehalten«, sagte Kumar, »auf Abstand zur innenliegenden Stromschiene.« Im Licht seiner Taschenlampe war im Schotterbett ein deutlicher Schuhabdruck zu sehen. »Hat die Schwellen nicht betreten. Sieht fast so aus, als hätte er so was wie eine Sicherheitsschulung absolviert.«
»Warum?«, fragte ich.
»Wenn man sich schon in der Nähe von Schienen bewegen muss, die Strom führen, bleibt man besser von den Schwellen weg. Die sind rutschig, und wenn man hinfällt und sich mit den Händen abfangen will – zapp.«
»Zapp«, sagte ich. »Das ist also der Fachausdruck? Und wie nennen Sie jemanden, der gezappt wurde?«
»Mister Knister.«
»Was Besseres ist Ihnen nicht eingefallen?«
Kumar zuckte mit den Schultern. »Hat ja nicht unbedingt höchste Priorität.«
Hinter der Kurve, außer Sichtweite der Station, fanden wir die Stelle, wo die Blutspur begann. Den ganzen Weg entlang war das Blut effektiv von Sand und Schotter aufgesogen worden, aber hier schimmerte das Licht meiner Taschenlampe auf einer unregelmäßigen, glitschig aussehenden dunkelroten Lache.
»Ich schaue mich mal weiter vorn um – vielleicht finde ich heraus, wo er reinkam«, sagte Kumar. »Kommen Sie klar?«
»Machen Sie sich keine Sorgen. Alles okay.«
Ich ging in die Hocke und suchte mit dem Lichtstrahl systematisch den Bereich um die Blutlache ab. Knapp einen halben Meter weiter in Richtung Baker Street entdeckte ich ein kleines längliches Objekt aus Leder, und das Licht funkelte auf der glatten Oberfläche eines Handys. Fast hätte ich es aufgehoben, aber ich konnte mich noch rechtzeitig beherrschen.
Ich trug zwar Handschuhe und hatte die Tasche voller Beweisbeutel und Etiketten, und wäre dies ein Überfall mit Körperverletzung oder ein Einbruch oder irgendein anderes geringeres Delikt gewesen, hätte ich das Handy selbst eingetütet. Aber das hier war eine Mordermittlung, und wehe dem unseligen Beamten, der die Regeln der intakten Beweiskette nicht befolgt, denn man wird ihn hinsetzen und in vielen Worten zu ihm davon sprechen, was damals im Fall O. J. Simpson falsch lief. Vorzugsweise mit Power-Point-Präsentation.
Ich zog mein Airwave-Funkgerät aus der Tasche, setzte die Batterien ein, rief den Beweissicherungsbeamten an und meldete ihm, dass es hier ein paar Beweise zu sichern gab. Während ich wartete, überprüfte ich die Umgebung noch einmal, und da fiel mir etwas an der Blutlache auf. Blut ist dicker als Wasser, vor allem, wenn es schon halb geronnen ist. Und es ist, wie ich bemerkte, in der Lage, etwas darunter Befindliches gänzlich zu verdecken. Ich beugte mich so dicht darüber, wie ich es wagte, ohne es mit meinem Atem zu kontaminieren. Da durchzuckten mich Hitze, Kohlenstaub und ein zu Tränen reizender Gestank nach Scheiße, als wäre ich kurz davor, mit dem Gesicht nach unten in einem Misthaufen zu landen. Ich musste tatsächlich niesen. Puh, das war mal ein Vestigium.
Ich legte mich bäuchlings auf den Boden und versuchte herauszubekommen, was da unter dem Blut lag. Es war dreieckig und hatte die Farbe von hellem Teig. Zuerst hielt ich es für einen Stein, aber dann fielen mir die scharfen Kanten auf, und ich begriff, dass es eine Tonscherbe war.
»Haben Sie noch was?«, fragte eine Stimme über mir – ein Spurentechniker.
Ich zeigte ihm, was ich gefunden hatte, und verkrümelte mich dann, weil ein Fotograf hinzukam, um alles in situ aufzunehmen. Ich nahm die Taschenlampe und leuchtete den Tunnel entlang. Etwa dreißig Meter weiter wurde das Licht von Kumars Warnweste reflektiert. Er blitzte zurück, und ich arbeitete mich vorsichtig zu ihm vor.
»Was gefunden?«
Kumar leuchtete eine moderne Stahltür unter einem unverkennbar viktorianischen Backsteinbogen an. »Ich dachte, er wäre vielleicht durch den alten Arbeitszugang reingekommen, aber der ist abgeschlossen. Vielleicht wollen Sie trotzdem Fingerabdrücke nehmen.«
»Wo sind wir jetzt eigentlich?«
»Unter der Marylebone Road Richtung Osten. Da vorn gibt’s noch ein paar alte Luftschächte, die ich überprüfen will. Kommen Sie mit?«
Es waren noch siebenhundert Meter bis zur nächsten Station, Great Portland Street. Wir gingen nicht bis ganz dorthin, nur bis der Bahnsteig in Sicht kam. Kumar überprüfte seine Luftschächte und meinte, wenn unser Mister X von dieser U-Bahn-Station gekommen wäre, hätte das stets wachsame Kamerakontrollpersonal ihn garantiert gesehen. »Wie zum Teufel ist der auf die Gleise gekommen?«
»Vielleicht gibt’s noch einen anderen Zugang«, sagte ich. »Einen, der nicht in den Plänen eingezeichnet ist, irgendwas, was wir verpasst haben.«
»Ich werde mal mit dem zuständigen Streckengänger reden«, sagte Kumar. »Der weiß das bestimmt.« Die Streckengänger verbrachten ihre Nächte damit, auf der Suche nach Defekten durch die Tunnel zu streifen, und waren Kumar zufolge die Hüter der tiefsten Geheimnisse der Londoner Tube. »Oder so«, sagte er.
Ich überließ es Kumar, auf seinen einheimischen Führer zu warten, und machte mich auf den Weg zurück zur Station Baker Street. Ungefähr auf halbem Wege rutschte ich auf etwas losem Schotter aus und fiel der Länge nach hin. Dabei fing ich mich natürlich mit den Händen ab, und es entging mir nicht, dass meine linke Handfläche genau auf der Stromschiene zu liegen kam. Mister Knister Peter Grant – welch eine Karriere.
Als ich zurück auf den Bahnsteig kletterte, war ich völlig verschwitzt. Ich wischte mir übers Gesicht und bemerkte eine dünne Schmutzschicht auf meinen Wangen. Meine Hände wurden ganz schwarz davon. Staub vom Schotterbett, vermutete ich, vielleicht auch alter Ruß von damals, als gepolsterte Wagen voll würdevoller Viktorianer von Dampflokomotiven durch die Tunnel gezogen worden waren.
»Um Himmels willen, kann nicht jemand dem Jungen ein Taschentuch geben?«, fragte eine dröhnende Stimme mit nordenglischer Färbung. »Und dann erklärt mir gefälligst, was in drei Teufels Namen er hier macht.«
Detective Chief Inspector Seawoll war ein massiger Mann aus einem kleinen Ort in der Nähe von Manchester – einem von diesen Orten, die (wie Stephanopoulos einmal bemerkt hatte) erklärten, woher zum Beispiel Morrisseys heitere Einstellung zum Leben kam. Wir hatten schon einmal zusammengearbeitet – er hatte mich auf der Bühne des Royal Opera House zu erhängen versucht, und ich hatte ihm fünf Milliliter Elefantentranquilizer in den Kreislauf gejagt. Glauben Sie mir, in der damaligen Situation war das alles vollkommen einleuchtend. Meiner Meinung nach waren wir quitt, außer dass er vier Monate krankgeschrieben wurde, was die meisten vernünftigen Polizisten als Bonus betrachtet hätten.
Die vier Monate waren offensichtlich um, und Seawoll war zurück an der Spitze seiner Mordkommission. Er hatte an einer Stelle auf dem Bahnsteig Position bezogen, wo er ein Auge auf die Spurensicherer haben konnte, ohne seinen Kamelhaarmantel und die handgefertigten Tim-Little-Schuhe ablegen zu müssen. Jetzt winkte er mich und Stephanopoulos zu sich.
»Freut mich zu sehen, dass es Ihnen wieder gut geht, Sir«, sagte ich, bevor ich mich beherrschen konnte.
Seawoll sah Stephanopoulos an. »Was macht der hier?«
»Etwas an der Sache kam mir komisch vor«, erklärte sie.
Seawoll seufzte. »Sie haben mir meine Miriam auf Abwege geführt«, sagte er zu mir. »Aber jetzt, wo ich wieder da bin, will ich doch hoffen, dass wir zur guten alten indiziengestützten Ermittlungsarbeit zurückkehren können und der abstruse Scheiß sich deutlich reduziert.«
»Ja, Sir«, sagte ich.
»Und wo wir schon dabei sind – in was für einen abstrusen Scheiß wollen Sie mich jetzt wieder reinreiten?«
»Ich glaube nicht, dass hier Magie im – «
Seawoll schnitt mir mit einer scharfen Handbewegung das Wort ab. »Ich will das M-Wort nicht aus Ihrem Mund hören.«
»Ich glaube nicht, dass an seinem Tod was Abstruses war«, sagte ich. »Außer …«
Wieder schnitt er mir das Wort ab. »Todesursache?«, fragte er Stephanopoulos.
»Stichwunde in den Rücken, wahrscheinlich Organschäden, aber gestorben ist er am Blutverlust.«
Seawoll fragte nach der Mordwaffe. Stephanopoulos deutete auf den Beweissicherungsbeamten. Dieser hielt uns einen Klarsichtbeutel hin. Er enthielt die biskuitfarbene Tonscherbe, die ich im Tunnel gefunden hatte.
»Was zum Teufel soll denn das sein?«, fragte Seawoll.
»Ein Stück von einem Teller«, sagte Stephanopoulos und drehte den Beweisbeutel, so dass wir sahen, dass es sich in der Tat um ein dreieckiges Stück eines zerbrochenen Tellers handelte, mit Zierrand. »Sieht aus wie Steingut.«
»Und die sind sicher, dass das die Waffe war?«, fragte Seawoll.
Sie sagte, die Pathologin sei so sicher, wie man es diesseits der Autopsie sein könne.
Ich war nicht scharf darauf, Seawoll von der kleinen Konzentration von Vestigia an der Scherbe zu erzählen, aber ich dachte mir, dass ich mir nur mehr Ärger einhandeln würde, wenn ich es sein ließ.
»Sir«, sagte ich. »Hieran ist ein bisschen … abstruser Scheiß.«
»Woher wissen Sie das?«
Ich überlegte, ob ich ihm erklären sollte, was Vestigia waren, aber Nightingale hatte mich gewarnt, dass es manchmal besser sei, ihnen eine hübsch einfache Erklärung zu geben, mit der sie etwas anfangen können. »Es hat eine Art Leuchten.«
»Ein Leuchten?«
»Ja, ein Leuchten.«
»Das nur Sie sehen können«, folgerte er. »Mit Ihren speziellen mystischen Kräften.«
Ich sah ihm in die Augen. »Ja. Mit meinen speziellen mystischen Kräften.«
»Na schön«, sagte Seawoll. »Unser Opfer wird also in einem U-Bahn-Tunnel mit einem Stück magischem Teller erstochen, schleppt sich auf der Suche nach Hilfe die Gleise entlang, klettert auf den Bahnsteig, klappt zusammen und blutet aus.«
Den genauen Todeszeitpunkt kannten wir – 1.17 Uhr morgens, weil eine Überwachungskamera alles aufgenommen hatte. Um 1.14 Uhr war verschwommen sein weißes Gesicht zu sehen, als er sich mühsam auf den Bahnsteig hievte, dann sein Torkeln, als er auf die Füße zu kommen versuchte, und dann der schreckliche letzte Zusammenbruch, das Zur-Seite-Kippen – die Kapitulation.
Sobald man den Mann bemerkt hatte, dauerte es keine drei Minuten, bis der Stationsleiter bei ihm war, aber da war, wie er sich ausdrückte, der Unbekannte schon »hinüber«. Es blieb ein Rätsel, wie er in den Tunnel hinein und sein Mörder hinausgekommen war, aber nachdem die Spurensicherer seine Geldbörse freigegeben hatten, wussten wir wenigstens, wer er war.
»Oh Scheiße«, sagte Seawoll. »Ein Ami.« Er reichte mir einen Beweisbeutel, in dem sich eine laminierte Karte befand. Ganz oben stand NEW YORK STATE, darunter DRIVER LICENSE, dann ein Name, eine Adresse und ein Geburtsdatum. Er hieß James Gallagher, kam aus einem Ort namens Albany, NY, und war dreiundzwanzig Jahre alt.
Wir hatten eine kleine Diskussion darüber, wie viel Uhr es jetzt in New York war, dann beauftragte Seawoll einen Beamten, die Polizei von Albany zu kontaktieren. Albany war die Hauptstadt des Staates New York, was ich nicht wusste, bis Stephanopoulos es mir sagte.
»Das Ausmaß Ihres Unwissens«, sagte Seawoll, »ist wahrhaft beängstigend, Peter.«
»Unser Opfer hingegen war offenbar wissensdurstig«, sagte Stephanopoulos. »Er war am St. Martin’s College eingeschrieben.«
In Gallaghers Geldbörse befand sich eine Mitgliedskarte der National Union of Students, außerdem ein paar Visitenkarten mit seinem Namen und einer Adresse, von der wir hofften, dass es sich um seine Londoner Wohnung handelte, in einer kleinen Gasse in der Nähe der Portobello Road.
»Nett, wenn sie es uns so einfach machen«, sagte Seawoll.
»Was denken Sie«, fragte Stephanopoulos, »erst die Adresse, dann Familie und Freunde?«
Bisher hatte ich größtenteils den Mund gehalten, und, ganz ehrlich, am liebsten hätte ich mich still und heimlich nach Hause verdrückt, aber es war nun mal eine Tatsache, dass James Gallagher mit einer magischen Waffe abgemurkst worden war. Na gut, mit einer magischen Tellerscherbe. »Ich würde mir gern seine Bude anschauen. Nur für den Fall, dass er ein Praktizierender war.«
»Praktizierender, hm?«, fragte Seawoll. »So nennt ihr das also?«
Ich verlegte mich wieder darauf, den Mund zu halten, und Seawoll schenkte mir einen beifälligen Blick.
»Schön«, sagte er dann. »Zuerst die Wohnung, dann nehmen Sie sich die Angehörigen und Freunde vor und schauen, ob Sie seinen gestrigen Tagesablauf rekonstruieren können. Die BTP wird Leute durch die Tunnel schicken, um sie genau zu untersuchen.«
»Transport for London wird im Dreieck springen«, sagte Stephanopoulos.
»Wenn’s ihnen Spaß macht«, brummte Seawoll.
»Wir sollten der SpuSi sagen, dass die Mordwaffe eventuell archäologisch bedeutsam ist«, bemerkte ich.
»Archäologisch?«, fragte Seawoll.
»Eventuell.«
»Ist das Ihre professionelle Meinung?«
»Ja.«
»Die man wie üblich in der Pfeife rauchen kann.«
»Wär’s Ihnen lieber, wenn ich meinen Boss rufe?«
Seawoll schürzte die Lippen, und mit Schrecken erkannte ich, dass er wirklich darüber nachdachte, Nightingale zu rufen. Das ärgerte mich, weil es durchblicken ließ, dass er mir den Job nicht zutraute. Und es erschütterte mich etwas, weil in seiner Weigerung, sich bei seinen Ermittlungen mit irgendwelchem »magischem Scheiß« zu befassen, immer etwas Tröstliches gelegen hatte. Wenn er erst anfing, mich ernst zu nehmen, würde mich das ziemlich unter Druck setzen, seine Erwartungen zu erfüllen.
»Hab gehört, Lesley ist eurem Verein beigetreten«, sagte er.
Ganz klassischer Polizeitrick – die 90-Grad-Wendung im Gespräch. Aber er funktionierte nicht, weil ich die Antwort auf diese Frage geübt hatte, seit Nightingale und der Commissioner ihre jüngste »Abmachung« geschlossen hatten.
»Nicht offiziell. Sie ist auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben.«
Seawoll schüttelte den Kopf. »Was für eine Verschwendung. Zum Heulen, das.«
»Na gut, Sir, wie sollen wir es bei dem Fall hier halten?«, fragte ich. »AB übernimmt den Mord und ich die … anderen Sachen?« AB ist der Funkcode für die Polizeistation von Belgravia, wo Seawolls Mordkommission ihren Sitz hatte. Wir von der Polizei benutzen niemals ein normales Wort, wenn es dafür auch einen unverständlichen Jargonausdruck gibt.
»Nach dem, wie das letztes Mal gelaufen ist?«, fragte er. »Oh nein. Sie kommen als Mitglied unseres Ermittlungsteams zu uns in die Zentrale, damit ich ein verdammtes Auge auf Sie haben kann.«
Ich sah Stephanopoulos an.
»Herzlich willkommen«, sagte sie.
3Ladbroke Grove
Bei Mordermittlungen geht die Metropolitan Police sehr geradlinig vor – sie hat’s nicht so mit dem Bauchgefühl des Privatschnüfflers oder den komplizierten logischen Schlussfolgerungen des brillanten Detektivs. Nein, die Met wirft lieber die Höchstzahl an verfügbaren Leuten ins Gefecht, und die verfolgen jede mögliche Spur, bis diese vor Erschöpfung zusammenbricht, der Mörder gefasst ist oder der leitende Ermittler an Altersschwäche stirbt. Daher werden Mordermittlungen nicht von eigenwilligen Detective Inspectors mit Drogen-/Beziehungs-/sonstigen psychosozialen Problemen durchgeführt, sondern von einer Horde wahnsinnig ehrgeiziger Detective Constables im ersten wilden Karriererausch. Sie sehen, ich passte da sehr gut rein.
Um zwanzig nach fünf waren mindestens dreißig von uns in der Station Baker Street versammelt. Aus diesem Massenauflauf nahm ich zwei DCs in meinem Auto nach Ladbroke Grove mit. Stephanopoulos wollte nachkommen. Eine der beiden Detectives in meinem Auto war Sahra Guleed, mit der ich über einer Leiche in Soho Freundschaft geschlossen hatte. Da sie auch bei der Razzia im Strip Club des Dr. Moreau dabei gewesen war, schien sie mir eine gute Wahl für jeglichen abstrusen Scheiß zu sein.
»Ich bin bei der Angehörigenbetreuung«, erklärte sie, als sie sich auf den Beifahrersitz setzte.
»Besser Sie als ich«, gab ich zurück.
Auf den Rücksitz quetschte sich ein fülliger blonder DC. »David Carey. Auch Angehörigenbetreuung.«
»Falls es eine große Familie ist«, fügte Guleed hinzu.