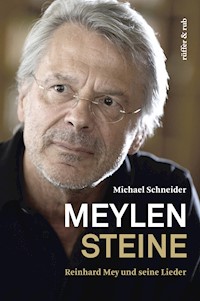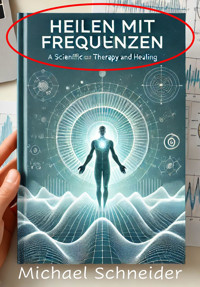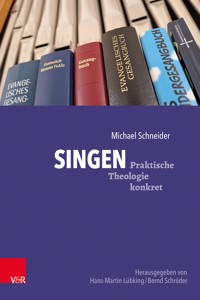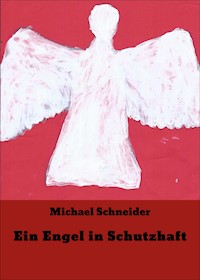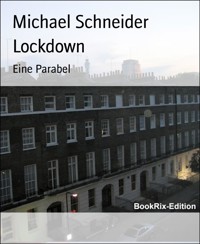21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein zweites Leben – Ein berührender Roman über Abschied, Trauer und Neubeginn mit Anfang 60 Professor Fabian Fohrbeck verliert mit 62 Jahren den Boden unter den Füßen: Seine geliebte Frau Dorothea stirbt überraschend und an der Uni droht ihm die Stellenstreichung. In einer psychosomatischen Rehaklinik beginnt er widerwillig, aber neugierig eine Reise der Selbsterkundung. Die Gespräche mit seiner Therapeutin lassen ein vielschichtiges Bild seiner Ehe entstehen und führen ihn auch in die verdrängten Zonen seiner eigenen Familiengeschichte. Fohrbeck erkennt, dass viele seiner Mitpatienten erschöpft und ausgebrannt sind – ein Spiegelbild der modernen Arbeitswelt. Leistungsdenken, Selbstoptimierung und Beschleunigung scheinen die bestimmenden Faktoren unserer Zeit zu sein. Doch es gibt Hoffnung auf neue Glücksverheißungen, auch für ihn. Die Begegnung mit der faszinierenden Tanztherapeutin Lea wird zu einer erotischen Obsession, die ihn auf neue Höhen, aber auch in Abgründe führt. Mit scharfem Blick und feiner Ironie erzählt Michael Schneider in Ein zweites Leben von einer Gesellschaft, die im eigenen Paradox gefangen ist: Trotz aller zeitsparenden Technologien bleibt uns keine Zeit mehr. Ein Roman, der zum Nachdenken anregt und Mut macht, auch in späteren Jahren noch einmal neu anzufangen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 811
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Michael Schneider
Ein zweites Leben
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Michael Schneider
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Michael Schneider
Michael Schneider, geboren 1943 in Königsberg, studierte Naturwissenschaften, anschließend Philosophie, Sozial- und Religionswissenschaft an der Freien Universität Berlin. 1974 Promotion über Marx und Freud. Lektor, Journalist, Literaturkritiker, Schauspieldramaturg und Hausautor am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Seit 1991 Dozent, seit 1995 Professor an der Filmakademie in Ludwigsburg. Mitglied des PEN-Zentrums, des Magischen Zirkels und des Wissenschaftlichen Beirats von Attac Deutschland.
Er war verheiratet mit der Grundschullehrerin und späteren Konrektorin Ingeborg Schneider, die als geistige Anregerin und kritische Lektorin die meisten seiner Essays, Novellen, Theaterstücke und Romane begleitet hat. Sie starb 2004.
Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen von Michael Schneider die Zaubernovelle »Das Spiegelkabinett«, »Der Traum der Vernunft. Roman eines deutschen Jakobiners« und der historische Schelmenroman »Das Geheimnis des Cagliostro«.
Einen Überblick über Schneiders umfangreiches Werk vermittelt seine Homepage: www.schneider-michael-schriftsteller.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Fabian Fohrbeck, Professor der Kulturwissenschaften, verliert mit 62 Jahren den Boden unter den Füßen. Seine langjährige Frau und Seelenverwandte Dorothea ist überraschend gestorben, an der Uni droht ihm wegen Sparmaßnahmen die Stellenstreichung, er bäumt sich auf – und bricht fast zusammen.
Fohrbeck findet sich in einer psychosomatischen Rehaklinik wieder, widerwillig zwar, aber auch neugierig. In den Gesprächen mit seiner Therapeutin entsteht ein vielschichtiges und liebevolles Bild von Dorothea und dem gemeinsamen Leben. Die Trauer um seine Frau geht einher mit einer spannenden Selbsterkundung, die in die verdrängten Zonen seiner eigenen Familiengeschichte führt. Zugleich lernt er nach und nach seine Mitpatienten kennen. Überraschend viele von ihnen sind abgekämpft, erschöpft, ausgebrannt, ein Spiegelbild der modernen Arbeitswelt. Fohrbeck wird klar, dass der fehlgeleitete Umgang mit der Zeit ein Grund für diese Entwicklung sein muss. Leistungsdenken, Selbstoptimierung und Beschleunigung sind die bestimmenden Faktoren unserer Zeit, aber es gibt neue Glücksverheißungen – auch für ihn. Die Begegnung mit der charismatischen Tanztherapeutin und Sängerin Lea wird für Fabian zu einer erotischen Obsession, die ihn auf neue Höhen, aber auch in Abgründe führt.
Mit scharfem Blick und großem Feingefühl, aber auch mit Witz und Ironie erzählt Michael Schneider von Abschied und Neubeginn, Trauer und Liebe – und zeigt eine Gesellschaft, die in ihrem eigenen Paradox gefangen ist: Trotz aller Techniken zur Zeitersparnis bleibt uns keine mehr.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2016, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture/Westend61
ISBN978-3-462-31569-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Erstes Kapitel
Ankunft
Selig sind die Ausgebrannten
Die Therapeutin
Auf der Klangliege
Der Freund
Sonja
Zweites Kapitel
Qigong
Die Ausreißerin
Thaimassage
Vom Glück und alten Kinderwünschen
Geschäftsbein
Von der vergessenen Sprache der Organe
Miniaturen
Im Zeichen der Ewigkeit
Thermalbad
Drittes Kapitel
Versäumnisse?
Fluchttrauma
Gefährdete Liebe
Die Sirene
Prüfungsangst
Am See
Universitas ade!
Parenting
Vom Wahn der Effizienz
Galli-Theater
Viertes Kapitel
Daheim allein
Das Hexenhäuschen
Kuriose Nachbarschaft
Glücklich ungleich
Der Findling
Ein neues Gefühl
Fünftes Kapitel
Die Messingstadt
Yuppieträume und ihr Preis
Die Einladung
Von den Paradoxien des digitalen Zeitalters
Die Kranichfrau
Ein Hilferuf
Ersatzväter
Von der Tücke der Aquarien
Und die Liebe höret nimmer auf
Künstlernamen
Zukunftsszenarien
Sechstes Kapitel
Nicht alle sind tot, die begraben sind
Asthma
Kindheitsmuster
Eklat
Rückführung
Ein Traum und eine Verabredung
Fantasia erotica
Die langen Schatten des Krieges
Der selbstlose Vater
Siebtes Kapitel
Katharsis
Achtes Kapitel
Frankenstein reloaded!
Geständnis
Privare
Ja – aber
Was ist ein Kuss?
Neuntes Kapitel
Wo die Liebe hinfällt
Die Erlaubnis
Mehr als eine Affäre
Zehntes Kapitel
Ein Winternachtstraum
Eine Simulantin?
Geld ist Zeit
Elftes Kapitel
Die Vermessung der Alma Mater
Cats
Die drei Musketiere der Fachschaft
Das Heideröslein
Shakespeare rechnet sich nicht
Rittersporn und Rosen
Zwölftes Kapitel
Andreas
Silvester in Prag
Dreizehntes Kapitel
Von der Habgier
Eros und Agape
Der Renegat
Hasenherz
Die Gewalt der Geschwindigkeit
Tristan-Akkord
Vierzehntes Kapitel
Im Wartestand
Déjà vu
Wut
Fünfzehntes Kapitel
Volk ohne Zeit
Der Überraschungsgast
Sechzehntes Kapitel
Abschied von Mar Azul
Danksagung
Für Ingeborg
Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
Wagt er zu weinen
Mitten in uns.
Rainer Maria Rilke
Glück ist die nachträgliche Erfüllung eines prähistorischen Wunsches, eines Kinderwunsches. Darum macht Reichtum so wenig glücklich. Geld war kein Kinderwunsch.
Sigmund Freud
Erstes Kapitel
Ankunft
Halten Sie sich nach zweihundert Metern rechts … Halten Sie sich rechts … Nehmen Sie im Kreisverkehr die erste Ausfahrt rechts … Aber die erste Ausfahrt war gesperrt, wie der rot durchkreuzte Schriftzug Bad Rodau auf dem gelben Hinweisschild signalisierte. Unschlüssig umfuhr ich noch einmal den Kreisverkehr. Nehmen Sie die erste Ausfahrt rechts, wiederholte die Navigatorstimme. Wieder fuhr ich an der gesperrten Ausfahrt vorbei und nahm die zweite Ausfahrt … Zur Strafe für meinen Ungehorsam verschwand der rote Pfeil auf dem Display, und die weibliche Stimme verstummte: Jetzt sieh zu, schien ihr plötzliches Schweigen zu sagen, wie du ohne mich deinen Weg findest.
Nach etwa einem Kilometer kam ich erneut an einen Kreisverkehr. Und nahm die erste Ausfahrt rechts nach Bad Rodau, die hier nicht gesperrt war. Folgte dann einer kurvenreichen Landstraße, die sich an einem von Uferweiden und Silberpappeln gesäumten Bach entlangzog, an einsamen Gehöften, eingezäunten Pferdekoppeln und einem Getreidesilo vorbei. Kurz hinter dem Ortsschild Bad Rodau bog ich auf einen Parkplatz. Ich nahm die angebrochene blaue Schachtel von der Ablage und zündete mir eine Zigarette an. Ein Mal noch eine rauchen!
Während ich den Rauch durch das offene Wagenfenster blies, war mir plötzlich, als säße Dorothea neben mir auf dem Beifahrersitz, in ihren beigen Sommershorts, die nackten Füße gegen das Handschuhfach gestemmt und genüsslich an ihrer Zigarette ziehend … Ich schloss die Augen und sah sie jetzt, während ich mich ihr langsam näherte, in ihrem roten Bikini auf der Bastmatte sitzen, hinter dem wehenden Dünengras funkelte das Meer, sie war in ein Buch vertieft, während ihre aufgestützte Rechte die Zigarette hielt, die sie mit einer zierlichen Bewegung zum Mund führte. Plötzlich – sei es, dass sie meine Nähe in ihrem Rücken spürte, sei es, dass sie das leise Knirschen des Sandes unter meinen Sohlen hörte – wandte sie sich nach mir um und empfing mich mit leuchtenden Augen. Das war Glück!
Ich öffnete die Wagentür und stieg aus. Schlurfte durch das Laub auf dem Boden der kleinen Parkbucht. Seit meiner Kindheit mochte ich das trockene Rascheln des Herbstlaubs unter meinen Schritten. Ich folgte der tänzelnden Abwärtsbewegung der Blätter, die der Wind von den Ahornbäumen blies. Bis mein Blick den Boden streifte und an unserem Nummernschild haften blieb: LM–DO 202. Ob ich nicht lieber ein neues Kennzeichen beantragen wolle?, hatte mich kürzlich ein Freund gefragt. – Warum?, antwortete ich, es ist unser Auto, und sie fährt ja noch immer mit.
Das an jeder Kreuzung ausgeschilderte Kurgebiet war leicht zu finden. Es lag am südlichen Rand des um einen See gelegenen Kurstädtchens Bad Rodau, das – wie dem Flyer zu entnehmen war – mit seinem mittelalterlichen Stadttor und seinen alten Fachwerkhäusern zu den architektonischen Perlen der Region zählte. Am Ende einer großen Allee, gleich hinter dem Thermalbad, zogen drei durch eine Parkanlage miteinander verbundene Häuser meine Aufmerksamkeit auf sich. Auf dem Dachfirst des mittleren Hauses thronte ein stilisierter Vogel mit gebogenem Schnabel und einer antennenartigen Feder auf dem Kopf, die an das zierliche Krönchen der Eichelhäher erinnerte. Unschwer erkannte ich das auf der Werbebroschüre abgebildete Emblem der psychosomatischen Klinik Phönix.
Langsam steuerte ich den Wagen in den letzten freien Parkstreifen. Die Tür zur Empfangshalle war nur angelehnt. Meinen Rollkoffer hinter mir herziehend, trat ich ein. Niemand war zu sehen, die Rezeption war unbesetzt. Ich hatte mich allerdings sehr verspätet, es war schon fast 21 Uhr, dabei hatte ich mein Kommen für spätestens 18 Uhr angekündigt.
Und doch war ich hier nicht allein: Aus der Tiefe der Lobby, die nur im Eingangsbereich noch spärlich beleuchtet war, drang, von leisem Klavierspiel begleitet, ein betörender Gesang an mein Ohr, eine Melodie, die ich nur allzu gut kannte – getragen von einer weichen Mezzosopranstimme, die mir direkt ins Herz ging. Wie verzaubert blieb ich stehen und lauschte der unsichtbaren Sängerin, die ihr ganzes Gefühl in die gedehnten melodischen Bogen des Ave-Maria zu legen schien.
Wie benommen ließ ich meinen Koffer stehen und folgte dem Sirenengesang. Dabei stieß ich versehentlich mit dem Fuß gegen eine Glasvitrine, wodurch ein klirrendes Geräusch entstand. Abrupt brach die Stimme ab, das Klavierspiel endete in schrillem Missklang. Ich trat neben die Mittelsäule, welche die Hallendecke stützte und mir die Sicht auf das kleine Podium verstellt hatte, auf dem das Piano und mehrere Trommeln standen. Gerade noch konnte ich sehen, wie eine Gestalt mit langen dunklen Haaren vom Klavierschemel aufstand, sich kurz nach dem Störenfried umdrehte, dann durch die Tür huschte und in dem dahinterliegenden Korridor verschwand. Wer war diese Frau, die mit ihrem Gesang Steine erweichen konnte? Und warum stahl sie sich weg wie eine ertappte Diebin? Wollte sie keine Zuhörer haben?
»San Sie der Profeschor Fohrbeck?«
Ich drehte mich um. Hinter der Rezeption war eine junge Frau mit blondem Pferdeschwanz aufgetaucht, ganz in Weiß gekleidet. Ich nickte geistesabwesend.
»Mir habe Se zum Abendesse erwartet, Herr Profeschor. Leider isch der Speisesaal scho gschlosse.«
»Entschuldigen Sie meine Verspätung, ich bin leider erst am späten Nachmittag von zu Hause losgekommen, außerdem haben mich zwei Staus aufgehalten. Ist Doktor Wieland noch im Hause?«
»Der Doktor konnt leider net auf Sie warte, da er heut Abend a wichtige Termin hätt.«
Schade! Gerne hätte ich den ersten Abend hier mit meinem Freund Ansgar verbracht, der leitender Therapeut der Phönix-Klinik war und sie mir empfohlen hatte.
Während die blonde Schwäbin im Computer nach meinen Daten suchte, sah ich mich um. Zu beiden Seiten der Eingangstür gab es Sitzecken mit orangefarbenen Sofas, bequemen Stoffsesseln und Glastischen, auf denen mit Orchideen bestückte Vasen standen. Wie dezente Raumteiler wirkten die hohen kubusförmigen Glasvitrinen, in denen allerlei medizinische Ratgeber und Bücher mit esoterisch anmutenden Titeln ausgestellt waren: »Das Glück, einen Baum zu umarmen« – »Die Aura-Fotografie als Schlüssel zum Selbst« – »Die sieben Hauptchakras und ihre Bedeutungen«. Auch Hermann Hesses »Siddharta« und Paulo Coelhos Erfolgsroman »Der Alchimist« fanden sich unter den ausgestellten Titeln. In einer anderen Vitrine waren verschiedenfarbige Edelsteine zu sehen, denen heilkräftige Wirkungen zugeschrieben wurden.
Schließlich fiel mein Blick auf eine sonderbare Pyramide, die neben der Mittelsäule platziert war: Es handelte sich um eine durchsichtige Edelstahlkonstruktion von circa einem Meter Höhe, deren Grundlinien zwei ineinandergesteckte Pyramiden nachbildeten. Die eine Spitze zeigte nach oben, während die andere auf dem Kopf stand und mit der Spitze den Boden berührte.
Was es mit dieser Pyramide auf sich habe?, fragte ich die junge Frau an der Rezeption.
»O., des isch was ganz Bsonders mit dene zwei Pyramide, Herr Profeschor. Schon die alte Ägypter habe gwusst, und neuere physikalische Experimente han des bestätigt, dass Läbensmittel wie Fleisch oder Gmüse, die man unter die Pyramide lege tät, und zwar genau unter die Spitze, länger konserviert bleibe … Und wenn Sie das innere Quadrat mit beide Hände längere Zeit anfasse, verspüre Sie ’nen wunderbaren Zufluss an Energie. I habs oft scho probiert. Wenn i müd bin, fass i die innre Pyramide an und fühl mi danach, wie wenn i grad aus der Dusche käm.«
Nur schwer konnte ich, bei dieser Mischung aus schwäbischem Pragmatismus und Okkultgläubigkeit, ein Lachen unterdrücken. Gleichzeitig fragte ich mich, ob ich hier eigentlich richtig war. Schließlich war ich nicht, gemeinsam mit Dorothea, aus der Kirche ausgetreten, um mich jetzt einer esoterischen Heilslehre anzuschließen, sei diese nun schamanistisch, buddhistisch oder ägyptisch-orientalisch inspiriert.
Die schwäbelnde Rezeptionistin erläuterte mir nun die Topografie der Klinik: »Mer san hier im Haus Sonne, wo auch die meischte Anwendunge stattfinde. Dort drübe isch das Haus Kristall. Sie wohne nebean im Haus Oase. I zeig Ihnen jetzt Ihr Zimmer.«
Ich folgte ihr durch einen langen Korridor, an dessen Wänden die Porträts der Mitarbeiter hingen, auch einige ausländische Namen und Gesichter darunter, nach den entsprechenden Teams geordnet. Alle Abteilungen wurden im gleichen Format vorgestellt, das Team, das für die Küche und die Reinigung zuständig war, rangierte gleich neben dem der Ärzte und Psychotherapeuten ohne die an den Kliniken übliche hierarchische Stufung.
Am Ende des Flurs lag der Speisesaal. Rechter Hand führte eine Tür mit Metalltreppe nach draußen in die beleuchtete Gartenanlage und auf einen überdachten, in leichtem Zickzack verlaufenden Holzsteg. Dieser ging an einem kleinen Seerosenteich vorbei und verband das Haus Sonne mit dem Haus Oase. Am Rand der Gartenanlage, zur Straßenseite hin, stand ein Holzhäuschen mit Balkon, an dessen Stirnseite ein Schild mit der tröstlichen Bezeichnung Raucherecke angebracht war. Mit Erleichterung registrierte ich, dass die Raucher hier nicht – wie in den meisten Kliniken – strikt verbannt wurden, dass ihnen vielmehr ein Platz, wenn auch nur draußen, zugestanden wurde. An verschiedenen Stellen des Rasens standen Liege- bzw. Hängestühle aus geflochtenem Leder. Linker Hand des Holzstegs, der die Gartenanlage teilte, erhob sich eine Blutbuche, deren mächtige Krone die Rasenfläche mit dem aufgespannten Federballnetz und den angrenzenden Zaun überragte. In ihrem Windschatten, nahe dem Eingang zum Haus Oase, wuchsen zwei dünnstämmige Birken, vor denen eine weitere Doppelpyramide aus Edelstahl stand; nur war diese drei- bis viermal so hoch wie das Modell in der Empfangshalle.
Mein Zimmer lag parterre, gleich am Anfang des Flurs.
»I hoff, Sie werde sich bei uns wohlfühle, Herr Profeschor«, sagte meine Begleiterin, nachdem sie mir gezeigt hatte, wie man mit der elektronischen Karte die Tür öffnete. »Frühstück isch von 8 bis 9. Uhr 30. Um 11 habe Se Termin bei Frau Doktor Klier. I wünsch Ihne a guts Nächtle!«
Das Zimmer war mit wenigen schlichten Möbeln im Fichtenton, einem kleinen Kühlschrank, einem Wasserkocher, einer Senseo-Espressomaschine, einem Set Wasser- und Teegläser und zwei Espressobechern ausgestattet. Es gab einen kleinen Flachbildschirm, einen DVD-Rekorder, einen CD-Player und eine Buchse mit WLAN-Anschluss. Nur die Stehlampe mit dem biegsamen Leselicht und dem Deckenfluter standen am falschen Platz; ich rückte sie gleich neben den gepolsterten Lehnstuhl am Balkonfenster.
Auf dem kleinen Sekretär, von dem aus man durchs Fenster in die Grünanlage blicken konnte, war gerade Platz genug für meinen Laptop. Dann packte ich meinen Koffer aus. Die paar mitgebrachten Bücher samt Tagebuch stellte ich in das kleine Regal, das über dem Nachttisch hing, und die mitgebrachte Rotweinflasche in die Minibar. Auch wenn mir bewusst war, dass Alkoholika in der Klinik verboten waren, auf meinen abendlichen »Absacker« wollte ich nicht verzichten.
Zwischen zwei Pullovern lag der Silberrahmen mit dem Porträt meiner Frau. Ich nahm es in die Hände und überlegte, wo ich es aufstellen sollte: auf den Nachttisch oder auf die kleine Wandkonsole neben dem Lehnstuhl? … Es war ein frühes Passfoto von Dorothea, das durch die Vergrößerung seine Schärfe verloren hatte und daher wie gemalt wirkte. Es stammte aus der Zeit, da wir uns kennengelernt hatten. Wie schön und ausdrucksvoll war ihr Gesicht mit der hohen, vom blonden Pony gesäumten Stirn, den leicht verschatteten türkisblauen Augen unter den dunkelblonden Brauen, der weichen Kinnlinie und dem sinnlichen Lippenbogen mit den kleinen Grübchen in den Mundwinkeln, die auch dann zu lächeln schienen, wenn ihre Lippen geschlossen waren.
Als ich, wenige Tage nach ihrem Tod, dieses alte Bild einscannte und es plötzlich auf dem Monitor erblickte, wurde mir jäh bewusst, dass es sie gleichsam nur noch in gepixelter Form gab, während ihr geliebter Leib im Kühlhaus des St.-Vinzenz-Krankenhauses lag. Es war zum Verrücktwerden!
Dieses vergrößerte Foto mit dem melancholischen Blick hatte ich zur Trauerfeier auf ihren Sarg gestellt. Und wenn ich verreiste, nahm ich es mit. Ich dachte daran, wie ich das erste Mal nach ihrem Tod in einem Hotel der Mainzer City übernachtete. Als ich spätabends nach meinem Vortrag das Hotelzimmer betrat, wollte ich nach alter Gewohnheit zum Telefon greifen, um Dorothea anzurufen, und ließ, die Sinnlosigkeit dieser Geste plötzlich begreifend, meinen ausgestreckten Arm wieder sinken. Damals hatte ich meinen Kopf in den Kissen des Doppelbettes vergraben und geweint. Jetzt war der Schmerz immer noch da, aber er überwältigte mich nicht mehr; irgendwie hatte ich inzwischen gelernt, mit ihm zu leben. Oder hatte ich ihn nur betäubt?
Ich stellte ihr Foto auf die Wandkonsole neben den Lehnstuhl. Dann zog ich mir eine Wolljacke über und holte die Rotweinflasche aus der Minibar.
Mit dem vollen Weinglas trat ich hinaus auf den Balkon. Es war kühl, der Wind ließ die Äste der Birken und der Blutbuche erzittern. Von den Wandleuchten des gegenüberliegenden Hauses fiel ein mattes Licht auf den Rasen und den Holzsteg. Ab und zu lugte der Mond durch die Wolkendecke und warf seinen Schimmer auf die Edelstahlpyramide. An zwei Sternen von besonderer Leuchtkraft, die ganz nah beieinanderlagen, blieb mein Blick haften: Philemon und Baucis. Die Geschichte jenes mythischen Paares, das in glücklicher Harmonie und Selbstgenügsamkeit auf dem Lande lebte, hatten Dorothea und ich immer auf uns bezogen: Als Zeus und Hermes eines Nachts, als Bettler verkleidet, an die Tür ihrer Hütte klopften, hatten Philemon und Baucis ihnen, als Einzige unter den Dorfbewohnern, Obdach gewährt. Zum Lohn dafür stellten die Götter ihnen einen Wunsch frei. Sie wünschten sich, dass keiner vor dem anderen sterben würde. Der Wunsch wurde ihnen gewährt – und so gingen sie, als die Zeit gekommen war, gemeinsam ins grüne Laub … Eine Woche vor ihrem Tod hatte Dorothea einem befreundeten Ehepaar per Mail zur silbernen Hochzeit gratuliert und dabei diese Geschichte erwähnt. Hatte sie geahnt, dass sie bald ohne mich ins grüne Laub gehen würde?
Was bin ich ohne sie? Ein Übriggebliebener. Ein halbiertes Wesen.
Mich fröstelte. Ich ging wieder hinein und machte mich bettfertig. Trotz meiner Müdigkeit konnte ich nicht einschlafen. Ich knipste die Nachttischlampe an und nahm mein Tagebuch aus dem Regal.
Ich zögerte, bevor ich es aufschlug. Die darin versammelten Eintragungen hatte ich in den einsamsten und verzweifeltsten Stunden meines Lebens geschrieben. War es denn nicht gefährlich, sich da wieder hineinzubegeben?
15. April
Meine Liebste,
auch wenn ich weiß, es ist eine Illusion, aber ohne sie käme ich nicht über den Tag: Ich stelle mir vor, dass du mich noch hörst, wenn ich mit dir spreche, und dass dich auf geheimnisvolle Weise noch erreicht, was ich dir schreibe.
Schließlich sind ja auch unsere beiden PCs noch immer per Kabel verbunden. Auch wenn ich von dir jetzt keine E-Mails mit blinkenden Smileys mehr empfange, ich spüre deine unsichtbare Gegenwart überall, nicht nur hier, wo dein Schreibplatz war und dein PC noch immer steht – ich spüre sie überall im Haus, in unserem wunderschönen alten Fachwerkhaus, das du so liebevoll eingerichtet hast, ebenso im Garten, der gerade jetzt in voller Frühlingsblüte steht.
Gestern Abend, als ich mir – das erste Mal wieder seit deinem Tod –mein Manuskript vornahm und das zuletzt Geschriebene durchlas, rief ich unwillkürlich aus: »Hör mal, Schatz, wie findest du das?«, um gleich darauf festzustellen, dass der Platz neben mir leer ist. In diesem Moment war mir, als müsste ich meinen Kopf gegen die Balken schlagen, bis ich das Bewusstsein verliere.
Heute Morgen habe ich mich auf deinen Stuhl gesetzt und den Videotext angeschaltet. Es ist das erste Mal seit deinem Tod, dass ich deinen Platz einnahm. Doch was interessieren mich die Katastrophenmeldungen von ZDF und ARD nach der Katastrophe, die dein plötzlicher Tod, dein Nichtmehrsein, für mich bedeutet.
17. April
Setzte mich heute aufs Mountainbike und machte unsere übliche Tour an der Lahn entlang, wobei ich mich manchmal unwillkürlich nach dir umdrehte, als führest du noch immer hinter mir – und konnte die blühenden Obstbäume und die leuchtend gelben Rapsfelder um mich herum sogar wieder ein wenig genießen. Die körperliche Bewegung, die Muskeln und Sehnen, die eigene Kraft zu spüren – gerade jetzt, wo die Seele so leidet –, das tut gut.
Doch als ich in der Abenddämmerung zurückkam und es war so still im Haus, da fasste mich wieder der ganze Jammer an. Wie soll ich leben ohne dich? Was bin ich ohne dich, ohne deine Gegenwart und Wärme, ohne unser tägliches vertrautes Sprechen und Austauschen? Du warst mein Spiegel. In der besonderen Art, wie du mich wahrnahmst, erkannte und spürte ich mich selbst. Jetzt, da der Spiegel zerbrochen ist, tappe ich wie ein Blinder im Dunkeln umher, ich spüre mich nur noch ungenau und weiß nicht mehr, wer ich eigentlich bin.
22. April
Wie schwer mir das Leben im Singular fällt. Noch immer stelle ich deinen Zahnputzbecher auf seinen Platz neben dem meinen. Noch immer hole ich, wenn ich zu Mittag oder Abend esse, unwillkürlich zwei Gabeln, Löffel und Messer aus dem Schubfach – bis ich meinen »Irrtum« bemerke. Und noch immer lege ich dein rotes Kopfkissen auf deine Betthälfte, wenn ich schlafen gehe.
Ich wage kaum, mich an unseren letzten Liebesschlaf zu erinnern, an jenen Mittwoch, drei Tage vor deinem Tod, dein warmer, weicher, schmiegsamer Leib … all das soll ich nur noch erinnernd »erleben« dürfen? Ich verdränge die Bilder, um nicht ganz elend zu werden.
23. April
Gestern habe ich das erste Mal seit deinem Tod wieder ferngesehen, unseren sonntäglichen »Tatort«. Aber wie sehr vermisste ich dein Händchen und unsere gemeinsamen Spekulationen, wer wohl der Täter sei. Und wie anders habe ich die Begräbnisszene empfunden, da der Pfarrer eine Schaufel Erde auf den Sarg des Opfers wirft und dann die bekannten Worte spricht: Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Da fiel ich richtig aus dem Film – in die bittere Wirklichkeit.
Im Grunde kann ich ihn nicht begreifen: den Tod. Dass von einem Moment auf den anderen deine Personalität mit allem, was sie ausmachte und was sie mit mir verband‚ dass dies alles in einer Sekunde ausgelöscht wurde und mit dir im Koma, ins Nichts, versank –es ist noch immer unfassbar für mich! Und doch muss ich deinen Tod annehmen, so wie man eine Naturkatastrophe annehmen muss.
Selig sind die Ausgebrannten
Als ich, nach einer unruhigen Nacht, am nächsten Morgen gegen neun den Speisesaal betrat, begrüßte mich, mit slawischem Akzent, eine mittelalte Frau mit Silberblick und lindgrüner Schürze. Sie wurde, wie ich bald hörte, von den Patienten »die Küchenfee« genannt, weil sie die Gäste mit einem so beglückenden Lächeln zu bedienen pflegte, als ob sie jedes Mal eine neue Götterspeise offerierte, selbst wenn es sich nur um eine Nudelsuppe mit Klößchen handelte. Sie wies mir sogleich meinen Platz an einem der Sechsertische zu, die entlang der Fensterfront aufgereiht waren.
»Guten Morgen.«
»Guten Morgen«, kam es von fünf Tischgästen zurück, die den Neuankömmling neugierig musterten. Ich kam mir vor wie ein Schüler, der das erste Mal vor der Klasse steht und in den Gesichtern seiner Mitschüler die Frage liest: Was ist denn das für einer? Ich nahm Platz neben einer sommersprossigen Frau mit schulterlangen roten Haaren, die einen grauen Trainingsanzug trug.
»Ich bin Roswita«, sagte sie und reichte mir die Hand.
»Ich bin Fabian.« Neben meinem Frühstücksgedeck lag eine Stoffserviette mit einem Klebestreifen, auf dem in schwarzen Druckbuchstaben stand: PROF. DR. FABIAN FOHRBECK.
»Ich heiße Marja«, sagte die Frau, die mir gegenübersaß. »Willkommen im Klub.« Sie mochte Ende fünfzig sein, hatte warme Augen und trug eine gebatikte Bluse in brünetten Herbstfarben. »Wir sind schon die ganze Zeit gespannt auf den Überraschungsgast, nicht wahr, Oswald?«
»Wir haben schon gerätselt«, sagte, in leicht sächselndem Tonfall, der Angesprochene, der neben Marja saß, ein breitschultriger Mann mit Bürstenhaarschnitt, Stoppelbart und jungenhaften Gesichtszügen: »Ist er nun ein Doktor der Medizin, der die Seite gewechselt hat und auch mal wissen will, wie man sich so als Burn-out-Patient fühlt?«
»Oder ein Doktor der Philosophie, der uns ein Licht aufsteckt über den Sinn des Lebens – warum wir eigentlich hier sind und unsere kostbare Zeit vertun?«, fragte in leicht spöttischem Ton die Frau, die an der Schmalseite des Tisches saß und gerade eine Scheibe Knäckebrot mit Butter bestrich. Ihre schwarzbraunen Haare bauschten sich über der Stirn zu einer helmartigen Frisur, die ihrem Gesicht etwas Wehrhaftes verlieh. »Simone Aschmoneit«, fügte sie mit einem angedeuteten Lächeln hinzu.
»Doktor Aschmoneit bitte«, ergänzte Marja mit hochgezogenen Brauen.
Während ich mir Kaffee einschenkte, fühlte ich noch immer alle Blicke auf mir ruhen.
Ob ich mit meinem Zimmer zufrieden sei, fragte Marja. Ich bejahte. Und ob ich schon meinen Therapieplan habe?
Ich schaute auf das Blatt, das neben meinem Frühstücksteller lag, aber da stand außer dem Termin bei Frau Doktor Klier noch nichts drauf.
Warnend hob Oswald den kleinen Löffel, mit dem er gerade sein Frühstücksei aufgeklopft hatte: »Glaub ja nicht, Fabian, dass du hier eine ruhige Kugel schieben und ausschlafen kannst. Schon vor dem Frühstück geht es mit Qigong auf der Wiese los. Therapie ist ein Knochenjob, kann ich dir sagen. Da bleiben kein Hemd und kein Auge trocken. Und Überstunden werden nicht bezahlt.«
»Oswald übertreibt wieder mal schamlos«, sagte Roswita, als müsse sie mich beruhigen. »Es gibt hier ein großes Angebot von Therapien, und wenn dir die eine nicht zusagt, kannst du problemlos eine andere wählen oder einfach spazieren gehen.«
»Das sagt eine«, sagte Oswald, »die jede zweite Anwendung schwänzt und stolz darauf ist, ihren Therapieplan zu höchstens fünfzig Prozent zu erfüllen.«
Roswita knüllte ihre Stoffserviette zusammen und hob den Arm mit dem Tuchknäuel drohend in Oswalds Richtung. Der ging grinsend in Deckung und streifte dabei versehentlich den Arm von Frau Aschmoneit, die gerade ihre Kaffeetasse zum Mund führte. Der Kaffee schwappte über die Tasse, spritzte auf das weiße Tischtuch und auf den Ärmel ihrer Trainingsjacke, die aus irgendeiner teuren Chemiefaser bestand.
»Kannst du nicht aufpassen?«
Oswald entschuldigte sich wortreich für das Malheur und legte Papierservietten über die hässlich braunen Flecken auf dem Tischtuch.
»Irgendwie wundert es mich ja nicht«, legte Frau Aschmoneit nach, während sie mit einer Stoffserviette den Fleck auf ihrem Ärmel wegzurubbeln suchte, »dass du deine Firma in die roten Zahlen gefahren hast.«
Für einen Moment gefror Oswalds Miene, dann sagte er: »Ich bezahle dir die Reinigung, Simone. Und werde dich für den nächsten European Song Contest empfehlen als die Frau mit der spitzesten Zunge von Deutschland.«
Roswita und Marja kicherten. Ich stand auf und ging zur Frühstückstheke. Als ich mir gerade ein Glas mit Orangensaft füllte, stand plötzlich Frau Aschmoneit mit ihrem Teller neben mir und fischte nach einem Stück Lachs.
»Was lehren Sie, wenn ich fragen darf?«
»Ich bin Kulturwissenschaftler … Und Sie?«
»Ich arbeite an der minimalintensiven Verbesserung der Welt. Ich berate Unternehmen.«
»Wir wollten«, sagte ich, »die Welt auch mal verbessern, anno 68 und danach.«
»Offenbar war die andere Seite effizienter und erfolgreicher.«
Mir fehlten die Worte.
»Sie müssen übrigens nicht denken, dass Sie die nächsten Wochen mit uns an diesem Tisch verbringen müssen. Mit den zugewiesenen Plätzen nimmt man es hier nicht so genau.«
Als ich mit meinem Tablett wieder am Gruppentisch Platz genommen hatte, ließ die Küchenfee gerade eine Liste mit den angebotenen Menüs für das Mittagessen herumgehen. Ich kreuzte das Fischgericht an.
Die Küche, beteuerten Marja und Roswita übereinstimmend, sei hier ganz ausgezeichnet. Der Koch arbeite vorwiegend mit Gemüse, Obst und Angeboten aus der Region. Er verstehe sich aber auch auf die asiatische Küche und sei besonders kreativ, was die Desserts angehe.
»Nur von der deutschen Küche versteht er rein gar nix!«, protestierte mit bayerischem Dialekt der bullige Mann, der mit einem Teller voller Rührei und Schinkenspeck von der Theke kam und den Platz neben Roswita besetzte. Er hatte kurze, an den Schläfen leicht angegraute Haare, mattblaue Augen und einen mächtigen Brustkorb, über den sich ein graues Polohemd spannte. »Wenn er uns doch wenigstens einmal die Woche, statt Tofu mit Sojasprossen, eine richtige Schweinshaxen mit Sauerkraut und Bratkartoffeln gönnen tät.«
»Du solltest ihm dankbar sein« sagte Roswita, »dass er beim Kochen auch an deinen Cholesterinspiegel denkt.«
»Ja, ja, Fett gilt heutzutage als Inbegriff des Schlechten, Ekligen und Krankmachenden. Und wer eine gesunde Schwarte hat, der hat in der Gesellschaft der Magersüchtigen nichts zu lachen. Ich bin übrigens Viktor«, sagte er beiläufig in meine Richtung, indem er Mittel- und Zeigefinger zum Victoryzeichen spreizte, dann aber mit einer raschen Drehung der Hand den Daumen nach unten kehrte. »Leider hält mein Name nicht, was er verspricht, sonst wär ich wohl nicht hier.«
»Wie du siehst«, sagte Oswald zu mir, »nehmen wir an diesem Tisch uns alle nicht zu ernst. Lachen ist bekanntlich die beste Medizin. Ist jedenfalls besser und gesünder als Antidepressiva. Oder wie unsere Cheftherapeutin, in zeitgemäßer Erweiterung der Bergpredigt, zu sagen pflegt: ›Selig sind die Ausgebrannten, denn sie haben endlich Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.‹«
Der Humor dieses Sachsen gefiel mir. Ich war erleichtert, dass man mich an einen Tisch platziert hatte, an dem wohl gewisse Spannungen und Reizbarkeiten herrschten, jedoch keine Trübsal geblasen wurde.
Die Therapeutin
Nach dem Frühstück nahm ich den Aufzug in den zweiten Stock. Während ich vor dem Büro der leitenden Therapeutin Doktor Klier wartete, überkam mich eine gewisse Unruhe, die sich mit einer Art von Scham verband. Es war schließlich das erste Mal, dass ich mich in eine psychosomatische Klinik begeben musste. Immer noch sträubte sich etwas in mir gegen die Vorstellung, dass ich, der eigentlich immer gesund gewesen und über eine hohe Leistungsmotivation und -fähigkeit verfügt hatte, nun für sechs Wochen krankgeschrieben war und wie ein psychisch Kranker behandelt werden sollte.
»Herr Fohrbeck.«
Ich hob den Blick. Aus der Tür gegenüber trat eine mittelgroße, etwas füllige Frau mit gescheiteltem schwarzen Haar.
»Ich bin Margarete Klier. Bitte kommen Sie rein.«
Mit seinen sonnengelben Tapeten, der mokkabraunen Ottomane mit der geschwungenen Lehne, dem alten Jugendstilvertiko mit dem geschnitzten Aufsatz und der Sitzecke gleich hinter der Tür wirkte der Raum eher wie ein Wohnzimmer denn wie ein Büro.
»Bitte nehmen Sie Platz.«
Ich setzte mich in einen Ledersessel, vor dem ein Keramiktisch mit zwei Konfektschalen stand, während die Therapeutin mir gegenüber in einem Ohrensessel Platz nahm. Sie mochte Ende fünfzig, Anfang sechzig sein und trug einen taubengrauen Wickelrock, eine schwarze Designerbluse mit weißen Blumenmustern, einen Seidenschal und schwarze Schnürstiefel. Ihr Outfit passte zu jener Mischung aus leicht matronenhafter Statur, intellektueller Ausstrahlung, die durch ihre hohe runde Stirn und die wachen Augen hinter der randlose Brille bekräftigt wurde, und einer gewissen Strenge, die wohl ihren schmalen Lippen und ihrer energischen Kinnlinie geschuldet war.
Frau Klier hob die Augen von der Krankenakte, die vor ihr auf dem Tisch lag. »Doktor Wieland hat mir viel von Ihnen und Ihrer Frau erzählt. … Wie lange ist es jetzt her, dass sie starb?«
»Sieben Monate.«
Frau Klier sah mich mitfühlend an. »Da ist das Gefühl des Verlustes, der Einsamkeit besonders schlimm, nicht wahr? Die ersten Wochen und Monate haben sich noch die Angehörigen, Kinder und Freunde um einen gekümmert. Man war nicht allein, konnte seinen Schmerz mit anderen teilen. Aber danach geht das Leben wieder seinen normalen Gang, jeder hat zu tun. Nur für den, der seinen Lebenspartner verloren hat, ist nichts mehr wie vorher. Für ihn gibt es keine Normalität mehr.«
Ich staunte, wie treffend die Therapeutin meine Situation beschrieb, ohne mich doch zu kennen. Keine Normalität mehr. Genau das war es!
»Wie lange waren Sie mit Ihrer Frau zusammen?«
»Fast dreißig Jahre.« Diese Zahl kam mir jetzt, da ich sie aussprach, irgendwie unwirklich, ja geradezu mythisch vor. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass es für mich jemals ein anderes Leben gegeben hatte, ein Leben vor Dorothea. Noch, dass es für mich ein Leben nach Dorothea geben könnte.
»Sie starb an einem Aneurysma … Waren Sie dabei?«
»Ja.«
»Gab es keine Anzeichen, nichts, was darauf hindeutete?«
»Vor achtzehn Jahren hatte sie schon einmal ein Aneurysma, einen Blutsturz im Gehirn. Aber die OP verlief glücklich, und sie wurde vollständig geheilt. Das zweite Mal war es nicht mehr operabel. Es war ein Sekundentod.«
»Wie schrecklich für Sie, welch ein Schock. Konnten Sie Ihren Schmerz und Ihre Trauer mit jemandem teilen?«
»Ja, vor allem mit Sonja, meiner Stieftochter. Und mit meiner Schwiegermutter. Sie ist dreiundneunzig. Sie stand am Bett ihrer einzigen Tochter und rief immer wieder fassungslos: ›Ach, mein Mäusken, warum du – und nicht ich.‹«
Frau Klier zog die Schultern hoch, als ob ihr fröstelte. »Das ist das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann: das eigene Kind zu überleben.« Ihr Blick ging unwillkürlich in Richtung Schreibtisch, wo ein Foto ihrer Familie mit ihren Kindern stand.
»Doktor Wieland sagte mir, Sie und Ihre Frau seien sehr glücklich miteinander gewesen.«
»Sie war mir alles, was eine Frau einem Mann sein kann.«
»Wie schön, dass Sie das sagen können. Doch umso größer der Schmerz.«
Ich musste an jenen Vers von Goethe denken, den Ansgar in den Tagen des großen Schmerzes mir einmal zitiert hatte: Alles geben die Götter, die unendlichen/ Ihren Lieblingen ganz./ Alle Freuden, die unendlichen/ Alle Schmerzen/ die unendlichen, ganz« – Ihren Lieblingen wohlgemerkt, hatte er tröstend hinzugefügt. Ich fühlte den Ansturm der Tränen hinter den Lidern.
»Möchten Sie darüber sprechen oder lieber nicht?«, fragte Frau Klier.
Es war ein Zustand, für den ich selbst jetzt noch kaum die richtigen Worte fand – ein Ausnahmezustand der Seele, der zwischen jähem Schmerz, Betäubung, Verlorenheit, Verzweiflung und dem Gefühl totaler Unwirklichkeit schwankte.
»So richtig fühlbar wurde mir meine plötzliche Verlassenheit erst, als alle abgereist waren und es wieder still im Hause war. Solange ich noch, gemeinsam mit Sonja und Andreas, mit der Ausrichtung der Trauerfeierlichkeiten beschäftigt war, solange die Stimmen der Kinder und Enkel das alte Fachwerkhaus erfüllten, drang der Schmerz nur gedämpft an mich heran.
Kaum aber waren sie alle fort, kam er zurück. Gebieterisch und unabweisbar stand er vor mir – kein Ausweichen, keine Ablenkung, kein Widerstand mehr möglich – und begehrte Einlass in mein gedrücktes Herz, es nunmehr ganz in Besitz nehmend.
Schlimm war das Erwachen am Morgen, wenn ich die leere Betthälfte neben mir wahrnahm. Meist schloss ich wieder die Augen und ließ mich in den Halbschlaf zurücksinken, hoffend auf einen gnädigen Traum, der bezeugte, dass sie noch lebte. Umso bitterer war das Erwachen danach.
Schließlich stand ich auf und ging hinunter ins Bad. Nahm meinen Frotteebademantel vom Türhaken, neben dem noch immer der ihre hing, die gleiche Ausgabe, nur zwei Nummern kleiner. Während ich die Stiege hinabstieg, wunderte ich mich, dass mir die Ärmel nur bis knapp über die Ellenbogen reichten: Wieder einmal war ich in ihren Bademantel geschlüpft. Ich hob den Arm und hielt meine Nase in die Achselhöhlung des Mantels: Einen Hauch ihres Geruchs, ihres Schweißes glaubte ich noch wahrzunehmen. Oder war es nur noch mein eigener?
Ich betrat die kleine Küche, um mir einen Kaffee zu machen. Wie immer gab ich sechs Messlöffel Kaffee in den Filter und füllte den Tank bis zum vierten Strich mit Wasser aus der Evian-Flasche. Ich wollte gerade den Ein-Aus-Knopf drücken, als mir jäh bewusst wurde, dass ich ab jetzt nur noch die halbe Menge Wasser und Kaffee benötigte.
Ich konnte, ich wollte es einfach nicht wahrhaben, dass eine neue Zeitrechnung begonnen hatte, dass ich von jetzt an im Singular statt wie bisher im Plural würde leben und handeln müssen.
Was mich am meisten quälte, war die plötzliche Stille um mich herum. Wie ein verwaistes Kind lief ich durch Haus und Garten und rief immer wieder denselben Satz: ›Wo bist du, Liebste? Wenn ich nur wüsste, wo du jetzt bist!‹ Doch niemand antwortete mehr – außer dem gleichgültigen Säuseln des Windes und dem monotonen Gurren des Taubenpaares, das im Geäst der Kiefer nistete.
Mir war, als sei ich gefangen in einem leeren Raum mit schalldichten Wänden, als sei ihr Tod gleichbedeutend mit Isolationshaft für mich, Isolation für den Rest meines Lebens.
Um von dem Schweigen, das mich jeden Morgen aufs Neue umfing, nicht völlig erdrückt zu werden, beschloss ich, den so plötzlich abgerissenen Dialog mit meiner Frau fortzusetzen, indem ich an sie schrieb – auch wenn es keine Anschrift mehr gab, an die ich meine Briefe adressieren konnte, war sie doch im wahrsten Sinne des Wortes unbekannt verzogen.«
»Und«, fragte Frau Klier bewegt, »schreiben Sie ihr noch immer?«
»Als ich Mitte Juni wieder meine Arbeit an der Universität aufnahm, habe ich damit aufgehört. Ich hatte einfach sehr viel zu tun, zumal just in diesen Monaten eine neue Sorge auf mir lastete und noch immer lastet: Die kulturwissenschaftliche Fakultät der Hochschule, an der ich seit vielen Jahren unterrichte und die ich mit aufgebaut habe, soll verkleinert werden, weil sie sich angeblich ›nicht rechnet‹ und ›zu wenig Drittmittel einfährt‹ – so der neue Rektor. Ich habe keinen Beamtenstatus, mein Vertrag wird alle zwei Jahre verlängert. Und da ich mir die Professur mit einer jüngeren Kollegin teile, steht auch mein Arbeitsplatz auf dem Spiel.«
»Auch das noch.« Frau Klier sah mich bekümmert an.
»Seit die Kürzungspläne bekannt wurden, ist ein Klima der Angst in die Fakultät eingezogen: Wen wird es treffen? Wie muss ich mich gegen die anderen Kollegen und Kolleginnen profilieren, damit es nicht mich trifft? Gleichzeitig wehrten wir uns. Verzweifelt suchten meine Mitarbeiter und ich nach Sponsoren zur Gewinnung von Drittmitteln, schrieben Anträge über Anträge, verfassten Memoranden und Eingaben an das Ministerium und, und, und … Von alldem Stress war ich bald so erschöpft und gleichzeitig so überreizt, dass ich nachts stundenlang wach lag, weil das Mühlrad in meinem Kopf nicht mehr zur Ruhe kam.«
»Sie waren also wieder im Hamsterrad«, resümierte Frau Klier. »Wie heißt es so schön in den Sprüchen Salomonis: Ein jegliches Dingbraucht seine Zeit. Das gilt auch für das Trauern und Loslassen. Doch nicht einmal dafür nehmen wir uns die nötige Zeit. Bis der Körper die Notbremse zieht.«
In den ersten Wochen nach dem Tod meiner Frau hatte ich oft geweint und viel geschrieben – an sie und über sie. Doch als der Hochschulalltag wieder begann, schaltete ich meine Gefühle ab. Auch war es mir peinlich, vor den Kollegen und Studenten meinen Schmerz zu zeigen. Dafür war ich dann ständig verschnupft und musste mir während der Vorlesung und des Seminars die triefende Nase schnäuzen, als ob die Tränen, die ich nicht mehr weinen wollte oder konnte, sich einen anderen Kanal suchten. Oft verließ ich erst gegen 21 Uhr das Büro der Fachschaft, nur um nicht in unserem Haus, in dem Dorothea noch überall präsent war, allein zu sein.
»Und wie erging es Ihnen in den Semesterferien?«
»Da schrieb ich mein Buch zu Ende.«
»Wovon handelt es?«
»Von der Habgier und dem zentralen Paradox unserer Epoche: warum wir mittels neuer Technologien immer mehr Zeit einsparen und doch keine mehr haben.«
Frau Klier schürzte die Lippen. Es war ja auch nicht ohne Ironie, dass ich, der Kulturwissenschaftler, ein kritisches Buch über den Turbokapitalismus schrieb und doch, als es mich persönlich betraf, auch nicht vermochte, innezuhalten.
»Aber nachdem ich das Manuskript abgeliefert hatte, fiel ich in ein Loch. Auf einmal kam mir alles so sinnlos vor. Wozu noch Bücher schreiben? Wozu noch unterrichten? Wozu noch um den Erhalt der Fakultät und um meinen Arbeitsplatz kämpfen? Wenn der mir liebste und wichtigste Mensch, die Frau an meiner Seite, nicht mehr da war. Ich fiel in eine gefährliche Gleichgültigkeit, kam morgens nur noch schwer aus dem Bett, fühlte mich matt und antriebslos, verlor den Appetit, hatte an nichts mehr Freude. Dazu kamen Herzrhythmusstörungen. Mein Hausarzt diagnostizierte eine Depression infolge von schwerem Lebensstress und überwies mich, nachdem ich mich mit Ansgar abgesprochen, in diese Klinik.«
Frau Klier nickte. Nach einer Weile sagte sie: »Trauer ist Ablösung. Es ist die Ent-Bindung und schmerzhafte Ablösung an den Stellen, an denen man zusammen gewachsen war, in Gefühlen, lieben Gewohnheiten und den Sicherheiten, die man vom anderen erwarten durfte. Lassen Sie los. Lassen Sie die Erinnerungen zu, die schönen wie die schmerzlichen! Weinen Sie, wenn Ihnen danach ist. Lachen Sie, wenn Ihnen danach ist. Tanzen Sie, wenn Ihnen danach ist. Und tun Sie alles, was Ihnen guttut und Freude bereitet … Vielleicht wird es Ihnen auch guttun, wieder an Ihre Frau zu schreiben.«
Sie besprach dann mit mir den Therapieplan für die erste Woche. Doch müsse ich den Plan nicht sklavisch befolgen. Wenn ich allein sein oder lieber spazieren gehen wolle, dann solle ich das ruhig tun. Andererseits sei es gut, sich in einer Gemeinschaft zu bewegen, die manches auffangen könne und in der es viel Empathie gebe.
Ich verließ das Büro von Frau Klier mit einem guten Gefühl: Diese Frau war einfühlsam, klug, sehr klar und bestimmt in ihrer Art. Und ich mochte ihre wohltemperierte Altstimme, die mich ein wenig an ein Violoncello erinnerte.
Auf der Klangliege
17 Uhr: Klangmeditation bei Herrn Sommer stand auf meinem Therapieplan.
Ich griff mir einen der bunten Regenschirme aus dem Halter vor der Eingangstür des Hauses Sonne und spannte ihn auf. Ein schmaler gewundener Kiesweg führte mich am Haus Kristall vorbei zu dem kleinen Pavillon am Rande des Kurparks.
»Ich bin Winfried. Willkommen in der Wiege der Klänge!«, empfing mich mit kräftigem Handschlag ein Mann in kurzärmeligem Sporthemd und weißer Leinenhose. Die weiche, geradezu sanfte Stimme des Therapeuten bildete einen erstaunlichen Kontrast zu seiner maskulinen Erscheinung: breite Schultern, muskulöse Oberarme, kurzer, kräftiger Hals, auf dem ein runder braun gebrannter Schädel saß, den ein spärlicher schwarzer Haarkranz zierte.
Ob ich schon mal auf solch einem Ding gelegen habe? Winfried deutete auf die Klangliege in der Mitte des Raumes.
Ich verneinte.
Ob ich selbst ein Instrument spiele?
Ja, Querflöte.
Dann sei ich ja bestens vorbereitet für die Klangmeditation. Sie sei zwar nicht so populär wie Yoga, Qigong und andere Formen der Meditation, aber darum nicht weniger heilsam. Das Wissen über Musik als meditative und Heilkraft gehe auf den griechischen Philosophen Pythagoras zurück. Die Vibration der Töne durchdringe das Innere des menschlichen Körpers, der ja bekanntlich zu achtzig Prozent aus Wasser bestehe.
»Es ist, wie wenn man einen Stein in einen See wirft: Rund um die Stelle, da der Stein auf die Wasseroberfläche trifft, bilden sich konzentrische Kreise. So ähnlich wirken auch die Schwingungen der Töne, die sich in unserem Körper ausbreiten – von den Zehen bis zum Kopf.«
Winfried führte mich an die Klangliege heran, ein aus Edelhölzern bestehendes Bett, das auf einem schön gerundeten Holzgestell ruhte, und erklärte mir ihre Funktionsweise. An der Unterseite der Liege waren, an Stiften befestigt wie bei einer Zither, zehn Saiten gespannt – das sogenannte Monochord. Auf dem kleinen Perserteppich darunter befanden sich kupferfarbene Klangschalen verschiedener Größe und ganz besonderer Legierungen. An der Längsseite der Liege hingen an einem Gestänge Zimbeln und Aluminiumröhren verschiedener Stärke und Länge – das Glockenspiel.
»Mithilfe der Saitenklänge des Monochords«, sagte Winfried, »wirst du dich wie in einem Klangkokon eingebettet fühlen, dein Körper wird in Schwingung geraten, als ob du in einer Wiege liegst.«
Ich zog meine Schuhe aus und nahm auf der Liege Platz. Der Therapeut hüllte mich in eine weiche flauschige Decke. Ich schloss die Augen.
Die Klangmeditation beginnt mit einem leisen tiefen Grundton, mehr ein Hall als ein Ton, der von ganz weit her zu kommen scheint, sich mal um winzige Nuancen steigert, dann wieder langsam abebbt. Manchmal klingt es wie ein fernes Summen oder Brummen, dann wie das Brandungsgeräusch eines weit entfernten Meeres, das eine ungemein beruhigende, beinahe einlullende Wirkung auf mich hat. Nach einer Weile kommen andere, hellere Töne dazu, lange nachhallende Glockentöne, die sich mit den Klängen des Monochords und dem Geräusch des Regens mischen, der auf das Dach des Pavillons prasselt. Bald glaube ich zu spüren, wie mein Körper in leichte Schwingung gerät, von bald tieferen, bald höheren Klangwellen umflutet, indes mein Geist auf Wanderschaft geht …
Wie um mich zu ärgern, taucht plötzlich die dicke Hostess in ihrer grauen Uniform vor mir auf, die, all meine Erklärungen ignorierend, den Zettel mit dem Bußgeldbescheid ausfüllt, weil ich, noch am Tag vor meiner Abreise, zwei Minuten lang auf einem Behindertenparkplatz vor der Postbank gestanden habe. Dann sehe ich mich mit Dorothea inmitten eines Demonstrationszuges, der von behelmten Polizisten mit Plastikschilden begleitet wird, über die abgesperrte Autobahn marschieren, in der Ferne blinkt der Tower des Frankfurter Flughafens, es ist so heiß, dass die T-Shirts wie nasse Lappen um unsere Schultern hängen, wir tragen Transparente mit globalisierungskritischen und Antikriegsparolen, während über unseren Köpfen die Polizeihubschrauber kreisen. Ein anschwellendes Dröhnen wie von Motoren: Plötzlich verwandelt sich die Skyline des Frankfurter Flughafens in die futuristischen Wolkenkratzer von Shanghai. In der Abenddämmerung spaziere ich mit Dorothea und den anderen Touristen über den Bund und bleibe bei einem chinesischen Straßenhändler hängen, der einen fantastischen Zaubertrick vorführt: Er greift kleine leuchtende Kugeln aus der Luft, die sich zwischen seinen Fingern auf wundersame Weise vermehren, dann steckt er sie sich nacheinander in den Mund, wo sie verschwinden und verglühen. Ich will dieses Kunststück unbedingt kaufen. Nach längerem Feilschen einige ich mich mit dem Händler schließlich auf einen Preis. In der Hand das Tütchen mit den erworbenen Zauberrequisiten, will ich wieder zu meiner Gruppe aufschließen. Doch sie scheint samt Dorothea in der unübersehbaren Menschenmenge verschwunden. Wie komme ich jetzt zurück ins Hotel? Und wie heißt es noch mal? Ich gerate in Panik, denn ich kann mich an den Namen dieses Hotels nicht mehr erinnern. Dann sehe ich mich, während unablässig Autos an mir vorbeirauschen, allein am Rande einer sechsspurigen Autobahn in einer kleinen Parkbucht stehen. Meine einzige Hoffnung ist, dass man mich hier, wo der Bus gehalten hat und alle ausgestiegen sind, auch wieder abholen wird. Ansonsten wäre ich verloren in dieser 23-Millionen-Metropole … Da, endlich!, endlich!, kommt Dorothea mit dem chinesischen Reisebegleiter, der mich irgendwie an Winfried erinnert, die Treppe herunter. Ja, wo warst du denn die ganze Zeit? Wir haben dich gesucht! Ich renne auf sie zu, und meine Angst, diese uralte fürchterliche Angst, allein gelassen zu werden, weicht einer unsagbaren Erleichterung. Von einer langsam abebbenden Klangwelle getragen, drifte ich in einen wohligen Zustand tiefster Entspannung, fühle mich geborgen und wieder zu Hause …
Der Freund
Für den Abend war ich mit Ansgar verabredet, der mich in meinem Zimmer im Haus Oase abholte.
Ansgar drückte mich so fest an sich, dass mir für einen Moment fast die Luft wegblieb. Er überragte mich um einen halben Kopf und war von athletischer Statur. Für sein Alter hatte er noch erstaunlich volles, wenn auch leicht ergrautes Haar mit einer jugendlich wirkenden Tolle, die ihm wie eine Schillerlocke in die Stirn fiel. Ich war froh, den Freund in meiner Nähe zu wissen.
»Und ? Wie fühlst du dich hier?«
»Ganz gut.«
»Ich habe einen Tisch in einem Chinarestaurant reservieren lassen, es sind nur zehn Minuten von hier.«
Ich nahm meinen Mantel, dann verließen wir die Klinik.
Das Restaurant lag gleich am Anfang der Langen Gasse, neben dem Alten Spital. Im Vestibül des Restaurants empfing uns die fast lebensgroße vergoldete Statue eines sitzenden Buddhas, auf dessen Lippen ein zeitloses Lächeln lag. Der chinesische Kellner begrüßte uns mit einer dezenten Verbeugung und führte uns an den Tisch nahe der Fensterfront, in deren Scheiben sich die Lampions mit den roten Fransen in einer langen Flucht spiegelten.
Nachdem wir bestellt hatten, erzählte ich dem Freund, dass Dorothea mir zu meinem letzten Geburtstag einen Buddha geschenkt hatte. Einen erdfarbenen Buddha im Lotussitz, der jetzt auf dem Bücherbord im Dachstuhl unseres Hauses stand. »Es war ihr letztes Geschenk an mich.«
Ansgar sah mich erstaunt an. »Da habe ich ja das richtige Lokal gewählt.«
»Von unserer Chinareise im Jahr davor hat sie zwei gerahmte Bilder des Buddhas mitgebracht: den liegenden Buddha, der wunderbar entspannt aussieht und sehr weibliche Züge hat, und den lachenden Buddha, dessen Lachfalten gleichsam noch seinen schwangeren Bauch überziehen. Dabei sind wir nie Buddhisten gewesen.«
»Vielleicht ahnte sie«, sagte Ansgar, »dass sie bald sterben würde und dass du würdest lernen müssen, was der Buddhismus lehrt: Das Loslassen.«
»In letzter Zeit denke ich oft, dass sie es ahnte, auch wenn sie nie davon sprach. Um mich, die Kinder und ihre Mutter nicht zu beunruhigen. In den Wochen vor ihrem Tod hat sie für jedes der Kinder noch ein eigenes Fotoalbum mit alten Familien- und Kinderbildern zusammengestellt.«
»Wahrscheinlich haben Menschen, die sich schon einmal auf der anderen Seite befunden haben – wie sie damals nach ihrem ersten Aneurysma –, ein besonderes Gespür für solche Dinge.«
Der Kellner kam mit den Getränken und der Vorspeise, zwei Frühlingsrollen.
»Trinken wir auf Dorothea und den lachenden Buddha.«, sagte Ansgar, indes seine buschigen Brauen in Bewegung gerieten – eine mir sehr vertraute mimische Kuriosität, die immer dann einsetzte, wenn ihn etwas bewegte oder begeisterte.
Wir stießen an.
»Und wie geht es dir und Amelie?«
»Amelie lässt dich herzlich grüßen, sie wäre heute Abend gerne mitgekommen, ist aber gerade auf Fortbildung. Seit ich in der Phönix-Klinik arbeite, haben wir endlich wieder Zeit füreinander. Und das tut unserer Beziehung gut.« Mit einem Seufzer der Erleichterung fügte Ansgar hinzu: »Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, nicht mehr in einer dieser medizinischen Mühlen arbeiten zu müssen. Damals hetzte ich rastlos durch die Gänge, stets die Augen auf Pieper oder Papiere gerichtet, um nicht den Blicken von Angehörigen zu begegnen oder den Anschein zu erwecken, ich sei ansprechbar. Hier habe ich endlich wieder Zeit für meine Patienten … Apropos. Was macht dein Herz? Tanzt es immer noch aus der Reihe?«
»Ab und zu schon. Doch ansonsten ist es gesund, sagt mein Kardiologe. Er hat mir ein Herzmittel auf pflanzlicher Basis verschrieben, das weder Leber noch Niere belastet. Und empfahl mir viel Bewegung und gesunde Ernährung.«
»Nun, für beides ist ja hier gesorgt. Vielleicht würde dir auch Tanz- und Musiktherapie guttun? Du bist doch sehr musikalisch.Hast du deine Querflöte mitgebracht?«
»Ja. Samt den CDs fürs Play-back.«
»Na wunderbar. Wir haben einen schönen Musikraum hier – mit allem, was dazugehört. Ein-, zweimal die Woche kommt Frau Sander zu uns, eine Gesangs- und Tanztherapeutin.«
»Ich habe seit meiner Studentenzeit nicht mehr gesungen.«
»Aber das Bella ciao. haben wir zusammen gesungen. Was heißt gesungen? Geschmettert haben wir es in der Dicken Wirtin, dass der Tresen wackelte.« Ansgar ließ wieder seine buschigen Brauen tanzen.
»Ich singe lieber auf der Flöte.«
»Vielleicht überlegst du es dir noch, wenn du Frau Sander mal singen hörst. Sie hat eine geradezu überirdische Stimme. Im Haus wird sie die Sirene genannt.«
Jetzt endlich dämmerte mir, von wem der Freund sprach: Es musste dieselbe Frau sein, die ich am Abend meiner Ankunft in der Lobby am Klavier überrascht hatte. Sie hatte wirklich eine überirdische Stimme.
»Überhaupt«, fuhr Ansgar fort, »ist dies schon eine ganz besondere Klinik.«
Er portätierte kurz den Chef Doktor Wallerstein, einen Mann mit imponierender Biografie. Doktor Wallerstein habe nicht nur Medizin, Psychologie und Philosophie studiert, sondern auch viele Jahre in Indien und China gelebt, um die asiatischen Kulturen und Heilmethoden kennenzulernen. Nach seiner Rückkehr habe er dann, zusammen mit seiner Frau, diese Privatklinik gegründet und vorwiegend aus eigenen Mitteln finanziert und es nach langen Kämpfen schließlich durchgesetzt, dass einige der hier praktizierten alternativen Heilmethoden auch von den gesetzlichen Kassen anerkannt wurden … Auch die leitende Therapeutin Frau Doktor Klier sei eine Frau von ungewöhnlichem Format. Wie Traumata, vor allem Kriegs- und Fluchttraumata, in die nächste und übernächste Generation weiterwirken – das sei ihr Spezialgebiet, über das sie auf internationalen Fachkongressen referiere.
»Ich habe schon ihre Bekanntschaft gemacht«, sagte ich. »Eine angenehme Frau.«
»Bei ihr bist du bestimmt in guten Händen … Und doch. So gerne ich hier auch arbeite, ein Paradies ist es nicht gerade.«
»Warum? Was ist das Problem?«
»Unsere prekäre Finanzlage. Wir machen hier nämlich keinen Unterschied zwischen Kassen- und Privatpatienten. Aber nein« – Ansgar schüttelte so heftig den Kopf, dass seine Haartolle ihm in die Stirn fiel –, »das ist kein Thema für heute Abend. Wie steht es um die Fakultät?«
»Noch ist alles in der Schwebe. Der eigentliche Grund für den drohenden Abbau der Fakultät sind vermutlich gar nicht die fehlenden Drittmittel, sondern dass sie eine Nische kritischer Gesellschaftswissenschaft geblieben ist und somit ein Hindernis auf dem Wege zur ›Exzellenz-Uni‹, die der ehrgeizige Rektor anstrebt. Nicht zufällig fing das Gerede ›Die Fakultät rechne sich nicht‹ erst an, als meine Mitarbeiter und ich das Konzeptwerk Zeitwohlstand versus Wachstum gegründet hatten, das von den Professoren der Wirtschaftswissenschaften heftig befehdet wird. Und es bekümmert mich natürlich, dass ich gerade jetzt ausfalle, da meine Anwesenheit in der Uni eigentlich dringend vonnöten wäre.«
»Das verstehe ich. Trotzdem, Fabian, so darfst du nicht denken.« Ansgar sah mich eindringlich an und fasste meine Hand. »Du hast deine Frau und Lebenspartnerin verloren. Fakultät hin, Fakultät her – du hast das verdammte Recht auf eine Auszeit. Auch dein Herz sagt dir das.«
Der Kellner brachte den Hauptgang: Lammfleisch mit Bohnen und Sojaspitzen und Pekingente in Mangosoße mit allerlei Gemüse.
Ich war unschlüssig, ob ich lieber zu Messer und Gabel oder zu den Essstäbchen greifen sollte, die neben meinem Teller lagen. Ich dachte an jene Szene in einem Pekinger Restaurant: wie ich mit Dorothea und den Mitreisenden an einem großen Drehtisch saß; wie geschickt sie mit den Essstäbchen den Reis, die Glasnudeln und die kleinen Tofustückchen fasste und vom Teller zum Munde führte, während ich und die meisten aus der deutschen Reisegruppe, nach kurzem ungeduldigen Hantieren mit den Stäbchen, wieder zum Gebrauch von Messer und Gabel zurückkehrten. »Ihr Verräter!«, rief uns Dorothea mit gespielter Entrüstung zu. Und alle hatten gelacht.
Nein, diesmal wollte ich nicht zu den Verrätern gehören, dachte ich und nahm die Stäbchen zwischen Daumen und Zeigefinger. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten und Pannen ging es immer besser …
Gegen 22 Uhr machten wir uns auf den Rückweg in die Klinik.
Sonja
Kaum hatte ich mein Zimmer betreten, klingelte mein Handy. Es war Sonja.
»Hallo du Lieber! Wie geht es dir? Bist du gut untergebracht?«
»Ganz okay. Es ist alles da, was man zum Überleben braucht. Und das Bett so schmal, wie es sich für einen Einsiedler gehört.«
»Hast du einen Balkon?«
»Ja, der geht zum Garten hinaus, in dem eine Blutbuche steht. Du weißt ja, ich liebe Blutbuchen. Überhaupt ist das Ambiente hier sehr angenehm, hat nichts von der sterilen Atmosphäre einer Klinik. Ähnelt eher einem Wellnesshotel mit leicht esoterischem Anstrich.«
»Wieso esoterisch?«
Ich erzählte Sonja von der Frau an der Rezeption und den wundersamen Wirkungen der Doppelpyramide.
Sonja lachte hell auf. »Das ist ja eine geniale Konservierungsmethode. Und ganz ohne Chemie. Statt eines Hometrainers werde ich mir von meinem Mann solch ein Ding zum Geburtstag wünschen. Und künftig das Hackfleisch statt in die Tiefkühltruhe unter die Pyramide legen. Und mich selbst gleich mit dazu. Um mein Haltbarkeitsdatum als Frau zu verlängern.«
Sonja hatte nicht nur den Humor und quecksilbrigen Witz ihrer Mutter, sie lachte auch genau wie diese. Ich liebte sie, als wäre sie meine eigene Tochter. Sie hatte es mir auch leicht gemacht, hatte sie mich doch nach der Scheidung ihrer Eltern von Anfang an als ihren neuen Vater angenommen. Auch wenn sie äußerlich wenig Gemeinsamkeiten mit ihrer Mutter hatte – sie war brünett, braunäugig, hatte einen dunkleren Teint und einen anderen Gesichtsschnitt –, so war sie ihr doch vom Wesen her sehr ähnlich. Ebenso herzlich, spontan und den Menschen zugewandt wie jene, mit rascher Auffassungsgabe, sicherer Intuition und großem Einfühlungsvermögen begabt.
Sonja wusste genau, wie mir zumute war, wenn ich jetzt von einer Reise zurückkam in mein nunmehr verwaistes Haus. Und ich konnte sicher sein, dass sie mich genau in diesen für mich besonders schmerzvollen Stunden anrief. Auch wenn sie 600 Kilometer von Amorbach entfernt in Berlin lebte und mit Beruf und der großen Familie doppelt belastet war – sie arbeitete als Kinderärztin in einer Gemeinschaftspraxis und hatte selbst drei Kinder –, alle vier bis sechs Wochen kam sie, entweder allein oder mit ihrer jüngsten Tochter, mich und Gisela, ihre Großmutter, besuchen.
Durch Dorotheas Tod war mir Sonja noch nähergekommen; mit niemandem sonst konnte ich meine Trauer und meinen Schmerz so teilen wie mit ihr. Sie half mir nicht nur bei der Abwicklung des Schriftverkehrs mit Behörden, Ämtern und Versicherungen, sie erklärte mir nicht nur das Touch-Bedienfeld des neuen Küchenherdes und wie man sich mithilfe von Backpulver der Ameisenstraße erwehrte, die vom Garten in die Küche führte; sie weinte mit mir, wenn ich weinen musste, und lachte mit mir, wenn wir uns wechselseitig die gewitzten Mails vorlasen, die Dorothea noch in den letzten Wochen vor ihrem Tod an Freunde, Kinder und Enkel geschrieben hatte.
Dass Sonja mir geblieben war, empfand ich denn auch, bei allem Schmerz und aller Bitternis, als großes Geschenk.
Zweites Kapitel
15. Oktober
Erwachte in der Frühe von einem Alb: Unser Bello lief jaulend vor mir weg, er schien irgendwie verwundet, ich verfolgte ihn und schlug ihn mit einem Stock; blutend und winselnd lag er vor mir. Ich erwachte mit einem ganz schrecklichen Gefühl, als hätte ich unseren Hund erschlagen. Dabei ist er ja seit Langem tot.
Qigong
Donnerstag, 8.30 Uhr: Qigong mit Frau Müller las ich auf meinem Therapieplan. Eigentlich war ich nicht in der Stimmung, mich noch vor dem Frühstück an einer Gruppenübung im Freien zu beteiligen, zumal ich eine unruhige Nacht verbracht hatte. Doch dann überwand ich mich, stand auf und schlüpfte, nach einer kurzen Dusche, in meinen Jogginganzug und meine Turnschuhe.
Kurz vor halb neun fand ich mich auf dem Rasenplatz vor dem Haus Sonne ein, wo sich etwa zwei Dutzend Patienten zum morgendlichen Qigong versammelt hatten. Es war kühl und recht windig, immer wieder schob sich eine graue Wolkendecke vor die Morgensonne, die so bleich aussah, dass man sie mit dem Mond verwechseln konnte. Aus Angst, ich könne mich bei dieser Übung, an der ich das erste Mal teilnahm, blamieren, stellte ich mich in die letzte Reihe, hinter eine Frau mit kurzen hennaroten Haaren, ausladendem Hinterteil und mächtigen Oberschenkeln, die in einer knielangen pinkfarbenen Mikrofaserhose steckten. Dazu trug sie Aerobic-Strümpfe und Wadenwärmer in grellen Farben, als ob sie es darauf angelegt hätte, noch in schwärzester Nacht durch ihre Signalfarben aufzufallen.
Die Übungsleiterin Frau Müller war eine zierliche Frau mit asiatischen Gesichtszügen und – kurioserweise – blonden Haaren. Sie trug einen weißen Trainingsanzug und begann, nachdem sie die Anwesenden begrüßt hatte, mit der Ersten Übung der Harmonie: Sie öffnete beide Arme, führte sie erst nach hinten und unten, sodann in einer halbkreisförmigen Bewegung langsam nach vorn zusammen und wieder zurück zur Brust, als ob sie eine große Schale umfassen und darin etwas sammeln würde. Dann kehrte sie die Handflächen nach innen und drückte das »Gesammelte« in mehrfacher Bewegung nach unten und von sich weg. Dazu sprach sie folgenden Text:
Mit jedem Einatmen sammelst du das gute Qi. Mit jedem Ausatmen entspannt sich dein Körper mehr und mehr; alle negativen Einflüsse senkst du mit den Händen nach unten und leitest sie über die Fußsohlen in die Erde ab. Dabei fühlst du den Widerstand wie Dampf, wie Wolken, unter deinen Händen.
Mit dieser Übung hatte ich meine Mühe, weil mir die Sicht auf die Übungsleiterin durch das vor mir kreisende wuchtige Hinterteil der Frau in den Papageienfarben verstellt wurde und ihr »gutes Qi« schon bald als Schweißausdünstung in meine Nase zog. Erst als ich mich einen Meter von ihr entfernt hatte, konnte ich mich auf den Bewegungsablauf dieser Übung konzentrieren. Nach der dritten Wiederholung hatte ich ihn so weit verinnerlichet, dass ich meinen eigenen Assoziationen folgen konnte: Ich stellte mir vor, dass ich in der imaginären Schale die guten und schönen Erinnerungen an meine Frau »sammeln« und die bitteren Gefühle des Allein- und Verlassenseins nach unten über meine Fußsohlen in die Erde ableiten würde. Es folgte die Zweite Übung der Harmonie:
Du stellst dir vor, einen Regenbogen oder einen riesengroßen bunten Ball in den Armen zu halten, du schwebst in einem heiteren Meer von Farben. Du kannst auch spüren, dass das Qi wie Honig durch die Arme von einer Hand zur anderen fließt. Du fühlst innere Ruhe, Glück und Heiterkeit.