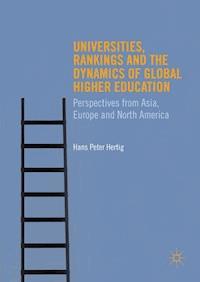Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rüffer & Rub
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hans Peter Hertig erzählt in einer unkonventionellen Art eine Schweizer Kulturgeschichte der letzten 100 Jahre: Der Autor porträtiert dazu 65 Kultur prägende Persönlichkeiten zwischen 1918 und heute aus der bildenden Kunst, Literatur, Musik, Film, Theater und Tanz sowie den Wissenschaften. An vier Orten führt Hertig jeweils zwölf dieser Personen zu einem fiktiven Treffen zusammen, wo sie über ihre Arbeit und aktuelle Zeitfragen diskutieren. So kommt es zu Treffen anlässlich der Aufführung des Stücks »L'Histoire du soldat« (1918, Musik: Igor Strawinsky, Libretto: Charles-Ferdinand Ramuz), 1946 im Café »Odeon« in Zürich, einem intellektuellen Brennpunkt der damaligen Zeit, 1969 zur legendären Ausstellung »When Attitudes Become Form« in der Kunsthalle Bern, 1996 beim Jazzmusiker George Gruntz am Morgestraich in Basel. 2021 treten anstelle eines einzelnen Treffens 17 individuelle Reportagen. In diesen begegnet der Autor neben Künstler:innen auch Personen, die deren Werke dem Publikum vermitteln. Im Zentrum von Hans Peter Hertigs »Eine andere Schweizer Kulturgeschichte« stehen die Werke, Beiträge und Praktiken von Kunst- und Literaturschaffenden, Musiker:innen und gesellschaftspolitisch engagierten Intellektuellen. Hertig bringt einem neben berühmten Stars wie Friedrich Dürrenmatt, Albert Einstein oder Pipilotti Rist Persönlichkeiten wie der Schriftstellerin Ella Maillart, die Dirigentin Sylvia Caduff oder den Architekten Aurelio Galfetti näher, die einer breiten Öffentlichkeit weniger bekannt sind. Das Buch zeigt wunderbar die Vielfältigkeit der Schweizer Kultur auf und ist ein anregender Einstieg für eine vertiefte Auseinandersetzung mit den porträtierten Kulturschaffenden. Die 65 prägenden Persönlichkeiten 1918 | Ernest Ansermet, Albert Einstein, Hermann Hesse, Arthur Honegger, Paul Klee, Carl Albert Loosli, Charles Ferdinand Ramuz, Gonzague de Reynold, Carl Spitteler, Sophie Taeuber, Félix Vallotton, Robert Walser 1946 | Othmar H. Ammann, Blaise Cendrars, Lisa della Casa, Max Frisch, Alberto Giacometti, Le Corbusier, Ella Maillart, Meret Oppenheim, Franz Schnyder, Michel Simon, Jean Rudolf von Salis, Jakob Tuggener 1969 | S. Corinna Bille, René Burri, Sylvia Caduff, Jacques Chessex, Friedrich Dürrenmatt, Franz Gertsch, Jean-Luc Godard, Niklaus Meienberg, Paul Nizon, Irène Schweizer, Jean Starobinski, Jean Tinguely 1996 | Ernst Beyeler, Luc Bondy, Anne Cuneo, Dimitri, Aurelio Galfetti, Heinz Holliger, Anna Huber, Marthe Keller, Giovanni Orelli, Pipilotti Rist, Erika Stucky, Urs Widmer 2021 | Endo Anaconda, Renato Berta, Christian Berzins, Vanessa Billy, Jean-Sébastien Bron, Marie Caffari, Claudia Comte, Caroline Coutau, Sylvie Courvoisier, Bice Curiger, Daniel de Roulet, Jacques Dubouchet, Patricia Kopatschinskaja, Simone Lappert, Klaus Merz, Melinda Nadj Abonji, Omar Porras
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Verlag und der Autor bedanken sich für die grosszügige Unterstützung bei
Elisabeth Jenny-Stiftung
Der rüffer & rub Sachbuchverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
Erste Auflage Frühjahr 2023
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2023 by rüffer & rub Sachbuchverlag GmbH, Zürich
[email protected] | www.ruefferundrub.ch
Bildnachweis Autorenporträt: © Felix Ghezzi
E-Book-Konvertierung: Bookwire GmbH
ISBN 978-3-907351-15-4
eISBN 978-3-907351-21-5
Prolog
L’Histoire du soldat— 1918
Grand Café Odeon— 1946
When Attitudes Become Form— 1969
Morgestraich— 1996
Von Tauben, Kakteen, Klavieren und Neuronen— 2021/2022
Epilog
Anhang
— Ausgewählte Werke von und über die Porträtierten
— Biografie des Autors
Eins, zwei, drei, im SauseschrittLäuft die Zeit, wir laufen mit.
Wilhelm Busch
Das Buch ist einem Schweizer Künstler gewidmet, der in internationalen Ranglisten der besten Schweizer Kunstschaffenden aller Zeiten keinen vordersten Platz einnimmt, aber stellvertretend dafür steht, was Kunst neben Qualität und Originalität eben auch auszeichnet, Authentizität und Engagement, dem Publikum bei jedem Auftritt immer das Beste, Alles, zu geben: Endo Anaconda. Der Liedermacher und Sänger starb ein paar Monate nach unserer Begegnung für dieses Buch.
Prolog
Am 16. Juni 1944 schreibt der ungarisch-französische Lichtbildkünstler Brassaï im Atelier von Pablo Picasso an der Rue des Grands Augustins 7 in Paris Kulturgeschichte. Er fotografiert eine Gruppe von 12 Persönlichkeiten, die Picasso zu einem kleinen Fest eingeladen hatte, um sich für deren Mitwirkung bei der Uraufführung seines Theaterstückes «Le Désir attrapé par la queue», eine surrealistische Farce, wie der Autor es nannte, zu bedanken. Ein einmaliges Zeitdokument. Kaum je zuvor und danach hat ein einzelnes Bild den intellektuellen und kulturellen Geist einer Lokalität und Epoche derart prägnant festgehalten. Alle von Brassaï porträtierten gehören zur Crème de la Crème des Paris der Kriegs- und Nachkriegsjahre, der vom Amateur-Dramatiker Picasso als Regisseur eingesetzte Albert Camus, die als Schauspieler agierenden Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre und Michel Leiris, der als Experte für was auch immer eingesetzte Psychoanalytiker Paul Lacan und all die anderen auf dem Foto. Was hat das Dutzend vernetzt? Die Lichtgestalt Picasso natürlich; wenn er rief, liess man sich nicht zweimal bitten. Und mindestens ebenso wichtig: die Kraft von zwei Geistesströmungen, welche Frankreichs Kulturschaffen dieser Zeit in hohem Masse prägten; die eine nicht mehr en vogue und in der Malerei des Gastgebers auch nie wirklich bestimmend, aber in den Köpfen noch mächtig präsent, der Surrealismus, die andere hoch aktuell und zumindest als politischer Flirt stark mobilisierend, der Kommunismus. Kultur und politisch-gesellschaftlicher Kontext, in welchem sie geschaffen wird, stehen geradezu idealtypisch in engster Beziehung.
Aber weshalb dieser Ausflug nach Paris für ein Buch, das im Titel Schweizer Kulturgeschichte verspricht? Sicher, es gibt ein paar indirekte Bezüge zwischen der Schweizer Kulturszene und Brassaïs Gruppenfoto. Auf diesem ebenfalls abgebildet ist Picassos Hund Kazbek. Der Afghane stand Alberto Giacometti ein paar Jahre später Modell für eine seiner bekanntesten Skulpturen, «Le Chien». Und wenn wir schon bei Giacometti sind: Leiris besprach den jungen in Paris lebenden Schweizer 1929 als erster namhafter Kunstkritiker und ebnete ihm den Weg zu einer glänzenden Karriere. Hundehalter Picasso trug seinerseits dazu bei, dass ein anderes Schweizer Nachwuchstalent Berühmtheit erlangte. Im Café Flore sitzend – wenn Anekdotenschreiber nicht wissen wo, ist es in Paris immer das Flore – ermutigte er die 23-jährige Meret Oppenheim aus Basel, eine Tasse in Pelz zu verpacken. Surrealisten-Papst André Breton stellte das Resultat als «Le Déjeuner en fourrure» in der berühmten Ausstellung «Exposition surréaliste d’objets» von 1936 aus. Vielleicht als verspäteten Dank an ihren Mentor Picasso übersetzte Meret Oppenheim «Le Désir attrapé par la queue» zwanzig Jahre später in «Wie man Wünsche am Schwanz packt». Ihretwegen erfolgte die deutsche Uraufführung nicht in Berlin oder Wien, sondern im Dezember 1956 im Kleintheater in Bern.
Damit ist die Brücke von Brassaïs Bild von 1944 zu einem Jahrhundert Schweizer Kulturgeschichte natürlich noch nicht einsichtig geschlagen. Es ist eine durch und durch persönliche: Im Sommer 2019 wurde Picassos Stück wieder einmal in Paris aufgeführt, in einem kriegerischen Rittersaal im Musée de l’Armée, der zur Person Picasso eigentlich nicht recht passen wollte. Nach der Aufführung ging ich mit einem Pariser Freund noch ein Glas trinken, nicht im Flore, notabene. Wir kamen auf Brassaïs Foto zu sprechen, und mein Gegenüber konfrontierte mich mit einer herausfordernden Frage: «In Picassos Atelier sind zwölf Personen abgelichtet. Wer, welches Dutzend, müsste auf einer Fotografie stellvertretend für das Schweizer Kulturschaffen Mitte der 1940er-Jahre abgebildet sein?» Mir kamen spontan Alberto Giacometti, Meret Oppenheim und Le Corbusier in den Sinn. Schliesslich waren wir in Paris, wo die drei lange gelebt hatten. Aber wer sonst noch? Ich kam ins Grübeln und in Verlegenheit. Die Rettung erfolgte als Handy-Alarm: «Zug von Gare de Lyon nach Basel in 50 Minuten». Ich verpasste ihn dann gleichwohl …
Die Frage ging mir nicht aus dem Kopf. Im zweiten Kapitel des vorliegenden Buches kommt mehr als drei Jahre später die Antwort. Darin porträtiere ich die zwölf Protagonisten, die ich als besonders repräsentativ für das Schweizer Kulturschaffen Mitte der 1940er-Jahre betrachte. Sie haben sich nicht wie im Pariser Vorbild tatsächlich getroffen – eine derart geballte Ladung führender Kulturschaffender zu gleicher Zeit am gleichen Ort ist für die französische Kulturgeschichte einmalig, und sie wäre selbst für die Schweiz, die sich gerne als einmalig versteht, der Einmaligkeit zu viel –, aber ein entsprechendes Treffen kann natürlich konstruiert werden. Und so bin ich denn auch vorgegangen: Ich habe eine mögliche Gelegenheit wie die Feier von Picassos Theaterstück aufgespürt, ein Ort, wo diese stattfindet, festgelegt, einen Gastgeber bestimmt und die zwölf Erkorenen zur fiktiven Feier eingeladen. Im Mai 1946 treffen sie sich im Grand Café Odeon in Zürich. Gastgeber ist Arnold Kübler, der Mitgründer und erste Chefredaktor des Kulturmagazins «DU». Er wollte die in den Kriegsjahren verschobene Gründungsfeier seines Magazins endlich nachholen und dazu bedeutende Schweizer Künstler:innen, Literat:innen und Musiker:innen einladen, die sein «DU» schon geziert hatten, gerade zierten oder, wie er hoffte, noch zieren würden. 1946 ergab sich anlässlich des fünfjährigen Jubiläums seiner Zeitschrift eine gute Gelegenheit.
So wie bei der Replik im Odeon Zürich zum Initialzünder der Picasso-Feier von 1944 in Paris, bin ich auch in den übrigen, das vorliegende Buch strukturierenden Treffen vorgegangen. Zu weiteren fiktiven Treffen ist es ganz einfach deshalb gekommen, weil ich bei der Odeon-«Zusammenkunft» Feuer fing. Mit diesem im Kopf und in der Feder ist schliesslich eine Schweizer Kulturgeschichte der letzten hundert Jahre entstanden, wenn auch eine nicht ganz orthodoxe. Einmal schon wegen dem Kalender, 1918–2022. Und ungewohnt auch bezüglich Aufbau und Ansatz: Alle 25 Jahre trifft sich eine Gruppe von Schweizer Kulturschaffenden fiktiv zu einem Treffen irgendwo in der Schweiz, ein Schaulaufen der für die jeweilige Zeit repräsentativen Literat:innen, Künstler:innen, Musiker:innen und Intellektuellen, erstmals 1918, am Tag nach der Premiere von «L’Histoire du soldat» bei Igor Strawinsky in Morges, 1946 wie oben skizziert bei Arnold Kübler in Zürich, 1969 anlässlich der legendären Ausstellung «When Attitudes Become Form» bei Harald Szeemann in der Kunsthalle Bern und 1996 beim Jazzer George Gruntz am «Morgestraich» in Basel. Vom Modell der vier ersten Treffen leicht abweichend schliesslich das fünfte und abschliessende Kapitel von 2021/2022. Der Wechsel von der Fiktion in die Realität rief nach einer anderen Methodik: Zwölf Persönlichkeiten an einem bestimmten Datum an einen bestimmten Ort einzuladen ist wenig realistisch. Anstelle des einen fiktiven Treffens treten deshalb 17 Porträts, die auf der Grundlage von einzelnen Interviews mit den Persönlichkeiten entstanden sind. Warum 17 anstelle von 12? Das Schlusskapitel ist auch Bestandesaufnahme und Ausblick. Zumindest hier sollen Persönlichkeiten auf die Bühne kommen, die diese nicht direkt bespielen, sondern bauen und gestalten. Auch sie sind Kulturschaffende, aber ihre Beiträge als Ausbildende, Kritiker:innen, Kurator:innen oder andere Scharniere zwischen Schreibtisch, Atelier oder Proberaum und Publikum bleiben im Schatten. Dabei hätte die Kunst die Salons und Gemächer, wo sich einst nur privilegierte gesellschaftliche Eliten an ihr ergötzen konnten, ohne sie gar nie verlassen. Sie geben Sinn, schaffen Struktur, entscheiden mit, was Bestand hat; ohne sie gäbe es kein öffentlich zugängliches Kulturschaffen.
Bevor es bei Strawinsky 1918 losgeht, in noch knapp zulässiger Kürze einige konzeptionelle und begriffliche Klärungen. Zuallererst: Was verstehe ich unter Kulturgeschichte? In ihrer «klassischen» Form ist Kulturgeschichte Kunstgeschichte. Einer ihrer Pioniere, der Basler Jacob Burckhardt, hat Mitte des 19. Jahrhunderts in brillanter Weise aus überragenden Kunstwerken der Renaissance den Zeitgeist dieser Epoche abgeleitet. Hundert Jahre später kommt es zu einer entscheidenden, politisch motivierten Begriffserweiterung. In der sogenannten «New Cultural History» geht es der aristokratischen und bürgerlichen Hochkultur an den Kragen, die traditionelle Bindung zwischen Kunst und Kultur wird gebrochen, Kultur erscheint als Synthese von Lebensentwürfen und Lebensstilen. Analysiert werden die «ways of life» der verschiedensten singulären Gruppierungen, die eine wie auch immer abgegrenzte Gemeinschaft ausmachen – transnationale Regionen, Staaten, sprachlich identifizierte Teile einer Nation, gesellschaftliche Klassen, religiöse Gruppierungen. Kunst ist ein Teil dieser Lebensstile, sowohl sie zu kreieren als auch sie zu geniessen. Und dazu gehört eine Vielfalt anderer Dinge, die Menschen sich zum Leben schaffen, Artefakte und Praktiken in Bereichen wie Sprache, Wohnen, Sport, Essen etc. Ihnen auf der Spur sind nicht mehr nur Historiker:innen und Kunstwissenschaftler:innen, sondern eine ganze Palette von Expert:innen aus Bereichen wie Philosophie, Anthropologie, Soziologie und Linguistik. Mit ihnen verlagert sich das Interesse auf Themen, welche die «klassische» Kulturgeschichte ausklammerte oder an den Rand drängte wie Macht, Gender, Rasse, Sexualität, postkoloniale Praktiken. Die Fachrichtung wird heterogen, interdisziplinär und gesellschaftskritisch, Burckhardt wird um Karl Marx, Michel Foucault und Edward Said erweitert und relativiert. Im vorliegenden Buch schleiche ich mich zwischen die beiden Fronten.
Im Zentrum meiner Betrachtungen zu einer Kulturgeschichte der Schweiz stehen die Werke, Beiträge und Praktiken von Kunst- und Literaturschaffenden, Musiker:innen und, stellvertretend für einen erweiterten Kulturbegriff, gesellschaftspolitisch engagierte Intellektuelle. Zum Label «Schweizer Kulturgeschichte»: Meine «andere Schweizer Kulturgeschichte» definiert sich über 65 Persönlichkeiten, die diese massgebend geschrieben haben oder noch schreiben. 64 davon waren oder sind, zumindest zeitweilig, Schweizer Staatsbürger:innen. Dass es nicht alle sind, zeigt, dass ich Staatsbürgerschaft nicht als Qualifikationskriterium benutze. Das Ergebnis ist ein logisches Resultat der Suche nach Persönlichkeiten, die das kulturelle Schaffen einer Epoche bestimmen und einen unübersehbaren Schweiz-Bezug besitzen. So wie der einzige Kulturschaffende ohne Schweizer Pass, Paul Klee. Klee war Deutscher, und seine künstlerische Karriere verlief vornehmlich in Deutschland. Aber er ist in Bern aufgewachsen, hat das letzte Drittel seines Lebens wieder dort verbracht und in seiner Zeit in Deutschland weiterhin enge Beziehungen zur Schweiz gepflegt. Wie er machten viele andere der 65 Gewürdigten vornehmlich im Ausland Karriere – allein von den zwölf bei Strawinsky Eingeladenen Félix Vallotton, Arthur Honegger, Sophie Taeuber-Arp und Albert Einstein. Kein Grund, sie von der Kulturgeschichte eines winzigen Landes wie der Schweiz auszuschliessen, wo ein Aufenthalt in die grossen Kulturstätten der eigenen Sprache und die begrenzten Karrierechancen ins Ausland führt. Kein Grund auch, Hermann Hesse 1918 nicht in das Dutzend Auserkorener aufzunehmen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch württembergischer Staatsbürger ist und sein Bezug zur Schweiz erst noch folgen wird. Kulturgeschichte, Pässe und Ländergrenzen vertragen sich schlecht.
Einfacher sind zeitliche Verortungen: Die Idee für das vorliegende Buch entstand im Frühjahr 2020. Und während ich am Konzept arbeitete, schlug Corona zu. Zeitungen begannen über Absagen zu berichten, darunter von Künstler:innen, die ich im Visier für meine Kulturgeschichte hatte, allein schon in der Musik: Endo Anacondas Taufe seiner letzten Stiller-Has-Platte, die Schweizer Tournee der in Brooklyn wohnenden Jazzerin Sylvie Courvoisier, jene von Patricia Kopatchinskaja mit der Camerata Bern und Schuberts «Der Tod und das Mädchen». Geschah da nicht Ähnliches bei der letzten Pandemie vor einem Jahrhundert, glaubte ich mich zu erinnern? Ganz genau: Igor Strawinsky und Charles Ferdinand Ramuz hatten in Lausanne ihr geniales Bühnenwerk «L’Histoire du soldat» uraufgeführt und wollten es anschliessend auf einer Westschweizer Tournee präsentieren. Es blieb bei der Premiere; die Spanische Grippe liess keine einzige weitere Vorführung zu. Der Parallele konnte ich nicht widerstehen, Datum und Ort meines ersten Treffens standen fest: der 29. September 1918, ein Tag nach der Uraufführung in Lausanne, im Hause des Komponisten Igor Strawinsky in Morges. Und so berichtet das vorliegende Buch über eine 104-jährige Schweizer Kulturgeschichte zwischen zwei Pandemien, dem Beginn der Spanischen Grippe von 1918 und dem (hoffentlich tatsächlich) auslaufenden Corona-Virus von 2022.
Faktisches versus Fiktives. Die Treffen 1918, 1946, 1969 und 1996 und die darin eingebetteten Dialoge sind fiktiv. Aber der Persönlichkeit der Dialogisierenden, den Vorlieben, Abneigungen, bekannten Verhaltensmustern versuche ich dabei so weit wie möglich gerecht zu werden. Schon in den Reisen der Protagonisten zu den Orten des Geschehens: Robert Walser wohnte 1918 in Biel; zur Feier bei Strawinsky in Morges ging er den letzten Streckenteil zu Fuss. Für lange Spaziergänge ist er bekannt; «eine Art Mittel gegen die Übermacht des Tiefsinns», wie er einmal schrieb. Den als Fan schneller Autos bekannten jungen Arthur Honegger lasse ich dagegen mit einem ausgeliehenen Bugatti von Paris nach Morges brausen. Nicht aus den Fingern gesogen ist auch die Präsenz der Gäste bei den Treffen – nichts hätte sie ihren Biografien gemäss daran gehindert –, bzw. der Grund, warum sich einige entschuldigt haben. Jean-Luc Godard musste 1969 in den ersten Tagen der Kunsthalle-Ausstellung tatsächlich in aller Eile seinen Beitrag für die Filmfestspiele Berlin fertigstellen, Luc Bondy befand sich am Morgestraich 1996 in der Tat für Vertragsverhandlungen in Wien. Und auch überraschende Gäste, wie 1946 Simone de Beauvoir zu später Stunde im Odeon, hätten durchaus aufkreuzen können. Sie befand sich an diesem Tag mit Jean-Paul Sartre in Zürich, wo ihr Begleiter am Vorabend an der ETH Zürich einen Vortrag gehalten hatte.
Der (Kunst-)Griff zum «Fabulieren» macht aus dem vorliegenden Buch ein Werk ausserhalb der engen akademischen Tradition. Es ist keine kulturtheoretische Studie, wie sie an Hochschulen gelesen wird. Andere haben diese Arbeit bereits geleistet, und in ihren Gebieten mit grossem Fachwissen. Meine Ambition ist eine andere. Ich will das Werk und die Persönlichkeit bedeutender «Schweizerischer» Kulturschaffender der letzten rund 100 Jahre porträtieren, und dies in einer Form, die unterhält und von einer interessierten Leserschaft von Nichtexperten mühelos verstanden wird. Das heisst nicht, dass ich Kulturschaffen im gesellschaftspolitischen Niemandsland belasse. Die Beziehung zwischen künstlerischem Werk und gesellschaftspolitisch relevantem, kulturellem Kontext ist eine wichtige Dimension meiner Betrachtungen. Was zu Beginn des 20. Jahrhunderts entsteht, und die beim ersten Treffen des Buches bei Strawinsky in Morges auftretenden Protagonisten kreieren, sind Erzeugnisse der sich durchsetzenden Moderne, geprägt vom Spannungsverhältnis zwischen Kapitalismus, Konservatismus und Sozialismus, der politischen Spaltung des Landes entlang der globalen Konfliktlinien des Ersten Weltkriegs und den Besonderheiten einer Pandemie. Ein Vierteljahrhundert später steht das Land im Bann der Geistigen Landesverteidigung. Weitere 25 Jahre danach rebelliert die Jugend und hinterfragt bis anhin tabuisierte gesellschaftliche Werte und Normen. 1996 ist die Welt neoliberalisiert und turboglobalisiert. Das Internet und die damit kreierten und gesteuerten sozialen Netzwerke verändern die Art der Kunstvermittlung und damit auch die Kunst an sich. Bei den 17 Porträts von 2021/2022 erscheint der globale Kontext, in welchem die Schweiz agiert, auf derart wackligem Grund, dass Epochen-Typisierungen und -Projektionen ins Leere laufen. Wendezeit.
Kultur im gesellschaftspolitischen Dialog. Und Kulturschaffen als interdisziplinärer Ansatz. Hier hat der Nichtspezialisierte sein Feld. Ich bin weder Kunsthistoriker noch Literaturwissenschaftler, Musikologe oder Filmsachverständiger. Aber ich beschäftigte mich in meiner beruflichen Karriere als Wissenschaftspolitiker und Wissenschaftstheoretiker im Wesentlichen mit disziplinübergreifenden Problemen. Gleiches fasziniert mich im Kulturbereich. Wie wenn sich in den Wissenschaften harte naturwissenschaftliche Disziplinen mit der Medizin oder den Sozial- und Geisteswissenschaften treffen, entsteht dort besonders Originelles und Neues, wo der Maler mit der Musikerin oder die Literatin mit dem Fotografen in Beziehung treten. In den Begegnungen des Buches treffen sich nicht nur interessante, grossartige Kulturschaffende und Intellektuelle, sondern auch die Sparten, die sie vertreten. Kulturgeschichte ist auch die Geschichte der Beziehung zwischen Kulturarten. Dies motiviert zu tiefsinnigen Reflexionen, zu Kulturtheorie. Sie ist im vorliegenden Buch nicht ganz ausgespart, aber zugunsten der Lesefreundlichkeit stark gebändigt. Ich verzichte auf tiefgreifende kulturtheoretische Bögen.
Eine letzte grundsätzliche, geradezu resümierende Bemerkung ist mir wichtig: Was ich im vorliegenden Buch präsentiere, ist nicht die Schweizer Kulturgeschichte der letzten hundert Jahre, sondern eine Schweizer Kulturgeschichte neben möglichen anderen. Geschichtsschreibung ist eine durch und durch subjektive Angelegenheit, gefärbt von der Sozialisation der Autor:innen, dem kulturellen Umfeld, in welchem sie aufwachsen, ihren Lebenserfahrungen, den Werten, die sie sich aneigneten und den moralischen und politischen Positionen, die daraus resultierten. Wen ich auswähle und wie ich die Ausgewählten und den Kontext, in welchem sie agieren, die Schweiz ihrer Zeit, bewerte, ist gefärbt. Unvermeidlich, aber kein Unglück, solange man von dieser Unvermeidlichkeit weiss und sie als solche akzeptiert.
Ich habe vielen zu danken: allen voran meinem Verlag rüffer & rub und dem mir direkt zur Seite stehenden Lektor, Felix Ghezzi. rüffer & rub gehört wie viele andere kleinere Verlage zu den Kulturvermittlern, denen es bei ihrer Arbeit primär um die Sache geht und die dabei oft erhebliche Geschäftsrisiken eingehen. Wenn dann noch eine Pandemie zuschlägt, braucht es viel Mut und Durchhaltewille. Autor:innen können dies nicht hoch genug einschätzen. Ähnlich wie die Arbeit der Erstleser:innen ihrer Texte, in meinem Fall meine Gattin, Beatrix Boillat. Mehr als wertvoll, unentbehrlich! Und dazu kommen im vorliegenden Buch natürlich noch die aktiv teilnehmenden Porträtierten. In den Kapiteln, in denen keine direkten Interviews vorgesehen waren, habe ich mich mit zwei Künstlerinnen ausgetauscht, Erika Stucky und Anna Huber. Im Gegenwartskapitel, wo Begegnungen Teil des Konzeptes sind, danke ich allen für das Interesse, das sie meinem Projekt entgegengebracht, und die Zeit, die sie in die jeweilige Begegnung investiert haben, in alphabetischer Reihenfolge: Endo Anaconda, Renato Berta, Christian Berzins, Vanessa Billy, Jean-Stéphane Bron, Marie Caffari, Claudia Comte, Sylvie Courvoisier, Caroline Coutau, Bice Curiger, Daniel de Roulet, Jacques Dubochet, Patricia Kopatchinskaja, Simone Lappert, Klaus Merz, Melinda Nadj Abonji und Omar Porras. Den mit ihnen getanzten Begegnungsreigen werde ich nie vergessen …
L’Histoire du soldat — 1918
Ernest Ansermet (1883–1969)
Gonzague de Reynold (1880–1970)
Albert Einstein (1879–1955)
Hermann Hesse (1877–1962)
Arthur Honegger (1892–1955)
Paul Klee (1879–1940)
Carl Albert Loosli (1877–1959)
Charles Ferdinand Ramuz (1878–1947)
Carl Spitteler (1845–1924)
Sophie Taeuber(-Arp) (1889–1943)
Félix Vallotton (1865–1925)
Robert Walser (1878–1956)
In der ersten Woche des Februars 1913 kommt es zu tumultartigen Debatten im eidgenössischen Parlament. Gegenstand sind nicht moderne Geschütze für die Schweizer Armee mit Blick auf bedrohliche Zeiten und schon gar nicht der mutige Vorstoss eines politischen Pioniers, die Schweizer Frauen stimm- und wahltauglich zu erklären. Was die Volksvertreter derart erhitzt, ist der Jahreskredit für die eidgenössische Kunstkommission. In seiner Ratsberichterstattung klärt das «Berner Tagblatt» auf, was mit dem Geld geschehe. Damit gefördert werde moderne Kunst, die Werke eines Geisteskranken, Vincent van Gogh, oder eines im Dschungel Tahitis residierenden Barbaren, Paul Gauguin. Es ist der Spiegel des konservativen Kunstverständnisses des Leibblatts der bernischen Konservativen. Die Diskussion wird zusätzlich angefeuert durch Vorstösse wie jene des Präsidenten der konservativen Künstlervereinigung «Sezession». Dieser bekniet den zuständigen Bundesrat, in der vor der Tür stehenden Schweizerischen Landesausstellung in Bern «Minderwertiges und Perverses auszufegen», damit Platz frei werde für «Bilder, die 95% des Volkes gefallen».
Nur fünfeinhalb Jahre später verblüfft die gleiche Schweiz mit künstlerischer Avantgarde auf höchstem Niveau, wenn auch nicht gerade jene im Dunstkreis des Bundeshauses. Am 28. September 1918 wird in Lausanne im Théâtre Municipal ein Pionierstück der Moderne uraufgeführt: «L’Histoire du soldat. Lue, jouée et dansée». Für die Musik zeichnet der Russe Igor Strawinsky, für das Libretto der Waadtländer Charles Ferdinand Ramuz. Die Geschichte vom Soldaten hält sich einen Abend, nach der Premiere ist Schluss. Die zweite Welle der Spanischen Grippe vereitelt nicht nur weitere Aufführungen in Lausanne, ins Wasser fallen auch eine mehrwöchige Tournee in der Westschweiz sowie Auftritte in Zürich, Basel und Bern. Die eingeplanten Bühnen müssen schliessen, mehrere Mitglieder des Adhoc-Ensembles fallen aus. Bis Ende Juni 1919 werden in der Schweiz 700000 Menschen, ein Fünftel der Bevölkerung, als infiziert registriert, in Wirklichkeit waren es ohne Zweifel beträchtlich mehr.
«L’Histoire du soldat» war ein Produkt materieller Not. Der Librettist und der Komponist brauchten Geld. Ramuz’ Einnahmen präsentierten sich seit dem Beginn seiner Karriere als freier Schriftsteller eher bescheiden und versiegten während des Ersten Weltkriegs quasi ganz. Strawinsky verlor durch die Oktoberrevolution 1917 seinen ganzen materiellen Besitz und die Urheberrechte in Russland. Die Spanische Grippe und der Weltkrieg setzten zudem seine wichtigste Einnahmequelle im Westen, das Ensemble Ballets Russes, ausser Gefecht; unter ihrem genialen Impresario Sergei Djaghilew und mit Tänzern wie Vaslav Nijinsky und Choreografen wie Michel Fokine hatte die führende Balletttruppe dieser Zeit vor allem Kreationen von Strawinsky wie «Feuervogel», «Petruschka» und natürlich «Le Sacre du printemps» aufgeführt. Sie machten den Komponisten zum gefeierten Star einer neuen Musikszene. Aber Not macht erfinderisch, zumindest wenn grosse Künstler die Köpfe zusammenstecken. In etwas mehr als einem Jahr produzierten Strawinsky und Ramuz ein gut 50-minütiges Werk, das mit einfachsten technischen Mitteln und kostengünstigem, kleinem Ensemble auf eine Art Wanderbühne-Tournee gehen würde: sieben Musiker, zwei Schauspieler, Soldat und Teufel – Letzterer in der Premierenversion auf zwei Personen aufgeteilt –, einen Erzähler sowie eine Tänzerin in der Rolle der Prinzessin. Die Spanische Grippe legt das Stück vom Soldaten, der seine Seele an den Teufel verkauft, für mehrere Jahre auf Eis. In der Schweiz war es erst 1923 wieder in Genf zu sehen, mit dem gleichen Dirigenten wie bei der Premiere, aber in gekürzter Form; Ramuz’ Original-Libretto hatte die Epidemie nicht überlebt.
Aber schon am Tag nach der Premiere – und jetzt betreten wir fiktives Terrain – macht die Geschichte vom Soldaten wieder Geschichte. Das Premierenensemble trifft sich mit einer Schar für die damalige Zeit repräsentativen Kulturschaffenden in der Wohnung Igor Strawinskys in Morges. Vater des Gedankens war der Winterthurer Kunstmäzen Werner Reinhart. Reinhart finanzierte die Vorbereitungsarbeiten und die Premiere des «Soldat» in Lausanne und wäre auch für eventuelle Defizite bei der geplanten Tournee aufgekommen – Strawinsky hatte ihm das Stück dann auch explizit gewidmet. Doch in unserer Fiktion geht Reinharts Grosszügigkeit noch weiter. Er schlug Strawinsky vor, auf seine Kosten am Tag nach der Premiere das ganze Ensemble und wichtige Protagonisten des Schweizer Kulturschaffens zu einer Nachfeier ins Hotel Beau-Rivage Palace in Ouchy einzuladen. Etwa ein Dutzend, wie er präzisierte. Wen genau, würde er Strawinsky überlassen. Dieser nahm dankend an; mit einem Änderungsvorschlag. Er wollte die illustre Schar bei sich zu Hause empfangen und damit auch ein Zeichen russischer Gastfreundschaft setzen. Auf dem Waadtländer Buffet mit Epesses, Papet vaudois und Bricelets de Bénichon würden dann auch Blinis und eisgekühlter Wodka thronen. Anschliessend konnte man die Geladenen zurück ins Hotel nach Ouchy verfrachten. Der Plan wird realisiert, oder fast, zwei der Geladenen schafften es nicht nach Morges, Paul Klee und Carl Spitteler. Klee war als formell Deutscher mit Münchner Wohnadresse anfangs 1916 in die deutsche Armee einberufen worden und von dieser ohne Fronteinsatz erst im Dezember 1918 zunächst beurlaubt und ein paar Monate später entlassen worden. Die Einladung von Strawinsky erhielt er als Schreiber in der Kassenverwaltung der Fliegerschule Gersthofen gar nie. Carl Spitteler war angemeldet, sagte aber in letzter Minute ab.
Ich werde die zehn Persönlichkeiten, die es schliesslich tatsächlich nach Morges schafften, im zeitlichen Verlauf ihres Eintreffens am Place St. Louis einführen und ihnen Stimme, Postur und Profil verleihen. Sie verhalten sich so, wie man dies aufgrund ihres bisherigen und gegenwärtigen Lebens und Wirkens und dem Netzwerk, in das sie eingebunden sind, erwarten kann. Fiktiv und konstruiert sind Handlungsverlauf und Gesprächskonstellationen, aber nicht, was der Rapporteur zu Biografie, Persönlichkeit und Werk der Protagonisten vermerkt und was diese in den Dialogen über sich selbst berichten.
Komponist, Librettist, Dirigent und Mäzen hatten zusammen zu Mittag gespeist und weitergesponnen, was sie bei einer kleinen Feier am Vorabend nach der Premiere im Hotel des Alpes neben der Aufführungsstätte begonnen hatten. Mit der Qualität der Aufführung waren sie weitgehend zufrieden. «Wir waren gut, wir hätten besser sein können», brachte es der schon in jungen Jahren äusserst selbstkritische und akribische Ansermet auf den Punkt, «die Vorbereitung war viel zu knapp bemessen. Ich habe bei den Proben immer darauf hingewiesen.» Nicht zuletzt aus diesem Grund hatte es sich gelohnt, von der ursprünglichen Absicht des Chefdramaturgen Strawinsky zumindest teilweise abzuweichen. Der Komponist wollte professionelle Schauspieler durch Laiendarsteller ersetzen, um damit authentischer zu werden. Musik, Libretto und Inszenierung riefen nach Spitzenleistungen. Und was wünschenswert und möglich war, zeigten dann meisterhaft die beiden ausgewiesenen Theaterprofis Georges Pitoëff als tanzender Teufel – neben Jean Villard als sprechender Mephisto – und Pitoëffs Gattin Ludmilla als Prinzessin. Nicht ganz einig war man sich über die Reaktion des Publikums. «Enthusiastisch», urteilte Reinhart. «Besser als erwartet», brummte Pessimist Ramuz. Einer beängstigend langen Stille nach dem Fall des Vorhangs folgte offenbar ein siebenminütiger tosender Applaus. Mehr, und dazu mit 400 Zuschauern ein fast volles Haus, konnte wohl kaum erwartet werden; Lausanne hatte sich des Spektakels durchaus würdig erwiesen. Schade, dass nun nicht wie vorgesehen auch andere Orte in den Genuss kommen würden. An eine Tournee war angesichts der Pandemie nicht zu denken. Mit «Heute Abend soll dennoch gefeiert werden» half Gastgeber Strawinsky über den Wermutstropfen hinweg, «interessante Gäste sind auf dem Weg zu uns, anregende Begegnungen und Gespräche winken».
Igor Strawinsky hatte Charles Ferdinand Ramuz im Spätherbst 1915 kennengelernt. Ramuz war ein Jahr zuvor aus Frankreich in die Schweiz zurückgekehrt. In den zehn Jahren in Paris hat er mit «Aline» und dem für den Prix Goncourt nominierten «Les Circonstances de la vie» erste Zeugnisse seines grossen Talents abgelegt. Aber die Zeit in Paris, Verheissung für alle französischsprachigen Jungschreiber aus der nationalen und internationalen Provinz, brachte nicht den erhofften Durchbruch. Nun lebte er in einem Weingut in Treytorrens, einem Weiler zwischen Cully und Rivaz im Lavaux am Genfersee, Auge und Ohr für neue Projekte waren offen. Und in der Tat stiess er auf eines, und was für eines. Nach einem Konzertbesuch in Montreux kam es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten, dem Konzertleiter des Kurhausorchesters von Montreux, Ernest Ansermet. Bei einem Glas Chasselas berichtete ihm dieser beiläufig von einem Russen, der in Clarens bei Montreux direkt neben ihm wohne, grossartige Musik schreibe und zu einem der ganz Grossen werden würde. «Bring ihn nach der Weinlese doch nach Treytorrens», schlug Ramuz vor, «wir werden den noch unvergorenen 1915er kosten und mit älteren Jahrgängen vergleichen.»
Wie viele Flaschen dann an diesem milden Oktobernachmittag «unter einem gleichzeitig verschleierten und leuchtenden Himmel und einer dünnen Nebelschicht, durch die die Sonne hindurchschien, als hätte man Ölpapier auf Glas geklebt» nötig waren, um aus diesem ersten Treffen die Basis für eine tiefe Freundschaft und enge Zusammenarbeit zu machen, hat Ramuz in seinem kleinen Bändchen «Erinnerungen an Strawinsky» nicht preisgegeben. Dass Wein in Gesellschaft von Brot zusammenschweisst aber schon. «Wein und Brot zusammen, das eine, um des andern Willens. Hier liegt der Ursprung deiner Persönlichkeit, und unmittelbar hier hat auch deine Kunst ihren Ausgang: das heisst, dein ganzes Ich», kommentiert Ramuz in seinen «Erinnerungen» und meint damit wohl nicht nur, was er an diesem Nachmittag von Strawinsky wahrnimmt, sondern auch wie er sich selbst sieht und was ihn mit dem Komponisten verbindet. Ein bestimmter Kunstbegriff? Übereinstimmende Vorstellungen von künstlerischer Ästhetik? Sicher auch; beide suchen in ihrem Wirken das Schnörkellose, Einfache und Direkte. Aber worauf sie bei diesem ersten Treffen stossen, was sie vereint, sind Gemeinsamkeiten auf einer anderen Ebene. Eine erdige Verbundenheit; zwei Bauern, die Kunst machen (wie Ramuz schreibt). Beide werden sich wie alle Künstler wandeln, der Musiker dabei aber bedeutend stärker als der Schriftsteller. Noch bevor Strawinsky 1920 die Schweiz verlässt, probiert er Neues, kleinere Ensembles, Integration von alternativen Musikstilen wie Tango und Jazz, bald wird er von seiner russisch-expressionistischen Phase in die Neoklassik wechseln. Ramuz bleibt dagegen im Wesentlichen bei seinem naturalistischen Stil, einer Erzählkunst und einem Französisch, die er französischen Verlegern gegenüber schon in frühen Jahren seines Schaffens als nicht verhandelbares Markenzeichnen seiner selbst bezeichnet hat. Authentizität untergräbt man nicht. Strawinsky bleibt ein Freund, aber den Weg in die Moderne, den der Komponist beschreitet, ist nicht der des Schriftstellers. Nach ein paar fruchtbaren gemeinsamen Wegstücken zweigt Ramuz bei der Gabelung Richtung «Waadtland» wieder ab.
Der «Fuchs», «Renard: Histoire burlesque chantée et jouée», ist Gegenstand ihrer ersten Zusammenarbeit. Ramuz hilft Strawinsky, eine russische Fabel ins Französische zu übersetzen. Knochenarbeit, wenn der Übersetzer der Originalsprache des Textes nicht mächtig ist. Silbe um Silbe, Wort um Wort, Vers um Vers. Es ist ein Ringen um das Wesen der Aussage, ohne die Eleganz der Sprache und die dahinter lauernde Musik aufs Spiel zu setzen. Unterbrochen wird die Arbeit von gemeinsamen Ausflügen in die Weinberge, nun nicht mehr im Lavaux, sondern in der Umgebung des neuen Wohnsitzes von Strawinsky in Morges. Ramuz saugt von Strawinsky auf, was dann für die gemeinsame Arbeit am «Soldaten» so wichtig wird: ein Gefühl für Musik, Konvergenzen zwischen Musik und Sprache. Er betritt neues Terrain und erweist sich auch hier als Meister. Aber es bleibt ein einmaliger Abstecher ohne nachhaltigen Einfluss auf sein Schreiben, mit der Ausnahme vielleicht, dass sich seine Sprache fortan noch rhythmischer präsentiert. Ein Abstecher ohne direkten Einfluss auf sein Werk, aber mit grosser Wirkung auf seine Karriere. Nach 1918 ist Ramuz der Schweizer Dichter, der mit Strawinsky «L’Histoire du soldat» erschuf. Aus dem Waadtländer Erzähler und Romancier, der hervorragend schreibt, wird ein internationaler, und in dieser Zeit fast noch schwieriger, ein schweizweit bekannter Schriftsteller.
Und noch etwas anderes bleibt von der Zusammenarbeit mit Strawinsky. Ramuz besingt es in seinen Erinnerungen an den Komponisten: «Du warst mir ein Beispiel der Ursprünglichkeit, und das ist es, was unserem Land am meisten fehlt, wo die Charaktere so veranlagt sind, dass sie sich immerfort analysieren, beurteilen, dass sie sich ihr eigenes Spiegelbild vorhalten und schliesslich überhaupt nicht mehr zum Handeln fähig sind …» An was denkt Ramuz mit seiner Kritik an der Passivität seines Milieus, seiner Umgebung, die er liebt und verehrt? Zugunsten von was sollten die Charaktere handeln? Zugunsten des Ursprünglichen im echten und natürlichsten Sinn des Wortes, zu dem, was enge Heimat ausmacht. Er meint damit nicht die (politische) Schweiz, nicht einmal den (politischen) Kanton Waadt, sondern kleiner, bescheidener, eine geomorphologische Einheit, Le Pays de Vaud mit dessen Landschaft und Leuten. Er meint die kleinen Dinge um die Ecke, den Alten mit Filzhut in der Kneipe, das Schöppchen Wein (vom einheimischen), das Lied, das jeder kennt und singt. Und durch was und wen ist dieses Ursprüngliche bedroht? Durch eine Moderne, die alles bedenkenlos frisst, den ungebremsten Liberalismus des frühem 20. Jahrhunderts, der alles niederreisst, was einmal von Wert war, und die Anfänge einer gleichmachenden Globalisierung, zu einer Zeit, als der Begriff noch gar nicht erfunden war. «Eine Schweiz der Hotels, eine wie mit Theaterkulissen verfälschte und konstruierte Schweiz, mit bengalischer Beleuchtung der Wasserfälle, künstlichen Gletschern, Fallgruben, Alphornbläsern, die nach jeder Melodie um Geld bitten, und Serviertöchtern in Landestrachten … eine Karikatur der echten Schweiz», wie es Ramuz abschätzig schildert.
Charles Ferdinand Ramuz ist nicht der Bilderfresser und Buchverbrenner, den am Anfang des Kapitels das «Berner Tagblatt» an die Wand malte. Aber die Fixierung auf seine Wurzeln, die Besonderheiten und Tugenden seiner Umgebung, des Ländlichen, vom Wandel Bedrohten, bringt ihn im frühen 20. Jahrhundert nichtsdestotrotz in das politisch gefährliche Terrain des «Blut und Bodens». Er wird zu einem «propagandiste malgré lui», wie Jérôme Meizoz in seiner Ramuz-Biografie treffend kommentiert. Ramuz hat es wohl selbst befürchtet, als er sich in den 1930er-Jahren in einem Essay als «unpolitisch» bezeichnet hat und mögliche politische Wege dieser Zeit wie Kapitalismus, Nationalsozialismus und Kommunismus allesamt verwirft. Aber sein gleichzeitiger Flirt mit einer lokalen Gruppierung des politisch rechten Flügels mit klar antiparlamentarischen und antisemitischen Tendenzen, der Ligue Vaudoise, und die Unterzeichnung eines Briefes der (unzweifelhaft) faschistischen Action Nationale in Frankreich zugunsten des (unzweifelhaft) faschistischen Schriftstellers Charles Maurras sprechen eine andere Sprache. Nur politische Naivität? Vielleicht. Aber sie bewirkt, dass Politiker der extremen Rechten in Deutschland, Frankreich und Italien in seinem Werk Sympathie für ihre Sache eruieren. Und Gleiches vermuten Gleichgesinnte in der Schweiz.
Einer von diesen «Gleichgesinnten» ist der erste der Geladenen im Hause Strawinskys an diesem frühen Nachmittag des 29. September in Morges: Frédéric Gonzague Graf Reynold de Cressier, oder, seit die Schweiz zum Verdruss des Grafen mit dem Gleichheitsgebot in der Bundesverfassung den Adelstitel abschaffte, nur noch Gonzague de Reynold. Ernest Ansermet hatte ihn Gastgeber Strawinsky vorgeschlagen, weniger als Schriftsteller, die Qualität seiner Produkte hätte für eine Selektion nicht gereicht, denn als Galionsfigur der literarisch tätigen konservativen Rechten des Landes. Diese hat zu dieser Zeit grossen Einfluss auf politische Entscheide bis in die höchsten politischen Gremien der Schweiz. Dessen Einladung könnte sich als kulturpolitisch nützlich erweisen, machte er Strawinsky gegenüber geltend. Ramuz war gegen eine Einladung, teils aus politischen, noch mehr aber aus zwischenmenschlichen Gründen; der Graf vom Murtensee war ihm als Persönlichkeit zutiefst zuwider. Aber Strawinsky, nicht unbedingt taub auf dem politisch rechten Ohr, folgte dem Rat des Musikkollegen.
Eigentlich ist de Reynold eher bekannt für seine Unpünktlichkeit, aber heute hat er sich um eine Stunde vertan und lässt sich schon um Mittag statt erst um 13 Uhr von seinem Fahrer im schwarzen Martini von seinem Domizil Schloss Cressier nach Morges chauffieren. Kurz nach halb zwei trifft er dort ein. Strawinsky hat das grosse Wohnzimmer im zweiten Stock vollständig geräumt und auf Seiten der Fenster mit Blick auf den wunderschönen Innenhof mit Kastanienbaum und Brunnen – den er übrigens abstellen liess, um beim Komponieren nicht gestört zu werden – einen langen Tisch für das Buffet mit Waadtländer Spezialitäten und einigen russischen Leckereien aufgestellt.
De Reynold hatte gezögert, die Einladung überhaupt anzunehmen. Der Gastgeber und einige der Eingeladenen waren ihm höchst suspekt. So der Sozialdemokrat, und in seinen Augen eigentlich Kommunist, Carl Albert Loosli, ehemaliger Redaktor der sozialistischen «Tagwacht», mit dem er in Bern immer wieder die Waffen kreuzte. Ebenso Félix Vallotton, dessen Bild, auf dem eine bekleidete Schwarze auf dem Bett sitzend eine liegende nackte Weisse geradezu spöttisch und herablassend betrachtet, war ein echter Skandal. Man konnte nur hoffen, dass dieses Zeugnis einer in französischen Künstlerkreisen ausgebrochenen regelrechten «Negrophilie», wie seine Pariser Freunde es nannten, in der Schweiz nie ausgestellt werden durfte. Was Strawinsky betraf, so kannte er diesen nur durch Kritiken, aber dass dessen Musik ihn als Wagner- und Berlioz-Anhänger kaum begeistern würde, war wenig spekulativ. Und dann diese skandalöse Ballettaufführung in Paris vor einigen Jahren, etwas mit «Frühling» im Titel, wie er sich zu erinnern glaubte. Wahrscheinlich würde er auch die Person hinter der Musik nicht mögen. Und warum lebte der Russe überhaupt seit mehreren Jahren in der Schweiz, war also lange vor der Revolution ausgewandert? Was suchte er hier? Der Premiere seines Stückes in Lausanne würde er jedenfalls fernbleiben. Zum Empfang am Folgetag entschloss de Reynold sich aber schliesslich hinzugehen. Mit einem Hintergedanken.
De Reynold hatte seit Langem vor, sich wieder einmal mit Ramuz zu treffen. Morges bot die passende Gelegenheit. Sie waren beide zu Beginn des Jahrhunderts in der Zeitschrift «La Voile latine» von einer Gruppe von Westschweizer Schriftstellern engagiert, die er, de Reynold, ein paar Jahre leitete. Es kam zu Flügelkämpfen, in denen sie sich bezüglich Entwicklung der Zeitschrift diametral widersprachen. Ramuz sah sie als rein künstlerisches Unternehmen, er selbst wollte sie zu einem Sprachrohr des sogenannten Helvetismus machen, einer patriotischen Geisteshaltung, die sich im Kulturbereich der Herausbildung einer schweizerischen Nationalliteratur und ganz grundsätzlich nationalbewusster Kunst verschrieb. Aber das war Jahre her, die «Voile» hatte ihre Segel längst gestrichen und der Ärger war verdaut, den ihm Ramuz anlässlich der Nationalen Kunstausstellung in Lausanne von 1904 bereitet hatte, als er in der Presse Modernisten wie Cézanne und van Gogh verteidigte. Und selbst wenn sie sich bezüglich ästhetischer Aspekte der Malerei nicht fanden, hiess dies noch lange nicht, dass sie sich seither nicht kulturpolitisch angenähert hatten. Die von ihm, de Reynold, 1914 mitbegründete «Neue Helvetische Gesellschaft» schien seinen Postulaten jedenfalls recht zu geben. Sie entwickelte sich prächtig und vermochte in den ersten Jahren ihre Mitgliederzahl fast zu verdoppeln. Wie auch immer: Im schriftstellerischen Werk Ramuz’ und einigen seiner Beiträge in der Kulturzeitschrift «Les Cahiers vaudois» glaubte de Reynold in den letzten Jahren einen Weggefährten erkannt zu haben. Vielleicht nicht von gleicher Radikalität wie er selbst, aber ein Weggefährte allemal.
Diesen Weg hatte der Graf vom Murtensee in seiner Streitschrift «Le Besoin de l’ordre» schon 1910 unmissverständlich vorgezeichnet, jener einer neuen radikalen Rechten, einer «konservativen Avantgarde», wie der Historiker Hans Ulrich Jost sie einst treffend etikettierte. De Reynold ist ihr «maître à penser». Im Visier sind «die herrschende Demokratie, die die religiöse, heroische an Kunst und Genie so reiche Schweiz verdirbt», ein Materialismus, «der die Tradition verachtet und die Vergangenheit verfälscht» und eine Überfremdung, die selbst in «die heiligen Bereiche der Kunst, der Wissenschaft und der Erziehung eindringt». Nötig ist die Rückbesinnung auf das, was einmal war und was das Eigene ausmacht. In der Malerei nicht japanisch anmutende Holzdrucke oder Nackte wie bei Vallotton, sondern Berge und Schweizer, die sie besteigen, wie bei Hodler. «Der Gotthard als Berg der Mitte, das Herz des Reichs, der die christliche Welt zusammenhalte, mit der Schweiz als Hüterin der Pässe und der Quellen», wie de Reynold schrieb. Kunst ist Teil eines Gesamtkunstwerkes, so wie es der Komponist Richard Wagner in Bayreuth und der Schriftsteller Gabriele D’Annunizo in Italien vorgespurt hatten. Wenn die Demokratie schon nichts taugt, soll sich der Staat zumindest in ein heroisches Gewand kleiden und Politik entsprechend ästhetisieren. Schönes schaffen für die, die diesen Staat zu führen wissen. Aber nicht nur für sie, denn die christliche Elite ist durchaus willens, einige Tropfen dieser Schönheit uneigennützig auf die trokkenen Lippen des einfachen Arbeiters fallen zu lassen, «um diesem den Trank, mit dem er gewöhnlich seinen Durst löschen muss, weniger bitter zu machen», wie sich Gesinnungsgenosse und Cousin de Reynolds, Georges de Montenach, der spätere Mitgründer der Universität Freiburg, Hochburg des katholischen Konservatismus, in seinem «L’Art et le peuple» von 1903 ausdrückte. Kein Wunder, dass eine so getröstete Arbeiterschaft 15 Jahre später radikal rebelliert …
Zurück zu de Reynold und dessen Ankunft in Morges. Strawinsky ist eben im Begriff, dem Premierenensemble vom Abend zuvor die Namen der zu erwarteten Gäste zu verraten und den Grund ihrer Einladung zu erläutern. Und wie er auf der Liste zu de Reynold kommt, erlaubt er sich ein Spässchen und zwar genau zu jenem Zeitpunkt als dieser, von ihm unerkannt, den Raum betritt: «Was den Grafen de Reynold betrifft, gebe ich das Wort Ramuz. Er wollte ihn unbedingt nicht dabeihaben.» Grinsen mit zwei Ausnahmen, aber Ramuz agiert souverän. «Igor hat mich wieder einmal falsch verstanden; sein Französisch ist auch nach all den Jahren immer noch miserabel.»
Die Situation ist gerettet. Und dass die folgende Unterredung der zwei Betroffenen äusserst kühl verläuft und es de Reynold nicht gelingt, Ramuz in sein Boot zu holen, ist sicher nicht diesem Missgeschick anzulasten. De Reynold, vom Vorfall ganz offensichtlich nicht aus der Fassung gebracht, steuert schnurstracks auf Ramuz zu und kommt gleich zur Sache: «Ich habe», lässt er verlauten, «Ihre kritischen Worte über den Verfall der Schweiz gelesen und kann jeden Satz unterschreiben. Man muss unbedingt Gegensteuer geben. Ich möchte eine neue politische Bewegung etablieren, welche die Schweiz wieder auf den richtigen Weg führt, und möchte Sie, Monsieur Ramuz, einladen, als Geistesverwandter mitzumachen. Eine Hauptstossrichtung soll dabei sein, die hiesige Kunst zu ‹helvetisieren›. Ich zähle auf Sie!»
Ramuz wusste, was kommen würde. Ein gemeinsamer Bekannter, Édouard Secretan, Chefredaktor der liberal-konservativen «Gazette de Lausanne», hatte ihm vor einiger Zeit von de Reynolds Plänen berichtet und angedeutet, dass dieser wohl auch bei ihm vorstellig werde. Um gewappnet zu sein, hatte er am Morgen vor dem Gang zu Strawinsky wieder einmal in de Reynolds Bibel «Le Besoin de l’ordre» geblättert. Eine gewisse Sympathie mit einzelnen Postulaten, wie sie etwa von der Heimatschutzbewegung als Opposition gegen ungezügelte Industrialisierung vertreten wurden, konnte er nicht leugnen. Aber mit der radikalen «Blut und Boden»-Politik des Schlossherrn wollte Ramuz in keiner Weise identifiziert werden. Er hatte seinerzeit in den Jahren in Paris darunter gelitten, dass viele Kritiker und Kollegen ihn als einen «écrivain régionaliste» und seinen Stil als «littérature de terroir» abstempelten, beides synonym für zweitklassig und am rechten politischen Rand agierend. Konservativismus war das eine, Antidemokratismus und Antisemitismus, wie dies bei de Reynold durchschimmerte, etwas anderes. Nein, da waren sie nicht im gleichen Boot, und auch nicht in dieser Helvetismus-Barke, auf die ihn de Reynold ziehen wollte.
Ramuz (heftig): «Monsieur le Comte et Monsieur le Professeur, wenn Sie mich für einen ‹Helvetisten› halten, sind Sie völlig neben der Spur. Patriotismus liegt mir nicht und schon gar nicht ein sich am Nationalstaat Schweiz entzündender. Eine Schweizer Nationalliteratur wäre mir ein Gräuel. Daran müssten Sie sich eigentlich aus den vielen gemeinsamen Sitzungen erinnern, bei denen wir uns vor Jahren jeweils heftig gestritten haben. Ich bin mir treu geblieben. Sie haben aber offenbar nichts gelernt.»
Eine derart radikale Abfuhr kommt für de Reynold unerwartet; er ist baff und weiss nichts zu erwidern. Ramuz fährt fort: «Wir leben nicht in der gleichen Welt, Herr de Reynold, weder geografisch noch sozial und kulturell. Ich bin Sohn eines Bauern und Kleinhändlers, gehöre zu den ‹gens de peu›. Haben Sie nicht realisiert, dass wir eine völlig andere Sprache sprechen, Sie mit Ihrem noblen, akademisierten Französisch, das Sie Ihren Studenten an der Universität Bern auftischen, und ich mit meinem Waadtländer Dialekt. Ich schreibe, wie die Leute sprechen. Und ich interessiere mich für Charaktere, die mir nahestehen und nahegehen; Sie, Herr de Reynold, gehören ganz sicher nicht dazu.» Immer noch keine Reaktion vom Schlossherrn, und so setzt Ramuz noch einen drauf: «Wissen Sie übrigens, dass ich inzwischen in Frankreich auch für eine linke pazifistische Bewegung schreibe?» De Reynold glaubt sich auf den Arm genommen. Er schluckt zweimal leer und schleicht von dannen, nicht ohne Ramuz kleinlaut vorzuschlagen, das Gespräch später am Tag weiterzuführen. Er wolle noch die Herren Strawinsky und Ansermet begrüssen.
Von Ramuz und de Reynold unbemerkt, hat sich Strawinsky auf Samtpfoten dem Duo genähert. Katzengleich, und eine Katze, Petruschka, hat er denn auch in seinen Armen. Er schnappt den letzten Satz von Ramuz auf und gibt sich empört.
Strawinsky: «Du schreibst für ein linkes Blatt in Frankreich? Das ist ja unerhört.»
Ramuz: «Nun es stimmt nicht ganz. Ich werde schreiben, wäre präziser. Ich bin vor Kurzem von Henri Barbusse, Goncourt Preisträger von 1916, angefragt worden, ob ich eine Geschichte für ‹Clarté›, die erste Ausgabe der Zeitung einer Bewegung, schreiben würde, die er eben mit Kollegen gegründet hat. Ich sagte zu; mein Beitrag wird anfangs nächstes Jahr erscheinen.»
Ramuz’ Abstecher ins linke Lager ist in der Tat eine äusserst interessante Anekdote der Schweizer Literaturgeschichte. Ramuz’ Stil, die einfache, oft mit direkter Rede durchzogene Sprache, das Thema und Milieu seiner Geschichten, der Blick auf die einfachen Leute, haben ihm die Bewunderung von Schriftstellerkollegen eingebracht, mit denen er politisch wenig am Hut hatte. So eben auch von Henri Barbusse. Acht Jahre später verfängt sich Ramuz sogar in einer noch schärferen Linkskurve. 1926 wird Barbusse die Redaktion der kommunistischen «L’Humanité» übernehmen und in einer Kritik den Autor des eben erschienen Romans «La grande peur dans la montagne» zum besten Schriftsteller der Gegenwart ernennen. Ramuz schreibe über das Volk und gebe diesem die Stimme, die es verdiene; er schaffe eine Art proletarische Kunst ausserhalb des Proletariats. Und Barbusse bleibt nicht allein. Ramuz erhält auch Blumen von Henry Poulaille, der wohl einflussreichsten Stimme der französischen Arbeiterliteratur dieser Zeit, und selbst der grosse Louis Aragon gibt sich die Ehre und bittet ihn um einen Artikel für seinen «Combat».
Von Gonzague de Reynold und Henri Barbusse gleichzeitig flattiert zu werden kann sich nicht jeder rühmen. Die Anekdote zeigt, dass sich hinter dem Schriftsteller Charles Ferdinand Ramuz eine äusserst komplexe und widersprüchliche Persönlichkeit verbirgt, die immer dann überrascht, wenn sie unbedarft politisches Terrain betritt. Diesbezüglich besteht beim Grafen de Reynold keine Gefahr; man weiss, was man hat. Er war, ist und bleibt ein mittelmässiger Schriftsteller. Politisch wird er sich im Laufe seiner literarischen Karriere noch deutlich radikalisieren, öffentlich Salazar und Mussolini bewundern – Letzterer wurde notabene 1937, im gleichen Jahr wie Ramuz von der Uni Lausanne mit einem Ehrendoktor bekränzt – und später auch mit dem Nationalsozialismus flirten. Den Bogen überspannt hat er eigentlich schon in den späten 1920er-Jahren. Seine Schrift «La Démocratie et la Suisse», in welcher er einen oligarchisch-christlichen Staat vorschlägt, mit einem Landammann an der Spitze, als den er sich zwischen den Zeilen selbst vorschlägt, entfacht einen Skandal und kostet ihn die Stelle als Professor für französische Literatur an der Universität Bern. Wie gut er in katholischkonservativen Kreisen trotz dieser unehrenhaften Abwahl verankert bleibt und das Ohr von Politikern auf höchster Ebene behält, zeigt neben dem Umstand, dass ihn die Universität Fribourg postwendend ihrerseits zum Professor macht, seine Nomination von 1922 in die Kommission für geistiges Eigentum des Völkerbundes.
De Reynolds Völkerbund-Karriere, 1932 wird er Vizepräsident der Kommission, führt direkt zu einem anderen der zwölf bei Strawinsky Geladenen. Als Schweizer Vertreter beim Völkerbund war eigentlich Albert Einstein vorgesehen. Der katholisch-konservative Bundesrat Giuseppe Motta bekniete aber die Völkerbund-Verantwortlichen, den Nobelpreisträger als Deutschen zu klassifizieren, damit Platz für den der Schweiz genehmeren Vertreter de Reynold frei werde. Was diese denn auch taten. Nach wenigen gemeinsamen Sitzungen bezeichnete Einstein in einem Brief an ein anderes Kommissionsmitglied de Reynold als «Esel von Bern». Er hatte seine guten Gründe. Auch wenn Einstein aus seinem Herzen nie eine Mördergrube machte, den Titel Esel hat er nicht leichthin vergeben; ein anderer Fall ist jedenfalls nicht aktenkundig.
Eben kreuzen sich die beiden im Hause Strawinskys, Einstein und das Grautier in spe. Einstein, nicht wissend, was ihm mit diesem einst blühen wird, nickt gut gelaunt und bahnt sich seinen Weg zum Gastgeber. Mit einem Gastgeschenk? Die geschulten Augen Strawinskys, Ansermets und der Musiker des gestrigen Premierenensembles wissen es besser: Was Einstein bei sich führt, ist ein Geigenkasten.
Im Herbst 1918 ist Einstein bereits ein hoch angesehener Wissenschaftler. Er hat 1905 als Angestellter im eidgenössischen Patentamt in Bern, einer Tätigkeit, die den 26-Jährigen offenbar nicht überforderte, vier wissenschaftliche Papiere publiziert, die allesamt den Nobelpreis für Physik verdient hätten. Für seine Lichtquanten-Hypothese, in der er die bis dato gültige Vorstellung vom Licht als Welle hinterfragte und die er mit einer alternativen Erklärung des Lichts als Teilchen ergänzte, wird er diesen 1921 denn auch erhalten. Zum Wissenschaftsstar, dem ersten der modernen Wissenschaftsgeschichte, macht ihn aber ein anderes, früheres Ereignis, ein gutes Jahr nach Morges. Im November 1919 wird seine allgemeine Relativitätstheorie experimentell nachgewiesen. Messungen im Zusammenhang mit einer totalen Sonnenfinsternis in den Tropen im Frühjahr 1919 lassen keine Zweifel übrig: Von grossen Massen ausgehende Gravitation vermag Licht abzulenken; Newtons Vorstellung vom sich linear verbreitenden Licht erweist sich wie von Einstein vorausgesagt als falsch. Die Physik steht kopf, die «New York Times» berichtet darüber auf der ersten Seite. Auf dem Kurfürstendamm in Berlin, wo Einstein als Professor an der Preussischen Akademie der Wissenschaften forscht und lehrt, halten Passanten beim Anblick des «Nerds» mit wildem Haar und Geigenkasten von nun an inne.
Auch Einstein hatte zuerst gezögert, der Einladung Strawinskys Folge zu leisten. Er war dem Geheimnisvollen auf der Spur, «dem Schönsten, was wir erleben können», wie er in einem bekannt geworden Zitat einmal sagte. Alles andere war unnötige Ablenkung; mit einigen Ausnahmen, darunter die Musik. Er war mit einer Geige aufgewachsen, im gutbürgerlichen jüdischen Elternhaus in Ulm, und er stellte das Instrument zeit seines Lebens nie mehr in die Ecke. Strawinsky kannte er wie die meisten ernsthaft Musikinteressierten seit dem Skandal bei der Uraufführung von «Le Sacre du printemps» 1913 in Paris. Er führte sich das Stück dann auch auf Schallplatte zu Gemüte. Es war nicht seine Musik; zu weit weg von dem, was ihn am meisten berührte: Haydn, Mozart, die Romantiker. Aber den russischen Komponisten, ein Mann der Avantgarde, persönlich kennenzulernen interessierte ihn natürlich. Und er wollte diesem direkt mitteilen, wie überrascht und geehrt er sich fühle, als Naturwissenschaftler zu einer Ehrung von Kulturschaffenden eingeladen zu werden, einer Gilde, die sich sonst kaum um seinesgleichen kümmere. Und ein Drittes, Praktisches, sprach für den Gang nach Morges. Die Universität und die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich hatten ihm soeben ein Angebot für eine gemeinsame Anstellung gemacht und zu einer Unterredung eingeladen. Die Fahrt von Berlin nach Zürich liess sich also gut mit dem Abstecher in die Westschweiz verbinden. Dass er in Zürich auch noch Fragen bezüglich der Unterhaltsbeiträge für seine Frau Mileva regeln und seine beiden Söhne besuchen konnte, kam dazu. Mehrere Fliegen auf einen Schlag also, und die Reise dazu noch von Schweizer Bildungsstätten finanziert.
Einstein war gut gelaunt auf seiner fast fünfstündigen Zugreise ins Waadtland. Seine Magenbeschwerden, die ihn in den beiden letzten Jahren immer wieder ans Bett gefesselt hatten, waren nur noch Episode. Das Zürcher Angebot reizte und ehrte ihn, auch wenn er sich wohl doch für einen Verbleib bei Max Planck in Berlin entscheiden würde. Auch privat bahnte sich eine Lösung an. Mileva willigte in die vorgeschlagene Scheidung ein. Sie würde das Preisgeld für den zu erwartenden Nobelpreis erhalten; die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen in den nächsten Jahren gewinnen würde, war gross. Und da war noch die optimistisch stimmende politische Grosswetterlage in seinem Gastland; lange würde sich das verhasste Kaiserreich nicht mehr halten können. In seine Vorlesungsnotizen wird er in ein paar Wochen schreiben: «fiel aus wegen Revolution». Für einmal scheute er auch das Gesellschaftliche und den Small Talk nicht über alle Massen, die ihn in Morges sicher erwarten würden. Aber warum kannte ihn Strawinsky überhaupt? Der Gastgeber beantwortete die Frage, bevor der Gast sie stellen konnte.
Strawinsky: «Ich weiss nicht, ob Sie die Ballets Russes und deren Leiter Sergei Djaghilew kennen, Herr Einstein. Er war vor einigen Wochen bei einem Dîner in Berlin Sitznachbar Ihres Chefs Max Planck und hat mir nachher von Ihnen erzählt. Der geigende zukünftige Nobelpreisträger in Physik, wie er sich ausdrückte. Und dass sich dieser nicht gescheut habe, nach dem Essen vorzuspielen. Darum weiss ich auch, dass in Ihrem Geigenkasten das steckt, was hineingehört, und nicht ein Messgerät für ein Experiment, das Sie hier am Genfersee planen. Was haben Sie den Damen und Herren denn vorgespielt?»
Einstein: «Ich spiele eigentlich immer dasselbe, aber erwähne nie einen Komponisten oder Titel, damit man nicht realisiert, dass es immer dasselbe ist. Weil ich quasi immer vor Physikern spiele, klappt das normalerweise auch recht gut.»
Strawinsky: «Nun so schlimm wird es bei den Physikern auch wieder nicht sein. Physik hat ja den Ruf, dass sie von allen Naturwissenschaften am nächsten bei der Philosophie ist, und von dieser ist es nur ein kleiner Schritt zur Kunst und zur Musik. Was interessiert denn einen Naturwissenschaftler an der Musik?»
Der Frage Strawinskys musste sich der weltberühmte Physiker sein Leben lang stellen. Sie hat ihn stets leicht verärgert und seine Antwort auf eine Erkundung, wie er das Werk Schuberts einschätze, gehört zu einem der zahlreichen berühmt gewordenen Einstein-Zitate: «Musizieren, Lieben – und Maulhalten.» Die Musik grosser Meister ist nicht zu hinterfragen; sie spricht für sich. Im Herbst 1918 war die Frage für ihn aber noch relativ selten, und weil sie von einem gefeierten Komponisten kam, war eine schnöde Antwort fehl am Platz.
Einstein: «Musik, gute Musik, die Musik der Meister fusst auf schöpferischen Gedanken. Natürlich bedingt sie auch Handwerk, kompositorische Grundgesetze, aber wie bei der Logik in der Physik, genügt dies nicht.»
Strawinsky: «Und woher kommt dieses Schöpferische?»
Einstein: «Sicher von etwas Übergeordnetem, das der Welt eine innere Harmonie schafft. Dieser Harmonie sind beide, die Musik und die Künste ganz allgemein und die Naturwissenschaften auf der Spur. Sie vereint diese; es sind Zweige desselben Baumes, beide werden aber diesen Baum, dem sie zugehören, nie wirklich begreifen und verstehen.»
Dass Einstein dann doch die drei letzten Jahrzehnte seines Lebens mit dem Versuch verbringen wird, den Baum zu durchschauen – «Gott würfelt nicht» –, um die Quantenphysik in einer vereinheitlichenden Formel zu erfassen und dabei schmerzlich scheitert, zeigt, dass grundsätzliche Einsichten die Stürme des Lebens selten überdauern. Gleiches oder zumindest Ähnliches ist auch Einsteins Gesprächspartner widerfahren. Strawinsky wird mehrere Grundsätze wie seine resolute Absage an die serielle Musik der Wiener Schule und die Abkehr vom Christentum in späteren Jahren wieder über den Haufen werfen. Der Dialog in Morges zwischen Kunst und Wissenschaft hätte sich verlängern können, aber zu den Stürmen des Lebens gehört auch Leibliches. Strawinsky sieht Einsteins verstohlene Blicke zum Buffet in der Ecke und lädt diesen ein, von den Köstlichkeiten zu probieren. Einstein, mit gesundetem Magen wie neugeboren, lässt sich nicht zweimal bitten.
Bei den Häppchen stösst der Nobelpreisträger in spe auf einen Berner, dem er in seiner Berner Zeit nie begegnet ist, ja mehr noch, von dem er noch nie etwas gehört hatte. Es ist der Schriftsteller und Journalist Carl Albert Loosli. Ramuz hatte diesen Strawinsky vorgeschlagen. Er kannte Loosli von einigen früheren gemeinsamen Projekten. Freunde würden Loosli liebevoll den «Philosophen von Bümpliz» nennen, erklärte er dem Gastgeber. Er wohne tatsächlich in einem Vorort von Bern mit diesem Namen, synonym für wenig edel oder wenig verheissungsvoll; kein Ort, wo man Philosophen vermutet. Aber Loosli gehöre unbedingt eingeladen. Einmal verkörpere er die perfekte politische und gesellschaftliche Antithese zu de Reynold: in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsener, schon in jungen Jahren in Erziehungsanstalten gesteckter Kämpfer für Unterprivilegierte und Ausgeschlossene, Pazifist und Sozialdemokrat. Zum andern engagiere sich Loosli unermüdlich in einem für die Schweiz äusserst relevanten Spannungsfeld, dem der kulturellen Kluft zwischen der deutschen und der lateinischen Schweiz. Politisch hätten Strawinsky und Loosli das Heu zwar nicht auf der gleichen Bühne, als Persönlichkeit würde er diesen aber sicherlich schätzen.
Und so kam der Philosoph von Bümpliz auf die Einladungsliste und zur Bekanntschaft Albert Einsteins, dem er politisch in der Tat bedeutend näherstand als den beiden Herren, die ihn nach Morges aufgeboten hatten. Einstein war Loosli sofort sympathisch, der einzige Gast ohne Krawatte, in unprätentiöser Kleidung – täuschte er sich oder hatte Einstein tatsächlich seine Socken zu Hause vergessen? – und einem doch eher unkonventionellen Buffetstil.
Einstein: «Was bringt Sie nach Morges, Herr … Loosli? Ich selbst bin Physiker und war von der Einladung zwar erfreut, aber auch äusserst überrascht.»
Wie sollte Loosli sich in wenigen Worten beschreiben? Selbst sah er sich als «Homme de lettres». Aber was hiess das schon, zumal für einen in Deutschland tätigen Physiker?
Loosli: «Ich weiss auch nicht genau, wie ich zu der Ehre kam. Ich war lange Zeit vollberuflich Journalist, unter anderem als Redaktor der sozialdemokratischen ‹Berner Tagwacht›, und dort Vorgänger des weit bekannteren Robert Grimm, einer Ikone der Schweizer Arbeiterbewegung, von dem Sie sicher schon gehört haben. Seit ein paar Jahren bin ich nun als freier Schriftsteller tätig. Und schreibe zum Brotverdienst natürlich auch noch Beiträge für Zeitungen, Feuilletons etc. Anzuprangern gibt es ja vieles in diesem Land; es präsentiert sich zerrissen in diesen Zeiten, kulturell als auch sozial. Ein Krieg wie dieser darf sich nicht wiederholen. Pazifismus ist das Gebot der Stunde. Ich hoffe, dass sich die Literatur hierzulande zukünftig verstärkt davon anstecken lässt. Schade, dass wir nicht mehr Intellektuelle wie den Schriftsteller und Nobelpreisträger Romain Rolland haben; er ist zwar Franzose, lebt aber zumindest gegenwärtig ganz nahe von hier, in Villeneuve.»
Dass Loosli mit seiner Antwort beim Gesprächspartner auf grosse Sympathie stösst, konnte er nicht wissen. Einstein war in seiner Berner Zeit nicht durch politische Stellungnahmen aufgefallen. Aber da war er ja zum einen vom Patentamt gezähmt, und zum anderen interessierte sich natürlich auch niemand für ihn, Redaktor der «Tagwacht» inklusive. Berlin hatte Einstein politisiert. Nur ein paar Wochen vor Morges schrieb er seiner Mutter nach Heilbronn, dass er in Berlin inzwischen als akademischer «Obersozi» gelte, wobei deutlich Stolz durchschimmerte. Und ein Sozi, und ganz sicher ein Obersozi im Berlin dieser Zeit, war ein überzeugter Kriegsgegner.
Einstein: «Damit leisten Sie mehr für die Menschheit als ich mit meinen Formeln. Aber wir sitzen im gleichen Boot. Ich konnte als Jugendlicher die ausgeprägte militärische Mentalität meiner deutschen Heimat nicht ausstehen und habe meinen Vater gebeten, mich auszubürgern. Ich wollte Schweizer werden, und so ist es dann auch gekommen. Schade, dass wir uns in Bern nie getroffen haben. Interessant übrigens, dass Sie Rolland nennen. Ich habe ihn vor etwa drei Jahren spontan angeschrieben, als ich von seinem Engagement für eine friedliche Koexistenz zwischen Frankreich und Deutschland hörte. Wir haben uns dann zwei, drei Mal getroffen und über ein eventuelles Manifest gegen Krieg und Rassismus sowie den Schutz künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeiten gesprochen. Es soll im nächsten Frühjahr lanciert werden. Im Moment werden Unterschriften gesammelt, u.a. bei Hermann Hesse, der eben auf uns zukommt, ein anderer Deutscher, den es in die Schweiz und sogar nach Bern verschlagen hat und der offenbar dort zu bleiben gedenkt. Kennen Sie ihn? Ich habe ihn via Rolland kennengelernt.»
Natürlich kannte Loosli Hesse. Wen kannte er schon nicht; der Berner war zwar wenig bekannt, aber bestens vernetzt. Hesse begrüsste ihn sogar mit einer ganz und gar undeutschen Umarmung. Er hatte Loosli schon vor Jahren entdeckt und auch gefördert. 1912 empfahl er ihn dem Chefredakteur der linksliberalen Kulturzeitschrift «März», dem späteren deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss, als «guten Humoristen und scharfen Satiriker». In der Folge konnte Loosli im renommierten «März» immer wieder Artikel platzieren und sich auch in Deutschland einen Namen machen, wenn auch nicht unbedingt in Physik-Kreisen. Privat trafen sich die beiden oft im Melchenbühl bei Bern, wo sich beim Maler Albert Welti ein lokaler Künstlertreff eingenistet hatte. Drei Pazifisten verschwörerisch zusammen also. Definitiv nicht zu dieser Gattung gehört Ramuz, der sich nun zur Gruppe gesellt. Und doch will er einen der drei loben.
Ramuz (zu Einstein gewandt): «Dieser Herr hier, Carl Albert Loosli, gehört zu den wenigen Deutschschweizer Intellektuellen, die sich mit grossem Engagement um Brücken von der übermächtigen Deutschschweiz zu den lateinischen Minderheiten bemühen. Für die französische Schweiz war die einseitige Parteinahme der deutschen Schweiz, ein eigentlicher Kniefall vor dem deutschen Kaiserreich, absolut unakzeptabel.»
Einstein: «Aber hat man denn nicht in gleicher Weise in der Westschweiz für die andere Seite, die Entente, Partei ergriffen?»
Loosli: «Partei ergriffen schon, aber nicht in gleicher Weise. Ich weiss nicht, wo Sie im Herbst 1912 residierten, vielleicht schon in Berlin. Aber sicher nicht in Zürich. Sonst hätten Sie mitbekommen, wie die Leute in Zürich Kaiser Wilhelm empfangen haben. Er ist wie ein eigener Monarch bejubelt worden.»
Einstein: «Doch, doch, ich war damals in Zürich. Nach einem gut einjährigen Aufenthalt in Prag. Schande über mich.»
Loosli (weiter und eine Spur lauter): «Und leider wurde man in der alemannischen Schweiz auch nicht vernünftiger, als es über die Kriegsschuld Deutschlands keine Zweifel mehr gab. Um ein kulturelles Ereignis zu bemühen: Das führende deutsche Orchester der letzten Jahre, das Gewandhaus Leipzig, hat während der Kriegsjahre eine einzige Konzerttournee ausserhalb des deutschen Reichs durchgeführt – in die Deutschschweiz. Man stelle sich dies vor, Brahms’ deutsches Requiem von einem deutschen Orchester 1917 in Zürich, Basel und Bern. Später im Jahr ist es dann in Leipzig auch noch zu einem Fest der Schweizer Musik gekommen, bei dem die Crème de la Crème der Schweizer Komponisten auftrat, wenn bezeichnenderweise auch nur solche aus der Deutschschweiz: Hans Huber, Othmar Schoeck, Hermann Suter …»
Hesse: «Sie haben von den fehlenden Brückenbauern gesprochen, Herr Ramuz, aber da war ja noch ein anderer, heute ebenfalls Geladener, ein Schriftstellerkollege aus Luzern, Carl Spitteler, der die Schweiz in seiner berühmten Rede von 1914 zur Einigkeit rief.»
Ramuz: «Sie haben recht. Aber leider zeigte sein Appell wenig Wirkung. Und Spitteler liess es bei diesem einzigen bewenden.»
Loosli (ein guter Bekannter Spittelers): «Was auch irgendwie verständlich ist. Seine Rede ist in Deutschland sehr schlecht angekommen und seine Schriften wurden aus den Regalen deutscher Buchhandlungen verdammt.»
Hesse: «Ja, die Rede war sehr mutig. Und Spitteler wusste dies auch. Er wies selbst daraufhin, dass er im Begriff sei, seinen guten Ruf und alle Sympathien in Deutschland aufs Spiel zu setzen. Die Deutschen sind diesbezüglich sehr empfindlich. Als Ferdinand Hodler seinerzeit einen deutschfeindlichen Aufruf europäischer Intellektueller unterschrieb, wurden seine Bilder massenweise abgehängt. Ich bin kein Hodler und will auch nicht jammern, aber ich kann davon ein Liedchen singen. Wie Sie wissen, Herr Einstein, habe ich in Deutschland seinerzeit auch gegen deutsche Kriegshatz opponiert. Mir passierte genau, was Spitteler befürchtete. Sie haben es einfacher, in Ihrem Gebiet, es ist politisch bedeutend wenig heikel. Bei uns Literaten ist Erfolg immer auch ein Produkt der dominierenden geistigen Strömungen der Zeit, in welcher wir schreiben. Was in Ihrem Fach zählt, Neues zu entdecken, Wissen zu erweitern, ist bei uns keine Erfolgsgarantie.»
Einstein: «Nun, so unpolitisch ist Wissenschaft auch wieder nicht. Ich könnte Ihnen anhand von Professorenwahlen ein Liedchen davon singen … Aber Spass beiseite, das politisch Brisante in den Naturwissenschaften ist, vor allem in der Grundlagenforschung, dass man nie genau weiss, was in der Büchse der Pandora lauert. Das zeigt sich oft erst Jahrzehnte später.»
Wie recht er hatte! Aber Hesse entschliesst sich nicht weiter zu bohren und für ein Zurück zum Thema «Schriftsteller und Erfolg».
Hesse: