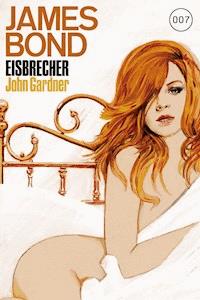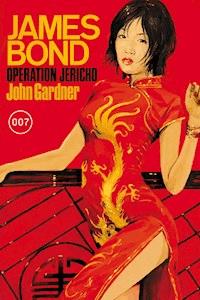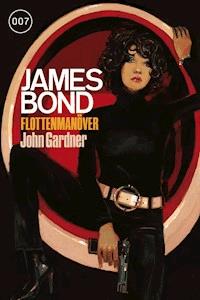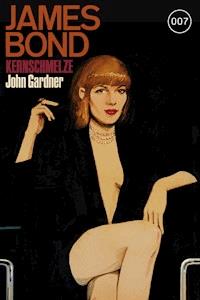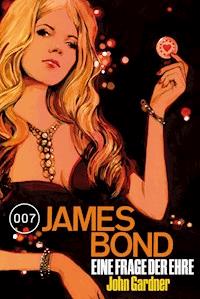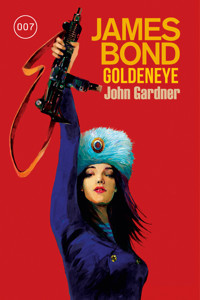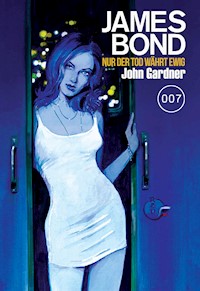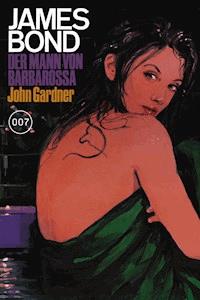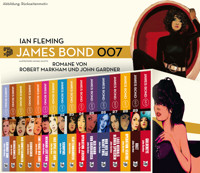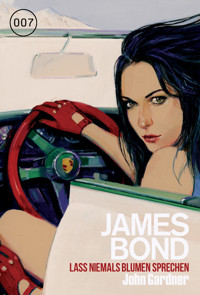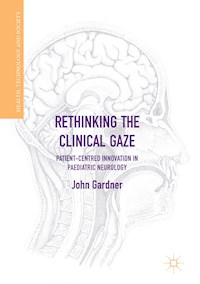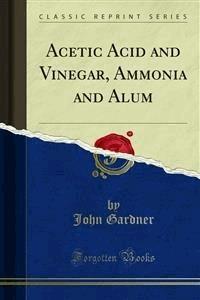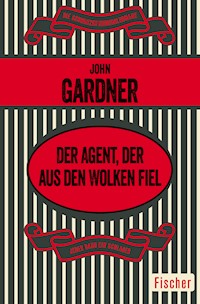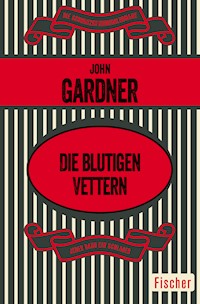4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser großangelegte, drei Generationen umspannende Gesellschaftsroman ist eng verknüpft mit Entstehung und Entwicklung europäischer Geheimdienste in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen. Die Männer und Frauen des Railton-Clans sind an allen Brennpunkten des Zeitgeschehens anzutreffen – sei es im Untergrund der Agenten oder auf glänzendem diplomatischem Parkett, an Kriegsschauplätzen oder in den Schlafzimmern ausländischer Spitzel. Sie halten zusammen in Tradition und verwandtschaftlicher Loyalität – und dennoch ist ein Verräter unter ihnen … Diese eindrucksvolle Saga von Abenteuer, Intrige und Liebesaffären fesselt im menschlichen Geschehen ebenso stark wie in der brillanten Schilderung eines Stücks europäischer Geschichte. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
John Gardner
Eine ehrbare Familie
Aus dem Englischen von Susanne Lepsius
FISCHER Digital
Der Roman eines britischen Clans, der zwischen den Kriegen die Fäden der europäischen Geheimdienste in Händen hielt
Inhalt
Erster Teil Dezember 1909 – Juni 1914
1
Der Marktflecken Haversage, eingebettet in eine Talsenke, hatte Triumphe und Niederlagen in seiner langen Geschichte erlebt.
Die Railtons waren Nachfahren des normannischen Ritters Pierre de Royalton, der sich unter Wilhelm dem Eroberer 1066 auf dem Schlachtfeld von Hastings ausgezeichnet hatte. Zur Zeit Heinrichs VIII. kam die Familie nach Haversage, ließ das «de» fallen und nannte sich ohne Adelsprädikat Railton.
Die Railtons bauten ein großes Herrenhaus auf einem Hügel, genannt Redhill, widmeten sich der Landwirtschaft, führten Reformen durch und wurden dadurch zum Vorbild für andere Großgrundbesitzer. Ein Railton wohnte stets im Herrenhaus Redhill, verwaltete den ausgedehnten Besitz und kümmerte sich als Gutsherr um das Wohlergehen des Dorfes. Die anderen Familienmitglieder dagegen verteilten sich im Dienst ihres Monarchen über das britische Weltreich. Sie dienten in Heer oder Marine oder vertraten ihr Land als Diplomaten. Die besten von ihnen, die geborenen Patriarchen, kehrten nach Redhill zurück, um dort ihren Lebensabend zu verbringen.
Das hatte auch Sir William Arthur Railton getan, der in der Familie schlicht «Der General» hieß.
Die gesamte Familie hatte Weihnachten 1909 wie üblich in Redhill verbracht. Der jüngere Bruder des Generals, Giles, kam mit seinem Sohn Andrew, dem Marineoffizier, dessen Frau Charlotte und den drei Söhnen: Caspar und den Zwillingsbrüdern Rupert und Roy. Giles’ zweiter Sohn Malcolm war mit seiner jungen Frau Bridget aus Irland angereist, während Marie – Giles’ einzige Tochter – mit ihrem französischen Ehemann Marcel Grenot und ihren zwei Kindern Paul und Denise die beschwerliche Fahrt von Paris bis Haversage auf sich genommen hatte.
Auch des Generals eigene zwei Söhne waren dagewesen: Charles, der jüngere, mit seiner erstaunlich nachlässig gekleideten Frau Mildred und ihrer Tochter Mary Anne und John, der ältere, Politiker und Parlamentsmitglied, mit seiner jungen zweiten Frau Sara und James, seinem Sohn aus erster Ehe, die so tragisch geendet hatte.
Es waren für alle sehr glückliche Feiertage, denn die Festtage in Redhill hatten immer einen ganz besonderen Charme, und der General war in bester Stimmung gewesen.
Dienstag nach Weihnachten waren sie alle ihre getrennten Wege gegangen und hatten den General allein mit seinen Angestellten zurückgelassen: mit Porter, seinem alten Diener, der Köchin und deren Tochter Vera, die als erstes Hausmädchen diente, den zwei Zimmermädchen sowie Ted Natter, dem Stallknecht, Billy Crook, dem Hausburschen, und einigen anderen.
Giles Railton wollte Silvester bei seinem Sohn Andrew und dessen Frau Charlotte und seinen Enkeln verbringen. Es war früh am Nachmittag, und er war im Begriff, sein Haus in Eccleston Square zu verlassen, als Porter, der Diener des Generals, ihn mit erstickter Stimme anrief, um zu sagen, daß sein Herr einen plötzlichen Anfall erlitten habe.
Giles benachrichtigte sofort seinen Sohn Andrew, verschwieg aber den Ernst der Lage; dann nahm er den nächsten Zug nach Haversage, wo Ted Natter ihn mit dem Einspänner abholte.
Selbst an diesem trüben Abend wirkte der gelbrote Ziegelbau einladend wie immer – ein Anblick, der sich Giles tief ins Gedächtnis eingeprägt hatte, denn Redhill bedeutete für ihn seine Kindheit, die Schulferien, die ersten Reitstunden, Weihnachten, seine Eltern, Herbst und lange Winter, den Zyklus von vielen Frühlingen und Sommern.
Der Einspänner hielt in der hufeisenförmigen Auffahrt, und Giles blickte in die Höhe. Ein plötzlicher, schwacher letzter Wintersonnenstrahl blitzte an einem der in Blei gefaßten Fenster im zweiten Stock auf, als versuche Gott vergeblich, eine Hoffnungsbotschaft zu senden.
Der Arzt erwartete ihn mit der Krankenschwester. Auf dem sonst so betriebsamen Haus lastete die gedrückte und verschreckte Atmosphäre, die ein sich plötzlich nahender Tod verbreitet.
Der General lag bewußtlos, wie schlafend, im oberen Stockwerk. Nachdem der Arzt gesagt hatte, daß es nur noch eine Frage von Stunden sei, ließ Giles den jungen Billy Crook zu sich kommen und befahl ihm, hinunter ins Dorf zu laufen, um dem Pfarrer Bescheid zu sagen. Er bat die Krankenschwester, ihn bei irgendwelchen Veränderungen zu benachrichtigen, dann ging er mit berufsmäßiger Zielstrebigkeit ins Arbeitszimmer des Generals.
Das Zimmer lag an der Rückfront des Hauses und blickte nach Süden. Im Sommer konnte man durch die hohen Fenstertüren in den geschützten Rosengarten gehen, von dessen höchstem Punkt aus man fast den ganzen Besitz und die gutseigenen Bauernhöfe sah.
Giles ging schnell die Papiere durch. Er wußte genau, was vernichtet und was behalten werden mußte. Und so kam es, daß er als erster das Testament las und sofort die daraus entstehenden Probleme erkannte.
Erst nachdem er die Papiere sorgfältig aussortiert hatte, informierte Giles, der einzige Bruder des Generals, die Familie über den bevorstehenden Tod des alten Soldaten. Er starb noch am gleichen Abend um zehn Uhr.
Bald läutete unten im Städtchen die Totenglocke, ihr dumpfer, melancholischer Klang ließ die mit Rauhreif bedeckten Äste erzittern, die Töne drangen wie eine Warnung in jeden Haushalt.
Auf dem Marktplatz schneuzte sich der Schlachter Jack Calmer laut ins Taschentuch, hielt im Essen inne und sah seine Frau und seine Tochter Rachel an. «Wir sollten ein Gebet für ihn sagen. Er war ein guter, aufrechter Mann.»
Sie hörten die Glocke in den Gasthäusern. Die Männer, die den General gekannt und sogar unter seinem Kommando gekämpft hatten, setzten ihre Bierkrüge ab und erhoben sich respektvoll. Sie wußten, sein Tod bedeutete unweigerlich Veränderung.
Die Glockenschläge konnte man meilenweit hören, weit über das Städtchen hinaus. Man hörte sie im Armenhaus, und Miss Ducket vergoß eine Träne, denn sie hatte den General noch als jungen Mann gekannt. Viele Menschen wurden durch das gleichmäßige Geläute daran erinnert, daß der Winter ihres eigenen Lebens bereits angebrochen war und daß die Uhr auf dem Kaminsims für sie alle tickte. Auch der Farmaufseher von Redhill, der junge Bob Berry, hörte sie und empfand Angst, aber aus anderen Gründen, desgleichen der Gutsverwalter Jack Hunter.
John, Charles und ihre Familien trafen am nächsten Morgen vor dem Mittagessen ein; Andrew und seine Familie kamen am Nachmittag an. Marie und ihr Mann, Marcel Grenot, bestiegen wieder den Zug, nachdem sie gerade von den Weihnachtsfeierlichkeiten nach Paris zurückgekehrt waren. Malcolm und Bridget, die Neujahr bei Bridgets Eltern verbracht hatten, wurden am folgenden Abend erwartet.
Es war also Giles, der darauf achtete, daß die Familiengeheimnisse gewahrt wurden, und es war ebenfalls Giles, der die beiden Söhne des Generals von dem Testament des alten Mannes in Kenntnis setzte. Giles sah Probleme voraus und tat sein Bestes, ihnen entgegenzuwirken.
Die Probleme, die das Testament aufwarf, hatten hauptsächlich mit Besitzansprüchen und Finanzen zu tun, aber auch mit den unterschiedlichen Charakteren und Ambitionen von John und Charles, den zwei Söhnen des Generals. In Johns Fall war das Problem doppelt schwierig wegen seiner jungen Frau Sara, die einige Familienmitglieder für unreif, verwöhnt und eigensinnig hielten.
Johns erste Ehe hatte tragisch geendet. Seine Frau Beatrice war bei der Geburt ihres ersten Kindes, James, gestorben. Der Junge war erst von einer Reihe von Kinderfrauen versorgt und dann, wie in der Familie üblich, in das strenge Wellington-Internat geschickt worden. James war jetzt siebzehn Jahre alt.
Johns großes Interesse galt der Politik, und ein Jahr nach Beatrices Tod war er Parlamentsmitglied geworden. Sein Leben bestand aus Arbeit, er liebte sein Land glühend, sein Traum war, Minister zu werden.
Im Unterschied zu seinem Bruder Charles schien John sich nicht allzuviel aus Frauen zu machen, und so war die Familie verständlicherweise höchst verblüfft gewesen, als er vor knapp drei Jahren seine Verlobung mit Sara Champney bekanntgab. Sara war fünfundzwanzig Jahre jünger als John, und seit ihrer Heirat war der früher so einsiedlerische John in Begleitung seiner jungen Frau ein oft gesehener Gast in der Londoner Gesellschaft.
Was immer die private Meinung der Familie Railton über Sara sein mochte, eins stritt ihr niemand ab: Sie schien John sehr zu lieben und war ein großer Erfolg bei allen wichtigen Regierungsmitgliedern, was für Johns Karriere nur von Nutzen sein konnte.
Aber nun, nach dem Tod des Generals, war Johns Laufbahn als Politiker in Frage gestellt. Abgesehen von einigen Legaten und der beträchtlichen Apanage von zweitausend Pfund im Jahr für Charles, ging der gesamte Familienbesitz an den erstgeborenen Sohn John – ein großes Vermögen, aber auch eine große Verpflichtung.
Neben dem Herrenhaus Redhill, den ausgedehnten Ländereien, den Pachthöfen und den hohen Renditen aus den Häusern im Städtchen Haversage gehörten zum Familienvermögen auch noch vier elegante Stadthäuser in London: eins in Cheyne Walk, das John mit Sara bewohnte, eins in South Audley Street, geräumig genug für Charles, Mildred und Mary Anne, eins in der King Street, in dem Andrew und seine Familie lebte. Das vierte Haus, in Eccleston Square, war bei weitem das schönste. Der Vater des Generals hatte es vor Jahren Giles direkt überschrieben, allerdings mit dem Vorbehalt, daß es nur innerhalb der Familie vererbt werden dürfe.
Jetzt hatte der General anscheinend gefunden, daß es an der Zeit sei, die vier Londoner Häuser direkt an die einzelnen Familienmitglieder zu vererben. King Street würde an James, Johns Sohn, gehen, sobald er einundzwanzig Jahre alt war; Andrew erhielt South Audley Street und Charles Cheyne Walk. John Railton war der Haupterbe, ihm fiel das Herrenhaus Redhill zu, alle Ländereien und Pachthöfe, das Einkommen aus den Häusern in Haversage und Umgebung sowie alle übrigen Vermögenswerte.
Das Dilemma, das aus dieser Erbschaft für John entstand, war allen Familienmitgliedern wohl bewußt: Redhill verlangte die ganze Kraft seines Besitzers, der mindestens sechs Monate im Jahr im Herrenhaus wohnen mußte. Aber John war Berufspolitiker und stand mitten in einem Wahlkampf. Konnte er mit gutem Gewissen seine Karriere als Politiker weiterverfolgen und gleichzeitig Redhill verwalten?
Am Tag nach des Generals Tod hatte Giles Railton die beiden Söhne des Generals, John und Charles, ins Arbeitszimmer des Verstorbenen gebeten, um das Testament zu besprechen.
Charles war bester Laune gewesen, denn die zweitausend Pfund jährlich verschafften ihm die Freiheit, die er sich seit langem ersehnt hatte. John Railton dagegen ging nach dem Gespräch bedrückt und sorgenvoll die breite, geschwungene Freitreppe zur Galerie oberhalb der großen Eingangshalle hinauf.
Die Erbschaft als solche hatte ihn nicht überrascht, dennoch war er verwirrt. Er war ein fleißiger und pflichtbewußter Mann und hatte nur zwei große Leidenschaften: seinen Beruf und Sara. Und nun überlegte er angestrengt, wie er am besten die Enttäuschung, die er seiner jungen Frau bereiten mußte, abmildern könnte.
Er und Sara schliefen in einem Zimmer, das fast direkt über dem Arbeitszimmer des Generals lag; die Fenster blickten auf den Rosengarten. Er gab ihr gemeinsames Geheimklopfzeichen und öffnete die Tür. Die schweren roten Vorhänge waren zugezogen, ein Feuer brannte im Kamin und sandte Schatten aus, die über dem Bett tanzten, auf dem Sara halb angekleidet lag. Die Flammen zuckten rot über ihr Gesicht, sie sah aus, als hätte sie geweint. Sara hatte den General sehr geliebt und schien betrübter über seinen Tod zu sein als seine zwei Söhne. Sie bat John, die Tür abzuschließen, und breitete die Arme aus, entweder um Trost zu geben oder zu empfangen.
Er ging zum Bett, aber schloß die Tür nicht ab, setzte sich neben sie und ergriff ihre Hand. Und dann brachte er ihr so schonend wie möglich bei, daß er vermutlich die Politik aufgeben würde und daß sie beide auf jeden Fall das Haus in Cheyne Walk an Charles abgeben und nach Redhill ziehen müßten.
Ihr langes blondes Haar lag lose ausgebreitet wie ein Fächer auf dem Kopfkissen, ihre großen Augen weiteten sich, während er sprach, und ihr Gesicht nahm einen erschreckten Ausdruck an.
Dann langsam wandelte sich ihre Miene, und sie sagte in einem Tonfall ungläubigen Zorns: «Du kannst doch nicht die Politik aufgeben! Besonders nicht mitten im Wahlkampf!»
John sagte, er würde wohl noch eine Zeitlang weitermachen, um den Wahlkreis für die Partei zu sichern …
«Und unser Haus!»
«Es war nie unser Haus, Sara. Es ist Familieneigentum, und ich habe neue Verantwortungen zu tragen. Ich glaube nicht, daß ich Redhill mit allen Ländereien, Pachthöfen und was sonst noch dazugehört, verwalten und noch eine politische Karriere machen kann.»
«Du meinst, wir müssen uns in diese Einsamkeit vergraben?»
Sie mochte Redhill, aber nur für Besuche. Sie hatte oft gesagt, sie würde es schwierig finden, in Redhill zu leben.
«Aber Johnny, wir werden so weit weg sein …»
«Von London. Ja.»
Sei standhaft, hatte Giles gesagt. Und so teilte John seiner Frau mit ruhiger Stimme die Tatsachen mit: «Mein Großvater hat seine Karriere als Regierungsmitglied aufgegeben, um den Besitz zu verwalten. Der General ließ sich vorzeitig pensionieren, als das Erbe ihm zufiel. Und jetzt bin ich an der Reihe, meine Pflicht zu erfüllen.»
«Warum nicht Charles?»
«Weil er mein jüngerer Bruder ist. Der General hat mir Redhill hinterlassen. Es ist wie eine Familienfirma, Sara.»
«Sag das nicht, es klingt, als sprächst du von einem Krämerladen.» Sie biß sich auf die Unterlippe. «Also gut, wir müssen hier wohnen. Aber sei kein Narr und gib nicht deine politische Karriere auf. Schließlich hat Asquith, und er ist immerhin der Premierminister, dir nach den Wahlen einen Posten im Kabinett versprochen. Und damit wird die Sache doch anders aussehen, nicht wahr?» sagte sie sanft.
Er nickte kurz, ging zum Fenster und zog die Vorhänge auf. Ja, dadurch würde die Sache tatsächlich anders aussehen, aber es bedeutete immer noch, daß Sara Herrin von Redhill sein würde. Sie würden einen Kompromiß schließen müssen.
Giles Railton blickte beim Abendessen in die Runde, hörte nur mit halbem Ohr dem leisen Geplauder von Johns junger Frau Sara zu, die zu seiner Linken saß.
Er hatte wenig Geduld mit Sara, die nur an sich selbst zu denken schien. So jedenfalls schätzte er sie ein. Seltsam, daß John so eine Frau geheiratet hatte. Wenn es Charles gewesen wäre – nun, das hätte ihn nicht gewundert, Charles mit seinen ewigen Weibergeschichten und Saufgelagen.
Sein Blick fiel auf den jungen James am anderen Ende des Tischs. Er hatte das gutgeschnittene Gesicht aller Railtons, aber sein Ausdruck war verschlossen. Armer, junger Bursche, dachte Giles. Seine Mutter war bei seiner Geburt gestorben, dann mußte er sich mit einer Stiefmutter abfinden, die nur einige Jahre älter als er selbst war. Und nun hatte er auch noch seinen heißgeliebten Großvater verloren. William hatte oft gesagt, daß der junge James häufiger als alle anderen mit seinen Problemen zu ihm käme.
Giles’ Sohn Andrew führte mit Charles über den Tisch hinweg eine diskrete Unterhaltung, während seine Frau, die zarte, porzellangleiche Charlotte leise mit John sprach. Charles, stellte Giles bei sich fest, war bereits leicht betrunken, seine Augen waren glasig und seine Lider schwer.
Andrews und Charlottes Kinder – Giles’ Enkel – saßen schweigend da; sie wußten, konnten es aber noch nicht ganz glauben, daß ihr Großonkel, der Familien-Patriarch, tot war. Der junge Caspar, ungefähr einen Monat älter als James, schien in eine eigene Welt verloren, während die Zwillinge Rupert und Roy in ein nervöses Gekicher verfallen waren. Giles wünschte einen Augenblick lang, daß er sich erinnern könnte, wie man sich mit fünfzehn Jahren fühlte. Sein anderer Sohn, Malcolm, dessen einzige Leidenschaft die Landwirtschaft war, und seine Tochter Marie mit ihrem Ehemann Marcel wurden jeden Moment erwartet.
Plötzlich, wie das so gelegentlich geschieht, trat eine Stille ein, die Gespräche brachen wie auf Verabredung ab. Alle Gesichter wandten sich Giles zu, als erwarte ein jeder, daß er etwas Bedeutsames sagen würde.
Aber Giles Railton fiel zum ersten Mal in seinem Leben nichts zu sagen ein. Im stillen stellte er jedoch in diesem Augenblick fest, daß er von allen Familienmitgliedern seine Tochter Marie und seinen Neffen James am meisten liebte, während sich seine ganze Verachtung auf Charles konzentrierte. Er fragte sich, was nun, nach dem Ableben des Generals, aus den Railtons werden würde und was er persönlich dazu beitragen könnte, ihre Zukunft zu beeinflussen. Er war zutiefst beunruhigt und bedrückt, doch dann faßte er einen Entschluß, und ein eiserner Wille ergriff von seiner Seele Besitz. Er hoffte auf eine ruhige, ungetrübte Zukunft, aber gleichzeitig glaubte er an die Wahrheit des Sprichworts: «In Zeiten des Friedens bereite den Krieg vor.» Der Dienst an seinem Land richtete sich nach diesem Wissen, und so beschloß er, in diesem Sinne auch für seine Familie zu sorgen und schon jetzt seine Vorkehrungen zu treffen.
Wie ein Großmeister bei einem Schachspiel plante Giles seine Züge, um Ehre und Besitz der Familie zu schützen und dafür zu sorgen, daß diejenigen, die er liebte, überlebten. Er würde die Schwachen dazu benutzen, um die Starken zu retten.
Mit dem Tod des Generals trat die Railton-Familie in ein neues Stadium ihrer langen Geschichte ein. Giles würde in der Verhaltensweise der Familie in der kommenden Dekade eine entscheidende Rolle spielen. Doch das Schicksal der Railton-Familie war nur ein Teil einer weiter gespannten und komplizierten Geschichte, die bereits ein Jahr zuvor, ohne das Wissen der Beteiligten, in einer Seemannskneipe in Kiel begonnen hatte.
2
Als Gustav Steinhauer das Lokal betrat und feststellte, daß es die ordinärste, mieseste, gefährlichste, betrunkenste, hurenreichste Kaschemme des Kieler Hafenbezirks war, dachte der preußische Beamte, daß er vermutlich einen Fehler begangen hatte, und als der riesige Maat einen Streit vom Zaun brach, wußte er es mit Bestimmtheit.
Er war von Berlin nach Kiel gereist, um den Maat Hans-Helmut Ulhurt zu begutachten, einen riesigen Kerl, aber gut proportioniert, mit Schultern und Armen wie aus Granit gehauen.
Jeder schien ihn zu kennen und zu bewundern. Steinhauer dachte im stillen, daß er vermutlich genau der richtige Mann für ihn sei. Er war zweifellos viel herumgekommen und wirkte schlau und gewandt.
Dann plötzlich öffnete sich die Tür, und drei englische, leicht angetrunkene und sehr naiv aussehende Matrosen erschienen.
Sie waren ebenfalls Maats, vermutlich von der Cornwall, dachte Steinhauer, denn dieses Schulschiff der Königlich Britischen Marine stattete dem Hafen gerade einen Höflichkeitsbesuch ab, obwohl es der Besatzung schwerfallen würde, auf Höflichkeit bei den deutschen Matrosen in Kiel zu stoßen. Jedermann wußte in diesem Mai des Jahres 1909, daß der deutsche Kaiser die Vormachtstellung zur See anstrebte, und so waren schon seit einigen Jahren die englischen und deutschen Werften emsig damit beschäftigt, in einem verbissenen Wettstreit Schiffe zu bauen. Die englische Marine war in deutschen Häfen nicht sehr willkommen, und die Besatzungen britischer Schiffe keine gerngesehenen Gäste, besonders nicht in einer Spelunke wie dem «Büffel».
Wie um diese feindliche Einstellung unter Beweis zu stellen, senkte sich tiefes Schweigen über den rauchgeschwängerten Raum, und eine unheildrohende Spannung lag in der Luft.
Die Engländer gingen geradewegs zum Tresen und bestellten sich in gebrochenem Deutsch Schnaps. Steinhauer bemerkte in Sekundenschnelle, daß jeder im Raum auf den großen blonden Ulhurt blickte, und er erinnerte sich, daß dem Mann der Ruf von Gewalttätigkeit vorausging. Sogar der Besitzer drehte sich nach ihm um, so als bitte er den Maat um die Erlaubnis, die Ausländer bedienen zu dürfen.
Steinhauer sollte sich in den kommenden Jahren noch oft an diesen Augenblick erinnern. Ulhurts Gesicht nahm einen fast sanften, erwartungsvollen Ausdruck an, aber dahinter lauerte etwas Tödliches.
«So, so, die englische Marine schickt sich jetzt an, die deutsche Sprache zu morden», Ulhurt sprach ein perfektes Englisch, ohne den typisch gutturalen Akzent der Deutschen. Steinhauer war erstaunt und erfreut. Ulhurt schob, noch während er sprach, den Stuhl zurück und stieß mit der Sohle seines großen Stiefels den Tisch um. Er wirkte entspannt, aber Steinhauer hatte Männer wie ihn oft in ähnlichen Situationen beobachtet und wußte daher, daß der Maat fest entschlossen war, die drei Engländer zusammenzuschlagen.
«Wißt ihr was?» fing Ulhurt an. «Die englische Marine ist Scheiße.» Und mit dieser Feststellung stürzte er sich auf den größten Engländer, versetzte ihm einen Stoß, und seine kräftigen Arme schlugen wie Axthiebe in die Magengrube seines Gegners.
Eine sekundenlange Stille folgte, dann brach in der Bar die Hölle los. Aber während dieser kurzen Pause schlug einer der anderen Engländer mit einem Stuhl nach Ulhurt. Steinhauer begriff schnell, daß diese drei Männer nur eine Art Vorhut bildeten, denn plötzlich war die Kneipe voll von englischen Matrosen, die mit Fäusten – und zu Steinhauers Entsetzen auch mit Messern – um sich schlugen.
Steinhauer versuchte, die Eingangstür zu erreichen, wurde aber zur Seite geworfen wie eine lästige Puppe. Den Rest verfolgte er nur noch wie durch einen Schleier.
Er nahm den ohrenbetäubenden Lärm wahr, die Schmerzensschreie, das Gekreische der Frauen, das Gestöhne dieser Männer, die sich ohne Rücksicht auf Verluste bekämpften, und beobachtete den Maat Ulhurt. Für einen so großen Mann war Ulhurt erstaunlich wendig und flink: ein Straßenkämpfer, ein erfahrener Bar-Krakeeler, der anscheinend fast lässig seine Feinde fertigmachte. Er kämpfte mit Händen, Kopf, Ellbogen, Knien und Stiefeln, gab sich nur selten eine Blöße und war immer auf der Hut vor einem Angriff von hinten.
Doch allmählich wurde Ulhurt zurückgetrieben, aber hinter ihm war keine Wand, sondern nur der Tresen, und das war sein Verderben.
Inzwischen warfen seine Gegner nicht mehr nur mit Flaschen, sondern zerbrachen sie, um die zersplitterten, gezackten Enden als Waffen zu benutzen. Ulhurt, mit dem Rücken zum Tresen, stieß mit einem scharfkantigen Flaschenhals nach jedem Engländer, der sich ihm näherte. Völlig unerwartet hoben zwei junge britische Matrosen hinter dem Tresen ein volles Hundertliterfaß Bier hoch und stießen es, als würden sie einen Sack Kartoffelschalen über Bord werfen, in Richtung Ulhurt, der nicht ausweichen konnte.
Er sah das Faß auf sich zukommen, aber zu spät! Er sprang zur Seite, aber das Faß streifte seinen rechten Oberschenkel, er fiel hin, wurde gegen die Wand gepreßt, und sein ausgestrecktes Bein war der vollen Wucht des Fasses ausgesetzt. Steinhauer beobachtete, wie der Mund des Mannes sich zu einem lautlosen Schmerzensschrei öffnete. Später behauptete er, daß er das grauenvolle Krachen der Knochen gehört hätte, als das Bein zermalmt wurde – an achtundzwanzig Stellen gebrochen, wie der Chirurg sagte.
Oh, Scheiße, dachte Steinhauer. Seine letzte Hoffnung! Ulhurt kannte sich in der Seefahrt aus, Hafenanlagen, Gewalttätigkeit, drahtlose Telegrafie waren ihm vertraut, und er sprach fünf Sprachen fließend. Er wäre ideal gewesen. Und nun waren ihm mit Ulhurts Bein alle Hoffnungen in die Brüche gegangen.
Dann kamen die Hafenpolizei und die britische Marinepatrouille. Männer wurden verhaftet und abgeführt, andere auf Wagen geladen und ins nahe liegende Marinekrankenhaus gebracht.
Draußen auf dem Bürgersteig zeigte Steinhauer einem deutschen Marine-Polizeioffizier seine Ausweispapiere, der ihn daraufhin mit großem Respekt behandelte.
Am Morgen ging er ins Krankenhaus und erfuhr, daß das Bein des Maats bis zum Oberschenkel amputiert worden war. «Sein Leben hängt an einem seidenen Faden», sagte der Chirurg. «Aber ich glaube, der seidene Faden hält. Der Mann hat eine Ochsennatur.»
Gustav Steinhauer fuhr nach Berlin zurück. Zwei Wochen später wurde der nunmehr einbeinige Maat Hans-Helmut Ulhurt zu seinem größten Erstaunen in eine Privatklinik im Berliner Vorort Neuweißensee verlegt. Sein privater Geheimkrieg würde bald beginnen, nur wußte er das noch nicht.
3
Am 17. Januar 1910 gegen elf Uhr früh machte sich Charles Railton auf den kurzen Weg vom Foreign Office zum Kriegsministerium. Für Charles war die Verabredung überraschend gekommen, doch die wenigen Menschen, die sich beim britischen Geheimdienst auskannten, hätten ihm sagen können, daß diese Verabredung ein einschneidendes Ereignis in seinem Leben sein würde.
Es gibt keinen Aktenvermerk über Charles Railtons Besuch in dem winzigen Zimmer, das Captain Vernon Kell als Büro diente. Captain Kell war der erste Chef des britischen Sicherheitsdiensts, der damals noch MO5 hieß und später in MI5 umbenannt wurde. Im Januar 1910 steckten der britische Sicherheitsdienst und die Spionageabwehr noch in den Kinderschuhen.
Charles war ein typischer Railton, sehr groß mit dichtem blondem Haar, einem ausgeprägten Kinn, hoher Stirn und einer langen, aristokratischen Nase und klaren blauen Augen, die, wenn notwendig, ebenso geschickt lügen konnten wie seine Zunge, was bei Damen gelegentlich sehr notwendig war. Doch bis zu diesem 17. Januar hatte Charles sich für einen Versager gehalten.
Charles war von Natur aus ein Abenteurer, und er war gegen seinen Wunsch und Willen in den diplomatischen Dienst gesteckt worden. John, sein älterer Bruder, war über die Armee in die Politik gelangt, und daher sollte Charles in die Diplomatie, wofür er nicht das geringste Talent besaß, was sich in den letzten Jahren nur zu deutlich erwiesen hatte. Seine augenblickliche Stellung war die eines Verbindungsmanns zwischen dem Foreign Office und der Admiralität, ein untergeordneter Posten, den er mit fünf anderen jungen Männern teilte und den er nur aufgrund der Beziehungen seines Vaters erhalten hatte – eine Tatsache, die ihm wohl bewußt war und ihm die letzten Illusionen über seine Befähigung geraubt hatte. Aber nun war der General tot, und an diesem Morgen des 17. Januar war er ins Foreign Office gegangen, sein Kündigungsschreiben in der Tasche.
Seine Frau, die stille, dunkelhaarige Pfarrerstochter Mildred, hatte ihn an diesem Morgen voller dunkler Vorahnungen das Haus in der South Audley Street verlassen sehen. Seit dem plötzlichen Tod des Generals und der unerwarteten Erbschaft war sie zutiefst beunruhigt, da sie fürchtete, daß er ohne die Disziplin, die sein täglicher Dienst im Foreign Office ihm auferlegte, wieder in seinen früheren Lebenswandel (den er sogar während der Ehe nie ganz aufgegeben hatte) zurückfallen würde. Sie wußte, er hatte andere Frauen gehabt, und hatte deswegen bittere Tränen vergossen; überdies hatte sein Trinken ihr große Sorgen bereitet. Doch dann war vor sechzehn Jahren ihr einziges Kind, das Mädchen Mary Anne, zur Welt gekommen, und Charles hatte sich gebessert. Aber nun machte sie sich von neuem Sorgen, denn abgesehen von allem anderen hatte sie am vorangegangenen Abend all ihren Mut zusammengenommen und ihrem Mann gebeichtet, daß sie – nach so langer Zeit – wieder schwanger war. Ein Zustand, der sie nicht sonderlich erfreute. Sie wußte, wie sehr ihr Mann unter der Langeweile seiner Arbeit litt, und hatte all seine wilden Pläne mit angehört, die er während der letzten zwei Wochen wie ein Lied mit unterschiedlichen Refrains wiederholt hatte. Und so hatte sie Angst um ihn, um ihre Tochter und um ihr noch ungeborenes Kind.
Aber weder sie noch Charles hatten mit dem Bruder des Generals, Onkel Giles, gerechnet. Giles hatte das Problem erkannt, eine Antwort gefunden und gehandelt. Und so hatte Charles die Nachricht bekommen, sich bei Captain Vernon Kell im Kriegsministerium zu melden. Die Anweisung hatte Charles so plötzlich erreicht, daß er nicht einmal die Zeit gehabt hatte, sein Kündigungsschreiben abzugeben.
Die Tür trug die Aufschrift: MO5 Capt. V. Kell. Charles hatte noch nie von MO5 gehört. Er klopfte an, und eine angenehme Stimme bat ihn einzutreten.
Vernon Kell saß hinter einem kleinen Schreibtisch in einem bescheidenen Zimmer, das restliche Mobiliar bestand aus einem Tischchen, zwei Stühlen und einem Aktenregal. An den Wänden hingen Landkarten, und auf dem Schreibtisch vor Kell stapelten sich Broschüren. Kell sah wie ein typischer Offizier aus: Schnurrbart und kantiges Gesicht, aber sein Ausdruck war freimütig und freundlich. Als er sich erhob, bemerkte Charles, daß Kell einen Augenblick lang die Schultern sinken ließ, sie allerdings sogleich wieder hob, aber mit sichtbarer Anstrengung. Auch schien ihm das Luftholen Mühe zu machen.
«Sie sind Railton, nicht wahr?» Er sprach stockend. «Entschuldigen Sie», er klopfte sich auf die Brust. «Geht gleich vorbei. Asthma. Verdammt lästig. Hatte es als Kind, ist wiedergekommen. Geben Sie mir eine Minute Zeit.»
Charles nickte, setzte sich auf einen der Stühle und wartete, bis Kell wieder normal atmete. Seine Gesundheit schien sehr angegriffen für einen Mann, der nach Charles’ Schätzung ungefähr so wie er selbst Ende Dreißig war.
«Tut mir aufrichtig leid», sagte Kell nach einer Weile, und sein Gesicht bekam wieder Farbe. «Ich hätte zu Hause bleiben sollen, hatte einen Anfall während des Wochenendes. Habe Qualen gelitten als Kind, dachte, ich hätte es überstanden, als ich auf die Kadettenschule ging, aber es ist wiedergekommen.» Er lächelte und sah Charles kurz und prüfend an. Doch Charles hatte den Eindruck, daß er ihm mit diesem einen kurzen Blick fast bis in die Seele gesehen, die geheimsten Winkel seines Verstandes erforscht und sich ein Urteil gebildet hatte.
«Was haben Sie denn so getrieben in letzter Zeit? Keiner hat Ihnen vermutlich gesagt, was Sie hier sollen? Hab ich recht?» Kell hatte eine natürliche, ungezwungene Art, sich zu geben, er war gar nicht «aufgeblasen», wie es der General genannt hatte. Der General verabscheute «Aufgeblasenheit».
«Ich war ein besserer Laufbote zwischen dem Foreign Office und der Admiralität, die Antwort auf Ihre zweite Frage ist ‹nein›.» Er hielt Kells Blick stand und sagte in einem neutralen Tonfall, daß er vorhabe zu kündigen.
Kell räusperte sich. «Diplomatie liegt Ihnen wohl nicht, hm? Hätten wahrscheinlich in die Fußstapfen Ihres Vaters treten sollen. Übrigens mein herzlichstes Beileid, Charles – wenn ich Sie Charles nennen darf.»
«Natürlich.»
«Gut, mein Name ist Vernon. Ich sollte eigentlich Stabsoffizier sein, wäre es auch, wenn ich nicht dieses verdammte Asthma hätte. Erst haben sie mich an einen Schreibtisch angenagelt und dann mir diesen Job aufgehalst, mir und Sprogitt – mein Assistent.» Er machte eine Kopfbewegung in Richtung auf eine Tür in der Ecke. «Sprogitt sitzt dort in einem Zimmer, das man nur als Besenkammer bezeichnen kann. Er und ich sind die zwei einzigen hier, deshalb halte ich Ausschau nach jemand, der mir helfen kann. Typisch, nicht? Erst machen sie mich zum Chef von MO5, und dann geben sie mir kein Personal.»
Nach einer kurzen Pause fragte Charles, was MO5 bedeute.
«Militäroperation fünf. Mir ist die ganze Sache so neu wie Ihnen. Was wissen Sie eigentlich über den Sicherheitsdienst? Oder wie diese Spinner da oben es nennen, den Geheimdienst?»
Charles gestand, daß er fast nichts darüber wisse.
«Nun, dann setze ich Sie wohl besser ins Bild.»
Während der nächsten Stunde erklärte Kell die Gründe, warum man ihn gebeten hatte, diese Dienststelle aufzuziehen. Er beschrieb in klaren, präzisen Worten die augenblickliche Situation der Geheimdienste, soweit sie Großbritannien betraf. «Gegen Ende des letzten Jahrhunderts existierte ein zweiköpfiges, nutzloses Monstrum: der militärische Informationsdienst und die Marine-Informationsdivision. Jeder hatte seinen Direktor, DMI für Militär und DID für die Admiralität. Zusätzlich gibt es noch eine Dienststelle, die im Britischen Reich und in Europa Agenten beschäftigt; einige sind Gauner, andere patriotische Männer und Frauen. Das Foreign Office ist äußerst unzufrieden mit der Arbeit des militärischen Informationsdienstes, und der Generalstab mißtraut dem Foreign Office. Die Marine-Informationsdivision ist halbwegs zuverlässig. Aber nun will das CID, Chefbüro für Imperiale Defensive, alles reorganisieren. Es hat weitreichende Kompetenzen. Aber auch das Foreign Office ist fest entschlossen, einen wirksamen Geheimdienst aufzubauen. Zwar untersteht dieser noch immer dem Kriegsministerium, auch wenn der Chef ein Marineoffizier ist. Übrigens ein fähiger Mann namens Smith-Cumming.»
«Und Ihre Abteilung MO5, was ist deren Aufgabe?»
«Kurz gesagt soll MO5 das Land gegen Spionage abschirmen. Und mit Spionage meine ich nicht nur ausländische Agenten, sondern auch unsere eigenen Aufrührer.»
«Sie meinen die Ultra-Radikalen? Die irischen Geheimbündler wie die Fenier und Leute dieser Art?»
Kell nickte. «Ja, Revolutionäre, die Fenier, Anarchisten, Aufwiegler und so weiter.»
«Und was wäre meine Aufgabe?» fragte Charles.
«Ich hoffe, daß Sie für mich arbeiten und mir helfen, den Spionen das Handwerk zu legen.»
«Aber ich bin ganz unerfahren …»
«Ich auch», sagte Kell, «aber die Arbeit ist interessant, eine reizvolle Aufgabe, besonders da niemand etwas Ähnliches je zuvor getan hat. Ich möchte eine gut funktionierende Organisation aufbauen, aber ich unterstehe dem CID, dem Chefbüro für Imperiale Defensive. Wenn ich mir meine Leute selbst auswählen und meine eigenen Methoden anwenden dürfte, dann könnten wir ein wirklicher Machtfaktor werden. Also, Charles, wollen Sie mit mir zusammenarbeiten?»
Charles nickte nach einem kaum wahrnehmbaren Zögern, und Kell sagte herzlich, es freue ihn. In Wahrheit gefiel ihm Charles nicht sonderlich. Irgend etwas in seinem Gesicht, in seinen Augen, in seinem ganzen Gehabe sagte ihm, daß Charles Railton nicht das moralische Niveau hatte, das man von einem Mann seiner Herkunft erwartete. Aber Kell glaubte, daß man Menschen ummodeln konnte, und wenn jemand aus Railton einen tüchtigen Beamten für diese neue Dienststelle machen konnte, dann war er es, Vernon Kell. Er berichtete nun Charles in kurzen Worten, daß er bereits eine Menge über seine neue Tätigkeit von Inspektor Patrick Quinn – Paddy Quinn – gelernt habe, dem Chef der Londoner Geheimpolizei.
«Quinn war sechs Jahre lang der Chef der sogenannten Irischen Abteilung, die für die Bekämpfung der irischen Aufrührer zuständig ist. Aber Quinn ist nicht nur ein äußerst tüchtiger Polizist, sondern auch ein Fachmann für viele Dinge, die für uns ausgesprochen nützlich sind, wie Verhör-Technik, Erfahrung mit den Arbeitsmethoden von Rebellen, Überwachung, Operationen im Untergrund. Im übrigen ist Quinn auch Königlicher Leibwächter. Wir haben also einen guten Berater an ihm», schloß Kell seinen Bericht.
«Und wann fange ich an?» fragte Charles.
«Am besten sofort. Und machen Sie sich keine Sorgen wegen Ihrer Überstellung, das wird erledigt.»
Und noch bevor Charles recht wußte, wie ihm geschah, saß er vor einem Stapel Papiere und Dokumente. Und einige Stunden später hatte er bereits eine sehr viel genauere Vorstellung dessen, was von ihm erwartet wurde.
Kell war der Ansicht, daß die Zeit auf keinen Menschen wartet, und Charles würde die gleiche Ausbildung wie sein neuer Chef hinter sich bringen müssen: einen Kurs in drahtloser Telegrafie, einen weiteren im Codieren und Chiffrieren in der Admiralität. Danach würde ihm Quinn einige «ungewöhnliche Fertigkeiten» beibringen. «Ach ja, Sie haben ja Sprogitt noch nicht kennengelernt.» Er rief den Namen des Mannes laut in Richtung der Tür, die sich öffnete und den Blick auf ein winziges Büro freigab, wo Sprogitt die meiste Zeit verbrachte.
An Charles’ erstem Tag im MO5 arbeiteten er und Vernon Kell ohne Mittagspause bis lange nach fünf Uhr, aber als sie schließlich das Kriegsministerium verließen, hatten sie bereits für MO5, diese neue Dienststelle, die später unter dem Namen «Die Firma» bekannt werden sollte, einen kompletten Organisationsplan aufgestellt.
Der Abend war kalt, und ein frostiger Dunst umhüllte die Gaslaternen von Whitehall. Aber Charles nahm kein Taxi und ging auch nicht wie sonst in seinen Club. Statt dessen ging er zu Fuß nach Hause und genoß die Frische der kühlen Luft.
Nach dem Essen erzählte er Mildred, daß in seinem Berufsleben ein Wechsel eingetreten sei, er hätte einen neuen Arbeitsbereich zugewiesen bekommen, doch auf nähere Erklärungen ließ er sich nicht ein.
Bevor er einschlief, dachte er über einen Aspekt dieses ereignisreichen Tages nach, der seine Neugier erweckt hatte. Er hatte Vernon Kell ganz beiläufig gefragt, wer ihn für die Arbeit bei MO 5 empfohlen hätte.
«Natürlich Ihr Onkel, Giles Railton.» Kell hatte erstaunt geklungen, als hätte Charles ihn etwas gefragt, das nur zu offensichtlich war.
Aber warum? fragte sich Charles, warum war das so offensichtlich? Warum war die Wahl auf ihn gefallen? Gewiß, Onkel Giles war ein hoher Beamter im Foreign Office. Aber wieso wußte so ein alter Langweiler wie Giles etwas über den britischen Geheimdienst?
Fast zur gleichen Zeit, als Charles sein Haus in South Audley Street erreichte, schrillte in einem sehr viel ärmeren Stadtviertel, in der Caledonian Road, eine Klingel. Ein Mann stieß die Tür zur Nummer 402 A, einem Herrenfriseurladen, auf, was automatisch den Klingelton auslöste.
Drinnen waren die Gasflammen hochgestellt, die zwei Friseursessel standen leer, und der süßliche Geruch von billigem Rum vermischte sich mit den unverkennbaren Gerüchen Londons, die durch die Tür hereinwehten – eine Mischung aus Unrat, Pferdeäpfeln und Ruß.
Einen Augenblick lang blieb der Mann bewegungslos stehen und wartete, bis die lärmende Warnung der Glocke verstummte. Er war modischer gekleidet als die übrigen Bewohner dieses schäbigen Bezirks. Er trug einen langen, dunklen Mantel mit einem Pelzkragen; der Schnitt verriet seine ausländische Herkunft.
Als die Glocke verstummte, erschien ein junger Mann mit einer nicht sehr sauberen Schürze im Türrahmen im Hintergrund des Ladens.
«Guten Abend …» sagte er mit einer gutturalen Aussprache, hielt aber plötzlich inne, als er das Gesicht des Fremden sah, wandte sich um und rief aufgeregt die Treppe hinauf: «Karl!» Und dann noch lauter auf deutsch: «Karl, komm! Der Herr ist wieder da!»
Der Besucher machte einen Schritt in den Laden, blieb stehen und ging dann selbstsicher weiter, sein hochgezwirbelter Schnurrbart zitterte wie die Schnurrhaare eines Raubtiers, das eine interessante Fährte wittert. Der junge Friseur wartete an der hinteren Tür des Ladens und blickte nervös nach oben, als er schwere Fußtritte auf den Stufen vernahm.
Der ältere Mann, der die Treppe herunterkam, war offensichtlich der Besitzer des Friseurladens. Seine Bewegungen verrieten eine selbstverständliche Autorität, seine ganze Erscheinung war gepflegter und adretter als die seines jungen Gesellen, sein Haar kurz geschnitten, sein Gesicht etwas feist. «Ach, Sie sind’s!» knurrte er, aber er klang dennoch erleichtert. «Wilhelm, schließ die Tür ab.» Wilhelm ließ das Rouleau hinunter und drehte den Schlüssel im Schloß herum. Erst als dies geschehen war, fing der Besitzer wieder zu sprechen an. «Erfreut, Sie zu sehen … Herr … Weiß?»
«Namen sind Nebensache. Kann ich Sie privat sprechen?»
Der Besitzer führte seinen Besucher zur Treppe, nickte Wilhelm kurz zu und bedeutete ihm, unten im Laden zu bleiben.
Im oberen Stockwerk fragte der Besucher: «Sind Sie zu einem Entschluß gekommen?» Er staubte mit einem Handschuh einen Stuhl ab und setzte sich, ohne auch nur für eine Sekunde den Friseur aus den Augen zu lassen.
«Ja», hob der Friseur bedächtig an, als wähle er seine Worte sorgsam aus. «Ja, ich bin bereit, meinem Vaterland zu dienen. Aber ich brauche Hilfe. Allein schaffe ich es nicht. Der junge Wilhelm ist zuverlässig. Er wird den Mund halten. Ich werde es tun, aber der Junge muß auch ein wenig Geld bekommen.»
«Geld bereitet keine Schwierigkeiten. Aber Sie tragen die Verantwortung.» Er zog ein großes, zusammengefaltetes Stück Papier aus der Tasche. «Bevor ich gehe, müssen Sie sich diese Namen und Adressen, die ich hier habe, einprägen. Es ist mir egal, wie lange Sie dazu brauchen. Aber ich gehe erst, wenn ich sicher bin, daß Sie sie in- und auswendig können. Verstanden?»
Der Friseur nahm das Papier mit spitzen Fingern, als sei es Dynamit – was es in gewisser Weise auch war.
Der Mann, den der Friseur mit Herrn Weiß angesprochen hatte, bestieg um Mitternacht die Fähre nach Ostende.
Er stand an der Reling und starrte auf die Lichter Englands, die langsam in der kalten Nacht verblaßten. Doch seine Gedanken kreisten nicht um den Friseur, auch nicht um seine Arbeit in London. Gustav Steinhauer hatte wichtigere Dinge im Kopf, Dinge, die ihm einen enormen Einfluß, eine einmalige Machtposition in Preußen verschaffen würden.
Er war voller Ungeduld, nach Berlin zurückzukehren. Diese kleinen Beutezüge im Ausland waren wichtig, aber es waren die Sonderaufträge des Kaisers, die den Stolz seines Lebens ausmachten. Und der wichtigste Faktor in diesem Spiel war Hans-Helmut Ulhurt. Es hatte einige Monate gedauert, bis Ulhurt sich erholt hatte, und er war noch immer in einer Privatklinik und mußte lernen, mit einem Holzbein zu gehen. Aber er machte Fortschritte.
Das einzige, was Ulhurt zu beunruhigen schien, war die Tatsache, daß die Kaiserlich Deutsche Marine keine Anklage wegen der Schlägerei im «Büffel» gegen ihn erhoben hatte. Steinhauer hatte ihm gesagt, er solle sich keine Sorgen machen, was das deutsche Marineministerium beträfe, sei er von der Erdoberfläche verschwunden.
«Dafür aber gibt es eine Menge neuer Arbeit für Sie, die ganz gewiß auch jene Art von Schlägereien einschließt, die Ihnen anscheinend so viel Spaß machen. Setzen Sie Ihre ganze Energie ein, um wieder gesund zu werden, lernen Sie, sich genauso flink auf einem Bein zu bewegen wie zuvor auf zwei Beinen», hatte Steinhauer ihm geraten. «Mit der Zeit wird Ihnen das schon gelingen. Ihre Freunde müssen hohe Strafen wegen dieser Nacht in Kiel verbüßen. Tun Sie also, was ich Ihnen sage, und halten Sie den Mund. Befolgen Sie meine Befehle, dann wird Ihnen nichts passieren.»Während seiner Rückreise nach Berlin überkam Steinhauer plötzlich ein ungutes Gefühl. Es war jetzt schon zwei Jahre her, daß der Kaiser ihn zu einer Privataudienz befohlen hatte – eine Ehre, für die er jahrelang gekämpft, geplant und intrigiert hatte.
Gustav Steinhauer stammte aus einer einfachen bürgerlichen Familie, aber durch einen erfolgreichen Onkel und eine in den Kleinadel eingeheiratete Kusine hatte er einen indirekten Zugang zum Hof.
Gustav war außergewöhlich begabt und überdies noch sehr fleißig. Mit fünfundzwanzig Jahren sprach er vier Fremdsprachen fließend, hatte einflußreiche Freunde erworben und sich im Auswärtigen Amt in der Wilhelmstraße eine Position erobert.
Es war während seines ersten Jahrs in der Wilhelmstraße, daß Gustav Steinhauer seine Vorliebe für Intrigen und Täuschungsmanöver entdeckte. Schon nach zwei Jahren war es ihm gelungen, häufig zwischen der Wilhelmstraße und dem Hof hin- und herzupendeln, um dem Kaiser und seinen Beratern Klatsch und Gerüchte zu hinterbringen, die sich als nützlich erweisen könnten.
Steinhauer hatte sich wohl gemerkt und vergaß es nie, daß der vor langer Zeit entlassene Bismarck sich, was geheime Nachrichten betraf, auf einen einzigen Mann und auf ein kompliziertes Spionagenetz verlassen hatte – der Mann hieß Eduard Stieber, er war verhaßt, aber mächtig gewesen. Steinhauers höchstes Ziel war, der Stieber des Kaisers zu werden. Kurz vor Weihnachten 1908 schien dieses Ziel unerwartet in greifbare Nähe zu rücken. Was damals besprochen worden war, hatte ihn schließlich zu dem Maat Ulhurt in Kiel geführt. Niemand in England, der mit der MI 1c – dem Geheimdienst – und mit der winzigen MO5 in Verbindung stand, konnte die Rolle voraussehen, die Steinhauer und sein einbeiniger Schützling eines Tages spielen würden. Und ganz gewiß konnte keiner aus der Railton-Familie, selbst wenn sie von der Existenz des Mannes gewußt hätten, auch nur ahnen, welche Verheerung Steinhauer in ihrem engsten Umkreis anrichten würde.
Die Audienz beim Kaiser kam so unerwartet, daß Steinhauer keine Zeit blieb, nachzudenken oder nervös zu werden. Er hatte seinen Onkel besucht und ihn in höchster Aufregung vorgefunden.
«Seine Majestät wünscht, dich zu sehen.» Onkel Brandt war erregt im Zimmer auf und ab gegangen. Er trug Uniform, da er an diesem Tag Dienst tat.
«Mich?» Steinhauer schluckte. «Wann?»
«Sofort. Der Hof begibt sich in zwei Tagen nach Österreich. Seine Majestät hat mich gestern zu sich beordert. Er fragte nach dir … Er erwartet dich jetzt.»
Wenige Minuten später wurde er durch die marmornen Korridore geleitet, und ehe er sich’s versah, stand er vor dem Kaiser, der ernst und etwas angsteinflößend aussah mit seinem hochgezwirbelten Schnurrbart und dieser seltsamen Aura von Macht und Würde, die ihn umgab.
Eine volle Minute lang musterte der Kaiser ihn von Kopf bis Fuß, als wolle er ihn abschätzen. Dann sprach er: «Sie sind Gustav Steinhauer vom Auswärtigen Amt?»
«Ja, Majestät.»
«Sie haben uns einige nützliche Informationen geliefert. Ich vertraue Ihnen.»
«Ich danke Euer Majestät.»
«Ich habe Arbeit für Sie, Steinhauer. Eine gefährliche, aber lohnende Aufgabe. Wollen Sie sie übernehmen?»
«Ich tue alles, was Majestät wünschen. Majestät brauchen nur zu befehlen. Für Euer Majestät und das Vaterland bin ich zu allem bereit.»
Der Kaiser nickte kurz. «Ausgezeichnet. Wie Sie wissen, ist meine große Leidenschaft die See. Es ist unbedingt notwendig, daß die Welt erkennt, daß das Vaterland und nicht England die Weltmeere beherrscht.» Er holte tief Luft, bevor er weitersprach. «Wenn Sie Ihren Dienst bei mir antreten, dürfen Sie das nie aus den Augen lassen.»
Dann fing der Kaiser an, in Einzelheiten zu gehen.
Gustav Steinhauer war entzückt, fast berauscht von der Macht, die in seine Hände gegeben worden war.
Als der Zug endlich in den Lehrter Bahnhof einlief, rief sich Gustav Steinhauer des Kaisers besondere Befehle, die er an jenem Tag vor Weihnachten 1908 erhalten hatte, erneut ins Gedächtnis.
Dem Kaiser war zu Ohren gekommen, daß das Armee-Oberkommando den gesamten Geheimdienst an sich reißen wollte, inbegriffen alle Agenten, die das Auswärtige Amt über ganz Europa verteilt hatte. Dieser Plan sollte innerhalb der nächsten zwei, höchstens drei Jahre in die Tat umgesetzt werden.
Der Kaiser hatte Steinhauer seine große Sorge anvertraut, daß sich diese Umstellung negativ auf die Geheimdienste auswirken würde, besonders was die Marine betraf.
«Mir ist völlig klar, Steinhauer», hatte Seine Majestät gesagt, «daß Ihre Position es Ihnen ermöglicht, mit den bereits in fremden Ländern stationierten Spionen Kontakt aufzunehmen. Aber diese Frauen und Männer werden unter der Kontrolle der Militärs stehen, wenn das Oberkommando sich durchsetzt. Was ich brauche, ist ein Mann, der einzig und allein für mich arbeitet. Und ich glaube, in Ihnen habe ich diesen Mann gefunden. Habe ich recht?»
«Selbstverständlich, Euer Majestät.»
«Nun gut. Dann werden Sie gewisse Dinge ausschließlich mir und mir allein berichten. Sie werden Ihren eigenen Agenten – einen Mann, der die See kennt, der mit Sabotage und anderen Spionagetricks vertraut ist – nach England einschleusen. Über diesen Mann haben Sie die volle Kontrolle. Und wer immer Ihre neuen Vorgesetzten sind, die Existenz dieses Mannes werden Sie ihnen nicht verraten.»
«Jawohl, Euer Majestät.»
«Gut!» Der Kaiser nickte kurz. «Ausgezeichnet. Nun, was diesen Mann betrifft: Er wird ein Schattendasein führen. Sie werden ihn ausfindig machen, ihn ausbilden und ins Ausland schicken. Die Berichte seiner Tätigkeit gehen an mich persönlich. Haben Sie mich verstanden?»
Steinhauer hatte seinen Monarchen genau verstanden. Er hatte elf mögliche Kandidaten unter die Lupe genommen, aber jeder hatte einen Makel. Und dann war er auf den Maat Hans-Helmut Ulhurt aufmerksam geworden – die ideale Lösung. Ein Mann, der alle Bedingungen erfüllte, aber auch ein Mann, den man nicht nur ausbilden, sondern auch zähmen mußte. Ein Mann, der Disziplin brauchte.
Nach seiner ersten Unterredung mit dem Kaiser, in deren Verlauf ihm seine Pflichten deutlich klargemacht worden waren, traf Gustav Steinhauer seine persönlichen Vorkehrungen für den Fall, daß irgend etwas schiefgehen sollte.
Es gelang ihm, noch zwei weitere Privataudienzen beim Kaiser zu bekommen und den eitlen Herrscher zu zwei Dingen zu überreden: Erstens zu einem Brief, aus dem klar hervorging, daß er, Steinhauer, im persönlichen Auftrag des Kaisers handelte, und zweitens bat er um Geld. Steinhauer erklärte dem Kaiser, daß die Rekrutierung und Ausbildung eines hochspezialisierten Geheimagenten äußerst teuer sei. Der Kaiser stimmte zu. Er sah auch sofort ein, daß Steinhauer unmöglich den Fonds des Auswärtigen Amtes und noch weniger den des nach Vormacht strebenden Militärs in Anspruch nehmen konnte.
Auf diese Weise hatte sich Steinhauer eine unabhängige Machtposition erobert, was ihn in die Lage versetzte, einem gewissen Hans-Helmut Ulhurt in der Klinik in Neuweißensee die notwendige, sorgfältige Pflege zukommen zu lassen. Er kaufte einfach die Klinik und stellte Personal seiner Wahl an.
Wenn er in Berlin war, versuchte Steinhauer, jeden zweiten Tag der Klinik einen Besuch abzustatten. Sein Ziel war, den Maat vollständig von sich abhängig zu machen.
Bald stellte er zwei Dinge fest: Ulhurt konnte freundlich und zugänglich sein und mit viel Sachkenntnis über eine Menge Dinge reden; aber er war auch voll aufgestauten Ärgers, und dann konnte er gefährlich wie eine Schlange sein. Man würde ihn trainieren müssen wie einen intelligenten Hund, der seine Beute aufstöbert und tötet und Nachrichten apportiert.
Nach seiner Rückkehr aus London erklärte Steinhauer dem Maat Ulhurt, er müsse eine Spezialausbildung absolvieren. Ulhurt wußte bereits gut Bescheid über drahtlose Telegrafie, aber nicht gut genug. Im übrigen müßte er lernen, mit Sprengstoff umzugehen, und einen Kurs in Chiffrieren nehmen.
«Sobald Sie wieder völlig gesund und beweglich sind, werde ich Sie auf eine Seereise mitnehmen.»
«Um mir wieder einen echten Seemannsgang anzugewöhnen?» Der Maat verzog sein Gesicht zu einem Grinsen.
«So ungefähr. Es gibt Leute und Länder gleich hinter dem Horizont, mit denen Sie sich vertraut machen müssen. Nennen wir es: Erfahrungen sammeln.»
«Nennen Sie es, wie Sie wollen.» Ulhurt erhob sich vom Bett, ging ohne Stock zur Tür und wieder zurück.
«Bald werden Sie neue Ausbilder hier haben.» Steinhauer stand noch im Begriff, die Kurse für Ulhurt zusammenzustellen. «Verschiedene Leute werden Ihnen alle notwendigen Fertigkeiten beibringen, und überdies werde ich Ihnen einen Spezialisten für orthopädisches Turnen schicken.»
«In der Schule habe ich meinem Turnlehrer mal die Zähne ausgeschlagen.» Ulhurt blickte auf seine Hand. «Er versuchte, gewisse Leibesübungen an mir auszuprobieren. Wissen Sie, was ich meine?»
«Ich kann’s mir vorstellen.»
«Da, schaun Sie!» Er hielt ihm eine Hand hin von der Größe eines kleineren Bananenbündels. «Sie können noch immer die Narben von seinen ausgeschlagenen Zähnen sehen.»
«Sie haben eine interessante und aufregende Zukunft vor sich.» Steinhauer versuchte zu lächeln, denn der riesige Maat wirkte plötzlich niedergeschlagen.
«Sogar mit nur einem Bein?»
«Besonders mit nur einem Bein.»
«Scheißbande, diese Engländer, Schweinekerle!» Ulhurt schlug auf sein Holzbein.
«Geben Sie den englischen Matrosen die Schuld?» Steinhauers Gesicht war ausdruckslos.
«Wem anders? Mein ganzes Leben ist verpfuscht.»
«Ich habe Ihnen doch schon gesagt, daß Ihr Leben nicht verpfuscht ist. Der Grund, warum Sie hier sind, ist, Sie auf Ihre zukünftige Arbeit fürs Vaterland –»
«Das Vaterland kann mich mal …»
«Ulhurt, muß ich Sie daran erinnern, daß Sie verdammtes Glück hatten? Die anderen sind –»
«Ich weiß. Diese verfluchten englischen Matrosen – umbringen könnte ich sie alle miteinander, diese Kacker.»
«Diese Möglichkeit wird Ihnen bald geboten werden. Hören Sie mir einen Moment zu. Je eher Sie sich an Ihr Holzbein gewöhnen, desto schneller können Sie es den englischen Matrosen heimzahlen. Sie haben bereits phantastische Fortschritte gemacht. Ich weiß, es ist im Moment schwer für Sie, aber ich werde Ihnen ein kleines Geheimnis anvertrauen. Bloß vergessen Sie nicht, daß es ein Geheimnis ist, etwas, das nur Sie und ich wissen.»
Der große Kopf nickte mürrisch.
«Die Aufgabe, auf die ich Sie vorbereite, betrifft englische Matrosen. Sie wird Sie in engen Kontakt mit ihnen bringen und es Ihnen ermöglichen, Rache zu nehmen. Arbeiten Sie also, und lernen Sie, was wir Ihnen beibringen können, dann haben Sie ein gutes Leben vor sich.» Steinhauer lächelte und klopfte dem Mann auf die breite Schulter. Er fühlte die Muskeln unter seiner Hand und dachte nicht zum ersten Mal, daß dieser Mann genug Körperkräfte besaß, um mit vollendeter Leichtigkeit Menschen umzubringen.
Alles schien bei ihm möglich. Er hatte die körperlichen Kräfte, die Erfahrung als Seemann, kannte alle Länder der Welt, sprach Französisch, Italienisch, Schwedisch und Englisch wie ein Einheimischer. Wie kam es, fragte sich Steinhauer, daß ein so intelligenter Mann zwei Seelen in seiner Brust vereinte? Einerseits war er ein tüchtiger Matrose, andrerseits ein betrunkener Hurenbock und Raufbold.
In einem momentanen Anfall von Zuneigung zu diesem verwundeten Riesen fragte er, ob er etwas für ihn tun könne.
«’ne Frau!» Ulhurt schien erstaunt, daß Steinhauer nicht von selbst auf die Idee gekommen war. «Am liebsten ’ne Schwarze. Schwarz ist zur Zeit meine Lieblingsfarbe, weil ich um mein Bein traure.»
Noch am gleichen Abend brachte einer von Steinhauers Vertrauensleuten eine große, gutaussehende Mulattin in die Klinik. Sie kam vom Alexanderplatz in einer Kutsche mit verhängten Fenstern und kehrte in den frühen Morgenstunden dorthin zurück mit genug Geld, um sich zwei Ruhetage zu gönnen. Der Krankenwärter berichtete Steinhauer, daß der Patient Fortschritte mache und sich nach der nächtlichen Verlustierung doppelt Mühe gegeben habe.
Sechsunddreißig Stunden später kehrte Steinhauer in die Klinik zurück und suchte Ulhurt in seinem Zimmer auf. Der riesige Maat lag auf seinem Bett, und Steinhauer, voll von hinterlistigen Plänen, zog sich einen Stuhl heran.
«Ihre Arbeit beginnt», sagte er leise, als könne ihn jemand belauschen.
«Englische Matrosen?» Ulhurt grinste bösartig.
«Leider nein. Noch nicht. Etwas ist passiert, und Sie sind der einzige Mann, der damit umgehen kann.»
Ulhurt starrte ihn mit ausdruckslosen Augen an.
«Wir beide», fuhr Steinhauer fort, «leben in einer zwielichtigen Welt, mein Freund. Geheimnisse werden zuweilen nicht gewahrt. Wir haben einen Agenten hier in Berlin – der Name tut nichts zur Sache.» Er warf einen nervösen Blick zur Tür. «Dieser Agent ist ein Verräter, er hat für uns gearbeitet, während er vorgab, für ein anderes Land tätig zu sein. Wir selbst haben das so arrangiert, so daß wir der fremden Macht falsche Informationen zukommen lassen konnten …»
«Wer ist die fremde Macht?»
«England.»
Der Maat grinste, und Steinhauer fuhrt fort: «Es hat sich aber herausgestellt, daß dieser Agent nützliche und korrekte Informationen an die Engländer weitergegeben hat.»
«Ja, und?»
Steinhauer sah wieder vorsichtig um sich. Er wirkte ausgesprochen aufgeregt. «Es war mein Fehler. Falls der Agent verhört wird, bin ich geliefert. Mehr brauche ich wohl nicht zu sagen.»
«Sie sitzen in der Scheiße, wenn ich nicht …» Der Maat lächelte vergnügt.
«Ja, so kann man es auch formulieren.» Steinhauer nickte. «Die Person muß zum Schweigen gebracht werden. Meine Chefs haben bereits Verdacht geschöpft. Der Agent lebt in einer kleinen, billigen Wohnung über dem Pschorrbräu – der Bierkneipe an der Ecke Friedrich- und Behrenstraße, Nummer 16, Wohnung 4 im zweiten Stock. Man kann sie durch die Kneipe erreichen, aber es gibt auch einen Privateingang in der Behrenstraße. Kennen Sie die Gegend?»
«Das kann man wohl sagen.» Ulhurts Augen glitzerten. «Sie wollen, daß ich …»
«Sie werden eine gute Belohnung erhalten, wenn Sie schnell, tüchtig – und lautlos handeln. Gehen Sie um sieben Uhr in die Wohnung, der Agent erwartet einen meiner Leute. Und dann …»
«Den Rest überlassen Sie mir.»
Steinhauer faltete nervös die Hände. «Es gibt eine Schwierigkeit.» Er zögerte. «Der Ort wird überwacht. Man darf Sie beim Rein- und Rausgehen nicht erkennen. Aber wir haben Sie ja genug gedrillt …»
«Keine Sorge. Sieben Uhr.»
«Ich werde hier auf Ihre Rückkehr warten.»
Um halb sieben Uhr abends humpelte Ulhurt in die gerammelt volle Kneipe in der Friedrichstraße. Alle Tische waren besetzt, und hübsche Kellnerinnen mit vier, manchmal fünf Bierkrügen in der Hand stapften wie nach einem komplizierten Plan durch die engen Gänge.
Ulhurt fand einen freien Stuhl und bestellte sich ein Pils. Er beobachtete eine halbe Stunde lang seine Umgebung, ganz besonders den Türbogen, der zur Treppe und somit zu den Wohnungen führte.
Um fünf vor sieben zahlte er für sein Bier, stand auf und ging zur Treppe. In den wenigen verbleibenden Minuten fand er den anderen Ausgang – einen schlecht beleuchteten Korridor, von dem aus Treppen zu der Tür in der Behrenstraße führten.
Es gab nur vier Wohnungen über der Kneipe, zwei auf jedem Stockwerk. Die großen Türen waren schmierig, die Farbe abgeblättert. Vor der Tür Nummer 4 zog er ein Paar dicke Handschuhe aus seiner Tasche und eine herausgerissene Klaviersaite, deren zwei Enden er um seine Handgelenke schlang. Er klopfte dreimal leise an die Tür, dann ließ er seine Hände sinken und faltete sie.
Eine Sekunde lang war er verblüfft, als die Tür sich öffnete. Vor ihm stand die Mulattin, die ihn in der Klinik besucht hatte. Sie trug nur einen seidenen Kimono, durch den ihr dunkler, lockender Körper sich klar abzeichnete.
«Ach, du bist’s, komm rein.» Sie schien erfreut, ihn zu sehen. Ulhurt war schließlich sogar für eine Hure ein sehr zufriedenstellender Partner. Sie öffnete die Tür ohne Zögern. Ulhurt schloß sie mit einem Fußtritt, drehte sich um, streifte den Draht über ihren Kopf und erwürgte sie. Das Ganze ging in Sekunden vor sich. Die Mulattin gab keinen Laut von sich.
Er legte sie auf den Teppich mit dem tief in ihren schönen Hals eingegrabenen Draht. Dann verließ er die Wohnung.
Auf der Behrenstraße waren nur wenige Menschen. Ulhurt blieb nicht stehen, um nach einem Polizei-Überwacher Ausschau zu halten. Er humpelte, so schnell er konnte, zur nächsten Stadtbahnstation.
Er war nicht mehr als fünf Schritte gegangen, als er merkte, daß er verfolgt wurde. Soweit er es beurteilen konnte, von vier Männern. Ulhurt bog in den nächsten Durchgang ein. Er war schmal und dunkel, nur ganz am Ende leuchtete eine Laterne, die hoch oben an einer Mauer angebracht war. Trainiert wie er war, würde er mit allen vieren fertig werden, wenn sie dumm genug waren, ihm zu folgen.
Sie waren so dumm. Zwei stürzten auf ihn zu und befahlen ihm stehenzubleiben.
Ulhurt drehte sich um, lehnte sich gegen die Mauer, versetzte dem ersten Mann mit seinem gesunden Bein einen Tritt in die Lenden. Der andere, ein kleiner, plumper Bursche, lief geradewegs in die granitharte Faust des Maats und sackte lautlos zusammen.
Die zwei anderen riefen irgendwas, sie hatten den Durchgang eben erst erreicht. Ulhurt grinste und beschloß, das Weite zu suchen. Er merkte, daß er, wenn notwendig, sehr schnell gehen konnte, und hatte fast das Ende des Durchgangs erreicht, als er im Lichtkegel der Laterne eine Gestalt auftauchen sah.
Und die Gestalt hielt eine Pistole in der Hand. Ihm wurde blitzartig klar, daß er den Mann mit der Pistole nicht schnell genug erreichen konnte. Nun gut, dann nicht. Aber er würde um sein Leben kämpfen. Er stieß einen röhrenden Schrei aus und war im Begriff, sich auf den Gegner zu stürzen, als Steinhauers kühle Stimme die nächtliche Stille durchschnitt. «Halt, Sie haben die Prüfung bestanden. Ich hätte Angst gehabt, das Ding zu benutzen.» Er ließ die Pistole in seine Manteltasche gleiten. Ulhurt starrte ihn wortlos an und wußte nicht, ob er wütend werden oder lachen sollte.
«Ich mußte wissen, wie Sie reagieren», erklärte Steinhauer später. «Ob Sie töten würden, egal, um wen es sich handelt.»
«Ich hätte auch Sie fast um die Ecke gebracht.» Der Maat lächelte gehässig. «Schade um das Mädchen. Sie war ehrlich gut.»
«Von der Sorte gibt es eine Menge.»
Am folgenden Abend fuhr wieder eine Kutsche vor der Klinik vor mit einer weiteren Belohnung für den Maat. Eine andere Mulattin, groß mit langen, wohlgeformten Beinen, die Ulhurt umschlangen wie die eines Ringers. Niemand verlangte von ihm, dieses Mädchen zu töten …
4
Giles Railton hängte behutsam die Hörmuschel des Telefons auf. Er hatte Vernon Kells Anruf einsilbig, wie es seine Art war, beantwortet. Giles haßte das Telefon. Nun, die Neuigkeiten waren zufriedenstellend, obwohl Kell nicht sonderlich begeistert von Charles zu sein schien. Aber zumindest gehörte sein Neffe jetzt jener Welt an, in der Giles schon jahrelang zu Hause war.
Giles saß in seinem Arbeitszimmer im zweiten Stock des eleganten Hauses in Eccleston Square, nur wenige Türen von Winston und Clemmie Churchill entfernt.
Als seine französische Frau Josephine noch lebte, hieß Giles’ Arbeitszimmer in der Familie «Vaters Versteck». Die Kinder durften das Zimmer nicht betreten, und Giles erinnerte sich noch gut an die laute Empörung des zehnjährigen Andrew: «Warum dürfen wir nicht mit Papas Soldaten spielen?»
Josephine war es schwergefallen, dem kleinen Jungen den Grund zu erklären. Fünf Jahre später war sie nicht mehr in der Lage, ihm etwas zu erklären. Sie war an einem Freitagabend munter und glücklich von einem Einkaufsbummel heimgekehrt und mit einem Hirnschlag am Fuß der Treppe tot umgefallen.
Giles rief sich nur selten diesen schrecklichen Tag ins Gedächtnis zurück. Er dachte überhaupt nur selten an seine Vergangenheit, es sei denn, er fand es nützlich, auf persönliche Erfahrungen zurückzugreifen. Die Ereignisse der letzten Wochen jedoch hatten ihn gezwungen, die Sicherheit seiner privaten, geistigen Festung zu verlassen. Der Tod seines älteren Bruders hatte nicht nur alte Erinnerungen geweckt, sondern auch eine Lawine dringender Probleme ausgelöst. Eines dieser Probleme war, zumindest im Moment, durch Vernon Kells Anruf beseitigt worden.
Im Unterschied zu den anderen Railtons war Giles nicht von hohem Wuchs. Er hatte mit vierzehn Jahren eine Größe von einem Meter fünfundsechzig erreicht und war dann nicht mehr gewachsen. Aber ansonsten wies er alle typischen Railton-Merkmale auf: die vorspringende Nase, die hellen Augen und das volle Haar, das jetzt anfing, grau zu werden. Giles war einundsechzig Jahre alt.
Es war seltsam, überlegte er, daß in der Railton-Familie die Kinder oft in so großen Abständen zur Welt gekommen waren. Die beiden Söhne des Generals, John und Charles, waren zwölf Jahre auseinander. Giles wußte auch noch von einem anderen Kind des Generals, das vor zwölf Jahren geboren worden war, aber natürlich nie erwähnt wurde. Der General hatte gewiß kein Mönchsleben geführt nach dem Tod seiner Frau Nellie, die im Herbst 1884 bei einem Reitunfall ums Leben gekommen war.
In den Augen seiner Kollegen war Giles Railton nur einer der vielen hohen Staatsbeamten – ein Veteran, der auf den unvermeidlichen Herbst seiner Tage wartete. Doch nichts lag der Wahrheit ferner, denn Giles Railton hatte erst kürzlich den Höhepunkt seiner Karriere erreicht.
In den amtlichen Papieren und Dokumenten wurde er als «ranghöchster Berater für auswärtige Angelegenheiten» geführt. Doch sein offizielles Dossier enthielt mehr Fiktionen als Fakten, und das schon seit Jahrzehnten. Die Akten erwähnten nicht die Rolle, die er beim Erwerb der Suez-Kanal-Aktien für die Regierung gespielt hatte, noch seine Reisen nach Indien oder seinen zweijährigen Aufenthalt in Ägypten. Die gestochene Handschrift verriet weder seine häufigen Aufenthalte und Reisen durch ganz Europa noch deren Anlaß und Zweck. Auch seine heimlichen Zusammenkünfte in Rußland waren nirgends vermerkt. Während die Diplomaten mit dem Zaren und dessen Beratern verhandelt hatten, hatte Giles sich mit Lenin, Trotzki und anderen Revolutionären getroffen, um deren gefährliche politische Ideen zu begreifen und zu analysieren.
Es war in diplomatischen Kreisen wohl bekannt, daß er jetzt Vorsitzender eines Komitees für das Chefbüro der Imperialen Defensive, kurz CID genannt, war, aber niemand nahm diesen Posten sehr ernst.