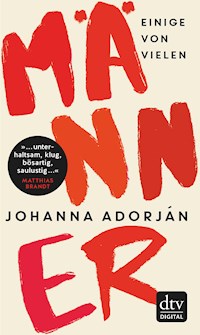Inhaltsverzeichnis
Widmung
Copyright
Für meinen Vater
Am 13. Oktober 1991 brachten meine Großeltern sich um. Es war ein Sonntag. Eigentlich nicht der ideale Wochentag für Selbstmorde. An Sonntagen rufen Verwandte an, Bekannte wollen vorbeikommen, um gemeinsam mit dem Hund spazieren zu gehen, ein Montag zum Beispiel erschiene mir viel geeigneter. Aber gut, es war Sonntag, es war Oktober, ich stelle mir einen klaren Herbsttag vor, denn das Ganze ereignete sich in Dänemark, in Charlottenlund, wo meine Großeltern wohnten, einem Vorort von Kopenhagen, in dem alle Häuser einen Garten haben und man seine Nachbarn beim Vornamen nennt. Ich stelle mir vor, dass meine Großmutter am Morgen als Erste aufwacht. Dass sie aufwacht und ihr erster Gedanke ist, dass dies der letzte Morgen ist, an dem sie aufwacht. Dass sie nie wieder aufwachen wird, nur noch einmal einschlafen. Meine Großmutter setzt sich schnell auf, schlägt die Decke zur Seite und schlüpft mit den Füßen in die Stoffschuhe, die sie jeden Abend ordentlich neben dem Bett abstellt. Dann steht sie auf, eine schlanke Frau von einundsiebzig Jahren, streicht sich das Nachthemd glatt, und durchquert leise, um meinen Großvater nicht zu wecken, die paar Meter zur Tür.
Im Flur empfängt sie schwanzwedelnd der Hund, Mitzi, eine Irish-Terrier-Dame, lieb, phlegmatisch, nicht besonders gehorsam. Meine Großmutter kommt gut mit ihr zurecht. Sie spricht Ungarisch mit ihr. »Jó kis kutya«, sagt meine Großmutter, nachdem sie die Tür zum Schlafzimmer leise hinter sich geschlossen hat, guter kleiner Hund. Sie hat einen Bass wie ein Mann. Wahrscheinlich kommt das von den vielen Zigaretten, sie raucht eigentlich pausenlos. Ich könnte in meiner Vorstellung von diesem Morgen noch einmal zurückgehen und ihr gleich nach dem Aufwachen schon eine brennende Zigarette zwischen die Finger stecken, Marke Prince Denmark, extra stark (Werbeslogan: Prince Denmark ist Männersache). Ja, spätestens als sie die Pantoffeln anhatte, wird sie sich eine angezündet haben. Es riecht also, während sie dem Hund im Flur über den Kopf streichelt und gleichzeitig hinter sich leise die Schlafzimmertür zuzieht, nach frischem Rauch.
Etwas später mischt sich zum Zigarettenrauch der Geruch von Kaffee. Für feine Nasen auch ein Hauch »Jicky« von Guerlain. Meine Großmutter hat einen Morgenmantel übergezogen, einen Kimono aus Seide, den ihr mein Vater einmal aus Japan mitgebracht hat, sie trägt ihn locker in der Taille zusammengebunden und sitzt jetzt am Küchentisch. Zwischen den Fingern der linken Hand hält sie eine brennende Zigarette. Sie hat lange, elegante Finger und hält die Zigarette ganz weit oben, nahe der Fingerkuppen, als wäre eine Zigarette etwas Kostbares. Meine Großmutter wartet darauf, dass der Kaffee endlich durchgelaufen ist. Vor ihr auf dem Tisch liegen ein Füller und ein Block.
Wer meine Großmutter jetzt sehen würde, könnte meinen, sie langweile sich. Ihre Augenbrauen stehen so weit über ihren Augen, das sie von ganz alleine aussehen wie hochgezogen, schwere Lider verleihen ihrem Gesichtsausdruck eine leicht blasierte Müdigkeit. Auf Fotos aus jungen Jahren sieht meine Großmutter ein bisschen aus wie Liz Taylor. Oder Lana Turner. Oder ein anderer Filmstar aus dieser Zeit mit dunklen langen Haaren und Wangenknochen, die wie gemeißelt wirken. Sie hat eine kurze gerade Nase und einen kleinen Mund mit geschwungener Unterlippe. Nur ihre Wimpern sind vielleicht etwas zu kurz, um perfekt zu sein, und sie zeigen gerade nach unten.
Sie ist auch an ihrem letzten Tag noch eine schöne Frau. Ihre Haut ist vom Sommer gebräunt, ein tiefes, fast schmutziges Braun, die Wangenknochen scheinen noch höher gerutscht zu sein. Die Haare trägt sie kinnlang gestuft. Mit den Jahren sind sie borstig wie Draht geworden, wie eine dicke, dunkelgraue Kapuze umrahmen sie ihr Gesicht. Am Morgen des 13. Oktober 1991 sitzt meine Großmutter am Küchentisch. Während sie darauf wartet, dass der Kaffee fertig durch die Maschine gelaufen ist, notiert sie sich auf ihren Ringblock, was zu erledigen ist. Zeitung abbestellen, schreibt sie. Rosen für den Winter fertig machen. Sie hat keine Brille auf, sie braucht keine, trotz ihrer einundsiebzig Jahre, worauf sie sehr stolz ist. Vor ihr auf dem Tisch glimmt eine Zigarette im Aschenbecher. Es knistert, wenn die Glut sich weiter ins Papier frisst. Meine Großmutter schreibt: Mitzi. Als sie den Füller absetzt, löst sich ein Klecks Tinte von der Feder, breitet sich auf dem Papier zu einem nassen blauen Fleck aus und lässt das Wort Mitzi darin verschwinden. Egal. Sie wird es sich schon merken können. Sie ist es in den letzten Tagen so oft durchgegangen, dass sie die Punkte ohnehin auswendig weiß. Sie schaltet das Radio an, ein kleines tragbares Plastikradio, das neben dem Toaster steht. Es kommt etwas von Bach. Ist ja Sonntag.
Am Morgen des 13. Oktober 1991 taucht mein Großvater mit einem rasselnden Atemzug aus dem Schlaf auf und ist sofort hellwach. Er greift nach seiner Brille, die auf dem Nachttisch liegt, und wirft einen Blick auf den Wecker. Neun Uhr. Er weiß, was für ein Tag es ist. Es muss ihm nicht erst einfallen, er wusste es auch im Schlaf. Aus der Küche sind Geräusche zu hören, die entstehen, wenn jemand versucht, besonders leise die Spülmaschine auszuräumen. Und, leise, das Bach a-Moll-Violinkonzert. Ist es die Aufnahme mit Menuhin? Er bleibt noch ein paar Takte liegen, dann setzt er sich auf, was für ihn anstrengend ist. Jede Bewegung erschöpft ihn, im Sitzen angekommen, muss er sich erst mal kurz ausruhen. Dann, als gäbe er sich innerlich einen Ruck, fährt er sich einmal mit beiden Händen flach über den Kopf, streicht sich die Haare nach hinten und zu den Seiten, wo sie hingehören. Und steht, ganz langsam, auf.
Menschen, die in den letzten Wochen ihres Lebens bei meinen Großeltern zu Besuch waren, die eintraten in ihr kleines, höhlenartiges, gemütlich voll gestelltes, verrauchtes Haus, sahen meinen Großvater entweder gar nicht, weil er schlief. Oder sie trafen ihn auf dem Sofa im Wohnzimmer an, müde und sehr dünn - in wenigen Monaten war sein Gewicht von 70 auf 58 Kilogramm gefallen, er sah aus wie geschrumpft. Da saß er, von Kissen gestützt, und stand auch dann nicht auf, wenn der Besuch sich verabschiedete. Er hatte Probleme mit dem Herzen. Der Muskel war schwach geworden, eine Alterserscheinung, vielleicht die Spätfolge einer Typhuserkrankung, die er sich während des Krieges zugezogen hatte. Die Ärzte gaben ihm nur noch ein paar Monate zu leben, zuletzt stand neben seinem Bett ein Sauerstoffgerät, an dem er Luft tanken konnte.
Ich kannte ihn nur mit weißen Haaren. Ein vornehmer Mann, die Haare seitlich gescheitelt, Schnurrbart, ausgeprägtes Kinn mit Grübchen darin. Er trug immer Hemden, oft ein Seidentuch um den Hals, und seine Augenbrauen waren lang und buschig und standen in so viele Richtungen ab, als führten sie ein Eigenleben. Ich habe ein Foto, das ihn mit Kittel und Mundschutz zeigt, an seinen Augenbrauen, die über den Rand seiner Brille hinausragen, ist er trotzdem sofort zu erkennen: Er war orthopädischer Chirurg, Spezialist für Füße und Beine. Mir hat er als Kind Plattfüße attestiert, das aber so nett, dass ich dachte, das sei ein Kompliment.
Für andere mag er ausgesehen haben wie ein ganz normaler, weißhaariger, älterer Herr mit buschigen Augenbrauen. Und meine Großmutter mag auf andere gewirkt haben wie eine ganz normale ältere Frau, die sich, falls man auf Details achten wollte, auffallend gerade hielt. Auf mich wirkten sie ungefähr so:
Auftritt meine Großeltern aus Kopenhagen. Aus einer Wolke aus Parfum und Zigarettenrauch tritt ein elegantes Paar hervor, das aussieht als hätte es eben den Oldtimer um die Ecke geparkt. Sie haben die tiefsten Stimmen, die man je gehört hat, ihr Deutsch hat einen fremdländischen Akzent, und sie sprechen mit mir, als wäre ich eine kleine Erwachsene. Magst du Ballett, interessierst du dich für Opern, hältst du außerirdisches Leben für vorstellbar. Meiner Großmutter wäre es im Traum nicht eingefallen, mit uns Enkeln auf Knien durchs Kinderzimmer zu rutschen, um nach einer verloren gegangenen Playmobil-Haarkappe zu suchen, die doch irgendwo sein musste. Dafür ging sie mit uns in die Oper. Und mein Großvater ließ mich, als ich fünf Jahre alt war, an seiner Zigarre ziehen - als ich daraufhin schrecklich husten musste, erschrak er sich fürchterlich und kaufte mir ganz schnell ein Eis. Sie kamen mir vor wie Filmstars, anziehend und geheimnisvoll, und dass sie mit mir verwandt waren, meine Vorfahren waren, machte die Sache vollends unwiderstehlich.
Sprung. Eine liebliche Landschaft in Österreich, bei Linz. Grüne, sanfte Hänge. Wie eine Spielzeugburg liegt hier auf einem Hügel das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen, das heute ein Museum ist. Harmlos sieht es aus, wie ein Miniaturmodell von etwas, das in Wirklichkeit viel größer ist. Als sei der Maßstab verrutscht - so überschaubar sind die Ausmaße dieses Ortes. Zwei Türmchen mit Zinnen, ein schweres Holztor. Wäre ein Fluss davor, könnte man sich hier gut eine Ziehbrücke vorstellen, aber da ist nur ein Fußweg, der sich den Berg hinauf bis vor das Tor schlängelt, das breiter ist als hoch. Eine kleine Tür, rechts im Tor ausgestanzt, steht offen. Jeder kann hindurchgehen, es funktioniert in beide Richtungen, hinein und hinaus. Manchmal, wenn zu viele Besucher da sind, kommt es zu kurzen Rückstaus, aber es wird jeder wieder hinauskommen, der hineingegangen ist. Man geht dann ein Stück den Hang hinab, vorbei an Schildern, auf denen »Todesstiege« steht, alles prima ausgebaut, geht ein paar Treppenstufen hinunter, am Haupteingang vorbei, zum Parkplatz, auf dem ab der Mittagszeit viele Busse stehen, man zahlt sein Parkticket, ist ja ganz einfach heute mit dem Euro, und dann fährt man nach Hause, erleichtert, ergriffen, erschöpft, und wo ist eigentlich die Flasche mit dem Wasser, und können wir an einer Tankstelle mit Toilette halten, und wie lange gilt diese Mautplakette eigentlich.
Ich bin mit meinem Vater hier. In der Nacht vor unserem Besuch habe ich geträumt, dass im KZ Gästebücher der früheren Gefangenen auslägen. Im Traum habe ich darin herumgeblättert und auf einmal zwischen all den Einträgen die Schrift meines Großvaters erkannt: »Mit kap a kutya. Kakilni, pisilni«, stand da auf Ungarisch - Was bekommt der Hund. Kacken, pinkeln, und seine Unterschrift.
Es ist früher Vormittag, wir sind fast die ersten Besucher. Mein Vater und ich stehen erst ein bisschen auf dem ehemaligen Appellplatz herum, der sich 350 Meter lang in der Sonne erstreckt. Ein strahlender Tag. Heiß. Keine Wolke am Himmel. Ab und zu summt eine Fliege vorbei. Es hat etwas von einem Ferienlager, so friedlich ist es, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint. Wir wissen nicht genau, was wir machen sollen, und gehen erst mal in einen Dokumentarfilm, der alle volle Stunde in einer der Baracken gezeigt wird, die den Platz umgeben. Die Vorführung findet in einem Raum statt, der wie ein Klassenzimmer wirkt. Alte Kinositzreihen bilden die Bestuhlung, die Holzsitze quietschen beim Herunterklappen und stellen sich schnell als unbequem heraus. An die Wand vorne wird der Film projiziert, er ist schon etwas älter, mit Knisterton und kontrastarmen Bildern, so dass mitunter kaum etwas zu erkennen ist.
Ein Steinbruch ist zu sehen. Hunderte Männer in gestreifter Häftlingskleidung schleppen schwere Granitblöcke eine steile Treppe hinauf. Dies, erklärt der Sprecher, ist die sogenannte Todesstiege, auf deren Stufen ungezählte Menschen starben, teils aus Erschöpfung, teils durch Misshandlungen der SS-Aufseher. Mauthausen war ein Lager der Kategorie III, Kategorie III bedeutete »Vernichtung durch Arbeit«. Auf der Leinwand ist nun ein Steilhang zu sehen, eine fünfzig Meter hohe, fast senkrechte Felswand, von der SS »Fallschirmspringerwand« genannt. Von hier stürzten SS-Männer Häftlinge in den Tod; tausend waren es allein an dem Tag im März 1943, an dem Himmler das Lager besichtigte.
Bilder von Toten, die in elektrisch geladenen Zäunen hängen, Zeitzeugen kommen zu Wort. »Ma glaubt’s ned wenn man’s ned mit eigenen Augen gesehen hat«, sagt einer mit starker österreichischer Färbung. »Viele glauben, dös is a Schmäh. Dös glaubt keiner.« Dann wird die Geschichte von fünfhundert russischen Gefangenen erzählt, denen im Januar 1945 die Flucht gelang. Die Hetzjagd, die SS-Angehörige und Anwohner auf sie veranstalten, überleben elf. Elf von fünfhundert. Am 5. Mai wurde Mauthausen von den Amerikanern befreit. Der US-Soldat, der, inzwischen ein alter Mann, im Film davon erzählen will, bricht immer wieder ab, weil er so weinen muss.
Die Aufnahmen vom Tag der Befreiung zeigen bis aufs Skelett abgemagerte Männer in gestreifter Häftlingskleidung, auf der Brust tragen sie den Judenstern. Alle sind kahl geschoren, haben übergroße Augen und Nasen, Strichmünder und lange dünne Finger, sie sind nur verschieden groß. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie mein Vater sich während des Films ein paar Mal unter seine Brille fasst. Ich traue mich nicht, mich zu ihm zu drehen. Nach dem Film sagen wir beide wenig, und wenn doch etwas, dann in betont beiläufigem Tonfall. Wusste ich gar nicht, dass es in Mauthausen eine Gaskammer gab, sage ich. Nein, sagt mein Vater, er auch nicht.
Danach nehmen wir an einer Führung durch das Lager teil. Ein junger Mann in Turnschuhen, kurzer Hose und Poloshirt ist unser »Guide«. In den silbermetallenen Gläsern seiner Sonnenbrille spiegelt sich der Appellplatz, auf dem wir stehen. Er ist mit Kies bedeckt, die schwere Steinwalze steht noch da, mit der Gefangene früher den Boden glätten mussten. Inzwischen sind viele Schulklassen um uns herum. Sie sind laut, sie lachen, sie verschicken Kurzmitteilungen. Wissen sie, wo sie hier sind? Interessiert es sie? Ist es schon toll, dass sie überhaupt kommen? Ich fühle Wut in mir aufkommen, Wut auf diese hässlichen Teenager mit ihren zu schwarz gefärbten Haaren und zu tief sitzenden Jeans.
Unser Guide leiert die Fakten in österreichischem Dialekt herunter. »Bitte, die Baracke dort, dort wurden den Häftlingen Organe entnommen, lebenden Häftlingen bitte, um zu schauen, wie lange sie überleben. Die meisten starben eines jämmerlichen Todes. Wenn Sie jetzt bitte nach rechts schauen.« Sein gelangweilter Tonfall nimmt dem Schrecken seine Wucht, ist das gut, ist das schlecht, ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass ich so nicht in Gefahr gerate zu weinen. Davor hatte ich Angst gehabt. Hier vor meinem Vater weinen zu müssen. Aber jetzt stehe ich hier in der Hitze, denke, dass ich eine Sonnencreme mit höherem Lichtschutzfaktor hätte mitnehmen sollen, frage mich, ob es am Ausgang Cola light zu kaufen gibt und höre dabei von dem Schrecken, der mir immer so präsent war, ohne dass ich ihn hätte genau benennen können. Hier stehend, denke ich vor allem: Aber mein Großvater hat es ja überlebt, er hat ja überlebt.
In einem Museum im Untergeschoss sind die medizinischen Versuche dokumentiert. »Hier in dieser Baracke wurden kerngesunden Menschen Organe entnommen und dann die Zeit gemessen, die sie beispielsweise ohne Nieren leben konnten«, leiert unser Guide. »Sie starben schon nach kurzer Zeit unter grausamsten Schmerzen. So, bitte, wenn Sie mir folgen würden.« Ein paar Meter weiter erzählt er, dass tätowierten Häftlingen die Haut abgetrennt und zu Lampenschirmen verarbeitet wurde, wie man es aus Auschwitz kennt. Im Schaukasten hinter ihm ist ein Bild zu sehen, die Gruppe drängelt sich davor, das undeutliche Schwarzweiß-Foto eines Lampenschirms mit kleinem Anker drauf. Ich entferne mich ein paar Mal von der Gruppe und gucke mir die Fotos in den Schaukästen genauer an. Immer darauf gefasst, nein, darauf aus, in einer dieser dünnen Gestalten meinen Großvater zu erkennen. Was hat er in Mauthausen erlebt? Er hat nie über diese Zeit gesprochen. Hat er im Steinbruch gearbeitet? Oder als Arzt? Was hätten jüdische Ärzte im KZ gemacht? Wem hätten sie wobei geholfen?
Durch einen Raum, der dem Gedenken der Opfer gewidmet ist - Fotos von Häftlingen sind hier mit Namen und Lebensdaten ausgestellt, die meisten allerdings Italiener, mein Großvater ist wieder nicht dabei -, geht es in die Gaskammer. Sie ist nicht besonders groß und hat eine niedrige Decke. Ich will nur noch raus. Schon hört man die Stimmen der nächsten Gruppe, die dicht hinter uns ist. Mädchenkichern dringt in die Gaskammer, ich merke, wie in mir plötzlich Gefühle hochsteigen, ich weiß nicht mal welche, Wut, Trauer? Irgendwie ist es jetzt doch alles ein bisschen viel, und ich wäre gerne allein. Auf dem Weg hinaus geht es noch durch einen kleinen Raum, in dem ein Galgen steht. Dennoch seien die meisten Menschen in diesem Raum mit Genickschuss getötet worden, erklärt unser Guide, das sei praktischer gewesen, »alleine schon wegen der Geschwindigkeit«. Dann hält er einen kurzen Vortrag über die aktuelle Neonazi-Situation in Österreich, erzählt, dass beinahe täglich Hakenkreuzschmierereien von den Wänden der Gaskammer entfernt werden müssten. Er sagt, dass er darüber erschüttert sei, aber er sagt es genauso unbeteiligt auf wie den Rest seines Programms. »Wir sind am Ende unserer Tour, vielen Dank, wenn noch Fragen sind …«
Mein Großvater hat sich einen Morgenmantel über seinen Pyjama gezogen, und seine Füße stecken in Herrenpantoffeln aus dunklem Leder, als er in die Küche kommt. Er schleicht mehr, als dass er geht. Das Radio läuft immer noch, inzwischen wird das Bach Doppelkonzert für zwei Geigen gespielt.
»Guten Morgen.« Seine Stimme ist noch tiefer als die meiner Großmutter, ein tief brummender Bass.
»Guten Morgen«, sagt meine Großmutter. »Haben Sie gut geschlafen?« Die beiden siezten sich ihr Leben lang, was auch unter Ungarn ihrer Generation absolut unüblich war - noch dazu unter miteinander Verheirateten.
»Nein, ich habe nicht sehr gut geschlafen«, sagt mein Großvater. »Und Sie?«
Meine Großmutter macht einen abschätzigen Gesichtsausdruck.
Mein Großvater setzt sich.
»Haben Sie die Zeitung noch nicht hereingenommen?«
»Es ist Sonntag«, sagt meine Großmutter.
»No ja«, sagt mein Großvater, als falle es ihm eben selber ein.
Meine Großmutter ist ein wenig angespannt, auch wenn sie das vor sich selbst nicht zugeben würde. Mitzi, der Hund, sitzt ihr zu Füßen und sieht bewundernd zu ihr auf. Wahrscheinlich spekuliert er darauf, etwas Essbares zugesteckt zu bekommen, was auch tatsächlich jeden Augenblick geschehen könnte, denn meine Großmutter hält nichts von autoritärer Hundeerziehung, vielleicht aber ist sein Hundekopf auch völlig leer. Er ist kein besonders kluger Hund, und wenn doch, weiß er es gut zu verstecken. Er sitzt also meiner Großmutter zu Füßen, sieht unverwandt zu ihr auf, und meine Großmutter krault ihm dann auch kurz den Kopf, zieht die kurzen drahtigen Löckchen zwischen den Ohren straff nach hinten, genau so wie Mitzi es mag.
»Wann gehen Sie zu Inga?«, fragt mein Großvater.
»Ich soll gegen Mittag dort sein«, sagt meine Großmutter.
Der Radioapparat macht ein knisterndes Geräusch. Mein Großvater richtet die Antenne anders aus, er bewegt sie nach links und nach rechts und lässt sie schließlich schräg zum Fenster stehen. Dann nimmt er die Kanne und schenkt sich Kaffee in seine Tasse. Dabei geht die Hälfte daneben.
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
© 2009 Luchterhand Literaturverlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH Alle Rechte vorbehalten. Printed in Germany
eISBN : 978-3-641-20337-5
www.luchterhand-literaturverlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de