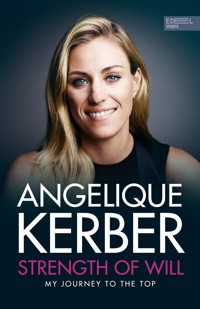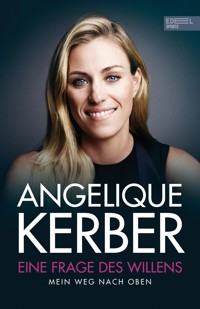
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Angelique Kerber ist die erfolgreichste und populärste deutsche Tennisspielerin des letzten Jahrzehnts, sie gewann u. a. Wimbledon, die US Open und Australian Open. In ihrer Autobiografie schildert sie zum ersten Mal ausführlich ihren Weg an die Tennisspitze und die Höhen und Tiefen ihrer Karriere. Sie berichtet auf sehr persönliche und nahbare Art, wie es zu ihren großartigen Erfolgen, aber auch zu schmerzlichen Niederlagen kam. Dabei spart sie die Zweifel und Ängste, die das Leben als Tennisprofi mit sich bringt, nicht aus, und erzählt offen und ehrlich, wie sie sich immer wieder aus Krisen herausgearbeitet hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Wimbledon 2018, in den Katakomben – Ein Prolog
1Im Dschungel der Großstädte – auf dem Weg zur Profispielerin
2Viele Wege führen am Ziel vorbei – Tennis oder nichts
3Den Schläger an den Nagel hängen?
4Eine Entscheidung zwischen Herz und Herz
Wimbledon 2018, Finale, erster Satz – ein Zwischenspiel
5Der Sprung in den Yarra River
6Startschuss für den puren Wahnsinn
7Ungebetene Gäste – Dämonen namens Zweifel
8Ein Spinning-Kurs gegen die Krise
9Ausgebrannt
Wimbledon 2018, Finale, Game, Set and Match – und noch nicht das Ende
10Die neue Nachdenklichkeit
11Tennis, Corona und die Liebe
Man sollte nie nie sagen – ein Epilog
Dank
WIMBLEDON 2018, IN DEN KATAKOMBEN – EIN PROLOG
Ich blicke wie hypnotisiert auf meine Knöchel. Sie sind akkurat getapt, das beruhigt. Aber eigentlich blicke ich durch sie hindurch. Wie durch fast alles in diesen Minuten. Oder sind es Stunden? Nirgends verschwimmt die Realität so sehr wie in Wimbledon. Es ist wohl ein elementarer Teil dieses faszinierenden Mythos, der mich beim Warten im holzgetäfelten Locker Room wieder komplett erfasst hat. Längst hätte ich schon auf dem Platz stehen sollen, aber das Herrenhalbfinale zwischen Rafael Nadal und Novak Djoković muss noch zu Ende gespielt werden, es ist am Vorabend abgebrochen worden. Alles wird sich wohl um zwei Stunden verspäten, so ist es mir zumindest gesagt worden. Ein Zeitgefühl existiert längst nicht mehr in meiner kleinen Ewigkeit.
Vielleicht liegt es daran, dass die Ruhe vor dem Sturm an diesem magischen Ort so besonders wirkt. Es ist die himmlischste und zugleich intensivste Stille, die ich kenne. Durchsetzt von Etikette, Geschichte – und von der Hoffnung, hier, bei diesem Grand-Slam-Turnier, zu gewinnen. Und ich will gewinnen, nichts anderes habe ich mir vorgenommen, dafür habe ich die letzten Wochen und Monate hart trainiert, eigentlich die letzten Jahre, mein ganzes Leben lang. Auf diesem „heiligen Rasen“ zu siegen, das ist für viele der absolute Gipfel im Tennis. Ich zähle mich zu diesen Menschen. Es ist mein persönlicher Traum, hier einmal im Finale zu stehen, auf dieser Tennisbühne, und das schon seit Kindheitstagen – und nun ist es so weit, sogar schon zum zweiten Mal. Um hier stehen zu können, habe ich in den Anfangsjahren jede Entbehrung in Kauf genommen, die Kraft gefunden, mich immer wieder zurückzukämpfen, und nie den Glauben verloren.
Allerdings ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, weiter darüber nachzudenken. Der Centre Court ist mit fünfzehntausend Zuschauern voll besetzt, ich sehe ihn noch nicht, aber ich kann die Euphorie dort schon spüren. Meine Gegnerin ist wie im Juli 2016 die US-Amerikanerin Serena Williams; damals habe ich es verpasst, erstmals nach zwanzig Jahren, nach Steffi Graf, wieder einen deutschen Sieg bei den Frauen zu holen. Ich verlor das Endspiel, weil Serena, die Weltranglistenerste, einfach zu stark war. Ihre Dominanz war unüberwindbar, geradezu einschüchternd. Dabei hatte ich im Januar noch die Australian Open gewonnen. Serena hat jedoch besonders beim Aufschlagspiel ihre Stärken ausgespielt, sie punktete mit großer Wucht. Gnadenlos konterte sie, darin ist sie eine Meisterin.
Doch diesmal fühle ich mich bereit. Etwas hat sich geändert, ich bin eine andere Spielerin. Erfahrener und besser gerüstet als 2016 für das ersehnte erfolgreiche Ende meiner Mission. Aber auch Serena wird sich auf dieses Match wie immer bestens vorbereitet haben. Selbst mit sechsunddreißig ist sie weiterhin eine der besten Spielerinnen auf der Tour. Serena ist für mich die ultimative Herausforderung. Serena und der heilige Rasen, das kommt einer Symbiose gleich. Das eine ist ohne das andere kaum vorstellbar.
Bekannt ist Serena als Problemlöserin, als eine, die sich auf jede Situation im Match einstellen kann. Eine spielende Legende, jetzt schon als GOAT („Greatest of all Time“) gefeiert. Aber mein Coach, der Belgier Wim Fissette, hat mich in dieser Hinsicht trainiert – und auf Fitness. Ich fühle mich gerade unglaublich fit. Wir haben uns auf meine Beinarbeit konzentriert, sie zählt zu meinen Stärken. Lange Ballwechsel werden mir wahrscheinlich weniger ausmachen als Serena. Konsequent die Chancen an der Grundlinie nutzen, das hat mir Wim immer wieder zu verstehen gegeben. Und ich weiß, dass sich in den vergangenen zwei Jahren mein Aufschlag verbessert hat, technisch bin ich versierter geworden, habe mehr Kraft und kann Bällen eine andere Richtung geben, sie variieren.
Das alles sage ich mir am 14. Juli 2018, als ich im Ladies Dressing Room stehe, dem Inner Sanctum der Anlage gewissermaßen. Korbstühle, weit ausladende Sessel und Chaiselongues zum Entspannen stehen herum, bezogen mit blumengemusterten Stoffen. Dazu geblümte Vorhänge zu Sprossenfenstern. Very british! Herrlich! Nur die Profis selbst und ihre Coaches haben Zutritt zu diesem Bereich, andere Team- oder Familienmitglieder sollten besser draußen bleiben, um die Konzentration nicht zu stören.
Serena sehe ich hier nicht. Bislang hat sie in Wimbledon schon sieben Titel gewonnen, zweimal ein Finale verloren. Wie wird es heute sein, an diesem Samstag, wo die Sonne warm in den „Frauentrakt“ scheint? Die Herzoginnen von Cambridge und Sussex, Kate und Meghan, sitzen, soweit ich weiß, unter den Zuschauern, der Golfer Tiger Woods und Formel-1-Star Lewis Hamilton, nicht zu vergessen das elitäre Londoner Publikum – und die Fans aus aller Welt. Serena, die junge Mutter, hat angekündigt, dass sie für alle Mütter dieser Welt spielen werde. Alle Zeitungen haben vom „Comeback der Mama“ beziehungsweise vom „Momback“ gesprochen und damit die Erwartungen hochgeschraubt. Achtunddreißig Jahre lang hat keine Mutter mehr in Wimbledon gewonnen, nun wünscht man sich natürlich, dass es dieses Mal klappt. Und die letzte verbliebene Spielverderberin auf dem Weg zum triumphalen Comeback bin ich. Aber das soll mich nicht einschüchtern, und es schüchtert mich auch nicht ein. Das sind perfekte Drehbücher, die die Zeitungen schreiben, das hat nichts mit dem zu tun, was in einem Finale wirklich passiert. Da kommt es auf ganz andere Dinge an, Serenas Party hin oder her. Liegt der Fokus auf ihr, so habe ich freies Spiel, werde nicht von irgendwelchen Erwartungen erdrückt. Alle sehen mich als die, die schon einmal gegen Serena verloren hat, nicht als die, die an ihren Stärken gearbeitet hat. Und die gelernt hat, die Fehler ihrer Gegnerin zum eigenen Vorteil zu nutzen. Ebenso den eigenen Mut einzusetzen. Herausforderung, du kannst kommen, ich bin bereit.
Klar, eine Blamage ist auch möglich, eine zweite Niederlage gegen Serena. Das ignoriere ich auch nicht. Aber wenn ich nur Angst habe, tue ich mir keinen Gefallen. Mental würde mich das nur in die Knie zwingen, aber das lasse ich nicht zu. Trotz aller Anspannung will ich mein Bestes geben, Leistung erbringen, vielleicht sogar Historisches erreichen. Wer weiß.
In diesem Moment betritt Serena den Raum. Wir begrüßen uns, ein freundliches Kopfnicken, ein „Hello, how are you?“. Aber das war’s auch schon, kein weiterer Small Talk.
Sie wärmt sich gut fünf Meter entfernt von mir auf, dehnt ihren Schlagarm, tippelt auf der Stelle, redet mit ihrem französischen Trainer Patrick Mouratoglou. Ihr Selbstvertrauen durchdringt den Raum, das kenne ich schon. Sie tauschen kurze Sätze aus, sprechen leise. Sicher auch über mich, mein Spiel, meine Stärken, meine Schwächen – ihre ausgeklügelte Taktik, vor der ich Respekt, aber keine Furcht habe. Serena und ich, wir schätzen uns gegenseitig ungemein.
Heimlich schaue ich sie mir an, wie sie auch mich aus den Augenwinkeln betrachtet. Sie wirkt ein wenig müde, weniger beweglich als noch vor zwei Jahren. Die Geburt ihres Kindes hat sie merkbar verändert. Was sie wohl über mich denkt? Dass es dieses Mal schwieriger werden könnte, mich zu schlagen? Ich bin nicht mehr die krasse Außenseiterin, als die man mich noch 2016 gesehen hat.
Plötzlich spüre ich, dass ich Serena heute schlagen kann. Die Quelle der Überzeugung sitzt ganz tief in mir. Müsste ich sie anatomisch orten, würde ich sagen: irgendwo zwischen Herz, Bauch und Verstand. Diese unsichtbare Kraft hat eine enorme Ausstrahlung, sie fühlt sich wohlig warm an und reicht bis in die Gliedmaßen. In dieser Form habe ich das vor einem so wichtigen Endspiel noch nie erlebt, das steht fest.
Das gute Gefühl könnte mir wie ein GPS den immer noch langen Weg zur Venus Rosewater Dish, der Siegertrophäe, weisen. Nichts würde mir mehr bedeuten, als hier zu gewinnen. Pokale fand ich immer toll, schon als junges Mädchen. Alles, was ich gewinnen konnte, nahm ich dankend mit. Es gab mir Selbstvertrauen. Trophäen schienen mich in dem zu bestätigen, was ich tat – nämlich Tennis zu spielen seit meinem dritten Lebensjahr. Die Silberschale war noch nicht in meiner kostbaren Sammlung, sie wäre ein Beweisstück der besonderen Art.
Auf einmal bin ich zuversichtlich, dass ich sie mit nach Hause bringen werde. Sie flößt mir eine Menge Ehrfurcht ein, ein wenig fühle ich mich, als würde ich gleich meinen Gang zum Schafott antreten müssen, aber in dem Bewusstsein, dass ich in der Lage sein werde, mein Schicksal lenken zu können. Ja, da ist sie, meine Angriffslust. Muss ich Serenas Aufschlag auch fürchten, sie wird sich vor meinen schnellen Beinen in Acht nehmen müssen.
Noch einmal schaue ich in ihre Richtung. Nichts, was mich aus der Fassung bringen könnte. Wie gesagt, Respekt und Ehrfurcht sind in Ordnung, aber ich weiß, was ich kann. Sollte ich verlieren, dann wäre es nicht mehr der Untergang wie früher. Aber ich werde nicht verlieren, heute werde ich es schaffen. Mit Präzision und Wendigkeit, ich werde rennen und keiner wird mich aufhalten können.
„Ladys!“, ruft plötzlich ein smarter Gentleman im adretten Clubanzug und bittet uns mit einer freundlichen, aber bestimmenden Geste zum Aufbruch. Das untrügliche Zeichen, der Countdown läuft, ab jetzt gibt es nur noch ein Vorwärts, kein Zurück. Man muss sich zeigen, steht im Fokus der Öffentlichkeit, der Kameras auf dem Court, die jede unserer Regungen eins zu eins einfangen und in alle Erdteile schicken. Ohne Filter werden unsere Gefühle verfolgt, immer auf der Jagd nach dem, was entlarvend sein könnte, unsere Freude, unsere Wut, die in uns nagende Verbissenheit, die Hoffnungen, die Erleichterung, wenn etwas, das brenzlig aussah, doch noch glückt. Die ganze Palette. Am liebsten noch Ausraster, Wutanfälle, laute Streitereien mit Schiedsrichtern. Ein perfektes, präzises Spiel allein ist nur von mäßigem Interesse. Dieses optische „Ausgeliefertsein“, als würde man sich nackt präsentieren, hat mir früher Unbehagen bereitet. Ich mochte es nicht, wenn man in mich hineinguckte, als wolle man meine Gedanken lesen. Aber das ist längst vorbei. Was auch mit Selbstsicherheit zu tun hat. Und mit Erfahrung – gesammelt in guten, aber vor allen Dingen in schlechteren Zeiten. Und davon gab es dann doch einige.
Nur noch wenige Minuten, dann beginnt das Match. Ich bin auf dem Weg zum Centre Court. Endlich. Es ist sicher das bislang wichtigste Spiel meiner Karriere. Ich höre die Zuschauer, einen Ansager über den Lautsprecher, sehe, wie die Sonne den Court in warmes Sommerlicht taucht. Doch im nächsten Moment ist alles ausgeblendet. Der Tunnelblick setzt ein, wie auf Knopfdruck mental antrainiert. In meiner Hand der Schläger, in der anderen gefühlt ein Ball. Nichts weiter zählt. Nichts kann noch um meine Aufmerksamkeit konkurrieren. Keine Herzogin, auch nicht Lewis Hamilton. Wunderbar, diese Möglichkeit des Gehirns, auf einmal nur ganz selektiv wahrzunehmen, Störfaktoren beiseitezuschieben, sich allein aufs Ziel zu konzentrieren. Und das Ziel heißt: Sieg. In diesem Moment will ich nur das.
Serena geht es nicht anders als mir. Sie läuft vor mir, den Blick starr nach vorn gerichtet, mittlerweile trägt sie Kopfhörer. Das kenne ich schon bei ihr, so schließt sie störende Geräusche aus, sorgt über ihre Playlist dafür, dass bei ihr der Tunnelblick einsetzt. Sie wirkt hochkonzentriert, aber auch angespannt. Wir Profis haben für die Gemütslage der Kolleginnen ein Gespür, das sich über die Jahre meist noch verfeinert. Tennis ist ein Kampfsport im edlen Gewand, bei dem es nicht nur um die eigene gute Leistung geht, sondern auch darum, sein Gegenüber zu bezwingen. Die Selbstwahrnehmung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Denn je mehr ich mich selbst kennenlernte, je mehr ich die Fähigkeit entwickelte, die eigenen Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen und zu kontrollieren, umso besser gelingt es mir seitdem, die Konkurrentinnen zu „lesen“ – was nicht ohne ein gewisses Maß an Empathie funktioniert. Ob Serena mich ebenfalls so „lesen“ kann wie ich sie, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich gehe auch bei ihr von einer großen Menschenkenntnis aus, die sie einsetzt, um ihre Gegnerinnen zu bezwingen. Doch langsam wird auch sie immer weniger präsent, mein Tunnelblick greift perfekt. Serena wird erst wieder vollends in mein Bewusstsein dringen, wenn wir uns gegenüberstehen, getrennt durch ein Netz, und sie ihren ersten Aufschlag macht.
Nun passieren wir die Pforte des Centre Courts, anschließend werden wir durch das Clubhaus eskortiert, durch die langen Korridore, vorbei an unzähligen Fotos in Farbe und in Schwarz-Weiß, die viel zu erzählen haben. Hinter jedem einzelnen Bild verbirgt sich eine besondere Geschichte, die ich aber jetzt konsequent ausblende.
Vor den Eingängen zu den VIP- und Member-Bereichen sind uniformierte Ordner positioniert, sie sollen verhindern, dass jemand unerlaubt unseren Weg kreuzt. Das gilt sogar für die exquisiteste aller Logen, zu der nur Royals und ihre Gäste Zutritt haben. Ölgemälde von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip weisen den Weg. Doch ganz gleich wie königlich es hier anmutet, ich zwinge mich, weiter fokussiert zu bleiben. Nur noch wenige Schritte bis zum Eingang des Centre Courts, alles andere zählt im Moment nicht.
In Gedanken gehe ich verschiedene Abwehrtaktiken durch, ich habe alle Schläge drauf, ich brauche mich nicht zu verstecken. Und Angst muss ich erst recht nicht haben. Ich spiele auf Rasen, das ist anders, als wenn ein Match auf Hartplatz stattfindet. Auf Hartplätzen fühle ich mich wohl, auf Rasen zu Hause; das Spiel ist schnell, fast schon intuitiv. Es bleibt keine Zeit nachzudenken, man muss einfach nur reaktionsschnell sein und der Unvorhersehbarkeit im Spiel auf Rasen mit Leichtigkeit begegnen. Und ich bin momentan reaktionsschnell. Ich kann ein starkes Match liefern. Ich will ein starkes Match liefern. Und mich auf meinen Instinkt verlassen.
Wir gehen eine Treppe hinunter, an deren Seite sich eine imposante Glasvitrine über zwei Stockwerke erstreckt. Darin drapiert die Pokale ehemaliger Champions aus verschiedenen Jahrzehnten. Auf deren fast unwirklich glänzender Oberfläche kann ich mich spiegeln. Beim Anblick meiner Silhouette merke ich, wie plötzlich Nervosität in mir aufsteigt. Anspannung, die ich brauche, um alle Kräfte zu mobilisieren. Und da ist auch eine immense Sehnsucht nach diesem Pokal, der mir noch fehlt.
Wir sind im Vorhof angekommen, er wirkt wie das Foyer eines Fünf-Sterne-Hotels. Gleich geht es auf den Platz. Ich weiß: Ich kann nicht mit einem starren Plan auf den Court gehen, ich weiß, dass ich meine Taktik ändern muss, das Spiel wird nie so laufen, wie ich es mir im Vorfeld viele Male vorgestellt habe. Wenn ich merke, dass ich verliere, kann ich nicht so weiterspielen wie bisher, dann muss ich etwas ändern. Unberechenbar bleiben: eine wichtige Regel. Nicht ganz einfach für mich zu beherzigen, da ich ein Gewohnheitsmensch bin.
Am Treppenende leuchten anmutig wunderschöne Blumen, in allen erdenklichen Blau- und Violetttönen. Alles ist perfekt organisiert, nichts wird dem Zufall überlassen. Als würde man hier in die Seele der Profis schauen. Nicht anders wird mit dem Rasen umgegangen, unzählige Angestellte und Greenkeeper arbeiten auf den Plätzen und überprüfen jeden Tag Dichte, Härte und Feuchtigkeit für ideale Spielbedingungen. Nicht umsonst wird der perfekte englische Rasen weltweit glorifiziert (die Schwierigkeit der Pflege sollte ich später noch bei meinem eigenen Wimbledon-Turnier in Bad Homburg kennenlernen). Das ist ein hoher Anspruch, aber den haben wir Profis ebenfalls. Wir wollen das Maximale geben. Auch hier, auch jetzt. Ich will die Revanche, ich werde keine Fehler machen, ich werde mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Immer wieder sage ich das still, wie ein Mantra. Lockerlassen, damit kannst du gewinnen. Letztes Mal wolltest du es in Wimbledon unbedingt schaffen. Du darfst dich aber nicht verkrampfen, du musst dich auf jeden einzelnen Punkt konzentrieren, der sich dir bietet. Ich weiß, dass ich dazu neige, sehr hart gegen mich selbst zu sein und mich schnell herunterzuziehen. Das darf mir auf dem Platz nicht passieren. Bleib optimistisch. Und was hat Wim gesagt: „Ein Grand-Slam-Titel ist kein Sprint, sondern ein Marathon.“ Alles leidvolle Erfahrungen, die ich machen musste, aus denen ich aber Konsequenzen zog – die richtigen. Daran glaube ich ganz fest. Ich bin nicht mehr so naiv wie vor zwei Jahren.
Ich merke, dass ich mein Körpergewicht im Wechsel von einem Bein auf das andere verlagere. Die Sohlen meiner Rasentennisschuhe quietschen dabei jedes Mal ein bisschen auf dem Parkettboden – das Geräusch passt so gar nicht in die hiesige Szenerie. Ich laufe deshalb etwas vorsichtiger, um Reibung zu vermeiden. Aber warum eigentlich? Wir sind in keiner Kirche, wir sind in Wimbledon, auf dem Weg zum Platz. Es ist mir nicht entgangen, dass sich Novak Djoković gegen Rafael Nadal in fünf Sätzen durchgesetzt hat – der Serbe wird morgen sein Finale bestreiten. Gute Nerven wünsche ich ihm. Doch jetzt heißt es: Ladies first. Oder: Frauen im Schatten der Männer, weil der Tag der Männer der letzte in Wimbledon ist? Man kann es so oder so sehen.
Eine fast gespenstische Ruhe umgibt uns, niemand redet. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Nach den zwei Stunden Wartezeit spüre ich jede Faser meines Körpers, Spannung und Anspannung in mir. Ich will raus auf den sattgrünen Rasen, mein Kampfgeist ist vollends erwacht, ich will über mich hinauswachsen, will Serena schlagen, sie in die Knie zwingen. Es gewinnt nur, wer kämpft. Zieh es durch! Es gibt nichts geschenkt, doch du kannst Grenzen überschreiten, du kannst stärker, besser und schneller als deine Gegnerin sein. Du musst nur wollen. Und ich will. Ich will wieder an die Spitze.
„Okay!“ Das erlösende Wort fällt. Es geht los. Fünfzehntausend glückliche Ticketbesitzer verbreiten eine knisternde Atmosphäre. Viele davon haben tagelang in Zelten in der berühmten „Queue“ ausgeharrt. Serena und ich treten nach draußen, zeigen uns wie schon vor zwei Jahren. Ich laufe links um die Ecke, Serena rechts. Ein schmaler, asphaltierter Zubringerpfad führt uns zu unseren jeweiligen Plätzen, einzig eine grüne, blickdichte und hohe Bande trennt uns noch vom heiligen Rasen. Ich bin nervös, reichlich. Ich spüre, dass ich ein wenig an Gewicht verloren habe, weil ich schon während des gesamten Grand-Slam-Turniers kaum eine Mahlzeit ganz aufessen konnte. Herrje, habe ich Fieber? Es fühlt sich heiß in mir an, der Puls rauscht, mein Herz klopft. Nach ein paar Metern biegen wir nach rechts ab. Es ist so weit …
Ich werde noch auf dieses Match zurückkommen. Auf den wichtigsten Sieg in meiner Karriere. Auf meinen Wimbledon-Triumph, mit dem mein größter Traum in Erfüllung ging. Doch was kommt nach solchen Erfolgen? Nach dem Gewinn eines Grand-Slam-Turniers? Was kommt nach dem Weltranglistenplatz 1? Niemals kann man die Tenniswelt im Handumdrehen erobern. Geschweige denn für immer an der Spitze bleiben. Die Realität holt alle wieder ein.
Ich war unten, nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Das gehört wohl zu meinem Leben dazu. Aber immer wieder ist es mir gelungen, aus der Tiefe heraus den nächsten Höhenflug zu starten. Nie blieb ich in dem Dunkel, ich musste mich nur motivieren. Aufgeben ist keine Option, jedenfalls nicht für mich. An seinen Träumen festhalten!Genau darum geht es, davon möchte ich in diesem Buch erzählen. Und das ist es auch, was ich anderen Menschen mit auf den Weg geben möchte. Den Mut nicht zu verlieren. Den Kampf wagen – auf dem Platz, aber auch außerhalb davon.
Denn es geht im Leben nicht nur um Siege und Niederlagen, um Erfolge und sportliche Durststrecken, um Selbstvertrauen oder Selbstzweifel. Es kommen Momente, wo andere Dinge wichtiger werden als der Profisport. Die Sehnsucht nach einem „normalen“ Leben, nach Beständigkeit. Auch dafür lohnt es sich zu kämpfen.
Mein Tennisleben beginnt jedoch mit dem Kampf um schnöde Weltranglistenpunkte. Mit Reisen zu Turnieren in Südamerika oder Thailand, fernab jeglicher öffentlichen Wahrnehmung. Mit Hotels, die nicht zu den schönsten zählten und oft in den Außenbezirken der Metropolen lagen. Doch verzichten möchte ich darauf nicht, denn diese Anfänge haben mich das Leben gelehrt. Demut. Den Umgang mit Krisen allemal, denn nichts ist einfach gewesen, auch später nicht.
Kapitel 1
IM DSCHUNGEL DER GROSSSTÄDTE – AUF DEM WEG ZUR PROFISPIELERIN
Ich saß im Auto einer wildfremden Person auf dem Beifahrersitz. Mitternacht war gerade vorüber, es war 2010, Anfang März, vor knapp zwei Monaten war ich zweiundzwanzig geworden. Von Paris sah ich nicht wirklich viel. Genau genommen: gar nichts. Wie auch. Es war stockdunkel und der Regen prasselte wie wild auf die Windschutzscheibe des Kleinwagens. Was den Fahrer aber nicht davon abhielt, das Gaspedal in unregelmäßigen Abständen zu malträtieren. Jemandem mit einem nervösen Magen konnte bei diesem Stop-and-go leicht übel werden. Zum Glück war ich in dieser Hinsicht nicht empfindlich.
Und doch: Irgendwie hatte ich gerade überhaupt kein gutes Gefühl. Um ehrlich zu sein: Mir war sogar extrem mulmig zumute. Still fragte ich mich: Wie konntest du nur so etwas machen? Was hat dich dazu gebracht, dich zu einem fremden Mann ins Auto zu setzen? Ausgerechnet du, du bist doch sonst immer so übervorsichtig. Noch ehe ich mir überhaupt Gedanken über den Ansatz einer Antwort machen konnte, wurde ich unvermittelt nach vorn geschleudert. Der Sicherheitsgurt katapultierte mich im selben Moment aber schlagartig wieder zurück in meinen Sitz, trotz altertümlicher Anmutung schien er zu funktionieren. Eine Straßensperre! Wie aus dem Nichts. Die ganze Autobahn war zu! Auch das noch. Die vielen Regentropfen auf der Frontscheibe verwandelten die aufleuchtenden Bremslichter der Autos vor uns in ein Meer aus verzerrten und wild tanzenden grellroten Punkten.
Pierre – ich glaube jedenfalls, dass der Fahrer sich mit diesem Namen vorgestellt hatte – schlug mit seinen Handballen auf das Lenkrad. Nicht sonderlich fest, eher kontrolliert. Als ob diese Geste so selbstverständlich zu seinem Alltag gehörte wie das Herausfriemeln einer Zigarette aus der zerdrückten Packung, die unter der Sonnenblende klemmte. „Mon dieu“, zischte er plötzlich. Verständlich, wer steht schon gern im Stau. Unmittelbar danach sah Pierre mich von der Seite an, zuckte mit den Schultern und sagte entschuldigend: „Match de Football.“
„Ein Fußballspiel? Mitten in der Nacht?“, wunderte ich mich.
Die Partie sei schon zu Ende, wie ich erfuhr, und das Verkehrschaos deshalb in vollem Gange. Damit die Pkw von den überfüllten Zufahrten schneller zu uns auf die Autobahn gelangen könnten, erklärte Pierre, stoppten die Sicherheitskräfte den fließenden Verkehr auf der zweispurigen Schnellstraße in strikt festgelegten Zyklen, und zwar komplett.
Ich blickte mich um und nahm auf der Rückbank mein Racketbag und meine Sporttasche ins Visier. Die Vollbremsung hatten beide Gepäckstücke gut überstanden. Trotzdem beruhigte es mich, dass ich den kleinen Pokal, den ich als Finalistin beim WTA-Turnier in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá bekommen hatte, in ein Handtuch gewickelt hatte. Ihm war hoffentlich nichts passiert, denn jeder Pokal war für mich so kostbar wie für andere Diamanten oder eine Oldtimer-Sammlung.
Vor wenigen Tagen war er mir überreicht worden, ich hatte in Bogotá im Finale gestanden, war gegen die Kolumbianerin und Lokalmatadorin Mariana Duque Mariño angetreten – hatte das Match aber leider verloren. Immerhin wurde ich Zweite, es war mein erstes Finale bei einem WTA-Turnier. Keine andere Deutsche hatte an der Turnierserie in Süd- und Mittelamerika teilgenommen – was wohl daran gelegen haben mochte, dass die Turniere nicht in die erste Kategorie fallen und damit nicht zu den begehrtesten zählen. Nicht jede Tennisspielerin mag das unbedingte Nachjagen von Weltranglistenpunkten, aber genau darum geht es. Besonders am Anfang sind diese Turniere ein wichtiges Sprungbrett. Ich jedenfalls war gerade dabei, mir eine gute Position zu erarbeiten, dafür nahm ich einiges in Kauf, war bereit, selbst die widrigsten Umstände zu akzeptieren.
Viele Spielerinnen meiden die abgelegenen WTA-Turniere auch deshalb, weil sie nicht immer dem professionellen Standard der restlichen Tour entsprechen. Die angemieteten Hotels sind oft ein Zugeständnis an den Kostendruck des Veranstalters und haben nicht selten das Niveau von Jugendherbergen, wenn überhaupt. Manchmal sind das schon ziemlich improvisierte Verhältnisse, mit denen man es zu tun hat, weit entfernt von der großen weiten Tenniswelt. Die Busse zu den Spielstätten fahren oft nur unregelmäßig. Und sie sind vielfach nicht in einem solchen Zustand, dass man sie als TÜV-konform bezeichnen könnte. Die Sandplätze haben manchmal mehr mit Getreideanbau als mit Tennisplätzen zu tun, und bei den Trainingseinheiten gibt es nicht selten alte, unzählige Male benutzte Bälle. Von den hygienischen Standards in der Players’ Lounge ganz zu schweigen.
Doch mich konnte das alles nicht erschüttern. Ich war nicht zimperlich, was die Unterkünfte betraf – mit meinem Vater hatte ich in den Anfangsjahren schon die schlimmsten Zimmer bezogen, mit zweifelhaften Hygienestandards und herumflitzendem Getier –, und ohnehin wollte ich einfach nur spielen, spielen, spielen. Was nicht heißt, dass ich kein Auge für die faszinierenden Momente dieser Orte bereithielt. Meine Neugierde an den verschiedenen Spielorten wurde immer größer, und ich verstand zunehmend das Privileg, die Welt bereisen und kennenlernen zu dürfen.
Bogotá zum Beispiel. Die Metropole war damals im Grunde ein einziger Moloch mit hoher Kriminalitätsrate. Drogenbosse und Guerillakämpfer beherrschten viele Viertel, eine heile Welt sah anders aus. So wurden beispielsweise die Shuttle-Fahrzeuge des Turniers bei Ankunft auf der Anlage von paramilitärischem Personal auf Bomben untersucht. Dennoch, das wusste ich vom ersten Moment an, hatte ich die Zeit dort nicht missen wollen, die Gespräche mit den kolumbianischen Spielerinnen, die von ihrer Stadt schwärmten, von den unzähligen prähispanischen und kolonialen Bauten. Ich mochte den atemberaubenden Ausblick, den man in der Stadt genoss, die elektrisierende Atmosphäre in den Straßen, die bunten, lauten Lokale, die Menschen, die mit Händen und Füßen redeten. Wer wie ich in Kiel im Norden Deutschlands aufgewachsen ist, konnte über dieses unglaubliche Temperament der Kolumbianer nur staunen.
Von Kolumbien war ich dann weiter nach Mexiko geflogen, nach Acapulco, gelegen am Pazifischen Ozean, mit vielen Sandstränden und Touristenattraktionen. Welch ein Kontrast zur Gebirgslandschaft. Auch hier stand ein weiteres Turnier auf dem Plan, wobei meine Teilnahme glücklos blieb. Ein schnelles Aus in der ersten Runde. Abhaken und vergessen. Aber jedes Spiel bot die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, jedes Spiel stellte mich vor neue Herausforderungen, sodass ich am Ende mehr über mich wusste. Und das war viel wert. Gerade in der frühen Phase meiner Karriere, in der ich mich befand. Aber wie überall gab es unterschiedliche Meinungen.
Es gab immer wieder jemanden, der kritisch hinterfragte, ob ich nicht an zu vielen Turnieren teilnehmen würde oder gar eines Tages ausgebrannt sein könnte. Ich hatte die Frage nie wirklich nachvollziehen können, da ich das Reisen nie als Strapaze, sondern als großes Abenteuer empfand – auch wenn sich immer mal wieder das Gefühl von Heimweh und die Sehnsucht nach Geborgenheit daruntermischten.
Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich schon als Teenager große Erfolge gefeiert hätte, etwa wie die sogenannten Wunderkinder Martina Hingis und Jennifer Capriati. Beide feierten schon früh große Siege, aber ebenso früh mussten sie ihre Karrieren beenden – die Gründe waren unterschiedlich und doch ähnlich. Als junger Mensch ist man unglaublich naiv und fühlt sich siegessicher, gerade wenn man von einem Sieg zum nächsten eilt. Aber die Siegeserwartungen in der Folge zu erfüllen, gerade wenn die Psyche noch hinterherhinkt, ist immens belastend. Das war bei Steffi Graf, auch ein „Wunderkind“, nicht der Fall gewesen, sie hatte von Anfang an eine starke Psyche gehabt und einen enormen Willen, verknüpft mit einer eisernen Disziplin.
Und ich selbst? Irgendwie war es wohl ein Glück für mich, dass ich in meiner Teenagerzeit nie so gehypt, nie als das Ausnahmetalent hingestellt wurde, sondern dass mein Weg in jungen Jahren im Windschatten großer sportlicher Biografien stattfand. Sicher, ich hatte auch einen großen Willen und Disziplin und versuchte bei jedem Spiel das Maximum herauszuholen, doch ich konnte meine Augen nicht davor verschließen, dass ich immer wieder Phasen hatte, in denen ich richtig schlecht spielte und nichts zusammenpasste. Anders konnte ich es nicht sagen. Womöglich zweifelte ich zu viel, das konnte gut sein. Talent hatte man mir bescheinigt, aber irgendwie war man dann doch überrascht gewesen, als ich in Bogotá im Finale stand. Als hätte man es mir nicht zugetraut. Ich jedenfalls hatte es mir zugetraut. Ich hatte das Feld mit all meiner Kraft von hinten aufgeräumt. In Mexiko war es dann aber schon wieder anders gewesen, als wäre ich eine Amateurin und nicht schon einige Jahre Profispielerin. Über die Gründe meiner Aufs und Abs – manchmal innerhalb recht kurzer Zeit – würde ich wohl noch intensiver nachdenken müssen.
Pierre startete wieder den Motor, es ging weiter – fragte sich nur, wie lange. Jedes Mal war es aufs Neue umständlich, in Paris die Flughäfen zu wechseln. Besonders suboptimal war es allerdings, wenn man spätabends aus Mexiko kam, in Orly landete und sehr früh am nächsten Morgen vom über vierzig Kilometer entfernten Charles-de-Gaulle-Airport weiterfliegen musste. Zumal – ungeachtet der vorgerückten Stunde – die Menschenschlange am Taxistand in Orly endlos war und ich aus Kostengründen noch den billigsten Flug hatte nehmen müssen, selbstverständlich mit vielen Stopovers.
Auf jeden Fall hatte ich spontan zugestimmt, als ein halbwegs vertrauenswürdig aussehender Autofahrer neben mir anhielt und in gebrochenem Englisch anbot, mich mitzunehmen. „Charles de Gaulle? Oui, no problem! But first … pick up … an old friend, d’accord?“, hatte er gefragt. Wir mussten auf der Fahrt also noch einen Freund von ihm abholen. Warum auch nicht, ich stieg ein. Denn der Preis, den er verlangte, war deutlich unter dem, was ein normales Taxi gekostet hätte. Das war eine große Verlockung gewesen, da ich zu der Zeit immer wieder auf die Finanzen schauen musste. Immerhin waren die Preisgelder niedrig und die Ausgaben hoch. Außerdem: Ich hatte Bogotá und Acapulco unbeschadet überstanden, ohne ausgeraubt zu werden. Wie absurd wäre es, jetzt in Paris abgezockt zu werden? Pierre, ich musste es zugeben, sah mit seinen dunklen Locken und der markanten Nase ziemlich gut aus, Charme hatte er auch, nur war er ein miserabler Fahrer. Während er mich im Pariser Stockdunkel von A über B (Freund abholen) nach C wie Charles de Gaulle brachte, hoffte ich still, dass alles gut gehen würde.
Hoch rechnete ich ihm an, dass er sich nicht verpflichtet fühlte, unentwegt auf mich einzureden. Er ließ mich in meinen Gedanken, doch nach einer halben Stunde, während wir immer noch auf freie Fahrt warteten, sah ich plötzlich auf dem Armaturenbrett eine gelbe Lampe aufblinken. Kein gutes Zeichen, oder? Eine deutliche Reaktion von Pierre war Antwort genug. Erneut schlug er mit seinen Handballen auf das Lenkrad, diesmal aber sichtlich unbeherrschter als zuvor, seine Locken wirbelten wild um seinen Kopf. Kurz danach riss er die Fahrertür auf, sprang mit einem Satz auf die Straße und öffnete mit einem beherzten Ruck die Motorhaube. Für eine gefühlte Ewigkeit tauchte er im Herzstück seines Wagens ab und war für mich nicht mehr sichtbar. Was tun? Sollte ich die Gelegenheit nutzen, einfach mein Zeug schnappen und verschwinden, weil der Wagen seinen Geist aufgegeben hatte? Aber was hieß schon verschwinden? Ich würde verloren auf der Autobahn stehen, um ein Uhr nachts, im Regen, im Nirwana zwischen zwei Flughäfen. Die Chance, ausgerechnet hier, im Match-de-Football-Chaos, ein freies Taxi zu bekommen, ging wohl gegen null. Und teurer wäre es allemal.
„Ich muss da jetzt durch“, sagte ich mir, hörbar und mit Nachdruck. Als könnten Lautstärke und Vehemenz meiner Worte mich tatsächlich davon überzeugen, dass alles noch gut ausgehen würde. Aber was, wenn das hier ein abgekartetes Spiel war, wenn Pierre auf vertrauenswürdig machte, um in der Finsternis hilflose Frauen zu verladen und dann zu verschleppen? Was könnte ich machen, wenn dieser Verdacht tatsächlich stimmte? Ich könnte meine Mutter anrufen und um Hilfe bitten. Aber wenn Beata das Klingeln nicht hörte, weil sie schon schlief? Sie war bestimmt längst im Bett. Doch das wäre nicht das einzige Hindernis: Meine Mutter war die wichtigste Person; sie organisierte meine Reisen, machte meine Termine, beriet mich, kümmerte sich um mich und hielt ihre beschützende Hand über mich – so gut es eben ging. Aber was sollte sie von Kiel aus gegen einen möglichen Unhold ausrichten können? Nichts. Zudem war ich mehr oder weniger erwachsen und hatte schon andere Krisen bewältigt. Ich war für mich allein verantwortlich, ich würde auch diese Situation meistern. Seit Jahren war ich auf vielen Kontinenten unterwegs und hatte gelernt, auf meinen Bauch zu hören, wenn es um Menschen ging, die ich nicht kannte, die mir fremd waren. Bislang hatte ich mich nur in wenigen Fällen getäuscht, und bei diesen war es auch nie um etwas Bedrohliches gegangen. In gefährlichen Situationen wären meine Sinne auch stärker geschärft gewesen.
Vielleicht hatte ich in Kolumbien einfach nur zu viele Gewaltgeschichten gehört, sodass meine Fantasie gerade mit mir durchging. Bei aller Angst machte sich durch die Erschöpfung der langen Reise auch etwas Gleichgültigkeit breit. Höchstwahrscheinlich war Pierre ein netter Kerl, der seinen Mitmenschen gern einen Gefallen tat – oder der wie ich gerade finanziell klamm war und sich mit seinen Fahrten etwas dazuverdienen wollte. Da sein Gefährt nicht gerade das neueste Modell war, erschien mir das sehr logisch.
Ein lautes Geräusch holte mich zurück in die Realität. Pierre hatte die Motorhaube zugeklappt und saß einen Augenaufschlag später wieder neben mir. Seine entspannte Miene verriet: alles in Ordnung. Das Anlassen des Motors gelang auch gleich beim ersten Versuch. Mittlerweile war mein Gemütszustand im Bereich der völligen Gelassenheit angekommen. Nichts würde mich mehr überraschen.
„Voilà“, meinte Pierre sichtlich zufrieden.
„Voilà“, entgegnete ich, womit mein Französischwortschatz ehrlicherweise erschöpft war. Doch mehr musste ich auch nicht sagen, denn genau in diesem Moment sah ich, dass das Meer aus grellroten Punkten auf der von Regentropfen übersäten Windschutzscheibe sukzessive verblasste. Die erloschenen Bremslichter der vor uns stehenden Autos signalisierten: Weiter geht’s! Langsam setzte sich die Karawane in Bewegung, und wie auf Kommando hörte auch der Regen auf.
Ich war froh, dass ich im Wagen geblieben war und weiterhin meinem ersten Eindruck von Pierre vertraute. Er wollte nun offenbar von der Autobahn abfahren, denn er hatte den Blinker gesetzt. Station B war wohl dran, der Freund, der abgeholt werden musste.
Und schon bestätigte Pierre meine Vermutung: „Un ami … you know“, sagte er und versuchte, die ihm fehlenden Worte durch erklärende Handbewegungen zu ersetzen. Dann schnappte er sich sein Handy, und wenig später sprudelte es förmlich aus ihm heraus. Ich verstand nur Satzfetzen. Offenbar sollte der Freund an irgendeiner Straße auf uns warten. Ein paar Minuten nachdem Pierre das Gespräch beendet hatte, tauchte der im Scheinwerferlicht am Straßenrand auf, wie Pierre etwa Mitte, Ende zwanzig, kastanienbraune Haare, fast streichholzkurz.
„Salut“, rief er beim Einsteigen zur Begrüßung und warf mein Racketbag kurzerhand auf meine Sporttasche, um auf der Rückbank Platz zu finden. Ob ich wollte oder nicht, die Reisegruppe wurde größer.
Die beiden Männer fingen sofort an, munter miteinander zu reden. Ich versank ein bisschen tiefer im Sitz und stellte erleichtert fest, dass Pierre wieder zurück auf die Autobahn fuhr.
Während die zwei Männer weiter in ihr Gespräch vertieft waren, tauchten vor meinem inneren Auge Bilder von mir auf, wie ich schon als kleines Mädchen für den Tennissport brannte. Meine Großmutter mütterlicherseits erzählte gern die Geschichte, dass ich selbst die Zeit beim Zähneputzen im Bad genutzt hätte, um einen Softball mit einem Minischläger an die Wand zu schlagen, irgendwie zwischen Waschbecken und Badewanne. Das XS-Racket hatte ich dann im Alter von drei Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen, damals zogen wir von Bremen – der Stadt, in der ich geboren wurde – nach Kiel um. Und danach hatte ich den Schläger quasi nicht mehr aus der Hand gelegt. Nachts stand er neben meinem Bett an einen Schrank gelehnt. Behütet wie der heilige Gral. Alte Fotos zeigen, wie ich ihn durch unsere Wohnung ziehe, die sich über der Gastwirtschaft einer Tennishalle in Kiel befand. Meine Eltern hatten die Wohnung bekommen, als mein Vater den Job als Tennistrainer annahm.
Nur eine Treppe trennte mich von den sechs Courts mit dem grünen Teppichbelag. Wenn meine Mutter unten im Büro der Halle arbeitete und mich mitnahm, ließ ich mir diese Chance so gut wie nie entgehen und funktionierte das benachbarte Foyer mit seinen zahlreichen Scheiben kurzum in meinen kleinen Centre Court um. Ich liebte Tennis. Ich lebte Tennis. Von Kindesbeinen an. Es war eine Selbstverständlichkeit, dass sich bei uns zu Hause fast alles um diesen Sport drehte. Meine Eltern spielten selbst meisterhaft Tennis und gaben mir Unterricht. Und da sie beide zeitweise als Coaches arbeiteten, nahmen sie mich jedes Mal am Wochenende zu ihren Punktspielen mit. Die Weichen waren früh gestellt.