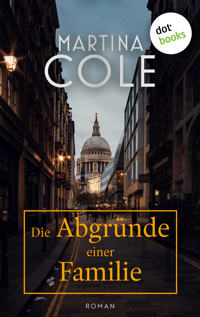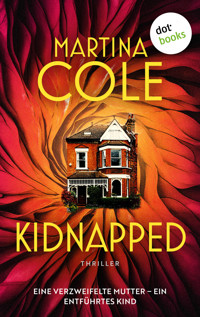4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie hat alles verloren – nun soll das Leben nach ihren Regeln spielen … London in den 50er Jahren: Dass die Bewohner der Lancaster Road sich nicht um das Gesetz scheren, ist allgemein bekannt. Auch Mauras Geschwister sehen keinen anderen Weg als die Kriminalität, um aus der verheerenden Armut auszubrechen, in der sie aufwachsen. Allen voran ihr älterer Bruder Michael, der zum König von Londons Unterwelt aufsteigt. Maura will mit all dem nichts zu tun haben – bis zu dem schicksalhaften Tag, der ihr Leben für immer verändert: Von ihrer großen Liebe, einem Polizisten, im dunkelsten Moment im Stich gelassen, schließt sie sich verbittert ihrem Bruder an und wird schon bald zu seiner skrupellosen rechten Hand. Doch wer den Coup des Jahrhunderts plant, muss sich vor dem Gesetz fürchten … »Von Anfang an hat Martina Cole uneingeschränkte Anerkennung für ihre unverwechselbar und kraftvoll geschriebenen Bücher erhalten.« The Times Das gefeierte Debüt der britischen Bestsellerautorin, eine düstere Mafia-Familiensaga, die sich über mehrere Jahrzehnte spannt und wie gemacht ist für alle Fans von Peaky Blinders und Jeffrey Archer!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 799
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
London in den 50er Jahren: Dass die Bewohner der Lancaster Road sich nicht um das Gesetz scheren, ist allgemein bekannt. Auch Mauras Geschwister sehen keinen anderen Weg als die Kriminalität, um aus der verheerenden Armut auszubrechen, in der sie aufwachsen. Allen voran ihr älterer Bruder Michael, der zum König von Londons Unterwelt aufsteigt. Maura will mit all dem nichts zu tun haben – bis zu dem schicksalhaften Tag, der ihr Leben für immer verändert: Von ihrer großen Liebe, einem Polizisten, im dunkelsten Moment im Stich gelassen, schließt sie sich verbittert ihrem Bruder an und wird schon bald zu seiner skrupellosen rechten Hand. Doch wer den Coup des Jahrhunderts plant, muss sich vor dem Gesetz fürchten …
Über die Autorin:
Martina Cole ist eine britische Spannungs-Bestsellerautorin, die bekannt für ihren knallharten, kompromisslosen und eindringlichen Schreibstil ist. Ihre Bücher wurden für Fernsehen und Theater adaptiert und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Martina Cole hält regelmäßig Kurse für kreatives Schreiben in britischen Gefängnissen ab. Sie ist Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation »Gingerbread« für Alleinerziehende und von »Women's Aid«.
Die Website der Autorin: martinacole.co.uk/
Die Autorin bei Facebook: facebook.com/OfficialMartinaCole/
Bei dotbooks veröffentlichte Martina Cole »Die Gefangene«, »Die Tochter«, »Kidnapped«, »Perfect Family«, »The Runaway«, »Eine irische Familie«, »Die Ehre der Familie«, und »Die Abgründe einer Familie«.
***
eBook-Neuausgabe April 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Originaltitel »Dangerous Lady« bei Headline Book Publishing PLC, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1994 unter dem Titel »Gefährliche Lady« bei Heyne.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1992 by Martina Cole
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1994 der deutschen Ausgabe by R. Piper GmbH & Co. KG, München Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-656-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Martina Cole
Eine irische Familie
Thriller
Aus dem Englischen von Susanne Aeckerle
dotbooks.
Widmung
Für meine Eltern
Buch eins
London, Notting Hill
Geld mußt du machen, Geld;
wenn es geht, mit Recht und Anstand,
wenn nicht, unter allen Umständen Geld.
Horaz, 65-8 v. Chr.
Soll ich meines Bruders Hüter sein?
Genesis 4, Vers 9
Kapitel 1
1950
»Sie kommen aber verdammt spät!«
Dr. Martin O’Reilly sah den Jungen an und seufzte.
»Ich mußte noch einen Krankenbesuch machen. Jetzt sag mir lieber, wo deine Mutter ist.«
»Im Bett, wo denn sonst.«
Der Junge setzte sich wieder auf die Treppe zu seinen sieben Brüdern, der jüngste drei, der älteste vierzehn. Der Doktor zündete sich eine Zigarre an. Er blieb ein paar Sekunden stehen und sog kräftig daran, um sicher zu sein, daß sie auch ordentlich brannte. Der Geruch einer geballten Ladung Ryans konnte selbst dem stärksten Mann den Magen umdrehen, obwohl ihm der Slumgestank nun wohl schon permanent in der Nase saß. Er durchsetzte die Kleider und drang durch die Poren bis tief unter die Haut. Vorsichtig begann O’Reilly den Treppenaufstieg, sorgsam darauf bedacht, auf keine der kleinen Hände zu treten. Die Kinder rutschten nach rechts und links weg, um ihm Platz zu machen. Genauso sorgsam vermied er jede Berührung mit der Wand. Den Gestank konnte er mit seiner Zigarre bekämpfen, doch die Kakerlaken – an die würde er sich nie gewöhnen. Wie die Viecher es schafften, senkrechte Wände raufzukrabbeln, war ihm einfach unbegreiflich. Das spottete doch allen Gesetzen der Schwerkraft!
Oben angekommen, stieß er die erste Tür auf und stand vor Sarah Ryan. Sie lag auf dem großen Doppelbett, ihr Bauch riesig und aufgetrieben. Er lächelte ihr zu, wobei ihm schier das Herz brechen wollte. Sarah Ryan war vierunddreißig Jahre alt. Ihr fahles blondes Haar war zu einem straffen Knoten geschlungen, die Haut bleich und trocken. Wären da nicht die leuchtenden, wachen Augen gewesen, hätte man sie für einen Leichnam halten können. Er konnte sich noch erinnern, wie er vor fünfzehn Jahren in dieses Haus gekommen war, um ihr erstes Kind zu entbinden. Was war sie doch für eine gutaussehende Frau gewesen! Nun war ihr Körper aufgeschwemmt und zernarbt von den ständigen Schwangerschaften, ihr Gesicht vorzeitig gealtert und voller Sorgenfalten.
»Ist wohl bald soweit?« fragte er freundlich.
Sarah versuchte sich aufzurichten. Die alte Zeitung, die unter ihr lag, raschelte bei der Bewegung. »Ja. Danke, daß Sie gekommen sind, Martin. Ich hab die kleinen Rotznasen losgeschickt, ihren Dad zu suchen, aber der hat sich natürlich mal wieder dünne gemacht.«
Sie umklammerte ihren Leib, als eine neue Wehe sie überkam. »Oh, dies hier kann’s kaum mehr erwarten, auf die Welt zu kommen.« Sie lächelte schwach. Dann weiteten sich ihre Augen, als sie sah, daß der Doktor eine Spritze aus seiner Tasche nahm.
»Das Ding werden Sie nicht in mich reinpieksen! Ich hab’s Ihnen schon beim letzten Mal gesagt. Ich will die verdammten Spritzen nicht. Das ist mein dreizehntes Kind, und bei keinem hab ich so was gebraucht. Nicht mal bei den Totgeburten. Ich will nichts davon wissen!«
»Nun kommen Sie, Sarah. Das macht es Ihnen leichter.«
Sie hob die Hand, um seinen Protest abzuwehren. »Tut mir leid, aber das Zeug tut höllisch weh. Dagegen ist Kinderkriegen der reinste ... reinste Klacks.«
Martin legte die Spritze auf den kleinen Nachtkasten, seufzte tief und zog die Decke über ihren Beinen weg. Seine geübten Hände tasteten die Seiten ihres Bauches ab. Dann ließ er zwei Finger in ihre Vagina gleiten. Als er fertig war, zog er die Decke wieder über sie.
»Ich fürchte, es ist eine Steißlage.«
Sarah zuckte die Schultern.
»Das wär das erste Mal. Bisher hab ich’s ja ganz gut hingekriegt. Ben sagte neulich, demnächst werden sie einfach aus mir rausplumpsen, wenn ich beim Kaufmann bin.«
Sie lachte, und der Doktor lachte mit ihr.
»Dann wär ich ja arbeitslos. Nun entspannen Sie sich, Sarah. Ich bin gleich wieder da. Ich möchte, daß einer der Jungen was für mich erledigt.« Er verließ das Zimmer und schloß leise die Tür hinter sich.
»Ist es endlich da?« Das kam von dem achtjährigen Leslie, der ihm vorhin die Tür aufgemacht hatte.
»Nein, es ist noch nicht soweit. Nur nicht so ungeduldig, du kleiner Hitzkopf.«
Der Doktor wandte sich an Michael, den Ältesten. Mit seinen knapp fünfzehn Jahren war er bereits über ein Meter achtzig groß und überragte den kleinen irischen Arzt bei weitem.
»Geh und hol die alte Mutter Jenkins, Michael. Ich werde diesmal Hilfe brauchen.«
Der Junge blickte starr auf den Doktor hinab. »Meine Mutter wird es doch schaffen, oder?« Seine Stimme klang tief und besorgt.
Der Doktor nickte. »Natürlich wird sie das.«
Noch immer rührte sich der Junge nicht.
»Bisher hat sie die alte Mutter Jenkins aber nie gebraucht.«
Der Doktor sah ungeduldig zu ihm auf. »Hör mal, Michael, ich kann hier nicht den ganzen Tag mit dir verplempern. Deiner Mum geht es schlecht, aber wenn wir es schaffen, dieses Baby auf die Welt zu bringen, kommt sie schon wieder auf die Beine. Je schneller du Mrs. Jenkins herbringst, desto besser. Die Zeit wird knapp.«
Michael wandte sich langsam ab. Mit einer Hand am Geländer, der anderen an der Wand, rutschte und sprang er über die Köpfe seiner Brüder die Treppe hinab. Als er unten schwer auf dem Linoleumboden aufkam, rief ihm der Arzt nach: »Sag ihr, daß ich die zehn Shilling zahle, sonst kommt sie nicht.«
Michael winkte, zum Zeichen, daß er den Doktor gehört hatte, riß die Haustür auf und stürmte hinaus.
Der Doktor sah auf die Köpfe der jüngeren Kinder hinab und biß noch härter auf seine Zigarre. Durch Michaels wilde Rutschpartie waren die Kakerlaken von der Wand gefallen. Benny, dem Jüngsten, krabbelten sie nicht nur über die Kleider, eine besonders mutige kroch ihm sogar langsam über das Gesicht. Martin sah, wie das Kind sie gleichgültig wegschnipste und nahm sich vor, den Hauswirt aufzufordern, das Haus ausräuchern zu lassen. Damit war man die verdammten Dinger zwar nicht für immer los, aber den Ryans wäre wenigstens eine Verschnaufpause gegönnt.
»So, und ein paar von euch laufen jetzt los und suchen euren Vater.« Geoffrey, Anthony und Leslie sprangen auf. Der Doktor zeigte nacheinander auf jeden der Jungs. »Du, Geoffrey, versuchst es im Latimer Arms. Du, Anthony, gehst rauf zum Roundhouse. Und du ...«
Leslie nickte, blickte aber starr zu Boden.
»... gehst zum Kensington Park Hotel. Wenn ihr ihn dort nicht findet, versucht es im Bramley Arms. Solltet ihr euren Dad aber doch irgendwo auftreiben, sagt ihm, er soll nach Hause kommen, weil er hier gebraucht wird. Könnt ihr das behalten?«
Drei Köpfe nickten einmütig und verschwanden durch die Haustür. Martin ging zu Sarah zurück.
»Das sind schon prima Jungs, die Sie da haben.«
Ihre Stimme klang skeptisch. »Ich weiß nicht so recht. Manchmal sind sie ein bißchen wild. Da ist der Alte dran schuld. Erst verprügelt er sie fürs Klauen, dann schickt er sie selbst dazu los. Sie können machen, was sie wollen, nie ist es recht.«
Sie krümmte sich unter der nächsten Wehe zusammen.
»Entspannen Sie sich, Sarah.« Er strich ihr ein paar Haarsträhnen aus dem Gesicht. Draußen wurde es dunkel, darum zog er die Vorhänge zu und knipste das Deckenlicht an. Er zündete sich am glühenden Stummel der ersten eine weitere Zigarre an. Dann untersuchte er sie erneut, die Zigarre fest zwischen die Zähne geklemmt. Als er sich wieder aufrichtete, lag ein besorgter Blick auf seinem Gesicht. Er entspannte sich sichtbar, als er eine Stimme im Flur hörte. Kurz darauf öffnete Mutter Jenkins die Tür. Wuchtig, mit ihren gut zweihundert Pfund Lebendgewicht, baute sie sich am Fußende von Sarahs Bett auf.
»Alles klar, Doktor?« Das war eine Begrüßung, keine Frage.
»Alles klar, Sarah? Diese verflixten Treppen. Bringen mich völlig aus der Puste. Aber diese Jungs!« Sie wedelte mit den Händen. »Wie die aufgescheuchten Hühner. Kaum haben sie mich gesehen, sind sie nach allen Seiten davongestoben!« Ihr tiefes, dröhnendes Lachen erfüllte den Raum. Wo ihr der Doktor doch die zehn Shilling zahlte, konnte sie sich wohl erlauben, freundlich zu sein.
»Sie sind ja auch ein beeindruckendes Frauenzimmer, Matilda, alles was recht ist. Nun gehen Sie wieder runter und machen Sie mir eine ordentliche Menge Wasser heiß. Ich muß meine Sachen sterilisieren. Der kleine Kerl hier ist eine Steißlage.«
Matilda nickte heftig mit dem Kopf.
»Jawoll, Doktor. Ich schick zu den Nachbarn rum, die solln ihre Kessel aufsetzen. Vielleicht fällt für uns sogar ein Täßchen Tee dabei ab.«
Als sie aus dem Raum stampfte, blitzte Sarah den Doktor wütend an.
»Was tut die hier? Ich hab keine zehn Shilling, und wenn, würde ich sie den Kindern geben. Die haben seit gestern nichts gegessen, und falls dieser Kerl, der mein Mann ist, nicht bald nach Hause kommt, gibt’s heute wieder nichts! So wie ich den kenne, ist der bei irgend ’nem billigen Flittchen und taucht nicht vor morgen auf!«
Sie war den Tränen nahe.
»Nun beruhigen Sie sich, Sarah. Ich bezahle sie.« Er griff nach ihrer Hand. »Still jetzt, meine Liebe. Das hier schaffe ich nicht alleine. Also pscht jetzt, und sparen Sie sich Ihre Kräfte!«
Sarah fiel mit schweißnassem Gesicht in die Kissen zurück. Ihre Lippen waren rissig und trocken. Mühsam lehnte sie sich zum Nachttisch hinüber, griff nach dem Wasserglas und trank dankbar ein paar Schlucke der lauwarmen Flüssigkeit. Kurze Zeit später brachte Matilda eine dampfende Wasserkumme herein. Der Doktor machte sich daran, seine Instrumente zu sterilisieren, darunter auch eine große Schere.
Um neun Uhr abends war Sarah in höchsten Nöten, und das Kind mit ihr. Zweimal hatte der Doktor versucht, seinen Arm in sie hineinzuzwängen und das Kind umzudrehen, und jedesmal war es ihm mißlungen. Er wischte sich die Hände an einem Tuch ab, das er mitgebracht hatte.
Das Baby mußte raus, und zwar bald, sonst würde er sie beide verlieren. Dieser verfluchte Benjamin Ryan! Es war immer dasselbe. Jedes Jahr machte er ihr ein Kind, aber nie war er da, wenn sie zur Welt kamen.
Die kleinen Jungen hielten weiter auf der Treppe Wacht. Alle waren müde und hungrig. Michael, der oben an der Treppe stand, verfluchte im stillen den Vater, während er in die kleinen Gesichter seiner Brüder sah. Benny nuckelte am Ärmel seiner Jacke.
Plötzlich wurde laut gegen die Haustür geklopft. Der sechsjährige Garry machte auf, wurde aber glatt von den zwei hereinstürmenden Polizisten zur Seite geschleudert. Michael warf ihnen nur einen Blick zu und stürzte leise fluchend ins Schlafzimmer seiner Mutter. Von der Treppe waren Schreie zu hören, als die beiden Polizisten sich nach oben kämpften, woran sie von den restlichen Jungs nach Kräften gehindert wurden, in der Hoffnung, dem Bruder so zur Flucht zu verhelfen.
Michael hatte das Schlafzimmerfenster geöffnet und hing halb draußen, halb drinnen, als die Polizisten ins Zimmer stürmten.
Dann ging das Licht aus.
»Wer von euch hat das Licht ausgemacht, ihr kleinen Rotzer?«
»Keiner hat das verdammte Licht ausgemacht. Der Strom ist weg.« Sarahs Stimme war sehr schwach. Die Polizisten knipsten ihre Taschenlampen an.
»Kommen Sie hier rüber mit dem Licht. Die Frau ist in Lebensgefahr.« Die Dringlichkeit in der Stimme des Arztes ließ die beiden Männer augenblicklich ans Bett treten. Der Junge war längst über alle Berge, das wußte sie. Sarah wand sich vor Schmerzen, ihre Wangen tränenüberströmt.
»Ihr seid doch nur auf Blut aus. Mein Junge hat nichts Unrechtes getan.«
Matilda Jenkins mischte sich ein. »Hat denn niemand einen Shilling für den Zähler?«
»Ich mach das schon.« Der jüngere der beiden Polizisten kramte in seiner Hosentasche nach Kleingeld. Er ließ seinen Kollegen bei dem Doktor zurück, ging hinaus und tastete sich die Treppe hinunter. So behutsam wie möglich wich er den Kindern aus, duckte sich in die Abseite unter die Treppe, fand den Zähler und warf einen Shilling ein. Dann noch einen. Schließlich trat er heraus und knipste die Taschenlampe aus. Sieben Augenpaare waren in offener Feindseligkeit auf ihn gerichtet, selbst die des Jüngsten, noch keine vier Jahre alt. Der Mann betrachtete die Jungs, als sähe er sie zum ersten Mal. Ihre Köpfe waren fast kahlgeschoren, um der Läuse Herr zu werden, und aus den löchrigen Pullovern schauten knochige Ellbogen heraus. Eine Weile stand er nur da und starrte sie an. Zum ersten Mal ging ihm auf, wie es wohl sein mußte, so zu leben, und ihn überkam ein Gefühl von Trauer und Sinnlosigkeit. Er nahm eine Zehnshillingnote aus dem Geldbeutel und hielt sie Geoffrey, dem Zweitältesten, hin.
»Lauf rüber zu Messers und hol für euch alle Fisch und Chips.«
»Wir wolln kein Bullengeld!«
»Nun hör sich das einer an! Ein ganz Hartgesottener! Paß auf, du Schlaukopf, deine kleinen Brüder sind am Verhungern, also tu, was ich dir sage!«
Er drückte Geoffrey das Geld in die Hand. Alles in dem Jungen sträubte sich, Geld von einem Polizisten, ihrem Erzfeind, anzunehmen, doch ein Blick in die Gesichter seiner kleinen Brüder ließ ihn weich werden. Sie hatten seit fast zwei Tagen nichts zu essen gekriegt. Mürrisch drängte er sich an dem Mann vorbei, der ihn am Arm packte.
»Sag deinem Bruder, daß wir ihn am Ende doch kriegen, also kann er sich genausogut gleich stellen.«
Wütend riß Geoffrey sich los. Er warf dem Mann einen Blick abgrundtiefer Verachtung zu, öffnete die Haustür und verschwand. Der Polizist ging kopfschüttelnd nach oben zurück.
Im Schlafzimmer kämpfte Sarah mit aller verbliebenen Kraft darum, das Kind zu gebären. Der andere Polizist hielt sie fest, während der Doktor einen Dammschnitt machte. Er hatte den Schnitt noch nicht beendet, als sie mit einem gewaltigen Pressen, das sie bis zum Hinterteil aufriß, das Kind herausdrückte. Es war immer noch in der Fruchtblase. Der Doktor schnitt sie auf und sah in das kleine, blau angelaufene Gesicht. Er säuberte die Nase des Babys und blies ihm sanft in den Mund, während er vorsichtig auf den winzigen Brustkorb drückte. Das Baby hustete und ließ einen ersten kleinen Schrei los. Dann, nach einem tiefen Atemzug, schrie es, was das Zeug hielt. Wie der Blitz hatte der Doktor die Nabelschnur durchschnitten, Matilda Jenkins das Kind übergeben und nähte nun in fliegender Eile Sarah wieder zusammen, als hinge sein eigenes Leben davon ab.
Sie lag erschöpft in den Kissen, ihr ganzer Körper gefühllos, wie taub. Sie schwor sich, daß dies ihr letztes Kind sein würde.
»Dein erstes Mädchen, Sarah«, meinte Matilda freundlich.
Sarah setzte sich auf, sprachlos, und ein Leuchten ging über ihr Gesicht. Sie lächelte breit, wobei all ihre großen, gelblichen Zähne zum Vorschein kamen.
»Du machst Witze! Ich dachte, es wär wieder ein Junge. Ein Mädchen! Ist das wirklich wahr?«
Selbst die Polizisten lächelten ihr zu. Sie war ehrlich verblüfft.
»Oh, gib sie mir. Laß sie mich halten! Endlich eine Tochter, Gott sei’s gedankt!«
Matilda legte ihr das Kind in die Arme. Das Baby war nun sauber gewaschen, und Sarah schaute in die blauesten Augen, die sie je gesehen hatte.
»Sie ist eine Schönheit, Sarah.«
Voller Wunder betrachtete Sarah ihre Tochter. Es war ihr dreizehntes Kind, aber das erste Mädchen. Alle Müdigkeit war vergessen, als sie die Tochter bestaunte. Dann blickte sie in die lächelnden Gesichter um sie herum, und ihr fiel wieder ein, warum die Polizisten gekommen waren. Den Älteren kannte sie nun schon seit fast fünfzehn Jahren. Selbst während des Krieges hatte Ben es nicht lassen können.
»Was soll mein Mickey denn angestellt haben?« Ihre Stimme klang flach.
»Er arbeitet wieder für einen Buchmacher, Sarah. Ich hab ihn jetzt zweimal verwarnt. Diesmal loch ich ihn ein. Sag ihm das, Sarah, und sag ihm, er soll zu mir kommen.«
Sie sah ihre Tochter an. Der Doktor hatte seine Arbeit beendet und Sarah, nachdem er die Zeitung unter ihr weggezogen hatte, wieder ordentlich zugedeckt. Sie hob den Kopf.
»Ich sag’s ihm, Frank, aber er ist wie sein Vater. Er geht seine eigenen Wege.« Ihre Stimme war leise geworden.
Matilda Jenkins öffnete die Schlafzimmertür und rief die Jungs herein. Sie kamen einer nach dem anderen reingetrottet, kauten an ihrem Fisch mit Chips und drängten sich um das Bett. Benny konnte nichts sehen, darum zog er den Doktor am Kittel.
»Was willst du, Kleiner?«
Bennys Affengesichtchen blickte zu ihm auf. Sein Mund war voller Fisch.
»Ist es Hovis?«
»Hovis?« Der Doktor war verwirrt. »Wovon sprichst du, Junge?«
»Na, Hovis ... braunes Brot. Also ist es das?«
Der Doktor schaute sich fragend um.
»Braunes Brot? Bist du von Sinnen, Kind?«
»Er meint, ob es tot ist. Braunes Brot ... mausetot. Kapiert?«
Das kam von Anthony, und sein Ton machte deutlich, daß wenn hier jemand nicht ganz richtig im Kopf war, dann bestimmt nicht sein kleiner Bruder.
»Braunes Brot, gütiger Himmel! Nein, ganz und gar nicht. Es ist äußerst lebendig. Jetzt iß deine Chips, du kleiner Heide. Braunes Brot, also so was!«
Die Polizisten lachten.
»Wie lange sind Sie schon in London, Doc?« fragte der Ältere. »Seit zwanzig Jahren? Und Sie verstehen uns immer noch nicht?« Sie schienen das äußerst komisch zu finden. »Wir machen uns besser auf den Weg, Sar. Vergiß nicht, Michael Bescheid zu sagen, wenn er auftaucht.«
»Ich vergeß es nicht. Ich sag’s ihm, aber er wird nicht kommen. Das weißt du.«
»Na, dann versuch wenigstens, ihn zu überreden. Viel Glück mit dem Neuankömmling. Wiedersehn.« Die beiden Männer gingen hinaus.
Sarah sah ihre Söhne an und lächelte.
»Es ist ein Mädchen!«
Die Jungs grinsten zurück.
»Eine Tochter für meine alten Tage.« Sie drückte das Kind an sich. »Ich werde sie Maura nennen. Maura Ryan. Das gefällt mir.«
»Soll ich Mickey holen gehen, Mum? Ich hab ihm ein paar Chips aufgehoben.«
»Ja, tu das, Geoffrey. Sag ihm, die Luft ist rein.«
Der Doktor hielt mit dem Einpacken seiner Instrumente inne und warf Sarah einen scharfen Blick zu.
»Sie wußten die ganze Zeit, wo er war?«
Sie grinste ihn an. »Klar doch. Er ist im Anderson-Luftschutzkeller, Nummer 119. Da versteckt er sich immer vor den Bullen.«
Als ihm das Komische an der Sache aufging, warf Martin O’Reilly den Kopf zurück und lachte laut. Sieben Münder hörten auf zu kauen, und sieben Augenpaare starrten ihn verdutzt an.
»Was für eine Nacht! Ihre kleine Tochter hat sich weiß Gott den rechten Zeitpunkt für ihr Erscheinen ausgesucht. Sie hat ihrem Bruder Michael heute nacht die Haut gerettet, soviel ist sicher.«
Auch Sarah lachte leise in sich hinein. »Das hat sie allerdings!«
Pat Johnstone, Sarahs beste Freundin und Nachbarin, kam mit einem Teetablett durch die Schlafzimmertür. Sie scheuchte die Jungs raus und goß Sarah eine starke Tasse Tee ein.
»Hier, Mädel. Das wird dir guttun. Was ist mit Ihnen, Doktor? Wolln Sie auch welchen?«
»Ja, sehr gerne. Ich bin völlig ausgedörrt.«
Pat goß dem Doktor eine Tasse ein und stellte sie auf den Nachtkasten. Dann setzte sie sich neben Sarah aufs Bett. Sie betrachtete das Baby und hielt überrascht die Luft an.
»O mein Gott! Das ist ja ein echter Wonneproppen!« Ihre normalerweise schon laute Stimme schien von den Wänden widerzuhallen. »Laß sie mich mal halten, Sar.«
Sarah gab ihr das Kind und nahm einen großen Schluck Tee. »Genau was ich jetzt brauche, Pat.«
»Stimmt es, daß die Greifer hinter deinem Mickey her waren und das Elektrische ausging? Ich hab mir fast vor Lachen in die Hose gemacht, als Mrs. Jenkins mir davon erzählt hat, so komisch fand ich das.«
Sarah verdrehte die Augen zur Decke. »O bitte, Pat. Erinnere mich bloß nicht daran!«
Der Doktor packte seine letzten Sachen ein und trank seinen Tee aus. »Das war köstlich. Hat mir richtig gutgetan. Ich muß jetzt los, Sarah. Stehn Sie ja nicht auf, bevor ich es Ihnen erlaube. Ich mußte Sie ganz schön zusammenflicken. Falls Sie anfangen zu bluten, soll einer der Jungs mich holen. In Ordnung?«
»Ja gut, Martin. Und danke für alles.«
»Nichts zu danken. Ich komme morgen früh wieder vorbei. Wiedersehn.«
Er verließ das Schlafzimmer und stieg die Treppe zum Flur hinunter, wo Matilda Jenkins schon mit aufgehaltener Hand auf ihn wartete. Er legte die Zehnshillingnote hinein.
»Danke, Matilda. Wiedersehn.«
»Wiedersehn, Doktor O’Reilly.«
Sie schloß hinter ihm die Haustür. Er ging die Stufen zur Straße hinunter und sah nach seinem Wagen, einem Rover 90. Der war sein ganzer Stolz und seine Freude. Von den Scheibenwischern fehlte allerdings jede Spur. Er hätte wissen müssen, daß ihm das in der Lancaster Road passieren würde.
»Ihr kleinen Mistkerle!«
Er stieg in den Wagen und fuhr davon. Am 2. Mai 1950 hatte er Maura Ryan zu ihrem Eintritt in diese Welt verholfen.
Kapitel 2
1953
Sarah Ryan blickte sich in ihrer Küche um. Ein Gefühl der Zufriedenheit durchströmte sie. Es sah herrlich aus. Sie holte tief Luft und seufzte vor Wohlbehagen. Seit Jahren war sie nicht so glücklich gewesen. Der Tisch bog sich unter all den Köstlichkeiten. Ein Truthahn, ein ganzer Schinken, ein gewaltiger Rinderbraten waren auf das sorgfältigste vorbereitet und warteten nun darauf, in den Ofen geschoben zu werden. Die Küche war erfüllt vom Duft der Hackfleischpasteten und Würstchen in Teig, die im Backofen leise vor sich hin brutzelten.
Ein lautes Krachen aus dem oberen Stockwerk ließ sie aus ihren Träumen hochschrecken. Ihr Mund wurde hart. Sie öffnete die Küchentür und brüllte so laut sie konnte: »Ich warne euch! Wenn ich noch einen Mucks höre, komm ich rauf und zieh euch das Fell über die Ohren!«
Ein paar Minuten blieb sie lauschend stehen, wobei sie sich nur mit Mühe das Lächeln verkneifen konnte. Nachdem sie sicher war, daß die Kinder nun alle in ihren Betten lagen, wandte sie sich, leise vor sich hin summend, wieder ihren Vorbereitungen zu. Als letztes mußte noch der Truthahn mit dicken Speckscheiben belegt werden. Schließlich trat sie einen Schritt zurück und bewunderte ihr Werk. Dann nahm sie den Schürhaken vom Herd und schlug dreimal gegen die Schornsteinwand. Ein paar Sekunden später kamen zwei dumpfe Schläge von der anderen Seite der Wand zurück. Sarah ging zum Ausguß, füllte den Kessel mit Wasser und stellte ihn auf die Gasflamme. Als das Wasser zu kochen begann, hörte sie, wie die Hintertür geöffnet wurde, steckte ihren Kopf in die Spülküche und sah, wie sich ihre Freundin Pat Johnstone den Schnee von den Schuhen klopfte.
»Komm rein, Pat. Ich hab den Kessel schon aufgesetzt.«
»Puh, das ist vielleicht kalt draußen heute abend, Sar!«
Pat ließ sich auf einen Sessel neben dem Kamin fallen. Sichtlich beeindruckt sah sie sich in der Küche um.
»Mensch, du bist aber fein raus dieses Jahr.«
Ein Anflug von Neid hatte sich in ihre Stimme geschlichen. Sarah goß das kochende Wasser in die Teekanne und lächelte ihrer Freundin zu.
»Michael hat heute morgen das ganze Zeug hier angeschleppt. Ich konnte es selber kaum glauben, wie ich das sah! Und er hat auch noch Süßigkeiten gebracht, und Kekse und Nüsse und Obst. Er ist ein guter Junge.«
Pat nickte und überschlug im Kopf schnell, was das alles gekostet haben mochte. Es stimmte also doch, was man sich über Michael erzählte. Mit dem, was man in der Lyons-Bäckerei oder in der Black-Cat-Zigarettenfabrik verdiente, war das nicht zu bezahlen. Verbrechen zahlt sich eben doch aus, so wie’s aussah.
»Und Geschenke für die Kinder, für jeden was.« Sarah plapperte fröhlich weiter, ohne zu merken, wie sehr sie den Neid der Freundin schürte. Sie goß den Tee in zwei dicke weiße Becher und gab einen davon Pat. Ein Geschirrtuch als Topflappen benutzend, öffnete sie den Backofen und nahm das Blech mit den Pasteten und den Würstchen in Teig heraus, stellte es zum Auskühlen auf den Herd und schob den Puter hinein. Ihre Bewegungen waren flink und gewandt. Sie richtete sich auf, wischte sich die Stirn mit dem Schürzenzipfel ab, trat an den Küchenschrank und zog eine Schublade auf. Mit einem Päckchen in der Hand drehte sie sich zu Pat um.
»Hier, das hätte ich fast vergessen! Fröhliche Weihnachten.«
Pat Johnstone ließ das Päckchen in den Schoß gleiten. Schuldbewußt sah sie zu Sarah auf.
»Aber ich hab nichts für dich, Sar ... Ich hab nicht das Geld.«
Sarah winkte ab. »Ach was, halt die Klappe und mach’s auf.«
Langsam riß Pat das braune Einwickelpapier ab. Dann schlug sie die Hand vor den Mund. Ihre Stimme zitterte, als sie zu sprechen versuchte.
»Oh, Sar! Oh, ist die schön ...«
Sarah tätschelte sanft die Schulter der Freundin.
»Dachte ich mir doch, daß sie dir gefallen würde!«
Pat zog die weiße Bluse aus der Verpackung und hielt sie an ihre Wange, rieb ihre Haut an dem weichen Material.
»Fühlt sich wie Seide an!«
»Das ist Seide. Wie ich die sah, wußte ich sofort, das ist was für dich.«
All die unfreundlichen Dinge, die Pat vorher durch den Kopf gegangen waren, kamen jetzt wieder hoch. In den letzten drei Monaten war der Neid auf ihre Freundin immer stärker geworden. Angefangen hatte es an dem Tag, an dem Michael das Haus hatte ausräuchern lassen. Tagelang hatten die Schwefelkerzen gebrannt und das Haus von allem Ungeziefer befreit. Dann hatte er es vom Dach bis zum Keller neu streichen lassen. Wie die meisten Frauen in ihrer Straße war Pat Johnstone über das alles reichlich verärgert. Nach den Maßstäben der Lancaster Road ging es den Ryans einfach viel zu gut, was sie zu Außenseitern machte. Wäre Michael Ryan inzwischen nicht zu einem Machtfaktor geworden, den man besser nicht unterschätzte, hätten die anderen Bewohner sicherlich versucht, die Familie Ryan rauszuekeln.
All das schoß ihr in Sekundenschnelle durch den Kopf, und sie schämte sich dafür. Sarah und sie waren zusammen zur Schule gegangen und hatten einander über die Jahre immer gegenseitig beigestanden und geholfen. Nun machte Sarah ihr ein Geschenk; und Pat hatte das Gefühl, es nicht verdient zu haben.
»Sie ist absolut hinreißend, Sar.«
Zufrieden, daß ihre Freundin glücklich war, setzte Sarah sich ihr gegenüber und nahm eine Viertelflasche Black and White vom Kaminsims. Sie goß zwei ordentliche Portionen in ihre Teebecher.
»Das hält die Kälte ab, Pat. Gott weiß, wie sehr wir das bei diesem Wetter brauchen können.«
Pat hob den Becher hoch und prostete ihrer Freundin zu. »Fröhliche Weihnachten, Sarah ... und mögen dir noch viele solcher Weihnachtsfeste vergönnt sein.«
Vom Whisky wohlig erwärmt, machten es sich die beiden Frauen in ihren Sesseln bequem und wandten sich der wichtigsten Tagesbeschäftigung zu: dem Klatsch.
Michael Ryan ging die Bayswater Road entlang. Wie immer bewegte er sich so, als würde ihm die Straße gehören – mit hoch erhobenem Kopf, selbst bei dem herrschenden Schneetreiben. Mit seinen achtzehn Jahren bot er einen beeindruckenden Anblick. Fast ein Meter neunzig groß, von athletischer Statur, wurden seine breiten Schultern noch durch den Schnitt seines dunkelbraunen Mantels betont. Seine schwarzen, dicken, immer noch widerspenstigen Haare trug er jetzt in einer modischen Entensterz-Frisur. Seinen tiefliegenden, blitzblauen Augen schien nichts um ihn herum zu entgehen. Das einzig Weiche in seinem markanten, scharfgeschnittenen Gesicht waren die Lippen. Sie waren voll und sinnlich wie die einer Frau, obwohl sie ihm manchmal einen Anflug von Grausamkeit verliehen. Frauen wie Männer fühlten sich zu Michael Ryan hingezogen, was er sehr wohl wußte, und, wie alles andere auch, zu seinem Vorteil nutzte.
Jetzt beobachtete er die Frauen, die am Gitter zum Hyde Park lehnten. Selbst bei Schneetreiben am Weihnachtsabend waren die Huren auf ihren Plätzen.
Ein paar von den Jüngeren, neu auf dem Strich, warfen ihm interessierte Blicke zu. Eine öffnete den Mantel und enthüllte ihm ihren kaum bekleideten Körper. Michael betrachtete sie von Kopf bis Fuß und kräuselte verächtlich die Lippen. So eine würde er noch nicht einmal mit der Feuerzange anfassen. Eine der Älteren, die das Ganze beobachtet hatte, lachte laut auf.
»Mach den Mantel zu, Kind, bevor du dir die Muschi erfrierst.«
Die anderen Frauen lachten, froh über diese kleine Ablenkung. Michael ging weiter. Er hatte nichts gegen die Nutten, ja, er bewunderte sie sogar. Was sie betrieben, war für ihn ein Geschäft wie jedes andere auch. Ein Geschäft von Angebot und Nachfrage. Nur konnte er es nicht leiden, daß manche Nutten in ihm einen potentiellen Zuhälter sahen. Er bildete sich gerne ein, die Leute würden das für unter seiner Würde halten. Er überquerte die Straße, wobei er geschickt dem Verkehr auswich. Das Schneetreiben hatte nachgelassen, und die Straßen wimmelten vor Menschen, die noch in letzter Minute Weihnachtseinkäufe machten. Die Portobello Road war total verstopft gewesen.
Er betrat die miefige Wärme des Bramley Arms, schob sich zwischen den Männern zur Bar hindurch und begrüßte den einen oder anderen mit einem Kopfnicken. Während des vergangenen Jahres hatte er hart daran gearbeitet, ein bestimmtes Bild von sich aufzubauen, und das zahlte sich jetzt aus. Die Leute hatten Respekt vor ihm. Mit einem Fingerschnippen machte er das Mädchen hinter der Bar auf sich aufmerksam und bestellte einen Brandy. Eigentlich mochte er Brandy nicht sonderlich, doch er gehörte zu seinem Image. Es hob ihn von den anderen ab. Die Männer an der Bar wichen zur Seite, um ihm Platz zu machen.
Er nahm einen Schluck Brandy, ließ seine Augen durch die überfüllte Kneipe schweifen und entdeckte eine Gruppe von Männern an dem Tisch neben dem Fenster. Mit seinem Glas in der Hand ging er zu ihnen hinüber. Einer der Männer blickte auf und erschrak sichtlich, als er ihn erkannte.
Tommy Blue spürte, wie sich seine Eingeweide vor Furcht zusammenzogen. Die vier Männer am Tisch bemerkten sein Erschrecken, verstummten und wandten sich dem Neuankömmling zu. Als sie Michael Ryans Lächeln sahen, schienen sie enger zusammenzurücken und sich auf ihren Stühlen kleinzumachen. Michael genoß das Gefühl des Schreckens, das er hervorrief, und goß den restlichen Brandy in einem Schluck runter. Dann wischte er sich mit dem Handrücken über den Mund und stellte das Glas sanft auf den Tisch.
»Ich hab nach dir gesucht, Tommy.«
Seine Stimme war leise und ruhig.
Tommy Blue sackte das Herz in die Hose. Mit zitternden Lippen versuchte er zu lächeln.
»Ich glaube, wir beide sollten einen kleinen Spaziergang machen.«
Michael sah jeden der Männer am Tisch an und deutete dann auf Tommy.
»Ich warte draußen auf dich.«
Er drehte sich um und bahnte sich seinen Weg zur Tür. Draußen lehnte er sich gegen die Wand der Kneipe. Er biß sich auf die Lippen, und das wachsende Gefühl der Erregung in seiner Brust ließ sein Herz schneller und lauter schlagen.
Ein Trüppchen Heilsarmisten kam die Straße entlang. Michael zog eine Packung Strands aus der Tasche und zündete sich eine Zigarette an. Die Klänge von »Vorwärts, christliche Soldaten« kamen allmählich näher. Er zog hart an seiner Zigarette. Fünf Minuten Zeit würde er Tommy Blue geben, bevor er noch mal hineinginge, um ihn eigenhändig rauszuzerren.
Drinnen saß Tommy wie festgeklebt an seinem Stuhl.
»Wieviel schuldest du ihm, Tom?« fragte Dustbin Daley, ein Lumpensammler aus Shepherd’s Bush.
»Fünfundvierzig insgesamt.« Tommy kriegte kaum die Zähne auseinander.
Einer seiner Kumpane stieß einen erschreckten Pfiff aus.
»Ich geh wohl besser raus ... sonst kommt der wieder zurück und macht mich hier drinnen fertig.« Schwankend kam Tommy auf die Füße und schlurfte zur Tür.
Dustbin Daley schüttelte den Kopf. »Der wird verdammt sauer sein.«
Die anderen stimmten ihm düster zu. Ihre gute Laune war verflogen, war zusammen mit Tommy Blue zur Tür hinausgeweht.
Tommy fröstelte, die Kälte kroch ihm in die Knochen. Er trug nur ein dünnes Jackett, an mehreren Stellen eingerissen, und einen vielfarbigen dicken Schal.
Michael warf die Zigarette auf den matschigen Bürgersteig und trat sie mit dem Stiefel aus. Er stieß sich von der Wand ab, griff sich Tommy am Jackett und zog ihn mit sich die Straße hinunter. Nun war er auf gleicher Höhe mit den Heilsarmisten. Eine junge Frau streckte ihm die Sammelbüchse hin. Sie schenkte Michael ein Lächeln, während sie die Büchse schüttelte.
»Fröhliche Weihnachten, Sir.« Ihre Augen strahlten ihn in offener Bewunderung an.
Michael schlug den Mantel zur Seite, fischte zwei Half Crowns aus der Hosentasche und ließ sie in die Büchse gleiten. Die junge Frau wurde rot vor Freude.
»Vielen Dank, Sir. Und noch mal fröhliche Weihnachten.«
Er nickte ihr zu, während er gleichzeitig Tommy Blue vorwärtsstieß. Die Tamburins und das Singen wurden in der Ferne immer leiser. Die beiden Männer gingen schweigend noch etwa fünf Minuten weiter. Tommy Blue spürte die Kälte nicht mehr. Er spürte gar nichts mehr. Die Furcht hatte total von ihm Besitz ergriffen. Er bewegte sich wie ein Automat, konnte nicht denken, nur abwarten. Das Bier, das er den ganzen Tag über stetig in sich reingeschüttet hatte, schien ihm nun wie ein Stein im Magen zu liegen.
In der Treadgold Street verlangsamte Michael seinen Schritt. Die Wäscherei hier wurde von allen liebevoll die »Dreckwäsche« genannt. Auch Michael hatte oft genug die Wäsche seiner Mutter hierher gebracht. Nun lag die Wäscherei verlassen da, geschlossen über die Feiertage. Michael nahm einen Schlüssel aus der Innentasche seines Mantels, schloß auf und schob Tommy hinein. Hinter sich zog er die Tür wieder zu und knipste das Licht an. Tommy stand bewegungslos da.
Wieder zog Michael sein Päckchen Strands hervor und zündete sich langsam eine Zigarette an. Er nahm einen tiefen Zug und blies Tommy den Rauch ins Gesicht.
»Du hast mich sehr ärgerlich gemacht.« Wie gewöhnlich war Michaels Stimme leise und ruhig.
Tommy schien aus seiner Trance zu erwachen. Er blinzelte ununterbrochen.
»Hör doch, Mickey, ich ... ich hab versucht, das Geld aufzutreiben. Ich schwör’s!«
»Halt die Schnauze, Tommy. Du gehst mir langsam auf den Keks.«
Er ließ die Zigarette fallen, griff nach Tommys Schal und zwang ihn, rückwärts zu gehen, bis er gegen eine der großen Maschinen stieß. Michael holte aus und versetzte Tommy einen gewaltigen Hieb mitten ins Gesicht. Tommys Nase schien unter dem Hieb völlig die Form zu verlieren. Michael ließ los, und Tommy sackte zu Boden. Stöhnend krümmte er sich zusammen und hielt schützend die Hände über den Kopf. Michael trat ihn mit solcher Wucht in den Rücken, daß Tommy quer über den verdreckten Boden schlidderte. Dann nahm er einen der großen Holzprügel, mit denen die Frauen die Schmutzwäsche einweichten, und stupste Tommy damit an die Schulter.
»Streck deinen Arm aus.« Michaels Stimme war völlig emotionslos. Tommy stöhnte laut auf.
»Bitte ... bitte, Mickey, ich flehe dich an.« Mit blutverschmiertem, tränenüberströmtem Gesicht sah er zu Michael auf. »Tu das nicht ... ich, ich krieg das Geld schon irgendwie zusammen, ich schwör’s dir.«
Michael trat ihn gegen die Beine und schlug ihm den Prügel quer über die Schultern.
»Wenn du den Arm nicht ausstreckst, brech ich dir deinen verdammten Rücken. Los jetzt, her mit dem Arm.«
Michaels Worte hallten durch die leere Wäscherei. Widerstrebend streckte Tommy seinen Arm aus, wobei sein ganzer Körper vor Furcht zuckte. Zweimal krachte der Prügel auf seinen Ellbogen nieder und brach ihm den Knochen. Tommy schrie vor Schmerz. Er war kurz davor, das Bewußtsein zu verlieren, und kämpfte vergeblich gegen die in heißen Wellen aufsteigende Übelkeit an. Würgend erbrach er sich auf den Boden, und das stinkende Gemisch aus Bier und Galle dampfte in der Kälte.
»Steh auf, Tommy.« Michaels Stimme war ruhig wie zuvor.
Langsam rappelte Tommy sich hoch. Sein Arm hing unbeholfen zur Seite herab, und der Ärmel seines Jacketts färbte sich allmählich blutrot. Blut lief ihm über die Finger und tropfte zu Boden. Er lehnte sich gegen die schwere Maschine und weinte leise vor sich hin.
»Du hast sieben Tage Zeit, Tommy, mehr nicht, um das Geld zusammenzukriegen. Und jetzt verpiß dich.«
Michael sah zu, wie Tommy humpelnd und stolpernd die Wäscherei verließ. Sorgfältig überprüfte er seine Kleidung, um sicherzugehen, daß kein Blut daran war. Dann wusch er leise vor sich hinpfeifend den Prügel ab und lehnte ihn wieder an die rückwärtige Wand, wo er ihn gefunden hatte. Immer noch pfeifend knipste er das Licht aus und verschloß hinter sich die Tür.
Joe der Fisch lauschte begierig auf alles, was Michael ihm berichtete, nickte von Zeit zu Zeit mit dem Kopf und murmelte immer wieder: »Gut ... gut.« Als Michael geendet hatte, grinste Joe ihn an. »Und der Arm ist tatsächlich gebrochen?«
»Ja. In tausend Stücke, völlig zerquetscht.«
Joe der Fisch seufzte. Er verabscheute Gewalt, aber in seinem Geschäft ließ sie sich nicht vermeiden. Er musterte den ihm gegenübersitzenden Michael Ryan. Er mochte den Jungen, erkannte sich in Michael wieder. Der Junge war von dem gleichen inneren Drang getrieben, etwas aus seinem Leben zu machen. Diesen Ehrgeiz hatte auch Joe als junger Mann besessen. Auch er hatte, wie Michael, als Geldeintreiber – als Schläger – begonnen, bis er sich sein eigenes Geschäft aufbauen konnte. Jetzt war er ein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft. Er besaß Läden, Klubs und Marktstände, von der Petticoat Lane bis zur Portobello Road. Doch der weitaus lohnendste Teil war das Wettgeschäft. Joe war seit über zwanzig Jahren Buchmacher und dabei allmählich zum Kredithai aufgestiegen. Als er Michael einstellte, hatte er in ihm sofort eine verwandte Seele entdeckt. Michael war absolut ehrlich. Wenn er sagte, ein Schuldner habe ihm fünfzig Pfund gezahlt, konnte Joe sicher sein, daß es kein Penny mehr gewesen war. Die meisten Geldeintreiber zweigten einen gewissen Anteil für sich selbst ab, da sie wußten, daß dem unglücklichen Schuldner nichts anderes übrig blieb, als diese Summe später noch einmal zu zahlen. Doch Michael Ryan hatte seine eigenen Prinzipien. Es konnte zwar durchaus sein, daß er einen Mann krankenhausreif schlug, aber Joe Geld vorzuenthalten, kam in Michaels Vorstellung einem Verbrechen gleich. Joe mochte ihn. Es gefiel ihm, wie Michael seine Wohnung bewunderte. Und ihm gefiel der Respekt, den der Junge ihm entgegenbrachte.
Er hustete, spuckte ins Feuer und hörte das leise Zischen, als die Spucke auf die glühenden Kohlen traf.
»Ab Januar möchte ich dir die gesamte Geldeintreibung unterstellen. Ich werde die Männer informieren, daß sie in Zukunft ihre Befehle von dir erhalten.«
Sprachlos starrte Michael ihn an. Dann verzog er sein Gesicht zu einem breiten, erfreuten Grinsen, und er schüttelte verwundert den Kopf.
»Danke, Joe! Teufel noch eins!«
Wie die meisten Menschen machte es auch Joe glücklich, Michael lächeln zu sehen. Es war, als wäre hinter einer düsterschwarzen Wolkenbank strahlend die Sonne zum Vorschein gekommen. Michael hatte die Gabe, Menschen dazu zu bringen, ihm Freude machen zu wollen, als wären sie irgendwie in seiner Schuld. Joe spürte eine erregende Wärme in sich aufsteigen. Er würde es genießen, mit dem Jungen zu arbeiten, ihm sein Handwerk beizubringen. Langsam ließ er seine Augen über Michaels Körper wandern. Er war zweifellos ein äußerst gutaussehender Junge.
Michael beobachtete Joes Augen, und ein erwartungsvoller Schauer durchlief ihn. Joe der Fisch war fünfzig Jahre alt. Er hatte nie geheiratet und stand auch in keinerlei Beziehung zu irgendwelchen Frauen, soweit Michael wußte. Und er wußte ebenfalls, daß Joe sich gern mit jungen Männern umgab. In den letzten paar Monaten hatte er sich bewußt bei Joe eingeschmeichelt, hatte ihm schöngetan und ihm das Gefühl vermittelt, er wäre dankbar, daß ihm Joe den Job als Geldeintreiber gegeben hatte. Lächelnd blickte er Joe ins Gesicht, wobei seine tiefblauen Augen in scheinbarer Dankbarkeit und Bewunderung aufleuchteten. Er sah, wie Joe seinen schweren Körper aus dem Sessel wuchtete. Abscheu flackerte kurz in Michaels Gesicht auf, wurde aber augenblicklich von dem strahlenden Lächeln ersetzt, das Joe so glücklich machte, wie er wußte.
Joe öffnete eine Schublade seines Schreibtisches und nahm ein Kästchen heraus. Er kam um den Schreibtisch herum und übergab es Michael.
»Nur ein kleiner Beweis meiner Anerkennung.« Seine Stimme war tief und ein wenig heiser. Gegen den Tisch gelehnt, beobachtete er Michaels Gesicht, während dieser das Kästchen öffnete. Als er hörte, wie Michael tief einatmete, entspannte er sich. Er würde nichts überstürzen, mußte den Jungen von sich aus kommen lassen.
Michael starrte auf die Krawattennadel, die glitzernd auf dem roten Samt des Kästchens lag. Sie war aus Gold, in Form eines großen M, mit Diamanten besetzt. Als er Joe ins Gesicht blickte, machte sich einen Augenblick lang Panik in ihm breit bei dem Gedanken, was nun vor ihm lag. Doch dann sah er, wie weich Joe ihn anschaute, und schluckte schwer. Es mußte sein, jetzt oder nie.
Er legte ihm die Hand auf die Hüfte und ließ sie dann langsam abwärtsgleiten, zu der deutlich sichtbaren Schwellung in der Hose des Mannes. Fasziniert schaute Joe auf die große, rauhe Hand, die sich da so sanft und anschmiegsam an ihm rieb. Für einen Moment schloß er die Augen und spürte, wie eine Welle der Erregung ihn durchpulste. Dann öffnete er sie wieder und blickte in Michaels Gesicht. Im Schein des Feuers sah der Junge wie ein dunkler Engel aus. Das bernsteinfarbene Flackern in seinen blauen Augen ließ Joes Herz Purzelbäume schlagen.
Schwer fiel er auf die Knie, fuhr Michael mit den Händen über die Hüften, die Leisten, knetete und rieb, atmete keuchend. Michael betrachtete ihn und grinste in sich hinein. Er fand, daß Joe lächerlich wirkte, und bemerkte, daß sich ein Schweißfilm über seinen Lippen gebildet hatte, die er sich nervös leckte.
Als er spürte, wie sich Joe an seinen Hosen zu schaffen machte, bezwang Michael nur mühsam den Drang, ihm die Faust ins Gesicht zu rammen. Er konnte jetzt nicht mehr zurück, nach all dem Planen und Intrigieren der letzten Monate. Joe war sein Freifahrtschein, seine Garantie, aus Notting Hill herauszukommen und Zugang zur echten Verbrecherwelt zu finden. Er biß die Zähne zusammen, lehnte sich im Sessel zurück und zwang sich zur Entspannung. Draußen, wo der Schnee alle Geräusche dämpfte, hörte Michael eine einsame Stimme »Stille Nacht« singen. Während er auf Joes beginnende Glatze hinabsah, lauschte Michael der geisterhaften, kindlichen Stimme und hätte weinen mögen.
Sarah begoß gerade den Truthahn, als sie Benjamin heimkommen hörte. Die Haustür wurde mit einem lauten Knall zugeschlagen, der Sarah zusammenzucken ließ. Sie schob den Truthahn zurück in den Ofen und setzte sich wieder ans Feuer. Benjamin stolperte in die Küche, Haare und Mantel immer noch voller Schnee. Er setzte sein breites, zahnloses Grinsen auf und kam unsicher auf sie zu.
»Hallo, Sarah, mein Schatz!«
Wie immer, wenn er betrunken war, brüllte er, als stände sie am anderen Ende der Straße.
»Kannst du nicht leiser sein! Du weckst mir noch die ganzen Gören auf!«
Benjamin stierte zwinkernd seine Frau an, während er schwankend vor ihr stand. Je mehr er sich konzentrierte, desto verschwommener erschien sie ihm. Als er schließlich zwei Sarahs vor sich sah, wankte er zu dem Sessel, auf dem noch vor knapp einer Stunde Pat Johnstone gesessen hatte. Er ließ sich niederplumpsen, hob ein Bein und furzte laut, worauf Sarah mißbilligend die Lippen schürzte. Dann lehnte er sich zurück und strahlte sie gutgelaunt an. Von der Hitze des Feuers fing sein Mantel an zu dampfen.
Wortlos stand sie auf und machte ihm rasch ein paar Schinkenbrote. Mit einem Blick auf die Uhr stellte sie fest, daß es bereits zwanzig nach eins war – alle waren jetzt zu Hause, bis auf Michael. Sie legte die Brote auf einen Teller und reichte ihn ihrem Mann. Unendliche Müdigkeit ergriff sie. Schließlich war sie schon seit sieben Uhr früh auf den Beinen.
In der Spülküche griff sie nach einem alten Mantel und trat hinaus in das winzige Gärtchen. Sie hockte sich nieder und nahm den Teller von einer großen Glasschüssel. Der Schnee war seitlich hochgeweht und bedeckte auch den Teller. Sorgfältig wischte sie ihn ab. Dann berührte sie vorsichtig die grüne Masse in der Schüssel und lächelte. Die jüngeren Kinder liebten Wakkelpudding. Das war das einzig Gute am Schnee: Er hielt alles schön kalt und frisch. Sie bedeckte die Schüssel wieder mit dem Teller, stand auf und ging zurück ins Haus, nachdem sie an der Eingangsstufe ihre Pantoffeln abgeklopft hatte, um den Schnee nicht reinzutragen.
Aus der Küche hörte sie das laute Schnarchen ihres Mannes. Er lag hingegossen in seinem Sessel, die langen Beine weit von sich gestreckt, in der Hand noch den leergegessenen Teller. Leise nahm sie ihm den Teller ab, stellte ihn in die Spüle, überprüfte ein letztes Mal den Puter, drehte das Gas so klein wie möglich und stieg die Treppe hinauf.
Als sie sich im Schlafzimmer auszog, sah sie, daß ihre Tochter in das große Doppelbett geklettert war. Dies war Mauras erstes richtiges Weihnachtsfest. Während sie ins Bett schlüpfte, betrachtete sie liebevoll den weißblonden Kopf und spürte das vertraute Ziehen im Bauch. Das Kind bewegte sich und kuschelte sich tiefer unter die Decke. Der Daumen wanderte in den Mund, ein paar Sekunden wurde wie wild daran genuckelt, dann verfiel die Kleine wieder in Tiefschlaf.
Wenn Benjamin ihr auch in den ganzen Ehejahren nichts gegeben hatte als dieses Kind, so verzieh sie ihm dafür doch alles andere.
Michael erwachte und sah auf die Uhr. Viertel nach drei. Als er den Kopf schüttelte, um das dumpfe Gefühl loszuwerden, bemerkte er den dicken Arm, der um seine Taille geschlungen war. Im Licht des heruntergebrannten Feuers sah er auf das schlafende Gesicht von Joe dem Fisch. Irgendwo in seinem Innersten fühlte er sich durch das, was in den letzten Stunden geschehen war, angeekelt. Ihm war nur allzu bewußt, was sich da vor dem lodernden Feuer abgespielt hatte. Doch in seinen Ekel mischte sich auch eine gewisse Erregung. Nun war Joe der Fisch in seiner Hand, genau wie er es sich geschworen hatte. Ein grausames Lächeln huschte über sein Gesicht. Er würde ihn benutzen, würde auf ihm spielen wie auf einem Musikinstrument. Allmählich würde er zum Mittelpunkt von Joes Leben werden. Dann, wenn Joe seinen Zweck erfüllt hatte, würde er sich seiner entledigen. Michael wußte, was er zu tun hatte. Er hatte es lange genug geplant.
Sanft beugte er sich hinab und küßte Joe auf den Mund. Joes wäßrige Augen öffneten sich, und er lächelte, wobei sich seine verfärbten Zähne entblößten.
»Ich muß jetzt gehn, Joe.«
Mit einem trägen Gähnen streckte der Ältere seine plumpen Arme über dem Kopf aus.
»Ist gut, Liebster. Sieh zu, daß du morgen mal vorbeikommst. Ich fühl mich Weihnachten immer so allein.« Seine Stimme klang traurig.
»Natürlich komm ich. Mach dir keine Sorgen.«
Joe schaute zu, wie Michael sich im Feuerschein anzog, und das Herz schien ihm aus der Brust springen zu wollen. Im Geist durchlebte er noch einmal die köstlichen Momente ihres Liebesspiels vor ein paar Stunden und sah wieder Michael unter sich liegen, während er in ihn eindrang. Er konnte kaum glauben, daß er dieses schöne wilde Tier bezwungen hatte. Als Michael in seinen Mantel schlüpfte, spürte Joe, wie die Einsamkeit in ihm hochkroch.
»Bis morgen dann.« Michaels Stimme war sanft und liebevoll. Er schenkte Joe eins seiner strahlenden Lächeln. Der kleine Mann wuchtete sich hoch, und beim Anblick seiner kurzen, dicken Beine und der beachtlichen Wampe wurde Michael fast schlecht.
»Hast du nicht etwas vergessen?« Joes Stimme klang mädchenhaft – hoch und atemlos vor Erwartung. Michel zog verwirrt die Brauen zusammen. Als er Joes gespitzte Lippen sah, ging er zu ihm und umarmte ihn. Joe zwängte seine Zunge in Michaels Mund und küßte ihn mit einer Kraft, die ihn erschreckte. Vorsichtig machte Michael sich los, warf ihm noch ein letztes Lächeln zu und verließ leise den Raum.
Das Bild von Joes teigigem, weißem Körper schien sich in sein Gedächtnis eingeätzt zu haben. Als er in die stille weiße Welt hinaustrat, war Michael froh über die beißende Kälte, die ihm schier den Atem nahm. Noch immer schneite es leicht, und er hob das Gesicht, um die sanften Flocken auf seine Haut fallen zu lassen und so von dem Ekel, den er empfand, reingewaschen zu werden.
Die Straßenlaternen warfen glitzernde Lichtstreifen über das verschneite Pflaster, als wäre sein Weg mit Tausenden von Diamanten bestreut. Michael ging schneller und begann zu lächeln. Er schüttelte den Kopf und zuckte mit den Schultern. Das Schlimmste war nun überstanden. Er wußte, worauf er sich eingelassen hatte, und war froh darüber. Sollte die fette alte Schwuchtel doch seinen Körper benutzen. Es hatte sich schon ausgezahlt. Der Tisch seiner Mutter bog sich unter den köstlichsten Leckerbissen. Die Kinder hatten alle etwas Neues zum Anziehen. Und ihm selbst würde es eines Tages unerhörte Reichtümer bringen. Nie wieder würde er zulassen, ein schlechtes Gefühl dabei zu haben.
Er schaute hinauf in den schwarzen Himmel und schüttelte seine Faust gegen die Sterne. Dies war ein Neubeginn für die Ryans. Er würde sie aus der Gosse herausholen und in die Welt der Besitzenden einführen, in die sie seiner Meinung nach gehörten. Als er seine Hände in die Manteltaschen schob, stieß er auf das Kästchen mit der Krawattennadel. Er grinste. Nach den Feiertagen würde er sofort losgehen und sich eine Krawatte kaufen!
Als Michael am Weihnachtstag die glücklichen Gesichter sah, all das viele, schier unerschöpfliche Essen und die Freude, die seine Geschenke auslösten, kam er endgültig mit sich ins reine. Was auch immer er tun mußte, egal wie schlimm, das hier war es wert. Nach dem ausgedehnten, lärmenden Weihnachtsessen saß Michael im Sessel, seine schlafende Schwester Maura auf dem Schoß. Während er auf das Kind blickte, das zufrieden an seinem Daumen lutschte, schwor er sich, wenn nötig auch Morde zu begehen, um das jetzige Glück seiner Familie zu bewahren.
Diesen Schwur sollte er immer wieder wahrmachen müssen.
Kapitel 3
1955
Garry und Benny Ryan spielten vor den ausgebombten Ruinen der ehemaligen Testerton Street. Als sie am Tag zuvor aus der Schule kamen, hatten sie den großen Sandhaufen bemerkt, der dort abgeladen worden war. Das konnte zweierlei bedeuten: Entweder sollten die restlichen Häuser wieder aufgebaut werden, oder man riß sie ab, um Platz für neue Fertighäuser zu schaffen. In jedem Fall aber hieß es, daß ihr Spielgelände verschwinden würde. Die Jungs waren daher früh aufgestanden und schon um halb sieben aus dem Haus gestürmt. Wenn sie es richtig anstellten, konnten sie das Gelände noch für ein paar Stunden durchstöbern, bevor sie zur Kindervorstellung ins Royalty nach Ladbroke Grove gingen.
Seit einer Stunde spielten sie nun auf dem Sandhaufen. Benny war mit seinen neun Jahren schon ein typischer Ryan. Groß für sein Alter, überragte er bereits den elfjährigen Garry, der wiederum, wegen seines schmalen, dürren Körpers, manchmal fast geisterhaft wirkte. Garry trug als einziger der Ryans eine Brille, die er dauernd hochschubste und deren dicke Gläser ihm zusätzlich eine eulenhaften Ausdruck verliehen. Im Gegensatz zu Benny, mit seinem schwarzen Haar, den charakteristischen dunkelblauen Ryanschen Augen und den vollen Lippen, hatte Garry hellbraunes Haar und eine gewisse Wildheit, eine versteckte Brutalität, durch die er stets erreichte, was er wollte. Garry war das anerkannte Familiengenie und las ständig. Überall in seinem Zimmer lagen Bücher und Heftchen verstreut. Außerdem hielt er sich für einen Erfinder – ein Zeitvertreib, der seine Mutter mit einer Mischung aus mütterlichem Stolz und dem fast unbezwingbaren Drang, ihn umzubringen, erfüllte.
Die Junisonne verlieh ihrem Spiel zusätzlichen Schwung. Um sie herum war die Welt inzwischen zum Leben erwacht. Der Verkehrslärm wurde lauter, und immer wieder brachte das Rattern vorbeibrausender Züge ihren Sandhaufen zum Zittern. Rechts von ihnen standen die Überreste der Häuser in der Testerton Street. Die Bombe war ein Volltreffer gewesen und hatte nur wenige Häuser am Ende der Straße verfehlt. Die Eingangstüren waren verschwunden, die Räume düstere Höhlen, in denen es erstaunlicherweise immer noch Tapeten und zerbrochene Möbel gab.
Die beiden Jungs kannten jeden Winkel dieser Häuser. Am Dachbalken des stabilsten hatten sie eine improvisierte Schaukel aufgehängt. Jetzt, wo der Sommer vor der Tür stand, würde die Schaukel zum Hauptinteresse aller Kinder aus der Umgebung werden. Selbst von Shepherd’s Bush und Bayswater würden die Jungs rüberkommen, um zwischen den Kämpfen mit rivalisierenden Banden hier zu schaukeln. Falls die Bauarbeiten nicht zu bald begannen, würde es ein guter Sommer werden.
Garry rutschte von dem Sandhaufen runter und ging auf die Häuser zu, Hände und Knie sandverkrustet. Als Benny sah, daß sein Bruder wegging, folgte er ihm hastig, wobei er sich die sandigen Hände an seinen Shorts abwischte. Atemlos holte er Garry ein.
»Und was machen wir jetzt?« Wie immer wartete er darauf, daß Garry entschied, welches Spiel als nächstes dran war.
Garry, dessen schmales Gesicht schon völlig verschmiert war, sah seinen Bruder an. »Wir suchen nach Bomben und so Zeugs. Lee hat hier Schießpulver versteckt, das er in Roxeth geklaut hat, und das werd ich einsacken.«
Ein besorgter Ausdruck huschte über Bennys Gesicht. Lee war mit seinen dreizehn Jahren schon fast so groß wie der siebzehnjährige Roy, beinahe einsachtzig, und gut Kirschen essen war mit ihm auch nicht.
»Lee schlägt uns zu Brei!«
Garry grinste und schob die Brille hoch. »Erst muß er uns mal kriegen!«
Benny lachte nervös. Lee würde sie kriegen, wie immer, aber diese Weisheit behielt er lieber für sich, denn wenn er Garry wütend machte, würde der ihn nach Hause schicken. Und dann müßte er mit seiner Schwester spielen! Er folgte Garry in das Eckhaus. Die Treppe war immer noch stabil genug, und die beiden Jungs stiegen bis ins oberste Stockwerk hinauf. Sie standen gefährlich nah an der bröckeligen Kante und blickten hinaus über London. In den letzten paar Jahren hatte sich vieles am Stadtbild verändert. Von ihrem Aussichtspunkt konnten sie ihre ganze kleine Welt überblicken. Garry sah in der Ferne, daß im Wormwood Scrubs Park der Jahrmarkt aufgebaut wurde. Er stieß Benny in die Rippen und deutete hinüber. Sie würden es kaum erwarten können, hinzukommen.
»Ich werd uns von Mickey ein bißchen Geld besorgen. Wir gehn nachher hin und gucken mal, was es für Karussells gibt.«
In seiner Aufregung hüpfte Benny zurück und stolperte über ein Stück Holz. Als er auf dem Boden landete, stöhnte er überrascht auf. »Guck mal, Gal, was hier ist!«
Garry starrte schon auf das, was da unter den großen Füßen seines Bruders zum Vorschein gekommen war.
»Was meinst du, wo das herkommt?«
Garry schüttelte den Kopf. Er kniete sich hin und hob eine der leeren Patronenhülsen auf. Da lagen mehr als ein Dutzend.
»Die hat wahrscheinlich jemand geklaut und dann hier liegen lassen.«
Garry schubste ärgerlich die Brille hoch und fuhr ihn an: »Mehr fällt dir mal wieder nicht ein, was? Klar sind die geklaut und dann hier versteckt worden. Und ich glaub, ich weiß auch, von wem.«
Benny kam stöhnend auf die Füße. Seine Hände brannten wie Feuer, wo er sie aufgeschürft hatte.
»Und wer, meinst du, hat die versteckt?«
»Ich wette, das war die Bande aus der Elgin Avenue«, erklärte Garry triumphierend.
»Los, laß sie uns einsacken. Bevor jemand kommt.«
Die beiden Jungs stopften sich die Hülsen in ihre Hemden. Dann rannten sie, so schnell sie konnten, die Treppe runter. Als sie aus dem Haus stürmten, kamen sie beide schlitternd zum Stehen. Lee, Leslie und Roy steuerten auf sie zu. Garry sah Benny besorgt von der Seite an.
»Egal was ist, erzähl ihnen bloß nichts davon.« Er klopfte auf sein Hemd. Bennys Hände brannten immer mehr, und er rieb sie vorsichtig an seinem Hemd ab. Schon bildeten sich Tränen in seinen Augen.
Roy bemerkte die beiden Jungs und rief ihnen zu: »Was steht ihr hier rum? Was habt ihr gemacht?«
Wie gewöhnlich übernahm Garry das Reden. »Wir haben nichts gemacht. Wir dachten nur, ihr sucht nach uns.«
»Warum sollten wir denn nach euch suchen?« fragte Roy ungläubig. »Ihr geht uns schon zu Hause genügend auf den Wecker. Jetzt verpißt euch, ihr zwei.«
Das mußte man den Jungs nicht zweimal sagen. Sie rannten wie der Blitz davon. Als sie den in sicherer Entfernung aufgeschütteten Sandhaufen erreichten, setzten sie sich obendrauf und beobachteten ihre Brüder. Die drei älteren Jungen standen immer noch vor dem zerbombten Haus. Alle drei rauchten.
»Hast du die gerochen? Die waren bestimmt baden, in der Silchester Road. Sie haben dies stinkige Zeug im Haar.« Bennys Stimme war voller Verachtung. Für ihn war jeder, der freiwillig badete, reif für die Klapsmühle. Er selbst ließ sich höchstens alle vierzehn Tage zu einem Bad bewegen, einem für Sixpence, Handtücher und Seife inbegriffen. Er haßte es. Wenn seine Mutter nicht mitging und draußen Wache hielt, hätte er das Geld sofort für Wichtigeres ausgegeben, wie Schießplättchen für seine Kanone oder Comic-Heftchen.
Kurze Zeit später tauchten drei Mädchen auf, zwei Blonde und eine Rothaarige. Garry lachte.
»Blöde Affen! Darum waren die baden. Mädels vernaschen, das haben die vor!«
Sie sahen, wie jedes der Mädchen sich einem ihrer Brüder anschloß und die Paare in verschiedene Richtungen davongingen. Noch angewiderter stand Benny auf.
»Komm, laß uns heimgehen. Ich hab Hunger.«
Schweigend machten sich die beiden Jungen auf den Heimweg.
Gegen drei Uhr nachmittags kam Roy mit Janine nach Hause. Es war das erste Mal, daß er ein Mädchen mitbrachte, und sie waren beide schrecklich nervös. Im Flur griff er nach ihrer Hand und lächelte ihr zu.
»Alles wird gutgehen, ganz bestimmt.«
Er sah in ihre grünen Augen und verspürte wie immer den Drang, sie zu küssen. Sie hatte milchigweiße Haut und lange, dicke rote Haare. Roy fand, daß Janine Klasse hatte. Sie war auch verhältnismäßig groß – ein Meter sechsundsiebzig. In gewisser Weise war er froh, daß sie »in Schwierigkeiten« war. Das würde ihnen den nötigen Schubs geben, sich in aller Öffentlichkeit zueinander zu bekennen.