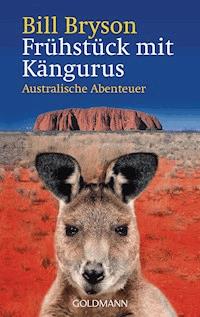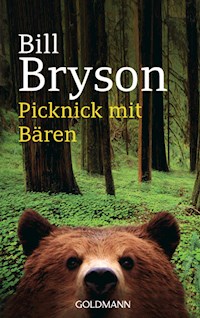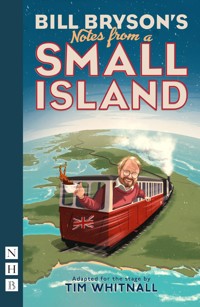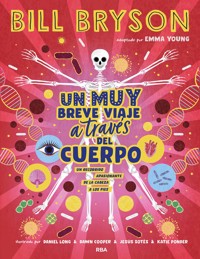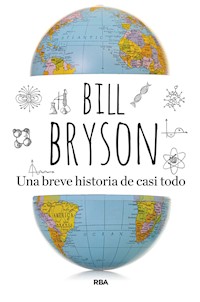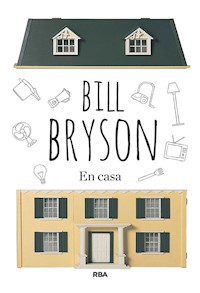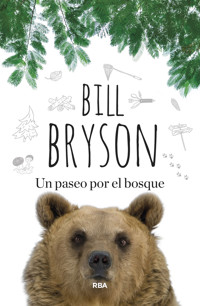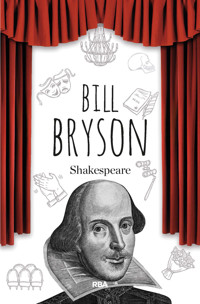9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Welt verstehen ohne einen Fuß vor die Tür zu setzen
Was bleibt nach der »Geschichte von fast allem« eigentlich noch zu schreiben? Die Geschichte von fast allem anderen, natürlich. Bill Bryson hat sich daher in seinen vier Wänden umgesehen und sich gefragt: Warum leben wir eigentlich, wie wir leben? Warum nutzen wir ausgerechnet Salz und Pfeffer, und weshalb hat unsere Gabel vier Zinken? Aber es bleibt nicht bei Geschichten von Bett, Sofa und Küchenherd. Die Geschichte des Heims ist auch immer eine der großen Entdeckungen und Abenteuer. Ohne die Weltausstellung in London hätte man vermutlich das Wasserklosett nicht so schnell zu schätzen gelernt. Und ohne die großen Entdecker müssten wir wohl ohne Kaffee, Tee oder Kakao auskommen. Bill Bryson zeigt uns unser Heim, wie wir es noch nie gesehen haben. Und wir verstehen ein wenig mehr, warum es so ist, wie es ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 865
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Für Jesse und Wyatt
Inhaltsverzeichnis
Ein paar Worte vorweg
Einige Zeit nach unserem Einzug in ein ehemaliges Pfarrhaus der anglikanischen Kirche mitten auf dem Land in der Grafschaft Norfolk musste ich auf den Dachboden, um zu erkunden, woher es langsam und unerklärlich tröpfelte. Da keine Treppe zum Dachboden führte, blieb mir nichts anderes übrig, als eine hohe Trittleiter zu erklimmen und mich dann eher unschicklich durch eine Luke zu winden – weshalb ich bis zu besagtem Tag auch noch nie oben gewesen war (und seither nur mit mäßiger Begeisterung wieder hochgeklettert bin).
Als ich endlich durch die Luke geplumpst war und mich in Staub und Düsternis aufgerappelt hatte, fand ich zu meiner Überraschung eine von außen nirgendwo sichtbare Tür. Sie ließ sich leicht öffnen und führte zu einer kleinen Stelle auf dem Dach, nicht größer als eine Tischplatte, zwischen vorderem und rückwärtigem Giebel. Viktorianische Häuser sind häufig ein Konglomerat baulicher Irrungen und Wirrungen, doch auf das hier konnte ich mir nun gar keinen Reim machen. Warum ein Architekt irgendwo eine Tür anbringen ließ, die offensichtlich weder notwendig noch zweckdienlich war, blieb mir schleierhaft, doch ich musste staunend zugeben, dass man von dort oben eine wundervolle Aussicht hatte.
Irgendwie ist es ja immer aufregend, auf eine Welt hinabzuschauen, die man gut kennt, aber noch nie aus diesem Blickwinkel gesehen hat. Ich befand mich etwa fünfzehn Meter über dem Boden, was einem mitten in Norfolk einen mehr oder weniger vollständigen Überblick beschert. Direkt vor mir stand die uralte, aus Feuerstein erbaute Kirche, zu der unser Haus einmal gehört hat; dahinter, ein kleines Stück den Hang hinunter und getrennt von Kirche und Pfarrhaus, war das beschauliche Dorf. Und in der anderen Richtung, nach Süden hin, zeichnete sich am Horizont Wymondham Abbey ab, ein wuchtiger, prächtiger, mittelalterlicher Kasten. Auf halbem Wege dazwischen zog ein knatternder Traktor schnurgerade Furchen ins Erdreich. Ringsherum lag ruhige, angenehme, zeitlos englische Landschaft.
Der ich mich besonders deshalb sehr vertraut fühlte, weil ich am Tag zuvor mit meinem Freund Brian Ayers einen Gutteil davon durchwandert hatte. Brian, gerade als Grafschaftsarchäologe in Pension gegangen, weiß wahrscheinlich mehr über Geschichte und Landschaft Norfolks als irgendjemand sonst auf der Welt. Da er noch nie in unserer Dorfkirche gewesen war, wollte er unbedingt einen Blick hineinwerfen. Sie ist hübsch und alt, älter als Nôtre Dame in Paris, ungefähr das Baujahr der Kathedralen von Chartres und Salisbury. Doch in Norfolk, wo es von mittelalterlichen Gotteshäusern nur so wimmelt – insgesamt sind es 659 –, übersieht man leicht eines.
»Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass die Kirchen auf dem Land langsam in den Boden sinken? Jedenfalls hat es den Anschein«, sagte Brian, als wir den Kirchhof betraten. Denn auch dieses Gotteshaus stand in einer Kuhle, wie ein Gewicht auf einem Kissen, und die Grundmauern befanden sich einen ganzen Meter tiefer als der Kirchhof, der das Gebäude umgab. »Wissen Sie, warum das so ist?«
Wie so oft, wenn ich mit Brian durch die Gegend zockele, musste ich zugeben, dass ich es nicht wusste.
»Also, diese Kirche versinkt nicht etwa«, sagte Brian lächelnd, »sondern der Friedhof hebt sich. Wie viele Menschen, meinen Sie, liegen hier begraben?«
Ich versuchte es anhand der Grabsteine zu schätzen und sagte: »Keine Ahnung. Achtzig? Hundert?«
»Na, das halte ich für leicht untertrieben«, erwiderte Brian nachsichtig. »Überlegen Sie mal. In einer Landgemeinde wie dieser leben durchschnittlich zweihundertfünfzig Menschen, was etwa eintausend Sterbefälle pro Jahrhundert bedeutet. Dazu kommen ein paar Tausend Seelen, die es nicht bis ins Erwachsenenalter schaffen. Multiplizieren Sie das Ganze mit der Anzahl der Jahrhunderte, die die Kirche auf dem Buckel hat, und Sie sehen, dass es sich hier nicht um achtzig oder hundert Grabstätten, sondern eher um zwanzigtausend handelt.«
Diese Worte fielen, bitte ich zu beachten, nur wenige Schritte von meiner Haustür entfernt. »Zwanzigtausend?«, stieß ich hervor.
Er nickte, völlig unbeeindruckt. »Ich muss ja wohl nicht betonen, dass das eine ganze Menge ist. Deshalb hat sich der Boden um einen Meter gehoben.« Er ließ mir eine Minute, um das zu verdauen, und fuhr dann fort: »In Norfolk gibt es eintausend Gemeinden. Und die haben natürlich über die Jahrhunderte hinweg viel – wie wir Archäologen sagen – materielle Kultur hinterlassen. Bauten, Geräte, Werkzeuge, Schmuck und eben auch Gräber.« Er musterte die diversen Kirchtürme in der Ferne. »Von hier aus kann man zehn, zwölf weitere Gemeinden sehen. Das heißt, in unserer unmittelbaren Umgebung befinden sich wahrscheinlich eine Viertelmillion Grabstätten – und das alles in einem Landstrich, der immer nur ländlich ruhig war, wo nie großartig was passiert ist.«
Das war Brians Art zu erklären, wie man in einer bukolischen, dünn besiedelten Region wie Norfolk auf 27 000 archäologische Funde pro Jahr kommen kann, auf mehr als in jeder anderen englischen Grafschaft. »Hier lassen die Menschen schon seit langem Dinge fallen – lange, bevor England England wurde.« Er zeigte mir eine Karte aller bekannten archäologischen Fundstellen in unserer Gemeinde. Auf fast jedem Acker und jeder Wiese war etwas geborgen oder entdeckt worden – jungsteinzeitliche Werkzeuge, römische Münzen und Keramik, angelsächsische Broschen, Grabstätten aus der Bronzezeit, Wikingergehöfte, und gleich hinter unserem Pfarrhaus hatte zum Beispiel ein Bauer beim Überqueren eines Feldes im Jahre 1985 einen seltenen römischen, unmöglich misszudeutenden phallusförmigen Anhänger gefunden.
Ich stelle mir immer wieder voller Staunen und Verwunderung vor, wie dort, wo jetzt mein Grundstück endet, einst ein Mann in einer Toga stand, sich von oben bis unten abklopft und bestürzt zur Kennnis nimmt, dass er sein liebevoll gehütetes Andenken verloren hat, das dann siebzehn, achtzehn Jahrhunderte lang unbemerkt in der Erde liegt – während Angelsachsen, Wikinger und Normannen kamen und gingen, während die englische Sprache und Nation entstanden und die britische Monarchie und tausenderlei andere Dinge sich entwickelten. Und zum guten Schluss, Ende des zwanzigsten Jahrhunderts, hebt dann jemand, der nun seinerseits verblüfft dreinschaut, das verlorene Schmuckstück auf.
Als ich auf dem Dach meines Hauses stand und den unerwarteten Ausblick genoss, kam mir plötzlich der Gedanke, wieso der Fund eines römischen Phallusanhängers die (zugegeben kurze) Aufmerksamkeit der Welt erregt hatte, nicht aber das ganz normale Tun und Treiben der Menschen in all den zweitausend Jahren, seitdem das Ding in den Staub gefallen war. Klar, die Leute sind jahrhundertelang brav und unauffällig ihren Alltagsgeschäften nachgegangen – Essen, Schlafen, Sex und den anderen kleinen Freuden des Lebens –, dachte ich. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Ja, genau! Daraus besteht Geschichte schließlich. Daraus, dass viele, viele Menschen normale Dinge tun! Selbst Einstein hat in seinem Leben sicher manchmal an seinen Urlaub gedacht und daran, was es zum Abendessen gab oder was für zierliche Fesseln die junge Dame hatte, die gegenüber aus der Straßenbahn stieg. Aus solchen Dingen besteht unser Leben und Denken, doch wir behandeln sie als zweitrangig und ernsthafter Betrachtung kaum wert. Ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Schülerdaseins ich mich in US-amerikanischer Geschichte mit dem Missouri-Kompromiss oder in englischer mit den Rosenkriegen beschäftigen musste, jedenfalls wurde ich bei Weitem häufiger dazu angehalten als dazu, über die Geschichte des Essens und Schlafens, der Sexualität oder anderer kleiner Freuden nachzudenken.
Deshalb, fand ich, ist es vielleicht nicht uninteressant, sich ein Buch lang einmal nur mit ganz gewöhnlichen Dingen zu befassen und ihnen endlich Beachtung zu schenken. Bei einem Gang durch mein Haus war ich beispielsweise verblüfft, ja, sogar ein wenig entsetzt darüber, wie wenig ich über die Welt hier drinnen wusste, und als ich eines Nachmittags am Küchentisch saß und gedankenverloren mit Salz- und Pfefferstreuer spielte, fiel mir auf, dass ich keinen blassen Schimmer hatte, warum wir von allen Gewürzen dieser Erde ausgerechnet eine solch anhaltende Liebe zu diesen beiden hegen. Warum nicht zu Pfeffer und Kardamom oder zu Salz und Zimt? Und warum haben Gabeln vier Zinken und nicht drei oder fünf? Für all das muss es doch Gründe geben.
Beim Anziehen fragte ich mich, warum alle meine Anzugjacken eine Reihe sinnloser Knöpfe an den Ärmeln haben, und als ich im Radio hörte, wie jemand davon sprach, dass er für Kost und Logis bezahle, merkte ich, dass ich nicht wusste, woher dieser Ausdruck kommt. Urplötzlich schien das Haus voller Geheimnisse zu stecken.
Und so kam ich auf die Idee, einmal hindurchzugehen, von Raum zu Raum, und zu überlegen, was für eine Rolle jeder einzelne über die Jahrhundert hinweg im Alltag der Menschen gespielt hat. Im Badezimmer würde ich auf die Geschichte der Körperhygiene stoßen, in der Küche auf die des Kochens, im Schlafzimmer auf die der Sexualität, des Sterbens und Schlafens – und so weiter und so fort. Ich wollte eine Geschichte der Welt schreiben, ohne dass ich das Haus verlassen musste.
Ich muss sagen, das Vorhaben hatte einen gewissen Reiz. Vor einiger Zeit habe ich ja in einem Buch versucht, das Universum zu verstehen und wie sich alles ineinanderfügt – kein geringes Unterfangen, wie Sie sich vorstellen können. Mich mit etwas zu beschäftigen, das so adrett begrenzt und angenehm endlich ist wie ein altes Pfarrhaus in einem englischen Dorf, war also sehr verlockend. Dazu musste ich nicht mal die Pantoffeln ausziehen.
Natürlich kam es ganz anders. Häuser sind erstaunlich komplex, wahre Fundgruben. Zu meiner großen Überraschung stellte ich nämlich fest, dass alles, was in der Welt geschieht – alles, was entdeckt, erschaffen oder bitter umkämpft wird –, zum guten Schluss auf die eine oder andere Weise im Haus landet. Kriege, Hungersnöte, die Industrielle Revolution, die Aufklärung – alles ist da: verborgen in Ihren Sofas und Kommoden, in den Falten Ihrer Vorhänge und den fluffigen Daunenkissen, in der Farbe Ihrer Wände und dem Wasser in Ihren Wasserleitungen. Die Geschichte der Dinge, die zu unserem Alltag gehören, ist eben nicht nur eine der Betten, Sofas und Küchenherde, wie ich leichthin angenommen hatte, sondern auch eine von Skorbut, Guano und Bettwanzen; sie hat mit dem Eiffelturm zu tun und mit Leichenräuberei, also eigentlich mit allem, was je passiert ist. Häuser sind keine Rückzugsgebiete von der Geschichte. In Häusern landet die Geschichte.
Ich muss wohl kaum darauf hinweisen, dass jede Art von Geschichte die Tendenz hat, sich auszuweiten. Um die Geschichte der alltäglichen Dinge in ein Buch zu packen, musste ich, das war mir von Anfang an klar, penibel auswählen. Und obwohl ich ab und zu in graue Vorzeiten zurückgehen werde (man kann nicht über Bäder und Badezimmer sprechen, ohne die Römer zu erwähnen), konzentriert sich das, was nun folgt, hauptsächlich auf die letzten einhundertfünfzig Jahre, mit besonderer Betonung auf der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, als die moderne Welt wirklich geboren wurde – und das deckt sich zufällig genau mit der Zeit, seit der das Haus existiert, durch das wir nun wandern.
Wir haben uns an so viele Annehmlichkeiten gewöhnt – es warm zu haben, sauber gewaschen und wohlgenährt zu sein –, dass wir eines leicht vergessen: All diese Errungenschaften sind noch gar nicht so alt. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis wir so weit waren, und dann kam meist alles auf einmal. Wie genau das passierte und warum es so lange brauchte, darum geht es auf den folgenden Seiten.
Obwohl ich den Namen des Dorfes, in dem das alte Pfarrhaus steht, nicht ausdrücklich nenne, möchte ich darauf hinweisen, dass es den Ort tatsächlich gibt und dass auch die Menschen, von denen ich erzähle, dort leben beziehungsweise gelebt haben.
Bild 1
Innenansicht von Joseph Paxtons lichtdurchflutetem Kristallpalast bei der Weltausstellung 1851. Das Tor steht heute in Kensington Gardens.
Erstes Kapitel
Das Jahr
I.
Im Herbst 1850 wuchs im Hyde Park in London ein absolut erstaunliches Gebäude in die Höhe: ein luftiges, riesiges Gewächshaus aus Eisen und Glas mit einer Grundfläche von etwa 77 000 Quadratmetern und von solch ungeheuren Ausmaßen, dass vier St. Paul’s Kathedralen darin Platz gefunden hätten. Während seines kurzen Erdendaseins war es das größte Gebäude der Welt. Offiziell als »Palast der Weltausstellung der Werke der Industrie aller Nationen« bekannt, war es ein wahrer Prunkbau, der vor allem deshalb für Erstaunen sorgte, weil er so atemberaubend gläsern, so prächtig und unerwartet schnell fertig war. Douglas Jerrold, Kolumnist der satirischen Wochenzeitschrift Punch, taufte ihn den »Crystal Palace«, und der Name blieb.
Der Bau selbst hatte gerade mal fünf Monate gedauert. Es war ein Wunder, dass er überhaupt rechtzeitig vollendet wurde, denn ein Jahr zuvor hatte er noch nicht einmal als Idee existiert. Die Ausstellung, für die er erdacht wurde, war der Traum eines Beamten namens Henry Cole, der sich ansonsten als Erfinder der Weihnachtskarte einen Anspruch auf einen Platz in der Geschichte erworben hat. (Er wollte die Leute dazu bringen, die neue Penny Post zu benutzen.) 1849 besuchte Cole die Industrieausstellung in Paris – eine vergleichsweise provinzielle Angelegenheit und nur von französischen Herstellern beschickt – und wollte unbedingt etwas Ähnliches in England auf die Beine stellen, aber in größerem Stil. Er begeisterte viele gesellschaftlich wichtige Menschen, einschließlich Prinz Albert, seines Zeichens Gatte Königin Victorias, für die Idee, und so fand am elften Januar 1850 das erste Vorbereitungstreffen für eine Weltausstellung statt. Am ersten Mai des folgenden Jahres sollte Eröffnung sein. Man hatte also knapp sechzehn Monate Zeit, um das größte Gebäude zu planen und zu bauen, das sich je einer vorgestellt hatte. Außerdem mussten Zehntausende von Ausstellungsstücken aus allen Teilen der Welt herbeigekarrt werden, Restaurants und Toiletten gebaut, Personal eingestellt, Versicherungen abgeschlossen, Handzettel gedruckt und für Polizeischutz gesorgt werden. Es gab tausenderlei Dinge zu tun, und das in einem Land, das keineswegs davon überzeugt war, dass es eine solch kostspielige und aufwändige Veranstaltung überhaupt wollte. Das Ziel war ohnehin in der kurzen Zeit unerreichbar. Allein für die Ausstellungshalle wurden in einem offenen Wettbewerb zweihundertfünfundvierzig Entwürfe eingereicht – und ausnahmslos als nicht realisierbar verworfen.
Angesichts der drohenden Katastrophe tat das Komitee, was Komitees in verzweifelten Situationen gern tun: Es ernannte ein neues Komitee mit einem wohlklingenderen Namen. Das »Baukomitee der Königlichen Kommission für die Weltausstellung der Werke der Industrie aller Nationen« bestand aus vier Männern – Matthew Digby Wyatt, Owen Jones, Charles Wild und dem großen Ingenieur Isambard Kingdom Brunel – und hatte einzig und allein die Aufgabe, mit einem eng begrenzten, schmalen Budget einen Entwurf zu präsentieren, der der in zehn Monaten beginnenden größten Ausstellung der Geschichte würdig war. Nur der junge Wyatt war ausgebildeter Architekt, er hatte jedoch bis dato noch nichts gebaut und verdiente sich seine Brötchen in der schreibenden Zunft. Wild war Ingenieur, hatte aber fast nur mit Schiffen und Brücken zu tun gehabt; Jones war Innenarchitekt. Nur Brunel hatte Erfahrung mit großen Projekten. Er war auch ohne jeden Zweifel genial, doch insofern enervierend, als es fast immer langwierig und kostspielig war, einen Kompromiss zwischen seinen hochfliegenden Visionen und dem realistisch Machbaren zu finden.
Der Bau, den die vier Männer ausheckten, war gelinde gesagt verunglückt: riesig und niedrig, ein trübselig dunkler Schuppen mit der heiteren Atmosphäre eines Schlachthofs. Es sah ganz so aus, als hätten hier vier Architekten in aller Eile jeder für sich etwas ersonnen. Die Kosten waren kaum zu kalkulieren, doch man hätte das Gebäude ohnehin nicht bauen können, weil man dreißig Millionen Backsteine gebraucht hätte. Woher die nehmen, geschweige denn in der kurzen Zeit verbauen? Gekrönt werden sollte das Ganze mit einer eisernen Kuppel von circa sechzig Metern Durchmesser, so jedenfalls Brunels Vorschlag – eine tolle Sache, gewiss, doch auf einer einstöckigen Halle vielleicht einen Hauch abwegig. Noch nie war etwas derart Riesiges aus Eisen konstruiert worden, und Brunel hätte natürlich erst anfangen können, herumzutüfteln, wie man das Trumm aufs Dach bekam, wenn der Bau darunter stand. Dabei sollte alles zusammen in zehn Monaten fertig sein! Unklar war auch, wer nach einem halben Jahr alles wieder abreißen würde und was aus der mächtigen Kuppel und den Millionen Backsteinen werden sollte; das bedachte man erst gar nicht.
Mitten in dieser sich verschärfenden Krise trat Joseph Paxton auf den Plan, ein ruhiger Zeitgenosse, Obergärtner im Chatsworth House, dem Hauptwohnsitz des Duke of Devonshire, der – unüberbietbar englisch – in Derbyshire gelegen ist. Paxton war ein Wahnsinnstyp. Er wurde 1803 geboren und stammte aus einer armen Bauernfamilie in Bedfordshire, die ihn, als er vierzehn war, zum Arbeiten in eine Gärtnerlehre schickte. Dabei zeichnete er sich rasch aus und leitete bereits sechs Jahre später eine Versuchsbaumschule für die renommierte neue Horticultural Society in Westlondon, die kurz darauf in Königliche Gartenbaugesellschaft umbenannt wurde – ein ungemein verantwortungsvoller Job für jemanden, der kaum dem Knabenalter entwachsen war. Als er sich einmal mit dem Duke of Devonshire unterhielt, der Chiswick House nebenan sein Eigen nannte (und außerdem ein Gutteil der restlichen britischen Inseln, insgesamt achthundert Quadratkilometer fruchtbaren Grund und Boden samt sieben großen Herrenhäusern), schloss der Duke ihn sofort ins Herz, offenbar weniger, weil er in Paxton schon das Genialische witterte, als vielmehr, weil der junge Mann laut und deutlich redete. Der Herzog war nämlich schwerhörig und wusste eine klare Sprache zu schätzen. Spontan fragte er Paxton, ob er Obergärtner in Chatsworth werden wollte. Paxton wollte. Er war zweiundzwanzig Jahre alt.
Ein überraschender und obendrein äußerst kluger Schachzug des Aristokraten. Denn Paxton stürzte sich mit schier schwindelerregender Energie und Hingabe in den Job. Er entwarf und baute den berühmten Emperor Fountain mit einem Wasserstrahl, der fast hundert Meter hoch in die Luft schoss, eine Meisterleistung der Ingenieurskunst, die in Europa bisher nur einmal übertroffen worden ist; er legte den größten Steingarten im Land an, plante ein neues Dorf auf dem Anwesen des Herzogs, wurde der führende Dahlienexperte der Welt, gewann Preise, weil er die feinsten Melonen, Feigen, Pfirsiche und Nektarinen im ganzen Land zog, und baute ein riesiges Tropenhaus, bekannt als Great Stove, großer Ofen. Das war mit einer Fläche von etwas über viertausend Quadratmetern so weitläufig, dass Königin Victoria bei einem Besuch 1843 mit einer Pferdekutsche durchfahren konnte. Durch verbesserte Bewirtschaftung und Verwaltung half Paxton dem Herzog außerdem, eine Million Pfund Schulden abzutragen. Und mit dem Segen seines Herrn gründete und leitete er zwei Gartenzeitschriften und eine landesweite Tageszeitung, die Daily News, bei der Charles Dickens kurze Zeit Redakteur war. Paxton schrieb Gartenbücher, investierte so geschickt in Eisenbahnaktien, dass er in den Vorstand von drei Gesellschaften berufen wurde, und ließ den ersten Stadtpark der Welt in Birkenhead bei Liverpool nach seinem Entwurf anlegen. Als der Chefbotaniker von Kew Gardens, dem königlichen botanischen Garten, Paxton 1849 eine kränkelnde, seltene Lilie schickte und fragte, ob er sie wohl retten könne, baute Paxton ein besonderes Treibhaus und – das versteht sich wohl von selbst – brachte sie in drei Monaten zum Blühen.
Als er erfuhr, dass die Verantwortlichen für die Weltausstellung verzweifelt nach einem Entwurf für die große Schauhalle suchten, kam er auf die Idee, dass etwas Ähnliches wie seine Treibhäuser vielleicht funktionieren würde. Er kritzelte also, während er eine Vorstandssitzung der Midland Railway leitete, eine grobe Skizze auf ein Stück Löschpapier und stellte in den nächsten zwei Wochen die gesamten Zeichnungen zur Begutachtung fertig. Dann wurden für ihn sämliche Wettbewerbsregeln gebrochen. Sein Entwurf wurde noch nach dem Abgabetermin angenommen und zudem explizit verbotene brennbare Materialien akzeptiert, zum Beispiel viele Quadratmeter Holzboden. Außerdem wiesen Architekturfachleute durchaus berechtigt daraufhin, dass er kein ausgebildeter Architekt sei und in dieser Größenordnung noch nie etwas gebaut habe. Gut, das hatte überhaupt noch niemand, und niemand konnte deshalb auch guten Gewissens behaupten, dass das Ganze machbar sei. Viele befürchteten, dass sich die Halle unerträglich aufheizen würde, wenn die Sonne darauf brannte und die Menschen sich darin drängelten. Andere hatten Angst, dass sich die Fenstersprossen oben in der Sommerhitze ausdehnen, die riesigen Glasscheiben lautlos herausfallen und die Besuchermassen darunter erschlagen würden. Die größte Sorge aber war, dass das äußerst zerbrechlich aussehende Gebilde in einem Sturm einfach weggeweht werden würde.
Die Risiken waren also beträchtlich, und man war sich ihrer sehr wohl bewusst, doch nach wenigen Tagen besorgten Zögerns erteilten die Kommissionsmitglieder Paxton den Zuschlag. Nichts – ja, wirklich absolut nichts – sagt mehr über das viktorianische Großbritannien und die Geniestreiche aus, zu denen es fähig war, als dass man einen Gärtner mit dem Bau des kühnsten Gebäudes des Jahrhunderts betraute. Für Paxtons Kristallpalast brauchte man nämlich keinerlei Backsteine, ja, auch keinen Mörtel, keinen Zement und kein Fundament. Er wurde wie ein Zelt zusammengeschraubt und auf den Boden gestellt. Das war nicht nur eine findige Antwort auf eine monumentale Aufgabe, sondern auch eine radikale Abkehr von allem, was bisher versucht worden war.
Der größte Vorteil von Paxtons luftigem Palast war, dass man ihn aus vorgefertigten, normierten Teilen errichten konnte. Grundelement waren gusseiserne Träger, etwa neunzig Zentimeter breit und gut sieben Meter lang, die man miteinander verschraubte, so dass ein Rahmen entstand, in den man die Glasscheiben einsetzen konnte – fast einhunderttausend Quadratmeter oder ein Drittel all des Glases, das normalerweise in einem Jahr in Großbritannien produziert wurde. Zum Einbauen konstruierte man eine besondere mobile Plattform, die sich an den Dachträgern entlangbewegte, so dass die Arbeiter achtzehntausend Scheiben in der Woche schafften – eine Effizienz und Produktivität, die selbst heute noch an ein Wunder grenzen würde. Um die notwendigen laufenden Meter Dachrinnen anzubringen, insgesamt mehr als dreißig Kilometer, entwarf Paxton eine Maschine, mit deren Hilfe ein kleines Team etwa sechshundert Meter am Tag verlegen konnte. Bisher wäre das die Tagesleistung von dreihundert Mann gewesen. Das Projekt war in jeder Hinsicht der helle Wahn.
Paxton hatte allerdings großes Glück, was das Timing betraf, denn genau rechtzeitig zur Weltausstellung wurde Glas plötzlich in Mengen verfügbar wie nie zuvor. Es war immer ein heikles Material gewesen. Gutes Glas zu produzieren war schwer, ja, überhaupt welches herzustellen war nicht leicht. Nicht umsonst war es so lange ein Luxusgegenstand gewesen. Doch erfreulicherweise brachten zwei neue technische Erfindungen eine Veränderung. Zunächst einmal erfanden die Franzosen Walzglas, das so genannt wurde, weil das flüssige Glas auf Platten ausgebreitet und dann gewalzt wurde. Zum ersten Mal konnte man wirklich große Scheiben und damit auch große Schaufenster herstellen. Das Walzglas musste aber zehn Tage abkühlen, wenn es ausgerollt worden war, was bedeutete, dass die Platten die meiste Zeit belegt waren. Danach musste jede Glasscheibe ausgiebig geschliffen und poliert werden. Was das Ganze natürlich teuer machte. 1838 wurde eine billigere Herstellungsmethode entwickelt: Flachglas. Das hatte die meisten guten Eigenschaften von Walzglas, kühlte aber schneller ab und musste nicht so lange poliert werden, war also viel billiger in der Herstellung. Plötzlich konnte man Glas in großen Scheiben unbegrenzt und preiswert produzieren.
Gleichzeitig wurden gerade zur rechten Zeit zwei uralte Steuern abgeschafft: die Fenstersteuer und die Glassteuer (die, streng genommen, eine Verbrauchssteuer war). Die Fenstersteuer stammte aus dem Jahre 1696 und war so exorbitant, dass die Leute, wo irgend möglich, überhaupt keine Fenster in ihre Häuser bauten. Die zugemauerten Fensteröffnungen, die uns heute an vielen historischen Gebäuden in Großbritannien auffallen, waren nur angemalt, damit sie wie Fenster aussahen. (Manchmal ist es sehr, sehr schade, dass sie nicht immer noch angemalt sind.) Die Steuer war als »Steuer auf Luft und Licht« zutiefst verhasst, denn sie bedeutete, dass Diener und andere Menschen mit begrenzten Mitteln dazu verdammt waren, in luft- und lichtlosen Räumen zu wohnen.
Die zweite Steuer wurde 1746 eingeführt und richtete sich nicht nach der Anzahl der Fenster, sondern nach dem Gewicht des Glases in den Fenstern. Also wurde während der gesamten georgianischen Ära dünnes, schwaches Glas produziert, während man die Fensterrahmen zum Ausgleich sehr robust machte. In der Zeit kamen auch die sogenannten Ochsenaugen oder Butzenscheiben auf. Mit Ochsenauge bezeichnete man die Stelle auf einer Glasplatte, an der das Nabeleisen des Glasmachers ansetzte. Weil dieser Teil des Glases als Makel galt, wurde er nicht besteuert und entwickelte einen gewissen Reiz für die, die aufs Geld achten mussten oder wollten. Butzenscheiben wurden beliebt in einfachen Gasthöfen und Läden sowie in Privathäusern auf der hinteren Seite des Hauses, wo es nicht auf Schick und Eleganz ankam. Die Glassteuer wurde 1845 abgeschafft, unmittelbar vor ihrem einhundertsten Geburtstag, und kurz danach auch die Steuer auf Fensterscheiben, zufällig – und praktisch – 1851. Just in dem Moment, als Paxton mehr Glas brauchte als je ein Mensch zuvor, sank der Preis um mehr als die Hälfte. Zusammen mit den technischen Neuerungen bei der Glasherstellung war das dann ein wesentlicher Grund, warum der Bau des Kristallpalastes überhaupt erst möglich wurde.
Der fertige Palast war (passend zum Jahr seiner Fertigstellung) genau 1851 Fuß (564 Meter) lang, 408 Fuß (124 Meter) breit und in der Mitte fast 110 Fuß (33,5 Meter) hoch, so dass man eine viel bewunderte Allee mit Ulmen darin belassen konnte, die sonst hätten gefällt werden müssen. Wegen der Größe des Gebäudes war der Materialeinsatz enorm: 293 655 Glasscheiben, 33 000 Eisenrahmen und tausende Quadratmeter Holzfußboden. Doch dank Paxtons Bauweise beliefen sich die letztendlichen Kosten auf höchst genehme 80 000 Pfund. Alles in allem brauchte man für den Bau knapp fünfunddreißig Wochen. Der Bau der St. Paul’s Kathedrale hatte fünfunddreißig Jahre gedauert.
Gut drei Kilometer entfernt werkelte man im Übrigen schon seit einem Jahrzehnt an dem neuen Parlamentsgebäude, und es war immer noch längst nicht fertig. Ein Autor des Punch schlug vor, und das nur halb im Scherz, die Regierung möge doch Paxton mit dem Entwurf eines Kristallparlaments beauftragen. Für verfahrene Situationen entstand die Redensart »Fragt Paxton«.
Der Kristallpalast war zugleich das größte und das leichteste, schwebendste Gebäude der Welt. Heute sind wir große Glasflächen gewöhnt, doch für jemanden, der im Jahre 1851 lebte, war die Möglichkeit, durch weite hohe, luftige Räume im Inneren eines Gebäudes zu wandeln, überwältigend, ja schwindelerregend. Den Blick, der sich dem ankommenden Besucher von Weitem auf die glitzernde, transparente gläserne Ausstellungshalle bot, können wir uns einfach nicht mehr vorstellen. Es muss so zart und flüchtig, so wunderbar zaubrisch ausgesehen haben wie eine Seifenblase. Ja, den Leuten, die in den Hyde Park kamen, müssen beim Anblick des über den Bäumen schwebenden, im Sonnenlicht funkelnden Prachtbaus regelrecht die Knie weich geworden sein.
II.
Als der Kristallpalast in London entstand, wurde neben einer uralten Dorfkirche unter dem weiten Himmel Norfolks unweit des Marktstädtchens Wymondham ein wesentlich bescheideneres Gebäude errichtet: ein eher unauffälliges, geräumiges Pfarrhaus mit unsymmetrischem Dach, kecken Schornsteinen und holzverzierten Giebeln – »recht groß, auf verlässliche, respektabel hässliche Weise bequem«, beschrieb Margaret Oliphant, eine ungeheuer populäre und produktive viktorianische Romanschreiberin, Häuser dieser Gattung.
Mit dem Haus werden wir es in diesem Buch immer wieder zu tun haben. Es wurde für Thomas J. G. Marsham, einen jungen Pfarrer aus guter Familie, von einem Edward Tull aus Aylsham erbaut, einem Architekten, der, wie wir noch sehen werden, faszinierend wenig Talent besaß. Marsham war neunundzwanzig Jahre alt und Nutznießer eines Systems, das ihm und seinesgleichen einen mehr als anständigen Lebensunterhalt bot und im Gegenzug wenig dafür verlangte.
1851 gab es 17 621 Geistliche in der anglikanischen Kirche, und ein Landpfarrer, der sich um das Seelenheil von nicht einmal zweihundertfünfzig Gemeindemitgliedern kümmern musste, kam auf ein Durchschnittseinkommen von fünfhundert Pfund im Jahr – nicht weniger als ein höherer Staatsbeamter wie zum Beispiel Henry Cole, der Mann hinter der Weltausstellung. Jüngere Söhne aus hohem und niederem Adel hatten die Wahl : Sie konnten in den Kirchendienst treten oder zum Militär gehen. Und sie brachten oft auch noch Familienvermögen mit. In vielen Pfarrstellen besserte man außerdem sein Einkommen durch das Verpachten von Pfarrland auf, also von Ackerflächen, die zu der Stelle gehörten. Selbst weniger privilegierten Amtsinhabern ging es im Allgemeinen richtig gut. Jane Austen wuchs in einem Pfarrhaus in Steventon in Hampshire auf, das sie als peinlich unzureichend betrachtete, doch es hatte ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Empfangszimmer, ein Arbeitszimmer, eine Bibliothek und sieben Schlafzimmer; Not litt hier niemand. Die reichste Pfründe befand sich in Doddington in Cambridgeshire; sie umfasste 38 000 Morgen Land und bescherte dem glücklichen Inhaber bis zu ihrer Aufteilung im Jahre 1865 ein jährliches Einkommen von 7300 Pfund – was heute ungefähr fünf Millionen Pfund wären.1
Damals gab es zwei Arten von Pfarrern in der anglikanischen Kirche: vicars und rectors. Der Unterschied war, was das Geistliche betrifft, minimal, in finanzieller Hinsicht allerdings riesengroß. Traditionell waren die vicars Ersatzleute für die rectors, doch zu Zeiten von Mr. Marsham war diese Unterscheidung schon weitgehend geschwunden, und ob ein Pfarrer vicar genannt wurde oder rector, richtete sich hauptsächlich danach, welcher Begriff in der betreffenden Pfarrgemeinde üblich war. Nur die Differenz im Einkommen, die blieb.
Die Entlohnung eines Geistlichen erfolgte nicht durch die Kirche selbst, sondern ergab sich, je nach Pfarrstelle, aus Pachten und dem Zehnten. Letzterer bestand entweder im Großzehnten (von den Hauptfeldfrüchten wie Weizen und Gerste) oder dem Kleinzehnten (Gemüse aus dem Garten, Masttiere und was man sonst noch futtern konnte). Die rectors bekamen den Großzehnten, die vicars den Kleinzehnten, was zur Folge hatte, dass Erstere durchweg die Wohlhabenderen waren, bisweilen um ein Erkleckliches. Da der Zehnte ständiger Grund für Spannungen zwischen Pfarrherrn und Bauern war, beschloss man 1836, ein Jahr vor der Thronbesteigung Königin Victorias, die Angelegenheit zu vereinfachen. Von nun an sollte der Bauer seinem Pastor nicht mehr einen vereinbarten Teil seiner Ernte geben, sondern eine feste jährliche Summe zahlen, die man anhand des allgemeinen Werts seines Landes errechnete. Das bedeutete, dass die Geistlichen auch dann ein Anrecht auf die ihnen zugebilligten Abgaben hatten, wenn die Bauern schlechte Jahre hatten, andersherum gesagt: Die Pfarrer hatten von nun an immer gute Jahre.
Der Job des Landgeistlichen war bemerkenswert locker. Fromm musste man nicht sein, das wurde nicht einmal erwartet. Um in der anglikanischen Kirche ein Amt zu bekleiden, musste man einen Universitätsabschluss haben.
Doch da die meisten Pfarrer Altphilologie und keineswegs Theologie studierten, hatten sie keinerlei Ausbildung im Predigen oder darin, anderen Menschen Inspiration zu sein, Trost zu spenden oder sonst einen sinnvollen christlichen Halt zu geben. Viele machten sich auch gar nicht erst die Mühe, Predigten zu schreiben, sondern kauften sich ein dickes Buch mit fertigen Texten und lasen jede Woche einen vor.
Völlig unbeabsichtigt kam dabei heraus, dass eine Kaste sehr gebildeter, gut situierter Leute entstand, die unendlich viel Zeit zur Verfügung hatten. Und die als Folge davon wiederum begannen, oft gänzlich aus dem Blauen heraus, sich für außergewöhnliche Dinge zu interessieren. Niemals zuvor in der Geschichte hat sich eine Gruppe von Leuten in einem derart breiten Spektrum von Gebieten so verdienstvoll hervorgetan, vorzugsweise in Aufgabenfeldern, für die sie keineswegs bestallt worden waren.
Schauen wir uns ein paar an:
George Bayldon, vicar in einer entlegenen Ecke Yorkshires, hatte stets so wenige Besucher in seinen Gottesdiensten, dass er die halbe Kirche in einen Hühnerstall verwandelte, sich autodidaktisch zum Sprachwissenschaftler ausbildete (und zwar zu einer echten Koryphäe) und das erste Wörterbuch des Isländischen verfasste. Nicht weit von ihm entfernt schrieb Laurence Sterne, Pfarrer einer Gemeinde unweit Yorks, populäre Romane, von denen Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman der bekannteste ist. Edmund Cartwright, rector einer Landpfarre in Leicestershire, erfand den mechanischen Webstuhl, der letztlich die Industrielle Revolution wahrhaft industriell machte. Zur Zeit der Londoner Weltausstellung waren allein in England über eine Viertelmillion seiner Webstühle in Gebrauch.
In Devon züchtete Pastor Jack Russell den Terrier gleichen Namens, während in Oxford Pastor William Buckland die erste wissenschaftliche Beschreibung eines Dinosauriers abfasste und nicht zufällig die führende Autorität der Welt auf dem Gebiet der Koprolithen wurde, dem versteinerten Kot urweltlicher Tiere. Thomas Robert Malthus in Surrey schrieb Eine Abhandlung über das Bevölkerungsgesetz; Oder eine Untersuchung seiner Bedeutung für die menschlicheWohlfahrt in Vergangenheit und Zukunft, nebst einer Prüfung unserer Aussichten über seine künftige Beseitigung oder Linderung der Übel, die es verursacht und begründete die Disziplin der politischen Ökonomie. (Wie Sie sich vielleicht aus Schulzeiten erinnern, behauptete er, dass mathematisch gesehen die Produktion von Nahrungsmitteln unmöglich mit dem Wachstum der Bevölkerung Schritt halten könne.) Pastor William Greenwell aus Durham war einer der Gründerväter der modernen Archäologie, ist aber unter Anglern bekannter geworden als Erfinder von »Greenwell’s Glory«, der allseits beliebten Forellenfliege zum Fliegenfischen.
In Dorset wurde ein Mann mit dem kecken Namen Octavius Pickard-Cambridge der Welt führender Spinnenexperte, während sein Zeitgenosse Pastor William Shepherd mit einer Geschichte der schmutzigen Witze aufwartete. John Clayton aus Yorkshire demonstrierte in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts zum ersten Mal praktisch, wie Gasbeleuchtung funktionieren könnte, und Pastor George Garrett aus Manchester erfand das U-Boot2. Adam Buddle, Pfarrer-Botaniker in Essex, war der Namenspatron der Buddleia, des prächtig blühenden Schmetterlingsflieders. Pastor John Mackenzie Bacon aus Berkshire war ein Pionier der Heißluftballon-Fahrt und Vater der Luftfotografie. Sabine Baring-Gould (ja, ein Mann) schrieb das Kirchenlied »Onward, Christian Soldiers« und – worauf man wohl nicht sofort käme – den ersten Roman, in dem ein Werwolf vorkam. Pastor Robert Stephen Hawker aus Cornwall verfasste ausgezeichnete Gedichte und wurde von Longfellow und Tennyson sehr bewundert, obwohl er seine Gemeindeschäfchen stets ein wenig in Alarm versetzte, weil er einen rosafarbenen Fez trug und einen Großteil seines Lebens unter dem machtvollen, wohltuenden Einfluss von Opium verbrachte.
Gilbert White im Western Weald von Hampshire war der angesehenste Naturforscher und -schützer seiner Zeit und Autor der brillanten und sehr beliebten Naturgeschichte Selbornes. In Northamptonshire wurde Pastor M. J. Berkeley zum führenden Experten auf dem Gebiet der Pilze und Pflanzenkrankheiten. Leider, leider war er offenbar verantwortlich für die Verbreitung vieler schädlicher Pflanzenkrankheiten, einschließlich der bösartigsten, dem Echten Mehltau. John Michell, rector in Derbyshire, zeigte William Herschel, wie man ein Teleskop baut, und Herschel entdeckte damit den Uranus. Michell erfand auch eine Methode, wie man die Erde wiegen kann, was wohl das raffinierteste wissenschaftliche Experiment des ganzen achtzehnten Jahrhunderts war. Er starb, bevor es durchgeführt werden konnte, aber das erledigte dann schließlich in London Henry Cavendish, ein aufgeweckter Verwandter von Paxtons Arbeitgeber, dem Herzog von Devonshire.
Der genialste Geistliche von allen war indes Pastor Thomas Bayes aus Tunbridge Wells in der Grafschaft Kent, der von 1701 bis 1761 lebte. Nach allem, was man weiß, war er ein schüchterner Mensch und hoffnungsloser Prediger, gleichwohl aber ein begnadeter Mathematiker. Er erfand die mathematische Gleichung, die als Bayes’sche Regel bekannt geworden ist und so aussieht:
Leute, die die Formel verstehen, können damit verschiedene äußerst komplexe Probleme lösen, bei denen es um Wahrscheinlichkeitsverteilungen oder, wie man auch sagt, inverse Wahrscheinlichkeiten geht. Man kann nämlich aus unvollständigem Wissen statistisch verlässliche Wahrscheinlichkeiten errechnen. Das Frappierende an der Bayes’schen Regel ist, dass sie zu ihres Schöpfers Lebzeiten überhaupt nicht angewendet werden konnte. Man braucht leistungsstarke Computer, um Berechnungen in dem Umfang anzustellen, die nötig sind, um das entsprechende Problem zu knacken. In den Tagen von Bayes war es nur ein interessanter, aber vollkommen zweckloser Denksport.
Er selbst hielt offenbar so wenig von seiner Regel, dass er sich nicht darum kümmerte, sie in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Ein Freund schickte sie 1763, zwei Jahre nach Bayes’ Tod, an die Royal Society in London, die sie in ihren Philosophischen Transaktionen unter dem bescheidenen Titel »Versuch zur Lösung einer Aufgabe aus der Lehre vom Zufall« publizierte. In Wirklichkeit war es ein turmhoher Meilenstein in der Geschichte der Mathematik. Heute wird die Bayes’sche Regel beim Erstellen von Modellen des Klimawandels benutzt, zum Vorhersagen von Börsenentwicklungen, zur Feststellung von Messergebnissen mit der Radiokarbonmethode, zur Interpretation kosmologischer Ereignisse und überall sonst, wo es um Wahrscheinlichkeit geht – und das nur deshalb, weil sich ein englischer Geistlicher im achtzehnten Jahrhundert mal ein paar Gedanken gemacht und sie notiert hat.
Viele andere Kirchenmänner produzierten keine großartigen Werke, sondern großartige Kinder. John Dryden, Christopher Wren, Robert Hooke, Thomas Hobbes, Oliver Goldsmith, Jane Austen, Joshua Reynolds, Samuel Taylor Coleridge, Horatio Nelson, die Schwestern Brontë, Alfred Lord Tennyson, Cecil Rhodes und Lewis Carroll (der selbst ordiniert wurde, den Beruf aber nie ausübte) waren alles Pfarrerskinder. Wie über die Maßen groß der Einfluss der Geistlichkeit war, sieht man, wenn man im Internet im britischen Dictionary of National Biography nachschaut. Wenn man rector eingibt, erhält man viertausendsechshundert Treffer, bei vicar weitere dreitausenddreihundert. Dagegen nehmen sich die 338 für »Physiker«, 492 für »Ökonom«, 639 für »Erfinder« und die 741 für »Naturwissenschaftler« sehr bescheiden aus. Sie sind interessanterweise nicht sehr viel zahlreicher als die für »Schürzenjäger«, »Mörder« oder »geistig Kranke«, werden allerdings von »Exzentrikern« mit 1010 Treffern erheblich übertroffen.
Unter den Pfarrern leisteten viele derart Hervorragendes, dass man über diesen wirklich außergewöhnlichen Herrschaften leicht vergisst, dass die meisten anderen, sofern sie überhaupt Großes vollbrachten oder den Ehrgeiz dazu hatten, keinerlei Spur davon hinterlassen haben – wie unser Mr. Marsham. Ruhm erlangte er bestenfalls als Urenkel von Robert Marsham, dem Begründer der Phänologie, der Wissenschaft (falls man sie so nennen kann), die jahreszeitliche Veränderungen verfolgt, die ersten Knospen am Baum, den ersten Kuckuck im Frühling und so weiter. Eigentlich könnte man annehmen, dass sich die Leute dergleichen selbstverständlich merkten, doch dem war bisher nicht so gewesen, jedenfalls hatten sie es nicht systematisch aufgeschrieben, und als Marsham erst einmal damit angefangen hatte, wurde es in aller Welt ein höchst beliebter, angesehener Zeitvertreib. In den Vereinigten Staaten betätigte sich zum Beispiel Thomas Jefferson als begeisterter Phänologe. Selbst als er schon Präsident war, fand er die Zeit, das erste und letzte Auftauchen von siebenunddreißig Obst- und Gemüsesorten auf den Märkten in Washington zu notieren und seinen Verwalter in Monticello, seiner Plantage in Virgina, anzuweisen, ebenfalls auf solche Dinge zu achten, damit man sehen konnte, ob die Daten signifikante Klimaunterschiede zwischen den beiden Orten anzeigten. Wenn heutige Klimaforscher sagen, dass die Apfelblüte drei Wochen früher als vor zweihundert Jahren stattfindet, berufen sie sich auf Robert Marshams Aufzeichnungen. Dieser Marsham war auch einer der reichsten Männer East Anglias. Er besaß ein großes Gut in einem Dorf bei Norwich, das sich mit dem kuriosen Namen Stratton Strawless schmückt. Dort wurde Thomas John Gordon Marsham im Jahre 1821 geboren. Als Erwachsener musste er dann nur ein paar Kilometer weiterziehen, um den Pfarrersposten in unserem Dorf anzunehmen.
Über sein Leben hier wissen wir fast nichts. Doch über den Alltag eines Landpfarrers im goldenen Zeitalter der Spezies viel, weil wir die fleißigen Aufzeichnungen von einem haben, der in der Nachbargemeinde Weston Longville lebte, acht Kilometer über die Felder nach Norden (und vom Dach unseres Pfarrhauses noch sichtbar). Er hieß James Woodforde und lebte in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. So viel anders als zu Mr. Marshams Zeiten wird es damals nicht gewesen sein. Woodforde war weder besonders fromm noch gebildet und auch nicht mit besonderen Begabungen gesegnet, doch er freute sich seines Daseins und führte fünfundvierzig Jahre lang munter Tagebuch, das, wie gesagt, einen ausgesprochen detaillierten Einblick in das Leben eines Landpfarrers bietet. Fast eineinhalb Jahrhunderte lang war es vergessen, doch nachdem es entdeckt wurde, veröffentlichte man es in gekürzter Form 1924 als Tagebuch eines Landpfarrers. Und obwohl es, wie ein Kritiker bemerkte, »wenig mehr war als eine Chronik der Völlerei«, wurde es zum internationalen Bestseller.
Welche Unmengen an Nahrungsmitteln im achtzehnten Jahrhundert aufgetischt wurden, ist schon erschütternd, und Woodforde setzte sich kaum zu einer Mahlzeit hin, die er hinterher nicht liebevoll in allen Einzelheiten beschrieb. Folgendes wurde bei einem typischen Abendessen im Jahre 1784 kredenzt: Seezunge in Hummersauce, junges Hähnchen, Ochsenzunge, Rinderbraten, Suppe, Kalbsfilet mit Morcheln und Trüffeln, Taubenpastete, Kalbsbries, junge Gans und Erbsen, Aprikosenkonfitüre, Käsekuchen, gedünstete Champignons und Trifle. Bei einem anderen Ma(h)l konnte er von einem Schleieteller probieren, einem Schinken, drei Hühnern, zwei gerösteten Enten, Nackenstück vom Schwein, Plumpudding und Zwetschgenkuchen, Apfeltörtchen, verschiedenen Früchten und Nüssen und das Ganze mit Rot- und Weißwein, Bier und Apfelwein herunterspülen. Nichts ging über ein gutes Essen. Als seine Schwester starb, hielt er seine aufrichtige Trauer schriftlich fest, fand aber auch Platz für die Bemerkung »Zum Abend heute feiner Truthahnbraten«. Aus der Außenwelt drang nicht viel in das Tagebuch. Der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg wurde kaum erwähnt, und den Sturm auf die Bastille 1789 notierte der gute Pastor zwar knapp als nackte Tatsache, schilderte aber en détail, was er zum Frühstück gefuttert hatte. Passenderweise betrifft auch der letzte Tagebucheintrag einen leckeren Schmaus.
Woodforde war sicher ein anständiger Mensch – von Zeit zu Zeit schickte er den Armen Essen und führte ein untadeliges, tugendhaftes Leben –, doch in all den Jahren, in denen er brav sein Tagebuch vollschrieb, scheint er nicht einmal auch nur einen Gedanken an das Verfassen einer Predigt verschwendet oder besondere Zuneigung zu seinen Pfarrkindern empfunden zu haben – außer dass er sich freute, wenn sie ihn zum Essen einluden, und stets gern hinging. Falls er nicht typisch ist für das, was typisch war, dann sieht man hier jedoch, was möglich war.
Wie Mr. Marsham in all das hineinpasst, wird man nie erfahren. Wenn es sein Lebensziel war, möglichst wenige Spuren in der Geschichte zu hinterlassen, dann erreichte er das auf glorreiche Weise. 1851 war er neunundzwanzig Jahre alt und unverheiratet (was er zeit seines Lebens blieb). Seine Haushälterin, eine Dame mit dem interessant ungewöhnlichen Namen Elizabeth Worm, blieb – bis zu ihrem Tode 1899 – bei ihm, wenigstens sie muss ihn also nett gefunden haben. Ob ihn sonst noch jemand nett und unterhaltsam fand, wissen wir leider nicht.
Einen kleinen ermutigenden Hinweis allerdings haben wir. Am letzten Sonntag im März 1851 führte die anglikanische Kirche eine landesweite Umfrage durch, um in Erfahrung zu bringen, wie viele Leute an dem Tag die Kirche besucht hatten. Die Ergebnisse waren schockierend. Mehr als die Hälfte aller Bewohner von England und Wales war überhaupt nicht zur Kirche gegangen und nur zwanzig Prozent in einen anglikanischen Gottesdienst. Wie genial die Pfarrer auch im Erdenken von mathematischen Regeln oder Anlegen von Wörterbüchern waren, für ihre Gemeinden waren sie offenbar nicht mehr annähernd so wichtig wie früher.
Gott sei Dank hatte sich das in Mr. Marshams Pfarrei noch nicht herumgesprochen. Die Umfrage dort ergab, dass an dem Sonntag neunundsiebzig Gläubige den Morgengottesdienst und sechsundachtzig den am Nachmittag besucht hatten. Das waren etwa siebzig Prozent der Schäflein in seinem Kirchspiel – ein deutlich über dem landesweiten Durchschnitt liegendes Resultat. Angenommen, diese Beteiligung war normal bei ihm, dann war unser Mr. Marsham offenbar ein geachteter Mann.
III.
In dem Monat, als die anglikanische Kirche ihre Besucherumfrage durchführte, fand in Großbritannien auch eine Volkszählung statt, bei der man mit vertrauensbildender Präzision zu dem Ergebnis kam, dass das Land 20 959 477 Einwohner hatte. Die Briten stellten zwar nur 1,6 Prozent der Weltbevölkerung, doch dafür waren sie so reich und produktiv wie keine andere Nation. Diese 1,6 Prozent der Menschheit zeichneten für die Hälfte der weltweiten Kohle- und Eisenproduktion verantwortlich und beherrschten fast zwei Drittel der Seefahrt und ein Drittel des Handels. So gut wie alle Baumwollerzeugnisse der Welt wurden in britischen Fabriken hergestellt, auf Maschinen, die in Großbritannien erfunden und gebaut worden waren. Die Londoner Banken verfügten über größere Einlagen als alle anderen Finanzzentren der Welt zusammen, und London war im Zentrum eines riesigen, wachsenden Empire, das zu seinen Hochzeiten knapp dreißig Millionen Quadratkilometer umfasste und in dem »God Save the Queen« die Nationalhymne eines Viertels der Weltbevölkerung war. Großbritannien war in fast allen messbaren Kategorien Weltspitze. Es war das reichste, kreativste, leistungsstärkste Land – in dem eben auch Gärtner zu Größe aufstiegen.
Plötzlich hatten die meisten Menschen zum ersten Mal in der Geschichte die Qual der Wahl. Karl Marx, Wohnsitz London, stellte erstaunt und mit einem leisen Unterton hilfloser Bewunderung fest, dass man in Großbritannien fünfhundert verschiedene Typen von Hämmern kaufen konnte. Allenthalben boomte die Wirtschaft. Heutige Londoner leben umgeben von großartigen viktorianischen Bauwerken, während die Leute damals von Baulärm umgeben waren. Binnen zwölf Jahren wurden acht Eisenbahnhöfe eröffnet, und die Unruhe und das Chaos – die Gräben, die Tunnel, die aufgerissene Erde, der ständige Stau der Fuhrwerke und anderer Fahrzeuge, der Rauch, der Lärm, das Drunter und Drüber –, die mit dem Bau von Eisenbahnen, Brücken, Kanalisationsanlagen, Pump- und Kraftwerken, U-Bahn und dergleichen einhergingen, bedeuteten, dass das viktorianische London nicht nur die größte Stadt der Welt war, sondern auch die lauteste, stinkendste, schmutzigste, lebendigste, verkehrsreichste und am meisten umgewühlte.
Die Volkszählung von 1851 ergab im Übrigen, dass im Königreich mittlerweile mehr Menschen in Städten lebten als auf dem Land (zum ersten Mal auf dem ganzen Erdenrund!), und diese ungeheuren Menschenmassen fielen überall ins Auge. Es gab Heerscharen von Arbeitern, von Reisenden, von Leuten, die zur Schule, ins Gefängnis oder ins Krankenhaus gingen. Wenn sie sich vergnügten, geschah das natürlich auch in Massen, und nirgendwo gingen sie mit solch überbordender Begeisterung hin wie zum Crystal Palace. Denn nicht nur das Gebäude war fantastisch, auch drinnen kam man aus dem Staunen nicht heraus. Verteilt auf vierzehntausend Ausstellungsobjekte wurden fast einhunderttausend Dinge gezeigt. Unter den Neuheiten waren ein Messer mit 1851(!) Klingen, Möbel, die aus entsprechend großen Kohleblöcken geschlagen worden waren (einzig und allein deshalb, weil man demonstrieren wollte, dass es möglich war), ein Bett, das zum Rettungsfloß umgebaut werden konnte, und eines, das seinen verblüfften Insassen selbsttätig in ein frisch eingelassenes Bad kippte; ferner Flugapparaturen aller Arten (außer funktionierenden), Instrumente für den Aderlass, der größte Spiegel der Welt, ein Riesenklumpen Guano aus Peru, die berühmten Diamanten mit Namen Hope beziehungsweise Koh-i-Noor3, das Modell einer Hängebrücke, die zwischen Großbritannien und Frankreich hätte gebaut werden können, sowie unendlich viele Maschinen, Textilien und alle möglichen anderen Manufakturwaren aus der ganzen Welt. The Times rechnete damals aus, dass es zweihundert Stunden dauern würde, sich alles anzusehen.
Nicht jedes Ausstellungsstück war prickelnd. Neufundland widmete seine gesamte Standfläche der Geschichte und Herstellung von Lebertran und wurde zu einer Oase der Ruhe, sehr geschätzt von allen, die Erholung von den sich durchschiebenden Massen suchten. Der Stand der Vereinigten Staaten wäre beinahe gar nicht bestückt worden. Weil der Kongress in einem Anfall von Sparsamkeit keine Mittel herausgerückt hatte, musste das Ganze privat finanziert werden. Doch als die amerikanischen Produkte in London ankamen, stellte man fest, dass die Organisatoren nur so viel bezahlt hatten, dass die Waren bis zum Hafen, nicht aber weiter zum Hyde Park transportiert werden konnten. Allem Anschein nach hatte man auch kein Geld bereitgestellt, den Stand aufzubauen und für fünf Monate mit Personal zu beschicken. Zum Glück sprang der in London lebende US-amerikanische Unternehmer George Peabody ein und rettete die amerikanische Delegation aus der selbstverschuldeten Krise, indem er einen Notgroschen von fünfzehntausend Dollar zur Verfügung stellte. All das bestätigte nur die mehr oder weniger allgemeine Überzeugung, dass die Amerikaner liebenswürdige Hinterwäldler und für unbeaufsichtigte Ausflüge in die große weite Welt noch nicht reif waren.
Umso größer war die Überraschung, als alles aufgebaut war. Am amerikanischen Stand schien es nicht mit rechten Dingen zuzugehen: Fast alle Maschinen taten etwas, was die Welt auch inständig von Maschinen erwartete – Nägel ausstanzen, Steine schleifen, Kerzen ziehen –, aber das mit einer Akkuratesse, Schnelligkeit und nimmermüder Zuverlässigkeit, angesichts derer sich andere Nationen nur verwundert die Augen reiben konnten. Elias Howes Nähmaschine beeindruckte die Damenwelt immens und verhieß das Unmögliche, nämlich, dass eine der ödesten häuslichen Tätigkeiten zum aufregenden Zeitvertreib werden konnte. Cyrus McCormick stellte eine Mähmaschine vor, die angeblich die Arbeit von vierzig Männern erledigte, eine derart verwegene Behauptung, dass sie kaum einer glaubte. Doch als man mit dem Vehikel hinaus aufs Land fuhr, zeigte sich, dass es alles konnte, was man versprochen hatte. Am aufregendsten aber war Samuel Colts neuer Trommelrevolver, der mehrschüssig und daher gnadenlos tödlich war – und obendrein noch manufakturmäßig hergestellt werden konnte.
Nur eine einheimische Kreation konnte es mit derartigen Meisterleistungen hinsichtlich Neuheit, Nützlichkeit und Präzision aufnehmen – Paxtons großartige Halle selbst, doch ausgerechnet die sollte nach dem Ende der Ausstellung verschwinden. Für viele Europäer waren die amerikanischen Erzeugnisse der erste beunruhigende Hinweis darauf, dass die Tabak kauenden Hillbillys jenseits des Großen Teichs in aller Stille auf dem Weg zum Industriegiganten waren – aber dann wieder fanden sie es so unwahrscheinlich, dass sie es nicht mal glaubten, als es tatsächlich so kam.
Die beliebteste Attraktion auf der Weltausstellung waren indes keine Ausstellungsstücke, sondern die eleganten »Rückzugsräume«, wo sich die Besucher in allem Komfort erleichtern konnten. Das Angebot wurde dankbar und begeistert von 827 000 Leuten in Anspruch genommen, einmal an einem einzigen Tag von 11 000 dringend Bedürftigen. 1851 bestand ein erschreckender Mangel an öffentlichen Toiletten. Im Britischen Museum mussten sich bis zu 30 000 Besucher am Tag gerade mal zwei Außenaborte teilen. Im Crystal Palace aber gab es sogar Spülklosetts, was die Besucher so entzückte, dass sie nichts Eiligeres zu tun hatten, als sich zu Hause ebensolche einbauen zu lassen. Was, wie wir später sehen werden, rasch katastrophale Folgen für London haben sollte.
Neben dieser hygienischen Neuerung gab es auf der Weltausstellung auch ein gesellschaftliches Novum, denn zum ersten Mal kamen Menschen aus allen Schichten zusammen und gingen quasi auf Tuchfühlung miteinander. Viele hatten Angst, dass die einfachen Leute – »die hehren Ungewaschenen«, wie William Makepeace Thackeray sie noch im Jahr zuvor in seinem Roman Die Geschichte von Pendennis genannt hatte – sich des in sie gesetzten Vertrauens als unwürdig erweisen und den Hochmögenden alles verderben, ja, vielleicht sogar Sabotage betreiben würden. Schließlich war es erst drei Jahre her, dass es in Paris, Berlin, Krakau, Budapest, Wien, Neapel, Bukarest und Zagreb Volksaufstände gegeben hatte und Regierungen gestürzt worden waren.
Man befürchtete ganz besonders, dass die Ausstellung Chartisten und ihre Sympathisanten anziehen würde. Der Chartismus war eine populäre Bewegung – der Name stammt von der »People’s Charter« (die wiederum in Anlehnung an die Magna Charta formuliert worden war) aus dem Jahre 1837. Man forderte eine Reihe politischer Reformen, die sich im Rückblick allesamt eher bescheiden ausnehmen: Es ging von der Abschaffung von rotten und pocket boroughs4 bis zur Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Männer. Über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren reichten die Chartisten eine Reihe von Petitionen im Londoner Parlament ein, von denen eine fast zehn Kilometer lang und angeblich von 5,7 Millionen Menschen unterschrieben war. Das Parlament zeigte sich beeindruckt, lehnte sie aber trotzdem ab, natürlich zum Besten des Volkes. Ein allgemeines Wahlrecht, so die einhellige Meinung, war eine gefährliche Sache – »gänzlich unvereinbar mit dem Bestehen einer Zivilisation«, wie es der Historiker und Parlamentsabgeordnete Thomas Babington Macaulay ausdrückte.
1848 spitzte sich die Situation in London zu. Die Chartisten kündigten eine Massenkundgebung auf dem Kennington Common, südlich der Themse, an. Man befürchtete, die wutschnaubende Menge würde sich in eine solche Entrüstung hineinsteigern, dass sie über die Westminster Bridge rasen und das Parlament stürmen würde. Rasch wurden in der ganzen Stadt Regierungsgebäude gesichert. Im Foreign Office verbarrikadierte Lord Palmerston, seines Zeichens Außenminister, die Fenster mit gebundenen Bänden der Times. Auf dem Dach des Britischen Museums wurden Männer mit einem Vorrat an Backsteinen postiert, die sie auf die Köpfe all derer herniederprasseln lassen sollten, die das Gebäude zu erobern versuchten. Vor der Bank von England wurden Kanonen aufgestellt und die Staatsdiener in mehreren Behörden sogar mit Schwertern und uralten, vielleicht nicht durchweg topgepflegten Musketen ausgerüstet, die für ihre Benutzer genauso eine Gefahr darstellten wie für diejenigen, die ihnen mutig entgegentraten. Einhundertsiebzigtausend Sonderschutzmänner – hauptsächlich reiche Herren und ihre Diener – standen in Alarmbereitschaft; das Kommando hatte der tattrige Herzog von Wellington, der zweiundachtzig Jahre alt und taub für alles war, was nicht extrem laut und beherzt daherkam.
Schließlich aber zerstreute sich die Versammlung friedlich, und das nicht nur, weil sich der Führer der Chartisten, Feargus O’Connor, auf einmal sehr bizarr verhielt (eine syphilitische Demenz war noch nicht diagnostiziert und führte erst im Jahr darauf zu seiner Einweisung in eine Anstalt). Die Versammelten waren vielmehr im Grunde ihres Herzens keine wilden Revolutionäre, und ein großes Blutvergießen wollten sie weder anzetteln noch ihm zum Opfer fallen. Außerdem sorgte ein rechtzeitiger Platzregen dafür, dass die Option »Rückzug in den Pub« weitaus reizvoller erschien als »Sturm auf das Parlament«. The Times befand,
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »At Home. A Short History of Private Life« bei Doubleday, an imprint of Transworld Publishers, London.
3. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Bill Bryson Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-641-09097-5
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe
Geldsummen von 1851 mit heutigen zu vergleichen ist nicht unkompliziert, denn man kann verschiedene Methoden dabei anwenden. Außerdem waren Dinge, die jetzt teuer sind (Ackerland, Dienstboten) damals verhältnismäßig billig, und umgekehrt. Ich danke Professor Ranald Michie von der Durham University für den Hinweis, dass man die akkuratesten Ergebnisse erhält, wenn man die Einzelhandelspreise von 1851 und heute vergleicht. So betrachtet, entsprächen Mr. Marshams fünfhundert Pfund heute etwa 400 000 Pfund. Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen in Großbritannien betrug 1851 etwas mehr als zwanzig Pfund.
Das Schiff hieß Resurgam, »Ich werde auferstehen«, was sich als eher unglücklicher Name erwies, denn drei Monate nachdem es 1878 vom Stapel gelaufen war, sank es in der Irischen See und erstand nie wieder auf. Garrett im Übrigen auch nicht. Von seinen Erfahrungen entmutigt, gab er das Predigen und Erfinden auf und zog nach Florida, wo er sich als Landwirt erprobte. Auch das erwies sich als Desaster, und er beendete sein enttäuschendes, gnadenlos immer weiter bergab führendes Leben als Infanterist des amerikanischen Heeres im Spanisch-Amerikanischen Krieg und starb, verarmt und vergessen, 1902 in New York an Tuberkulose.
Der Koh-i-Noor war zwei Jahre zuvor eine der Kronjuwelen geworden, und zwar nachdem er von der britischen Armee bei ihrer Eroberung des Punjab dem unrechtmäßigen Besitzer abgenommen (oder, je nach Standpunkt des Betrachters: erbeutet) worden war. Die meisten Leute waren allerdings von dem Juwel eher enttäuscht. Obwohl der Stein – mit fast zweihundert Karat – groß war, war er schlecht geschliffen, und es mangelte ihm an Brillanz. Nach der Weltausstellung wurde er beherzt auf funkelndere einhundertneun Karat heruntergestutzt und in die Königskrone eingesetzt.
In rotten boroughs konnte ein Parlamentsabgeordneter von einer sehr geringen Anzahl Menschen gewählt werden. Im schottischen Bute zum Beispiel besaß gerade mal ein Einwohner von vierzehntausend das Wahlrecht und konnte sich auch selbst wählen. In pocket boroughs wiederum wohnte überhaupt niemand, aber sie waren mit einem Sitz im Parlament »vertreten«, den derjenige, der darüber verfügte, verkaufen oder auch mal einem »schwer vermittelbaren« Sohn vermachen konnte. Der berühmteste pocket borough war Dunwich, einstmals eine Küstenstadt in Suffolk mit einem großen Hafen, dem drittgrößten in England, der zusammen mit der Stadt 1286 in einem Sturm ins Meer gespült worden war. Trotz seines unübersehbaren Nichtvorhandenseins wurde dieser borough bis 1832 von einer Reihe privilegierter Nullen im Parlament repräsentiert.