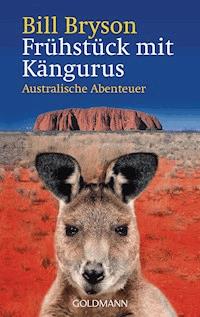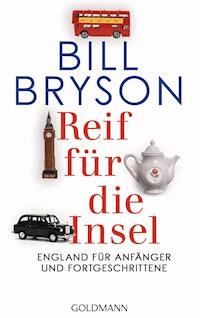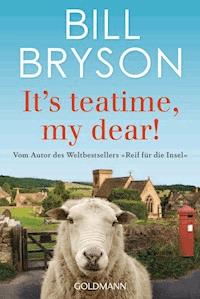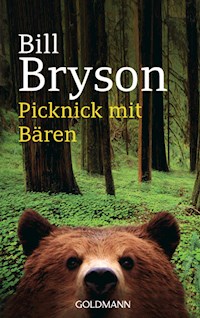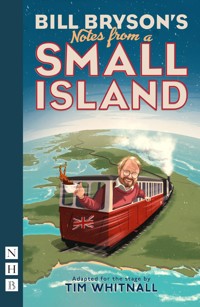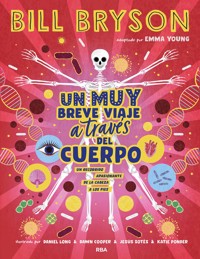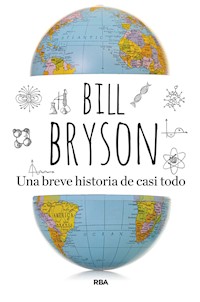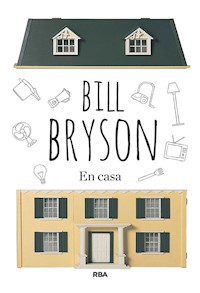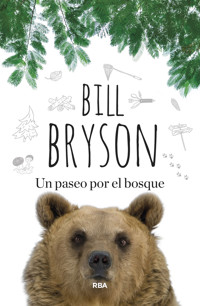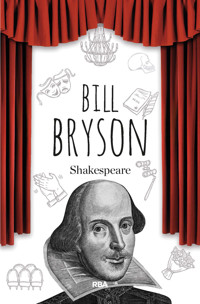11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein intelligenter, aberwitzig komischer und immer wieder überraschender Beitrag zur amerikanischen Kulturgeschichte
Nachdem Bill Bryson zwanzig Jahre in England gelebt hat, ist er wieder reif für seine amerikanische Heimat. Dort angekommen, stellt er allerdings fest, dass sich vieles verändert hat. Oder ist ihm der ganz normale Wahnsinn früher einfach nicht aufgefallen?
Der erfolgreichste Sachbuchautor unserer Zeit schreibt ein hinreißend komisches Porträt seines Heimatlandes und seiner Mitbürger.
Bill Bryson ist der Tom Sharpe des modernen Reiseberichts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Notes from a Big Country« bei Doubleday, London
Taschenbuchausgabe Februar 2002
Copyright © der Originalausgabe 1998by Bill BrysonCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2000 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen derPenguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Covergestaltung: UNO Werbeagentur Coverfoto: gettyimages / Stone / Kendall McMinimy
AL · Herstellung: Sebastian Strohmaier
ISBN 978-3-641-09054-8V004
www.penguin.de
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Replace outdated disclaimer texts as necessary, make sure there is only one instance of the disclaimer.
Inhaltsverzeichnis
Buch
Nachdem er zwanzig Jahre in England gelebt hat, findet der amerikanische Autor Bill Bryson, daß es an der Zeit sei, seiner Wahlheimat den Rücken zu kehren und mit seiner Familie zurück in seine Heimat zu gehen. Doch schon bald kommt ihm dort vieles, was ihm früher einmal selbstverständlich erschien, befremdlich, sogar merkwürdig vor.
Mit frischem Blick, geschärft durch die Jahre der Abwesenheit, macht sich Bill Bryson daran, die USA unter die Lupe zu nehmen. Lustvoll seziert er Arten und Unarten seiner Landsleute, und mit wahrer Entdeckerwonne spürt er Absurdes und Kurioses auf, das im privaten wie im öffentlichen Leben lauert. Ob Bill Bryson sich den Wonnen des Junkfood-Paradieses hingibt, von Motels und Highways erzählt oder uns über die Tücken amerikanischer Müllschlucker aufklärt: »Streiflichter aus Amerika« ist eine amüsante Reise durch den Wahnsinn des Alltags im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und ein immer wieder überraschender Beitrag zur amerikanischen Kulturgeschichte – ironisch, scharfzüngig und voll britischen Humors!
Autor
Bill Bryson wurde 1951 in Des Moines, Iowa, geboren. 1977 ging er nach Großbritannien und schrieb dort mehrere Jahre u.a. für die Times und den Independent. Mit »Reif für die Insel« gelang Bryson schließlich der weltweite Durchbruch. Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt, und auch mit seinen zuletzt erschienenen Reiseberichten »Picknick mit Bären« und »Frühstück mit Kängurus« stürmte Bill Bryson die internationalen Bestsellerlisten. 1996 kehrte Bill Bryson mit seiner Familie in die USA zurück, wo er heute in Hanover, New Hampshire lebt.
Von Bill Bryson ist bei Goldmann bereits erschienen:
Picknick mit Bären Reif für die Insel Streifzüge durch das Abendland Frühstück mit Kängurus. Australische Abenteuer
Ein Wort vorweg
Im Spätsommer 1996 rief mich Simon Kelner, ein alter Freund und außergewöhnlich netter Bursche, in New Hampshire an und fragte, ob ich für die Night & Day-Beilage der Mail on Sunday, deren Chef er gerade geworden war, eine wöchentliche Kolumne über die Vereinigten Staaten schreiben würde.
Über die Jahre hin hatte mich Simon überredet, alles mögliche zu schreiben, für das ich keine Zeit hatte, aber dieses Ansinnen übertraf alles bisher Dagewesene.
»Nein«, sagte ich. »Ich kann nicht. Tut mir leid. Unmöglich.«
»Dann fängst du also nächste Woche an.«
»Simon, du hast mich offensichtlich nicht verstanden. Es geht nicht.«
»Wir haben gedacht, wir nennen es ›Streiflichter aus Amerika‹.«
»Simon, nenn es ›Leerspalte am Anfang der Beilage‹! Ich habe keine Zeit.«
»Wunderbar«, sagte er, offenbar nicht ganz bei der Sache. Ich hatte den Eindruck, daß er gleichzeitig mit etwas anderem beschäftigt war, und tippte darauf, daß er Models für ein Bademodenheft begutachtete. Einerlei, er hielt jedenfalls die ganze Zeit die Hand über den Hörer und erteilte Leuten in seiner Umgebung Chefredakteuranweisungen.
»Dann schicken wir dir den Vertrag«, sagte er, als er wieder dran war.
»Nein, Simon, ich schaff es nicht. Ich kann dir keine wöchentliche Kolumne schreiben. Schluß, aus, Ende. Hast du das kapiert? Simon, sag mir, daß du es kapiert hast.«
»Großartig. Ich freue mich. So, ich muß los.«
»Simon, hör mir bitte zu. Ich kann keine wöchentliche Kolumne schreiben. Es ist unmöglich. Simon, hörst du zu? Simon? Hallo? Simon, bist du noch dran? Hallo? Mist.«
Hier sind also siebenundsiebzig Kolumnen, die Ausbeute aus den ersten achtzehn Monaten der ›Streiflichter aus Amerika‹. Und ehrlich, ich hatte wirklich keine Zeit dazu.
Wieder zu Hause
In einem meiner Bücher habe ich einmal gewitzelt, daß man drei Dinge im Leben nie schafft. Man gewinnt nie einen Streit mit der Telefongesellschaft, man bringt einen Kellner nicht dazu, einen zu sehen, bevor er nicht bereit ist, einen zu sehen, und man kann nie wieder nach Hause zurückkommen. In den letzten Monaten habe ich Punkt drei stillschweigend, ja sogar gern einer Revision unterzogen.
Im Mai vor einem Jahr bin ich nach fast zwei Jahrzehnten in England zurück in die Staaten gezogen, mit Frau und Kindern. Nach so langer Zeit wieder nach Hause zu kommen ist eine unerwartet verstörende Angelegenheit, ein bißchen, wie wenn man aus einem langen Koma erwacht. Man entdeckt nämlich bald, daß die Zeit Änderungen mit sich gebracht hat, angesichts derer man sich ein wenig blöde und von gestern vorkommt. Man zückt hoffnungslos unangemessene Geldscheine, wenn man kleine Einkäufe tätigt, steht kopfschüttelnd vor Verkaufsautomaten und öffentlichen Telefonen und stellt erstaunt fest – spätestens dann, wenn man fest am Ellenbogen gepackt wird –, daß es Straßenkarten an Tankstellen nicht mehr gratis gibt.
In meinem Fall wurde das Problem dadurch erschwert, daß ich als Jugendlicher weggegangen war und als Mann mittleren Alters zurückkehrte. Alles, was man als Erwachsener tut – Hypotheken aufnehmen, Kinder kriegen, Rentenversicherungen abschließen, ein Interesse für Stromleitungen im eigenen Heim entwickeln –, hatte ich nur in England getan. Fliegengitterfenster und all die anderen Dinge, die typisch amerikanisch waren, betrachtete ich stets als Domäne meines Vaters.
Als ich dann plötzlich für ein Haus in Neuengland verantwortlich war und mich mit den mysteriösen Leitungen, Rohren und Thermostaten, dem Müllschlucker mit seinen Mucken und der lebensgefährlichen automatischen Garagentür herumschlagen mußte, fand ich das sowohl furchterregend als auch spannend.
Und genau das ist es in mancherlei Hinsicht, wenn man nach vielen Jahren im Ausland wieder nach Hause zieht – man trifft auf eine merkwürdige Mischung aus tröstlich Vertrautem und seltsam Unbekanntem und gerät schon mal aus der Fassung, wenn man sich gleichzeitig derart in seinem Element und fehl am Platze fühlt. Ich kann die unmöglichsten Kleinigkeiten hersagen, an denen man sofort erkennt, daß ich Amerikaner bin – welcher der fünfzig Staaten eine Einkammerlegislative hat, was ein »squeeze play« im Baseball ist, wer Captain Kangaroo im Fernsehen gespielt hat –, und ich kenne sogar zwei Drittel des Textes der amerikanischen Nationalhymne, des Star-Spangled-Banner, mithin mehr als die meisten Leute, die sie in aller Öffentlichkeit gesungen haben.
Aber schicken Sie mich in einen Heimwerkerladen, und ich bin selbst jetzt noch hilflos und verloren. Monatelang führte ich mit dem Verkäufer in unserem hiesigen True Value Gespräche, die in etwa so verliefen:
»Hi, ich brauch was von dem Zeugs, mit dem man Löcher in der Wand stopft. In der Heimat meiner Frau heißt das Polyfilla.«
»Ah, Sie meinen Spackle.«
»Sehr gut möglich. Und ich brauche ein paar von den kleinen Plastikdingern, mit denen man Schrauben in der Wand verankert, wenn man Regale aufhängen will. Ich kenne sie als Rawlplugs.«
»Na, wir nennen sie Dübel.«
»Gut, das werd ich mir merken.«
Wirklich, ich hätte mich auch nicht fremder gefühlt, wenn ich in Lederhosen dort aufgekreuzt wäre. Es war ein Schock. Obwohl ich mich in Großbritannien immer sehr wohl gefühlt hatte, hatte ich doch stets Amerika als meine Heimat im eigentlichen Sinne betrachtet. Von dort kam ich, dieses Land verstand ich wirklich, das war die Grundlage, von der aus ich alles andere beurteilte.
Ulkigerweise fühlt man sich nirgendwo mehr als Kind seines eigenen Landes, als dort, wo fast alle anderen Menschen Kinder dieses anderen Landes sind. Amerikaner zu sein war zwanzig Jahre lang das, was mich definierte. Es gehörte zu meiner Persönlichkeit, dadurch unterschied ich mich. Einmal bekam ich deshalb sogar einen Job. In einem Anfall jugendlichen Übermuts hatte ich nämlich gegenüber einem Redakteur der Times behauptet, ich würde als einziges Redaktionsmitglied »Cincinnati« richtig schreiben können. (Was dann auch der Fall war.)
Gott sei Dank hat meine Rückkehr in die USA auch ihre guten Seiten. All das, was schön ist in meiner alten Heimat, hatte etwas bezaubernd Neues für mich. Wie jeder Ausländer war ich regelrecht benommen von der berühmten Lockerheit der Leute, der schwindelerregenden Überfülle an allem und jedem, der schier grenzenlosen, wundersamen Leere eines amerikanischen Kellers, dem Entzücken, gutgelaunte Kellnerinnen zu erleben, der seltsam erstaunlichen Erfahrung, daß Eisessen kein Luxus ist.
Außerdem widerfuhr mir ständig die unerwartete Freude, den Dingen wiederzubegegnen, mit denen ich aufgewachsen war, die ich aber großteils vergessen hatte: Baseball im Radio, das zutiefst befriedigende Boing-bäng einer zuschlagenden Fliegengittertür im Sommer, lebensgefährliche Gewitterstürme, richtig hohen Schnee, Thanksgiving und der Vierte Juli, Glühwürmchen, Klimaanlagen an unerträglich heißen Tagen, Jell-o-jelly, (Wackelpeter mit echten Fruchtstückchen, den zwar keiner ißt, der aber hübsch aussieht, wenn er einfach so auf dem Teller vor einem schwabbelt), der angenehm komische Anblick, sich selbst in Shorts zu sehen. Eigenartig, das bedeutet einem doch alles sehr viel.
Letztendlich hatte ich also unrecht. Man kann wieder nach Hause zurückkehren. Hauptsache, man bringt ein bißchen Extrageld für Straßenkarten mit und merkt sich das Wort Spackle.
Hilfe!
Neulich rief ich meine Computer-Hotline an, weil ich mal wieder wissen wollte, wie es ist, wenn ein viel Jüngerer einen als Blödmann abstempelt. Der jungendlich klingende Mensch am anderen Ende der Leitung sagte mir, er brauche die Seriennummer auf meinem Computer, bevor er mir weiterhelfen könne.
»Und wo finde ich die?« fragte ich mißtrauisch.
»Sie ist unter der zentralen Funktionseinheit des Gleichgewichtsstörungsaggregats«, sagte er oder Worte ähnlich verblüffenden Inhalts.
Sehen Sie, deshalb rufe ich die Computerinfonummer auch nicht oft an. Wir haben noch keine vier Sekunden gesprochen, und schon spüre ich, wie ich in einem Strudel von Ignoranz und Scham in die eisigen Tiefen eines Meeres der Demütigung hinabgezogen werde. Schicksalsergeben weiß ich, daß der junge Mann mich nun jeden Moment fragt, wieviel RAM ich habe.
»Steht das irgendwo in der Nähe des Bildschirmdingsbums?« frage ich hilflos.
»Kommt drauf an. Haben Sie das Modell Z-40LX Multimedia HPii oder das ZX46/2Y Chrom BE-BOP?«
Und so plaudern wir dann weiter. Mit dem Endergebnis, daß die Seriennummer meines Computers in eine kleine Metallplakette am Boden des Gehäuses eingestanzt ist – dem Gehäuse mit der CD-Schublade, die zu öffnen und schließen solchen Spaß macht. Sie können mich ja einen idealistischen Narren nennen, aber wenn ich alle Computer, die ich verkaufte, mit einer Identifikationsnummer versähe und dann von den Benutzern verlangte, daß sie die jedesmal, wenn sie mit mir reden wollten, parat hätten – dann würde ich sie eher nicht so anbringen, daß man immer, wenn man sie herausfinden will, Möbel rücken und den Nachbarn zu Hilfe holen muß.
Aber darum geht’s mir im Moment nicht.
Mir geht’s darum, daß die Nummer meines Modells CQ 124765900-03312-DiP/22/4 oder so ähnlich lautete. Warum? Warum um Himmels willen braucht mein Computer eine derart atemberaubend komplizierte Kennzeichnung? Bei diesem Numeriersystem gäbe es immer noch genügend freie Zahlenkombinationen, wenn jedes Neutrino im Universum, jedes Materienpartikelchen zwischen hier und dem letzten Wölkchen des verwehenden Urknallgases einen Computer von dieser Firma kaufen würde.
Neugierig geworden, unterzog ich alle Nummern in meinem Leben einer genaueren Betrachtung, und fast jede war absurd übertrieben. Meine Scheckkartennummer hat zum Beispiel dreizehn Ziffern. Das reicht für fast zehn Billionen potentielle Kunden. Wen wollen sie verarschen? Meine Kundenkartennummer bei der Autovermietung hat nicht weniger als siebzehn Ziffern. Sogar mein Videoladen um die Ecke scheint 1999 Billionen Kunden in seiner Kartei zu haben (was vielleicht erklärt, warum L. A. Confidential nie da ist).
Aber bei weitem am imponierendsten ist meine Blue-Cross- /Blue-Shield-Krankenversichertenkarte – die Karte, die jeder Amerikaner bei sich tragen muß, wenn er nicht an einem Unfallort liegengelassen werden will. Sie identifiziert mich nicht nur als Nummer YGH475907018 00, sondern auch als der Gruppe 02368 zugehörig. Vermutlich ist in jeder Gruppe ein Mensch mit derselben Nummer, wie ich sie habe. Da könnte man ja beinahe auf die Idee kommen, Treffen zu veranstalten.
All das ist aber nur der langen Vorrede kurzer Sinn, um zum Hauptpunkt unserer heutigen Erörterung zu kommen, nämlich einer der großen Verbesserungen im amerikanischen Alltag, der Einführung von Telefonnummern, die jeder Idiot behalten kann. Lassen Sie mich erklären.
Aus komplizierten historischen Gründen befinden sich auf den Tasten aller amerikanischen Telefone (außer auf der 1 und der 0) auch drei Buchstaben des Alphabets. Auf der Taste für 2 steht ABC, der für 3 DEF und so weiter.
Früher einmal wußte man, daß man sich Nummern leichter merken kann, wenn man sich auf die Buchstaben verläßt und nicht auf die Ziffern. Wenn man zum Beispiel in meiner Heimatstadt Des Moines die Zeitansage anrufen wollte, mußte man 244-5646 wählen, was natürlich keiner behalten konnte. Wenn man aber BIG JOHN wählte, bekam man ebendiese Nummer, und alle behielten sie mühelos. (Nur seltsamerweise meine Mutter nicht, die es nie so mit Vornamen hatte und gewöhnlich bei irgendeinem Fremden landete, den sie weckte und nach der Zeit fragte. Aber das ist eine andere Geschichte.)
Irgendwann in den letzten zwanzig Jahren entdeckten große Firmen, daß sie uns allen das Leben leichter machen und jede Menge gewinnträchtiger Telefonate für sich verbuchen konnten, wenn sie sich Nummern mit eingängigen Buchstabenkombinationen zulegten. Wenn man jetzt eine Geschäftsnummer anruft, wählt man fast ausnahmslos 1-800-FFY TWA oder 24-GET-PIZZA oder was weiß ich. In den letzten zwei Dekaden gab es nicht viel, das simplen Gemütern wie mir das Leben deutlich lebenswerter gemacht hat, aber das zählt einwandfrei dazu.
Während ich in England einer schulmeisterlichen Stimme lauschen mußte, die mich beschied, daß die Vorwahl für Chippenham nun 01724750 lautete, außer bei einer vierstelligen Telefonnummer, da sei sie 9, esse ich nun Pizza, buche Flüge und bin, was die moderne Telekommunikation betrifft, um einiges versöhnlicher gestimmt.
Und jetzt verrate ich Ihnen eine großartige Idee. Ich finde, wir sollten alle eine Nummer für alles haben. Meine wäre natürlich 1-800-BILL. Und sie wäre wirklich für alles – sie würde auf meinen Schecks auftauchen, meinen Paß zieren, ich könnte ein Video damit ausleihen, und mein Telefon würde klingeln, wenn man sie wählte.
Es würde natürlich bedeuten, daß man unzählige Computerprogramme neu schreiben müßte, aber das wäre sicher zu schaffen. Ich habe vor, es mit meinem Computerlieferanten zu besprechen, sobald ich mal wieder an meine Seriennummer komme.
Also, Herr Doktor, ich wollte mich gerade hinlegen …
Das gibt’s doch nicht! Laut letztem statistischen Jahrbuch der Vereinigten Staaten ziehen sich jedes Jahr mehr als 40 000 US-Bürger auf Betten, Matratzen und Kissen Verletzungen zu. Denken Sie mal eine Minute darüber nach. Das sind mehr Menschen, als in einer mittleren Großstadt wohnen, fast 1100 Betten-, Matratzen- oder Kissenunfälle pro Tag. In der Zeit, die Sie zum Lesen dieses Artikels brauchen, haben es vier Amerikaner irgendwie geschafft, sich an ihrem Bettzeug zu lädieren.
Wenn ich es nun anspreche, dann nicht deshalb, weil ich die Leute hier für tölpelhafter als den Rest der Welt halte, wenn es gilt, sich abends hinzulegen (obwohl es offensichtlich Tausende gibt, die eine zusätzliche Trainingseinheit gebrauchen könnten), sondern weil ich Ihnen erzählen will, daß es über dieses ausgedehnte, riesige Land fast keine Statistik gibt, bei der man nicht ins Stutzen gerät.
So richtig begriff ich das erst neulich wieder, als ich in unserer Stadtbücherei etwas völlig anderes in der erwähnten Statistik nachschlagen wollte und zufällig auf »Tabelle Nummer 206: Verletzungen durch Konsumgüter« stieß. Selten habe ich ein unterhaltsameres halbes Stündchen verbracht.
Bedenken Sie doch einmal diese faszinierende Tatsache: Fast 50 000 Amerikaner ziehen sich jedes Jahr an Bleistiften, Kugelschreibern und anderem Schreibtischzubehör Verwundungen zu. Wie machen sie das? Ich habe so manche lange Stunde am Schreibtisch gesessen und hätte fast jedes Malheur als willkommene Abwechslung begrüßt, bin aber nicht ein einziges Mal auch nur annähernd soweit gekommen, mir wirklich körperlichen Schaden zuzufügen.
Ich frage Sie also noch einmal: Wie schaffen diese Leute das? Vergessen Sie bitte nicht, daß es sich um ernsthafte Blessuren handelt, die einen Trip zur Ersten Hilfe nötig machen. Sich eine Heftklammer in die Zeigefingerspitze zu rammen zählt nicht (was mir tatsächlich häufiger passiert und manchmal nur zufällig). Wenn ich nun den Blick über meinen Schreibtisch schweifen lasse, sehe ich in einem Umkreis von drei Metern keine einzige Gefahrenquelle – es sei denn, ich stecke den Kopf in den Laserdrucker oder ersteche mich mit der Schere.
Aber so ist das ja mit Haushaltsunfällen, falls Tabelle 206 irgendwelche Anhaltspunkte bietet – sie widerfahren einem allenthalben. Überlegen Sie mal mit: 1992 (dem letzten Jahr, aus dem Zahlen verfügbar sind) haben sich hier mehr als 400 000 Menschen an Sesseln, Sofas oder Schlafcouchen lädiert. Was lernen wir daraus? Etwas Entscheidendes über das Design moderner Möbel oder nur, daß die Leute hier außergewöhnlich sorglose Hinsetzer sind? Auf jeden Fall, daß das Problem immer schlimmer wird. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der Sessel-, Sofa- und Schlafcouchunfälle um 30 000 erhöht, was ein besorgniserregender Trend selbst für diejenigen von uns ist, die Polstermöbeln offen und furchtlos entgegentreten. (Das mag natürlich die Kernursache der Misere sein – blindes Vertrauen.)
Wie vorauszusehen, war die aufregendste Kategorie »Treppen, Rampen und Flure« mit fast zwei Millionen verdutzter Opfer; ansonsten waren gefährliche Gegenstände jedoch viel harmloser als ihr Ruf. An Stereoanlagen haben sich mit 46 022 Fällen mehr Menschen verletzt als an Skateboards (44 068), Trampolins (43 655) oder sogar Rasierapparaten beziehungsweise
-messern (43 365). Lediglich 166 670 übereifrige Hacker haben sich mit Beilen und Äxten verstümmelt, und selbst Sägen und Kettensägen forderten nur die relativ bescheidene Zahl von 38 692 Opfern. Papiergeld und Münzen übrigens fast soviel wie Scheren (30 274 zu 34 062).
Doch während ich mir durchaus vorstellen kann, daß jemand eine Zehncentmünze verschluckt (»He, Leute wollt ihr mal einen guten Trick sehen?«) und dann wünscht, er hätte es nicht getan, weiß ich partout nicht, was man mit Geldscheinen anstellen muß, um anschließend bei der Ersten Hilfe zu landen. Interessant wäre natürlich, ein paar der Patienten kennenzulernen.
Ja, ich würde mit fast allen der 263 000 Menschen, die sich an Zimmerdecken, Wänden und Innenraumverkleidungen Schaden zugefügt haben, gern mal einen Schwatz halten. Ich bin sicher, wer mit einer Zimmerdecke aneinandergeraten ist, hat eine hörenswerte Geschichte zu erzählen. Desgleichen würde ich Zeit für die 31 000 Unglücksraben erübrigen, die mit ihren »Putz- und Pflegeutensilien« Schwierigkeiten hatten.
Doch am allerliebsten würde ich mit den 142 000 Pechvögeln plaudern, die sich in ärztliche Behandlung begeben mußten, weil sie durch ihre Kleidung Verwundungen erlitten haben. Was haben sie nun? Eine komplizierte Schlafanzugfraktur? Ein Trainingshosenhämatom? Da läßt mich meine Phantasie im Stich.
Ein Freund von mir ist orthopädischer Chirurg, und hat mir erst neulich erzählt, daß eines der Berufsrisiken in seinem Job ist, daß man sich fast überhaupt nicht mehr traut, was zu tun, weil man ständig Leute flickt, die in der unwahrscheinlichsten, unvorhersehbarsten Art und Weise auf die Nase fallen. (Gerade an dem Tag hatte er einen Mann behandelt, dem – zur Verblüffung beider Beteiligter – ein Elch durch die Windschutzscheibe geflogen war.) Dank Tabelle 206 dämmerte mir plötzlich, was mein Freund meinte.
Übrigens hatte ich in der Bücherei ursprünglich etwas über die Kriminalitätszahlen für New Hampshire, wo ich nun wohne, nachlesen wollen. Ich hatte gehört, es sei einer der sichersten Staaten der USA, was sich auch bestätigte. Im letzten erfaßten Jahr hatte es nur vier Morde gegeben – im Vergleich zu mehr als dreiundzwanzigtausend im gesamten Land – und sehr wenig schwere Verbrechen.
Aber das alles bedeutet natürlich, daß es statistisch gesehen viel wahrscheinlicher ist, daß ich durch meine Zimmerdecke oder Unterhosen zu Schaden komme – um nur zwei potentiell tödliche Gefahrenquellen zu nennen – als durch einen Fremden. Und ehrlich gesagt, finde ich das kein bißchen tröstlich.
Baseballsüchtig
Manchmal fragen mich Leute: »Was ist der Unterschied zwischen Baseball und Cricket?«
Die Antwort ist einfach. Es sind beides Spiele, die große Geschicklichkeit, Bälle und Schläger erfordern, aber einen entscheidenden Unterschied aufweisen: Baseball ist aufregend, und wenn man am Ende des Tages nach Hause geht, weiß man, wer gewonnen hat.
War nur ein kleiner Scherz am Rande. Cricket ist ein wunderbarer Sport, voll herrlicher winziger Augenblicke echter Action, über eine lange Spielzeit verteilt. Wenn mir ein Arzt je vollkommene Ruhe und ein Minimum an Aufregung verordnet, werde ich sofort Cricketfan. Bis dahin, das verstehen Sie hoffentlich, gehört mein Herz dem Baseball.
Damit bin ich aufgewachsen, ich habe es als Junge gespielt, und das ist natürlich lebenswichtig, wenn man einen Sport auch nur annähernd liebenlernen will. So richtig begriffen habe ich das, als ich in England mit ein paar Jungs auf den Fußballplatz ging, um ein bißchen rumzubolzen.
Ich hatte im Fernsehen schon Fußball gesehen und dachte, ich sei einigermaßen im Bilde, was man dabei tun muß. Als also der Ball mit einer hohen Flanke in meine Richtung geschlagen wurde, wollte ich ihn lässig mit Kopfstoß ins Netz lupfen, so wie ich es bei Kevin Keegan gesehen hatte. Ich dachte, es wäre wie Beachballköpfen – ich höre, wie es ganz leise »bong« macht, der Ball löst sich elegant von meiner Braue und segelt in einem wunderschönen Bogen ins Tor. Aber natürlich war es, als hätte ich eine Bowlingkugel geköpft. Ich hatte noch nie erlebt, daß sich etwas so gräßlich anders anfühlte, als ich erwartet hatte. Noch Stunden danach schwankte ich, einen roten Kreis und das Wort »adidas« auf die Stirn gedruckt, auf wackligen Beinen durch die Gegend und schwor mir, etwas so Dämliches und Schmerzhaftes nie wieder zu tun.
Ich bringe es nur deshalb hier zur Sprache, weil die World Series gerade begonnen hat und ich Ihnen erzählen will, warum ich so aufgeregt bin. Die World Series ist der jährliche Baseballwettbewerb zwischen dem Meister der American League und dem Meister der National League.
Das heißt, so ganz stimmt das nicht mehr; das Reglement ist vor einigen Jahren geändert worden. Bei dem alten bestand das Problem darin, daß nur zwei Mannschaften teilnahmen. Und man muß ja keine höhere Mathematik können, um sich auszurechnen, daß eine Menge mehr Geld aus der Angelegenheit herauszuschlagen ist, wenn man es so deichselt, daß mehr Teams mitmachen.
Also teilte sich jede Liga in drei Gruppen – die West-, Ost-und Zentralliga – mit vier oder fünf Teams, und in der World Series konkurrieren nun nicht mehr die beiden besten Mannschaften – jedenfalls nicht notwendigerweise –, sondern die Gewinner einer Reihe Playoffspiele zwischen den Gruppensiegern der drei Gruppen in den beiden Ligen – plus (und das war besonders genial, finde ich) einigen »Wild card«-Teams, die überhaupt nichts gewonnen haben.
Es ist alles höchst kompliziert, bedeutet aber im wesentlichen, daß jedes Baseballteam außer den Chicago Cubs die Chance hat, bei der World Series mitzumischen.
Die Chicago Cubs schaffen es nicht, weil sie sich nie qualifizieren – nicht einmal bei diesem großzügigen, teilnehmerfreundlichen System. Oft sieht es so aus, als könnten sie es noch hinkriegen, und manchmal stehen sie auch auf einem so überragenden Tabellenplatz, daß nach menschlichem Ermessen nichts mehr schiefgehen kann. Aber zum Schluß schaffen sie es doch immer wieder beharrlich – es nicht zu schaffen. Einerlei, was sie dazu anstellen müssen – siebzehn Spiele hintereinander verlieren, leichte Bälle durch die Beine flutschen lassen, im Outfield ganz komisch ineinanderzukrachen –, die Cubs kriegen es hin. Wär doch gelacht.
Und zwar seit mehr als einem halben Jahrhundert zuverlässig und effizient. Ich glaube, sie sind im Jahr 1938 zum letztenmal bei einer World Series dabeigewesen. So lange ist es nicht einmal her, daß Mussolini gute Zeiten hatte. Und weil dieses herzzerreißende Versagen der Cubs beinahe das einzige ist, das sich während meiner Lebenszeit nicht geändert hat, sind sie mir lieb und teuer.
Baseballfan zu sein ist nicht leicht, denn Baseballfans sind ein hoffnungslos sentimentaler Haufen. Dabei sind in einem so wahnsinnig lukrativen Gewerbe wie einer US-amerikanischen Sportart Gefühle völlig unangebracht. Weil ich hier gar keinen Platz habe, um zu erläutern, wie sie sich an meinem geliebtem Spiel während der letzten vierzig Jahre versündigt haben, erzähle ich Ihnen nur das Schlimmste: Sie haben fast alle tollen alten Stadien abgerissen und an ihrer Stelle große nichtssagende Mehrzweckhallen gebaut.
Früher hatte einmal jede große Stadt in den Vereinigten Staaten ein altehrwürdiges Baseballstadion. Meist waren sie feucht und knarzig, aber sie hatten Charakter. An den Sitzen holte man sich Splitter, wegen des vielen, über die Jahre in der Erregung ausgespuckten Glitschzeugs klebte man mit den Schuhsohlen am Boden fest, und die Sicht war einem unweigerlich von einem gußeisernen Dachträger versperrt. Doch das gehörte in diesen glorreichen Zeiten dazu.
Jetzt gibt es nur noch vier alte Stadien. Zum einen den Fenway Park in Boston, die Spielstätte der Red Sox. Ich will nicht behaupten, daß die Nähe Fenways bei unserer Entscheidung, uns in New Hampshire niederzulassen, den Ausschlag gegeben hat, aber es war ein Grund unter anderen. Nun wollten die Besitzer das Stadion abreißen und ein neues bauen. Ich sage immer wieder, wenn sie Fenway dem Erdboden gleichmachen, betrete ich die neue Halle nicht, aber ich weiß, das ist eine Lüge, denn ich bin hoffnungslos süchtig nach Baseball.
Und mein Respekt und meine Bewunderung für die Chicago Cubs werden um so größer. Ich rechne es ihnen nämlich hoch und heilig an, daß sie nie damit gedroht haben, Chicago zu verlassen, und immer noch im Wrigley Field spielen. Meistens sogar noch tagsüber – denn daß Baseball am Tage gespielt wird, lag auch in Gottes Absicht. Glauben Sie mir, ein Tagesspiel im Wrigley Field ist eines der großen amerikanischen Abenteuer.
Womit wir beim eigentlichen Problem wären: Niemand verdient es mehr als die Chicago Cubs, an der World Series teilzunehmen. Aber sie dürfen nicht, weil das ihre Tradition, an der Qualifikation beharrlich zu scheitern, zerstören würde. Ein unlösbarer Konflikt. Jetzt wissen Sie, was ich meine, wenn ich behaupte, daß es nicht leicht ist, Baseballfan zu sein.
Dumm, dümmer, am dümmsten
Vor einigen Jahren unterzog eine Organisation namens National Endowment for the Humanities, also eine Stiftung zur Förderung der Geisteswissenschaften, achttausend amerikanische High-School-Absolventen einem Allgemeinbildungstest und stellte fest, daß sehr viele von ihnen – na ja, keine hatten.
Zwei Drittel wußten nicht, wann der amerikanische Bürgerkrieg stattgefunden hat oder aus der Feder welches Präsidenten die Rede von Gettysburg stammt. Etwa derselbe Anteil war in gnädiger Unkenntnis darüber, wer Josef Stalin, Winston Churchill oder Charles de Gaulle waren. Ein Drittel dachte, Franklin Roosevelt sei während des Vietnamkrieges Präsident gewesen und Kolumbus nach 1750 gen Amerika gesegelt. Zweiundvierzig Prozent – und das ist mein Lieblingsbeispiel – konnten kein einziges Land in Asien nennen.
Nun bin ich solchen Befragungen gegenüber immer skeptisch, weil ich weiß, wie leicht man mich auf dem falschen Fuß erwischen könnte. (»Die Studie ergab, daß Bryson die simplen Anweisungen zum Zusammenbau eines haushaltsüblichen Grills nicht verstand und beim Autofahren fast immer versehentlich den Wischer für die Windschutzscheibe und die Heckscheibe betätigte, wenn er irgendwo abbog.«) Aber heutzutage ist eine Gedankenleere verbreitet, die schwer zu ignorieren ist. Das Phänomen ist allgemein bekannt als das Verdummen Amerikas.
Mir selbst ist es zum erstenmal aufgestoßen, als der Meteorologe im sogenannten Wetterkanal hier in unserem Fernsehen sagte: »In Albany fielen heute zwölf Zoll Schnee« und dann frohgemut hinzufügte: »Das ist ungefähr ein Fuß.«
Nein, du Depp, es ist ein Fuß!
Am selben Abend schaute ich mir einen Dokumentarfilm auf dem Discovery Channel an (und ahnte nicht, daß ich eben diesen Dokumentarfilm bis in alle Ewigkeit sechsmal im Monat auf ebendiesem Sender sehen konnte), und der Sprecher salbaderte: »Wind und Regen haben in dreihundert Jahren neunzig Zentimeter von der Sphinx abgetragen.« Dann machte er eine Pause und verkündete feierlich: »Das ist ein Schnitt von dreißig Zentimetern in einem Jahrhundert.«
Verstehen Sie, was ich meine? Es handelte sich nicht um einen kuriosen Ausrutscher, wie sie gelegentlich passieren. Es passiert die ganze Zeit. Manchmal kommt es mir vor, als habe die gesamte Nation ein Schlafmittel geschluckt und sei immer noch leicht weggetreten.
Neulich flog ich mit der Continental Airlines auf einem Inlandsflug (»Nicht ganz die schlechteste«, schlage ich als Werbeslogan vor) und las, weiß der Himmel warum, den »Brief des Vorstandsvorsitzenden«, mit dem jedes Bordmagazin beginnt – das heißt, den Brief, in dem sie einem erklären, wie unermüdlich sie bestrebt sind, den Service zu verbessern (offenbar dergestalt, daß jeder in Newark umsteigen muß). Gut, dieser blitzgescheite Erguß eines Mr. Gordon Bethune, des Herrn Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektors, beschäftigte sich mit den Ergebnissen einer Umfrage unter den Kunden, deren Bedürfnisse man hatte herausfinden wollen.
Danach wollten die Passagiere »eine saubere, sichere und zuverlässige Fluggesellschaft, die sie pünktlich und mit ihrem Gepäck dorthin bringt, wo sie hinwollen«.
Gute Güte! Da muß ich gleich Stift und Block zücken! Haben die Leute gesagt, »mit ihrem Gepäck«? Wahnsinn!
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube keine Sekunde, daß Amerikaner von Natur aus dümmer oder hirntoter sind als andere Menschen. Man bemüht sich nur routinemäßig, ihnen in allen Lebenslagen das Denken zu ersparen, und nun haben sie es sich abgewöhnt.
Was zum Teil dem – wie ich es nenne – »London, England«-Syndrom zuzuschreiben ist, dem Brauch unserer Zeitungen, ihren Artikeln Stadt plus Land voranzustellen. Wenn beispielsweise die New York Times über Parlamentswahlen in Großbritannien berichtet, beginnt sie die Story mit »London, England«, damit bloß kein Leser überlegen muß: »London? Mal sehen, ist das in Nebraska?«
Im Alltagsleben hier findet man diese kleinen Krücken überall, bisweilen in erstaunlicher Anzahl. Vor ein paar Monaten schrieb ein Kolumnist im Boston Globe über unfreiwillig komische Anzeigen und Bekanntmachungen – wie etwa das Schild in einem Optikerladen: »Wir überprüfen Ihre Sehstärke, während Sie hier sind« – und erläuterte dann gewissenhaft, was bei jeder einzelnen nicht stimmte. Zitat: »Natürlich wäre es schwierig, die Sehstärke überprüfen zu lassen, ohne daß man dabei ist.«
Zum Schreien, aber kein Einzelfall. Erst vor einigen Wochen machte ein Schreiber im New York Times-Magazin genau das gleiche: In einem Essay über amüsante sprachliche Mißverständnisse analysierte er sie der Reihe nach. Er erzählte zum Beispiel, daß ein Freund von ihm immer gedacht habe, die Textzeile in dem Beatles-Song »Lucy in the Sky« laute »the girl with colitis goes by«, und enthüllte dann glucksend, die Zeile heiße in Wirklichkeit – na, Ihnen brauche ich nicht zu sagen, daß das Mädel keinen Dickdarmkatarrh hatte, sondern »kaleidoscope eyes« …
Sinn und Zweck des Ganzen ist, den Leuten das Denken abzunehmen. Ein für allemal. Jüngst bat mich eine amerikanische Publikation, eine Bemerkung zu David Niven herauszunehmen, »weil er tot ist und wir der Meinung sind, daß viele unserer jüngeren Leser/innen ihn nicht mehr kennen«.
O ja, stets zu Diensten.
Bei einer anderen Gelegenheit erwähnte ich jemanden, der in Großbritannien eine staatliche Schule besucht, und da sagte der amerikanische Redakteur: »Ich dachte, in Großbritannien hätten sie keine Bundesstaaten.«
»Ich meine ›staatlich‹ im weiteren Sinne.«
»Also eine öffentliche Schule, eine public school.«
»Hm, nein, public schools in England sind Privatschulen.«
Lange Pause. »Sie wollen mich auf den Arm nehmen.«
»Nein, das weiß doch jedes Kind.«
»Verstehe ich Sie denn also richtig, daß in Großbritannien public schools privat sind?«
»Jawohl.«
»Und wie heißen dann öffentliche Schulen?«
»Staatliche Schulen.«
Noch eine lange Pause. »Aber ich dachte, sie hätten keine Bundesstaaten.«
Schließen wir nun mit meiner Lieblingsdummheit, der Antwort Bob Doles auf die Frage, wie er den Hauptinhalt seiner Wahlkampagne definiere.
»Es geht um die Zukunft«, erwiderte er gewichtig, »denn auf die bewegen wir uns zu.«
Das Schreckliche ist: Er hat recht.
Risiken und Nebenwirkungen
Wissen Sie, was ich wirklich vermisse, seit ich nicht mehr in England bin? Ich vermisse, in leicht angesäuseltem Zustand um Mitternacht nach Hause zu kommen und im Fernsehen die lehrreichen Sendungen der Open University zu gucken. Ehrlich.
Wenn ich jetzt um Mitternacht nach Hause käme, fände ich in der Glotze nur Scharen wohlproportionierter, hüllenlos herumtollender Grazien plus den Wetterkanal, der auf seine Weise, das gebe ich ja zu, ganz unterhaltsam, aber kein Vergleich ist mit der hypnotischen Faszination der Open University nach sechs Gläsern Bier. Und das meine ich todernst.
Ich weiß partout nicht, warum, aber ich habe es immer seltsam unwiderstehlich gefunden, wenn ich in England spätnachts den Fernseher einschaltete und einen Burschen erblickte, der aussah, als hätte er alle Klamotten, die er je brauchen würde, 1977 bei einem Einkaufstrip zu C & A erstanden (damit er den Rest seiner Tage ungestört vor Oszilloskopen verbringen kann) und der mit einer eigenartig unpersönlichen Stimme schnarrte: »Und nun sehen wir, daß wir, wenn wir zwei gesicherte Lösungen addieren, eine neue gesicherte Lösung erhalten.«
Meistens hatte ich keinen blassen Schimmer, worüber geredet wurde – gerade darum war es ja so hypnotisierend –, aber sehr gelegentlich (na gut, einmal) konnte ich dem Thema sogar folgen und hatte meinen Spaß daran. Es handelte sich um einen wider Erwarten kurzweiligen Dokumentarfilm, den ich vor drei, vier Jahren zufällig einschaltete und in dem die Vermarktung von Qualitätsarzneimitteln in Großbritannien und den Vereinigten Staaten verglichen wurde.
Auf beiden Märkten muß man nämlich dasselbe Produkt auf völlig verschiedene Weise verkaufen. In Großbritannien verspricht zum Beispiel eine Werbung für Erkältungskapseln nicht mehr, als daß es einem nach deren Einnahme ein wenig besser geht. Man läuft zwar weiter mit roter Nase und Morgenmantel herum, doch man lächelt wieder, wenn auch matt. Die Werbung in den USA dagegen garantiert einem sofortige und komplette Genesung. Ein Amerikaner, der dieses Wundermittel nimmt, wirft nicht nur seinen Morgenmantel ab und eilt schnurstracks zur Arbeit, sondern fühlt sich auch wohler als seit Jahren und beendet den Tag mit einer Sause auf der Bowlingbahn.
Letztendlich lief es darauf hinaus, daß die Briten nicht erwarten, daß frei erhältliche Medikamente ihr Leben verändern, während die Amerikaner nichts weniger als das fordern. Im Laufe der Jahre, das kann ich Ihnen versichern, ist dieser rührende Glaube der Nation in nichts erschüttert worden.
Sie müssen nur einmal zehn Minuten einen x-beliebigen Fernsehsender einschalten, eine Illustrierte durchblättern oder an den ächzenden Regalen eines Drugstore entlanglatschen, und Ihnen wird klar, daß die Amerikaner verlangen, daß es ihnen stets und ständig mehr oder weniger hervorragend geht. Selbst unser Familienshampoo, fällt mir auf, verspricht uns »ein ganz neues Lebensgefühl«.
Es ist komisch mit den Amerikanern. Sie trichtern sich und allen anderen ständig die Mahnung »Sag nein zu Drogen« ein, und dann laufen sie in den Drugstore und kaufen sie kistenweise. Sie geben fast fünfundsiebzig Milliarden Dollar im Jahr für Medikamente aller Art aus, und pharmazeutische Produkte werden mit einer Aggressivität und Direktheit vermarktet, die doch einigermaßen gewöhnungsbedürftig sind.
In einem Werbespot, der im Moment im Fernsehen läuft, wendet sich eine nette, mittelalterliche Dame an die Kamera und gesteht ganz freimütig: »Wissen Sie, wenn ich Durchfall habe, gönne ich mir ein wenig Komfort.« (»Warum warten, bis man Durchfall hat?« kann ich da nur sagen.)
In einer anderen Werbung grinst ein Mann an einer Bowlingbahn (in solchen Spots stehen Männer meistens an Bowlingbahnen) nach einem schlechten Wurf und murmelt seinem Partner zu: »Es sind wieder diese Hämorrhoiden.« Und jetzt kommt’s. Der Kerl hat Hämorrhoidensalbe in der Tasche! Nicht im Sportbeutel, nein, auch nicht im Handschuhfach seines Autos, sondern in seiner Hemdtasche, damit er sie jederzeit zücken und die Kumpels bitten kann: Stellt euch mal alle um mich rum. Irre!
Eine der erstaunlichsten Änderungen der letzten zwei Dekaden aber ist, daß nun selbst für verschreibungspflichtige Medikamente geworben wird. Vor mir liegt die beliebte Illustrierte Health, rammelvoller Anzeigen mit dicken Lettern. »Warum nehmen Sie zwei Tabletten, wenn eine reicht? Prempro ist das einzige verschreibungspflichtige Präparat, das Premarin und ein Progestin in einer Tablette kombiniert«, lese ich, oder: »Allegra, das neue Allergiemedikament! Jetzt auf Rezept in Ihrer Apotheke! Und Sie können wieder unbeschwert hinaus.«
Eine dritte Annonce fragt ziemlich keck: »Haben Sie schon einmal eine vaginale Hefepilzentzündung mitten in der Wildnis behandelt?« (Nicht daß ich wüßte!) Eine vierte steuert gleich auf das ökonomische Kernproblem der Sache zu. »Der Arzt hat mir gesagt, ich müßte wahrscheinlich für den Rest meines Lebens Blutdruckpillen nehmen«, erklärt uns der Kerl aus der Anzeige. »Schön daran ist, wieviel ich spare, seit er mir Adalat CC (Nifidipin) statt Procardia XL (Nifidipin) verschreibt.«
Man soll also die Werbung lesen und dann seinen Arzt belabern (oder seinen Fachmann für Gesundheitsfragen), bis der einem das Gewünschte verordnet. Ich finde die Vorstellung komisch, daß Illustriertenleser entscheiden, welche Medizin am besten für sie ist. Aber offenbar sind Amerikaner in punkto Medikamenten sehr beschlagen. Denn die Werbung setzt durchgängig ein imponierend hohes Niveau biochemischer Kenntnisse voraus. Die Vaginalzäpfchenanzeige versichert den Leserinnen selbstbewußt, daß die Einahme von Diflucan der von »Monistat 7, Gyne-Lotrimin oder Mycelex-7 über sieben Tage hinweg vergleichbar ist«, während die Anzeige für Prempro verspricht, daß es »die gleiche Wirkung hat, wie wenn man Premarin und ein Progestin separat einnimmt«.
Führt man sich vor Augen, daß das für Tausende und Abertausende Amerikaner sinnvolle Aussagen sind, scheint die Tatsache, daß unser Bowlingbruder eine Tube Hämorrhoidensalbe in der Hemdtasche hat, nicht mehr ganz so abwegig.
Ich weiß nicht, ob diese landesweite zwanghafte Beschäftigung mit der eigenen Gesundheit wirklich was bringt. Ich weiß nur, daß es einen viel angenehmeren Weg gibt, vollkommene innere Harmonie zu erlangen. Trinken Sie sechs Gläser Bier, und schauen Sie vor dem Schlafengehen neunzig Minuten Open University. Das hat bei mir noch immer gewirkt.
Die Post! Die Post!
Zu den Reizen des Lebens in einer kleinen, altmodischen Stadt in Neuengland gehört eine kleine, altmodische Post. Unsere ist besonders reizend. Das hübsche, fast zweihundert Jahre alte Backsteingebäude ist stattlich, aber nicht protzig, und sieht genauso aus, wie eine Post aussehen sollte. Es riecht sogar gut – nach einer Mischung aus Gummikleber und etwas zu hoch aufgedrehter alter Zentralheizung.
Die Angestellten am Schalter sind stets flink und effizient und geben einem gern ein Stück Tesafilm, wenn sich die Lasche eines Briefcouverts zu lösen droht. Darüber hinaus beschäftigen sie sich nur mit postalischen Aufgaben – sie kümmern sich weder um Rentenzahlungen noch Kindergeld, Kraftfahrzeugsteuern, Fernsehgebühren, Pässe, Lotteriescheine oder sonst eines der hundert Dinge, die einen Besuch in einer britischen Post zu einem solch beliebten Ganztagsereignis machen und schwatzhaften Leuten, die nichts so genießen wie eine ordentlich lange Jagd nach dem genauen Geldbetrag in ihren Börsen und Handtaschen, einen todsicher befriedigenden Zeitvertreib bieten. Hier dagegen gibt es nie Warteschlangen, und man ist in Minutenschnelle drin und wieder draußen.
Und das Allerbeste ist, daß jede amerikanische Post einmal im Jahr einen sogenannten Kundentag feiert. Unserer war gestern. Von diesem wundervollen Brauch hatte ich noch nie gehört und war sofort angetan. Die Angestellten hatten Fahnen aufgehängt, einen langen Tisch mit einer hübschen, karierten Decke aufgestellt und einen Festschmaus mit Donuts, Pastetchen und heißem Kaffee aufgetischt – alles gratis.
Es kam mir wie das reinste Wunder vor, daß sich eine gesichtslose staatliche Behörde bei mir und meinen Mitbürgern dafür erkenntlich zeigte, daß wir sie als Kunden beehrten. Ich war beeindruckt und dankbar, und fand, ehrlich gesagt, auch gut, daß man daran erinnert wurde, daß Postangestellte nicht nur hirnlose Automaten sind, die ihre Tage damit verbringen, Briefe zu zerreißen und mutwillig meine Honorarschecks an einen Typen in Vermont namens Bill Bubba zu schicken, sondern engagierte Spezialisten, die ihre Tage damit verbringen, meine Briefe zu zerfetzen und meine Honorarschecks an einen Typen in Vermont namens Bill Bubba zu schicken.
Wie dem auch sei, ich war hingerissen. Daß Sie nun denken, meine Loyalität zur Post sei billig mit einem Schokodonut und einem Plastikbecher Kaffee zu kaufen, ist mir zwar peinlich, aber es trifft zu. Sosehr ich auch die Post Ihrer Majestät der Königin von England schätze, einen morgendlichen Imbiß hat sie mir noch nie angeboten, und ich muß gestehen, daß ich nach Erledigung meiner Besorgungen nach Hause schlenderte, mir die Krümel aus dem Gesicht wischte und hinsichtlich des Lebens in Amerika im allgemeinen und der Post der Vereinigten Staaten im besonderen nur Gutes zu sagen hatte.
Aber wie bei fast allen staatlichen Dienstleistungen währte die Freude nicht lange. Als ich nach Hause kam, lag die Post auf der Fußmatte. Die Massen an Werbemüll und -schrott, die tagtäglich in jedem US-amerikanischen Haushalt eintrudeln, können Sie sich einfach nicht vorstellen. Unter den üblichen zahlreichen Aufforderungen, einen Regenwald zu retten, neue Kreditkarten oder die lebenslange Mitgliedschaft in der nationalen Inkontinenzstiftung zu erwerben, meinen Namen (gegen eine kleine Gebühr) in den Who’s Who der Menschen in Neuengland, die Bill heißen, eintragen zu lassen, Band eins der Großen Explosionen zur Ansicht zu bestellen (ohne Kaufverpflichtung), die National Rifle Association, das heißt, die organisierte Waffenlobby bei ihrer Kampagne »Bewaffnet die Krabbelkinder« zu unterstützen – also, unter den Dutzenden unerwünschter Werbebroschüren und Supersonderangebotszetteln mit dämlichen kleinen Aufklebern, auf denen mein Name und meine Adresse schon gedruckt standen, lag einsam und zerrissen ein Brief, den ich einundvierzig Tage zuvor an einen Freund in Kalifornien geschickt hatte, und zwar an seinen Arbeitsplatz. Nun war das Schreiben mit dem Vermerk zurückgekommen »Adresse unvollständig – Bitte überprüfen und noch einmal versuchen« oder Worten ähnlichen Inhalts.
Bei diesem Anblick entfuhr mir doch ein kleiner Verzweiflungsseufzer, und zwar nicht nur, weil ich der US-Post soeben erst meine Seele für einen Donut verkauft hatte, sondern weil ich zufällig kurz davor im Smithsonian einen Artikel über Wortspiele gelesen hatte, in dem der Autor behauptete, daß ein übermütiger Scherzkeks einmal einen Brief losgeschickt hatte, der mit schelmischer Vieldeutigkeit an
HILL
JOHN
MASS
adressiert und auch angekommen war, nachdem die Postbehörden herausgefutzelt hatten, daß man es als »John« under »Hill« and over »Massachusetts« lesen mußte, was im Adressenklartext hieß: John Underhill, Andover, Massachusetts. Capito?
Die Geschichte ist hübsch, und ich würde sie wirklich gern glauben, doch das Schicksal meines Briefes, der nun nach einem einundvierzigtägigen Abenteuertrip in den Westen wieder bei mir gelandet war, schien doch zur Vorsicht zu gemahnen, was die Post und ihre Spürnasenqualitäten betraf.
Das Problem bestand offenbar darin, daß ich als Adresse meines Freundes nur »c/o Black Oak Books, Berkeley, California« daraufgeschrieben hatte, also weder Straßennamen noch -nummer, weil ich beide nicht wußte. Ich sehe ja ein, daß das keine vollständige Adresse ist, aber sie ist doch sehr viel ausführlicher als »Hill John Mass«, und der Buchladen Black Oak Books ist obendrein eine Institution in Berkeley. Jeder, der die Stadt einigermaßen kennt – und in meiner Weltentrücktheit und Naivität hatte ich das von den dortigen Postbehörden angenommen –, kennt auch den Black-Oak-Buchladen. Nur die Post nicht. (Im übrigen weiß der Himmel, was mein Brief beinahe sechs Wochen in Kalifornien machte. Wenigstens kam er mit einer hübschen Bräune zurück.)
Um diese Klagemär aber mit einem herzerwärmenden Ausblick abzuschließen, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, daß mir, kurz bevor ich aus England wegzog, die Königliche Post einen Brief an »Bill Bryson, Schriftsteller,Yorkshire Dales« achtundvierzig Stunden, nachdem er in London aufgegeben worden war, zustellte. Eine beeindruckende detektivische Leistung! (Macht nichts, daß der Absender ein bißchen plemplem war.)
Da steh ich nun, hin- und hergerissen zwischen meiner Zuneigung zu einer Post, die mir nichts zu essen gibt, aber eine besondere Herausforderung bewältigt, und einer, die mir zwar Klebeband schenkt und mich rasch bedient, mir aber nicht behilflich ist, wenn ich einen Straßennamen vergessen habe. Daraus lernen wir natürlich, daß man bei einem Umzug von einem Land in ein anderes akzeptieren muß, daß manche Dinge besser und manche schlechter sind und nichts daran zu ändern ist. Das ist vielleicht nicht die tiefgründigste Einsicht, aber ich habe einen Donut umsonst bekommen und bin, na ja, alles in allem zufrieden.
Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muß nach Vermont und meine Post bei einem Mr. Bubba abholen.
Wie man auch zu Hause seinen Spaß haben kann
Meine Frau findet alles am Leben in den Vereinigten Staaten wunderbar. Sie ist entzückt, wenn man ihr ihre Lebensmitteleinkäufe in Tüten einpackt, sie liebt Gratiseiswasser und
-streichholzbriefchen in Restaurants, und ein Pizzalieferservice ins Haus ist für sie der Gipfel der Zivilisation. Bisher hatte ich noch nicht den Mut, ihr zu sagen, daß die Kellnerinnen hier alle Leute nötigen, »einen schönen Tag zu haben«.
Ich persönlich mag Amerika zwar auch und bin für seine vielen Annehmlichkeiten dankbar, aber nicht ganz so sklavisch und unkritisch. Gut, beim Einkaufen werden einem die Lebensmittel eingepackt. Natürlich ist das eine nette Geste, doch was hat man anderes davon, als daß man zuschauen kann, wie einem die Lebensmittel eingepackt werden? Es verschafft einem ja mitnichten wertvolle zusätzliche Freizeit. Ich will kein Spielverderber sein, aber wenn ich die Wahl zwischen Gratiseiswasser und staatlicher Gesundheitsfürsorge hätte, würde ich mich doch instinktiv für letzteres entscheiden.
Schwamm drüber. Manches hier ist trotz allem so herrlich, daß ich es selbst kaum aushalten kann. Und dazu gehört an vorderster Stelle und ohne jeden Zweifel die Art der Müllentsorgung. Die Müllschlucker sind der Inbegriff dessen, was eine arbeitssparende Einrichtung sein sollte und so selten ist – laut, lustig, extrem gefährlich und so überwältigend funktionstüchtig, daß man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie man je ohne sie ausgekommen ist. Wenn sie mich vor achtzehn Monaten gefragt hätten, wie die Aussichten dafür stünden, daß binnen kurzem mein Haupthobby sein würde, ausgewählte Gegenstände in ein Loch im Küchenabwaschbecken zu stecken, hätte ich Ihnen wahrscheinlich bloß ins Gesicht gelacht. Aber so ist es nun.
Ich habe noch nie einen Müllschlucker besessen, mußte also die Bandbreite seiner Möglichkeiten zunächst einmal mittels Trial-and-Error-Methode erkunden. Mit Eßstäbchen erzielt man vielleicht die lebhafteste Wirkung (ich empfehle es natürlich nicht, aber irgendwann kommt bei jedem Gerät der Zeitpunkt, daß man einfach sehen will, was es alles kann), doch Honigmelonenschalen erzeugen den vollsten, kehligsten Klang und brauchen auch weniger Rutschzeit. Mit großen Mengen Kaffeesatz erzielen Sie am ehesten den Vesuveffekt, aber aus Gründen, die klar auf der Hand liegen, sollten sie dieses schwierige Kunststück am besten erst dann ausprobieren, wenn Ihre Gattin den ganzen Tag außer Haus ist und Sie Wischlappen und Trittleiter bereitstehen haben.
Am aufregendsten ist es freilich, wenn der Müllschlucker verstopft. Dann muß man nämlich mit dem Arm hineinlangen und ihn frei machen, das heißt, gewärtig sein, daß er jeden Moment wieder zum Leben erwacht und den Arm mir nichts, dir nichts von einem nützlichen Greifwerkzeug in ein Setzholz verwandelt. Vom Leben am Abgrund brauchen Sie mir also nichts zu erzählen.
Auf ihre Weise auch sehr befriedigend und gewiß nicht weniger sinnreich erdacht ist die wenig bekannte Kaminaschengrube. Es handelt sich um ein simples Blech – eine Art Falltür – über einer tiefen, ziegelsteingemauerten Grube, die vor dem Wohnzimmerkamin in den Boden eingelassen ist. Anstatt beim Kaminsaubermachen die Asche in einen Eimer zu fegen und sie dann kleckernderweise durchs Haus zu schleppen, manövriert man sie in dieses Loch, und sie verschwindet für immer. Spitze!
Theoretisch muß die Aschengrube ja irgendwann voll werden, doch unsere scheint bodenlos zu sein. Unten im Keller ist eine kleine Metalltür in der Wand, durch die man sehen kann, wie sich die Grube so macht, und manchmal gehe ich auch hinunter und werfe einen Blick hinein. Es ist nicht unbedingt notwendig, aber es verschafft mir eine Ausrede, in den Keller zu gehen, und eine solche begrüße ich immer aufs schärfste, weil Keller die dritte große Attraktion des Lebens in Amerika sind. Sie sind grandios, hauptsächlich, weil sie so erstaunlich geräumig und nutzlos sind.
Ich kenne Keller natürlich, weil ich mit einem aufgewachsen bin. Alle amerikanischen Keller sind gleich. Sie haben eine Wäscheleine, die selten benutzt wird, ein diagonal über den Boden fließendes Wasserrinnsal aus einer nicht lokalisierbaren Quelle und einen komischen Geruch – eine Mischung aus alten Zeitschriften, Campingausrüstung, die hätte gelüftet werden müssen, es aber nicht wurde, und etwas, das mit einem Meerschweinchen namens Puschelchen zu tun hat, das vor sechs Monaten durch ein Zentralheizungsgitter entfleucht und seitdem nicht mehr gesichtet worden ist (und jetzt wohl auch besser Skelettchen genannt werden sollte).
Ja, Keller sind so kolossal nutzlos, daß man selten dort hinuntergeht und immer wieder überrascht ist, wenn einem einfällt, daß man einen hat. Jeder Vater, der jemals in einen Keller geht, hält irgendwann einmal inne und denkt: »Manno, mit diesem ganzen Platz sollten wir wirklich was machen. Wir könnten eine Hausbar und einen Billardtisch und vielleicht eine Musikbox und ein Whirlpoolbad und ein paar Flipper …«
Aber das alles gehört natürlich zu den Dingen, die man eines Tages tun will und doch nie tut. Wie Spanisch lernen oder Heimfriseur werden.
Gelegentlich, vor allem in Erstlingsheimen, stellt man durchaus schon einmal fest, daß ein junger, tatendurstiger Vater den Keller in ein Spielzimmer für die Kinder verwandelt hat. Aber das ist generell ein Fehler, weil Kinder nicht in Kellern spielen. Und zwar deshalb, weil sie, ganz einerlei, wie lieb die Eltern sind, immer denken, daß Mami und Papi leise die Tür oben an der Treppe abschließen und nach Florida ziehen. Nein, Keller sind zutiefst und unweigerlich angsteinflößend – deshalb kommen sie ja auch stets in Horrorfilmen vor. Normalerweise wird der Schatten von Joan Crawford, die eine Axt in der Hand hält, an die hintere Wand geworfen. Vielleicht gehen deshalb Väter nicht so oft hinunter.
Ich könnte ewig und drei Tage weitere kleine unbesungene Herrlichkeiten des häuslichen Lebens in Amerika auflisten – Kühlschränke, die Eiswasser und Eiswürfel zubereiten, begehbare Einbauschränke, elektrische Stecker in Badezimmern –, doch ich verzichte darauf. Ich habe keinen Platz mehr, und da Mrs. B. gerade zum Einkaufen entschwunden ist, könnte ich doch flugs mal ausprobieren, was der Müllschlucker mit einem Saftkarton anstellt. Ich werde Sie über das Ergebnis unterrichten.
Konstruktionsmängel
Ich habe einen Sohn im Teenageralter, der Leichtathlet ist und Rennen läuft. Er nennt, vorsichtig geschätzt, sechstausendeinhundert Paar Laufschuhe sein eigen, und jeder einzelne davon zeugt von einer geballteren Portion planerischer Anstrengungen als, sagen wir, die schöne Retortenstadt Milton Keynes unweit Londons.
Die Schuhe sind ein Wunderwerk. Ich habe eben in einer Sportzeitschrift meines Filius einen Testbericht über das Neueste in Sachen »Running- und Freizeitschuhe« gelesen, und er strotzte von Sätzen wie folgendem: »Eine doppelt dichte, extraflexible, längsgerichtete Zwischensohle mit Luftkammern gibt Ihnen Stabilität, während eine Gelferseneinlage stoßdämpfend wirkt, der Schuh aber dennoch einen schmalen Fußabdruck hinterläßt, ein Charakteristikum, das typischerweise nur dem biomechanisch effizienten Läufer dient.« Alan Shepard ist weniger wissenschaftlich abgesichert in den Weltraum geflogen.