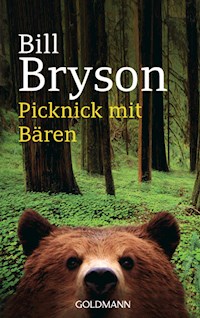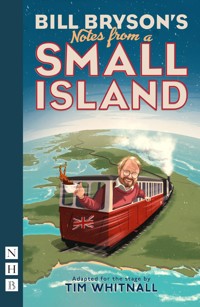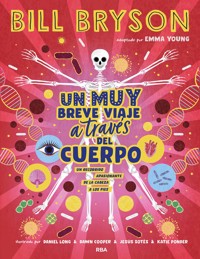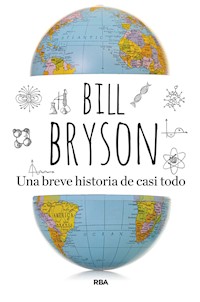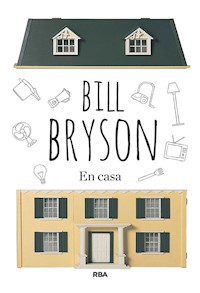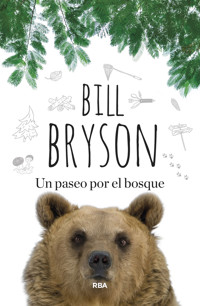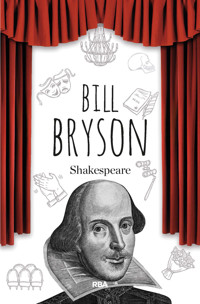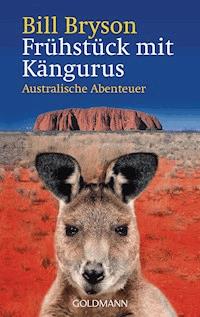
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist das für ein Land, in dem sich fliegende Füchse tummeln und Schweinefußnasenbeutler einst ihr Unwesen trieben? In seinem ebenso amüsanten wie informativen Streifzug durch ein unbekanntes Australien erzählt Bill Bryson von den historischen Hintergründen der Entdeckung dieses faszinierenden Kontinents - und hält den Leser mit seinem scharfen Blick für alles Skurrile und Ungewöhnliche in Atem.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Frühstück mitKängurus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »In a Sunburned Country« bei Broadway Books, New York
Copyright © der Originalausgabe 2000 by Bill Bryson Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2001 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbHSatz: Uhl+Massopust, AalenCoveragentur: Design Team
Covermotiv: Zefa (Collage)
ISBN 978-3-641-09056-2V003
www.goldmann-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Für David, Felicity, Catherine und Sam
ERSTER TEIL
Ins Outback
Erstes Kapitel
I
Auf dem Flug nach Australien fiel mir wieder nicht ein, wie der Premierminister heißt. Ich seufzte. Das passiert mir immer – ich will mir den Namen merken, vergesse ihn (meist mehr oder weniger prompt) und fühle mich dann schrecklich schuldig. Denn ich finde, dass ihn wenigstens ein Mensch außerhalb Australiens kennen sollte.
Es ist aber auch schwer, sich einigermaßen über das Land auf dem Laufenden zu halten. Als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal von London aus dorthin flog, vertrieb ich mir die vielen Stunden mit der Lektüre einer Geschichte der australischen Politik des zwanzigsten Jahrhunderts und stieß auf die erstaunliche Tatsache, dass der Premierminister Harold Holt im Jahre 1967 an einem Strand in Victoria entlangspazierte, in die Brandung hechtete und verschwand. Von dem armen Mann ward nie wieder etwas gesehen. Ich fand das doppelt erstaunlich – erstens, weil Australien einfach so einen Premierminister verlor (also, wo gibt’s denn so was?), und zweitens, weil es mir nie zu Ohren gekommen war.
Was nur einmal mehr beweist, wie schmählich wenig Beachtung wir unseren Brüdern und Schwestern am anderen Ende der Welt – down under – schenken. Doch das hat seine Gründe: Australien ist sehr weit weg und großenteils unbewohnt. Sein Anteil an der Weltbevölkerung ist verschwindend gering: nur neunzehn Millionen Menschen leben dort – um mehr als diese Zahl wächst ja China schon jedes Jahr. Und mit einer Wirtschaftskraft, die in etwa dem US-Bundesstaat Illinois entspricht, spielt es im weltweiten Vergleich auch nur eine Nebenrolle. Es schickt uns zwar ab und zu nützliche Dinge – Opale, Merinowolle, Errol Flynn und Bumerangs –, doch nichts, das wir unbedingt zum Leben bräuchten. Der wichtigste Grund dafür, dass es ständig übersehen wird, scheint mir jedoch darin zu liegen, dass es sich nie daneben benimmt. Die politischen Verhältnisse sind stabil, die Leute friedlich und gut. Australien kennt keine Staatsstreiche, überfischt nicht rücksichtslos die Weltmeere, verkauft keine Waffen an fiese Despoten, baut nicht in frechen Mengen Koka an oder führt sich in nassforscher oder sonst wie ungebührlicher Weise auf.
Doch selbst all dessen eingedenk, ist unsere Ignoranz gegenüber dem, was dort passiert, schwer zu erklären. Wie Sie sich denken können, ist sie vor allem in den Vereinigten Staaten verbreitet. Kurz bevor ich zu meiner Reise aufbrach, ging ich in die Stadtbücherei meines Heimatorts Hanover, New Hampshire, und schaute Australien im New York Times Index nach. Ich wollte sehen, wie viel Aufmerksamkeit es in den letzten Jahren in meinem Heimatland erregt hatte. Nur weil der Band von 1997 aufgeschlagen auf dem Tisch lag, begann ich mit diesem Jahr. Über das ganze Spektrum möglicher Interessensgebiete verteilt – Politik, Sport, Reise, die anstehenden Olympischen Spiele in Sydney, Essen und Trinken, die schönen Künste, Nachrufe und dergleichen –, hatte die New York Times 1997 zwanzig Artikel gebracht, die sich überwiegend oder ausschließlich mit australischen Angelegenheiten beschäftigten. Nur zum Vergleich: Im selben Zeitraum gab es einhundertundzwanzig Beiträge über Peru, etwa einhundertundfünfzig über Albanien und Kambodscha, jeweils mehr als dreihundert über Nord- und Südkorea und weit über fünfhundert über Israel. Alles in allem war Australien gleichauf mit Weißrussland und Burundi. Mehr zu lesen gab es selbst über Themen wie Freiluftballons und deren Fahrer, die Scientology-Kirche, Hunde (ausgenommen Hundeschlitten-Fahren) und über Pamela Harriman, die Ex-Botschafterin und Partylöwin, deren Ableben im Februar 1997 offenbar eine Katastrophe darstellte, die zweiundzwanzigmal in der Times erwähnt werden musste. Grob gesagt, war Australien den Amerikanern 1997 unwesentlich wichtiger als Bananen, aber bei weitem nicht so wichtig wie Speiseeis.
Und dabei war 1997 sogar noch ein gutes Jahr für Nachrichten aus dem fünften Kontinent. 1996 war er Thema in gerade einmal neun Berichten und 1998 nur in sechs. Anderswo auf dem Globus schreibt man vielleicht häufiger über ihn – aber das liest doch keiner! (Bitte alle melden, die erstens den derzeitigen australischen Premierminister nennen können und zweitens wissen, in welchem Bundesstaat Melbourne liegt, oder überhaupt eine Frage zu Australien beantworten können, die nichts mit Cricket, Rugby oder Mel Gibson zu tun hat.) Die Australier hassen es, dass die Welt sie so wenig beachtet, und das kann ich gut verstehen. Denn es ist ein Land, in dem interessante Dinge passieren. Am laufenden Band!
Bester Beweis dafür ist eine der Geschichten, die es 1997 in die New York Times schaffte, wenn auch unter die Rubrik »Vermischtes«. Im Januar ebendieses Jahres, schreibt der Times-Reporter, untersuchten Wissenschaftler ernsthaft, ob das mysteriöse Erdgrummeln im äußersten australischen Outback vier Jahre zuvor tatsächlich die Explosion einer Atombombe gewesen war, die Mitglieder der japanischen Weltuntergangssekte Aum Shinrikyo gezündet hatten. Um dreiundzwanzig Uhr drei (Ortszeit) des achtundzwanzigsten Mai 1993 zuckten und kritzelten nämlich in der gesamten Pazifikregion die Nadeln der Seismografen los, nachdem es in der Nähe des Ortes Banjawarn Station in der Großen Victoriawüste in Westaustralien offenbar heftig gebebt hatte. Ein paar Fernfahrer und Prospektoren, das heißt, Leute, die Öl und sonstige Bodenschätze suchen, im Grunde die einzigen Menschen, die sich in dieser einsamen Weite aufhalten, berichteten, dass sie plötzlich einen Blitz am Himmel gesehen und das Donnern einer mächtigen, doch sehr entfernten Detonation gehört beziehungsweise gespürt hätten. Einem war in seinem Zelt eine Dose Bier vom Tisch gehupft.
Man fand keine eindeutige Ursache. Die seismografischen Aufzeichnungen hatten ein anderes Profil als die eines Erdbebens oder einer Explosion in einem Bergwerk, wobei die Druckwelle ohnehin einhundertundsiebzigmal stärker war als die der heftigsten Bergwerksexplosion, die je in Westaustralien registriert wurde. Die Aufzeichnungen passten eher zu einem großen Meteoriteneinschlag, doch der hätte einen Krater von mehreren hundert Metern Durchmesser schlagen müssen, und einen solchen Krater fand man nicht. Letztendlich zerbrachen sich die Wissenschaftler ein, zwei Tage lang den Kopf und legten das Ganze dann als unerklärliche Kuriosität ad acta. So was passierte eben von Zeit zu Zeit.
1995 allerdings erlangte die Aum-Sekte jäh traurige Berühmtheit, als sie in der Tokioter U-Bahn in großzügigen Mengen das Nervengas Sarin versprühte und zwölf Menschen starben. Bei den nachfolgenden Ermittlungen fand man heraus, dass die Sekte über beträchtlichen Landbesitz verfügte, unter anderem auch über ein Fünfhunderttausend-Morgen-Wüsten-Areal in Westaustralien unweit der Stelle, an der sich das mysteriöse Beben zugetragen hatte. Die Behörden entdeckten dort ein ungewöhnlich gut ausgestattetes Speziallabor sowie den Beweis, dass die Sektenmitglieder Uran gefördert hatten. Unabhängig davon wurde bekannt, dass die Sekte zwei Atomwissenschaftler aus der früheren Sowjetunion in ihre Reihen rekrutiert hatte. Da das erklärte Ziel der Gruppe die Zerstörung der Welt ist, hat es den Anschein, als sei der Zwischenfall in der Wüste eine Trockenübung dafür gewesen, Tokio in die Luft zu jagen.
Sie verstehen natürlich, worauf ich hinaus will. Australien ist ein Land, das Premierminister verliert und so riesig und dünn besiedelt ist, dass ein Trupp enthusiastischer Laien in der Wüste die erste Nichtregierungsatombombe der Welt zünden kann und fast vier Jahre vergehen, bis es jemand merkt. Klar, dieses Land musste ich kennen lernen!
Aber weil wir so wenig über es wissen, sind vielleicht ein paar Vorbemerkungen angebracht.
Australien ist das sechstgrößte Land der Erde und die größte Insel. Es ist die einzige Insel, die auch ein Kontinent ist, und der einzige Kontinent, der auch ein Land ist. Es ist der erste und der letzte Kontinent, der vom Meer aus erobert wurde. Es ist die einzige Nation, die als Gefängnis angefangen hat.
Es ist die Heimat des größten lebenden Wesens auf Erden, des Great Barrier Reef, und des berühmtesten und eindrucksvollsten Monolithen, des Ayers Rock oder Uluru, um den nun offiziellen, respektvolleren Aborigine-Namen zu benutzen. Es gibt dort mehr Lebewesen, die einen umbringen können, als irgendwo sonst. Die zehn giftigsten Schlangen leben alle in Australien. Fünf seiner tierischen Bewohner – die Trichterspinne, die Würfelqualle, die Blauringkrake, der Steinfisch und eine bestimmte Zeckenart – sind tödlich für den Menschen. In diesem Land können selbst die flauschigsten Raupen Sie mit einem giftigen Kniepen außer Gefecht setzen, und Muscheln pieksen hier nicht nur, sondern attackieren Sie manchmal sogar. Heben Sie an einem Strand in Queensland zufällig eine harmlose Kegelschnecke auf, wie das unschuldige Touristen ja gern tun, dann werden Sie erleben, dass der kleine Racker darin nicht nur erstaunlich fix und unwirsch reagiert, sondern auch überaus giftig ist. Wenn Sie aber nicht plötzlich und unerwartet zu Tode gestochen oder gespießt werden, werden Sie vielleicht von Haien oder Krokodilen gefressen, von tückischen Meeresströmungen hilflos zappelnd in den Ozean hinausgetragen, oder Sie taumeln mutterseelenallein im brütend heißen Outback in einen kläglichen Tod. Ein hartes Land.
Und alt. Seit sechzig Millionen Jahren, seit Bildung der Great Dividing Range hat sich Australien geologisch praktisch nicht verändert und konnte dadurch viele der ältesten Dinge bewahren, die man je auf Erden fand, die urältesten Felsen und Fossilien, die frühesten Tierspuren und Flussbetten, ja, die ersten schwachen Zeichen des Lebens selbst. Und zu einem unbestimmten Zeitpunkt in Australiens unendlich langer Vergangenheit – vielleicht vor fünfundvierzigtausend, vielleicht vor sechzigtausend Jahren, aber ganz gewiss, bevor es moderne menschliche Wesen in Nord- und Südamerika oder Europa gab – drang heimlich, still und leise ein zutiefst rätselhaftes Volk ein, die Aborigines. Sie weisen keine eindeutige rassische oder sprachliche Verwandtschaft mit den Völkern im umliegenden asiatischen Raum auf, und eigentlich ist ihre Anwesenheit auf dem Kontinent nur dann plausibel, wenn man annimmt, dass sie mindestens dreißigtausend Jahre vor allen anderen Menschen hochseetüchtige Schiffe ersannen, bauten, sich auf einen Exodus begaben und dann fast alles, was sie gelernt hatten, vergaßen oder sich nicht mehr dafür interessierten, ja sich überhaupt kaum noch mit dem offenen Meer einließen.
Diese Leistung ist so einzigartig und außergewöhnlich, so schwer zu erklären, dass die meisten Geschichtsbücher sie mit ein, zwei Absätzen abtun und dann gleich zur zweiten, besser dokumentierten Invasion übergehen, die 1770 mit der Ankunft Captain James Cooks und seiner tapferen kleinen Jolle, der HMS Endeavour, in der Botany Bay begann. Macht nichts, dass Captain Cook Australien nicht entdeckt hat und zur Zeit seines Besuchs nicht mal Kapitän war. Die meisten Leute, auch die meisten Australier, glauben, dass mit ihm alles anfängt.
Die Welt, die diese ersten Engländer vorfanden, war berühmt dafür, dass alles verkehrt herum war – statt Winter war in Australien Sommer, die Sternbilder standen auf dem Kopf. Es war einfach völlig anders als irgendetwas, das sie vorher schon einmal gesehen hatten, selbst in den benachbarten Breiten des Pazifik. Die Lebewesen schienen sich entwickelt zu haben, als hätten sie die Gebrauchsanleitung nicht gelesen. Das typischste von ihnen rannte, hoppelte oder galoppierte nicht, sondern sprang durch die Landschaft wie ein Gummiball. Die seltsamsten Geschöpfe tummelten sich dort: Fische, die auf Bäume kletterten, fliegende Füchse (in Wirklichkeit sehr große Fledermäuse) und derart umfängliche Krustentiere, dass ein erwachsener Mann in die Schalen kriechen konnte.
Kurz und gut, ein solches Land gab es auf der Welt nicht noch einmal. Gibt es immer noch nicht. Achtzig Prozent aller Tiere und Pflanzen in Australien existieren nur dort. Ja mehr noch, sie existieren in einer Vielzahl, die zu den harschen Lebensbedingungen gar nicht zu passen scheint. Australien ist der trockenste, flachste, heißeste, ausgedörrteste, unfruchtbarste, klimatisch aggressivste aller bewohnten Kontinente. Nur die Antarktis ist lebensfeindlicher. Das Land ist geologisch so inaktiv, dass, genau genommen, der Erdboden selbst ein Fossil ist. Und dennoch wimmelt er von Leben in unzähligen Formen. Schon allein bei den Insekten haben die Forscher keinen blassen Schimmer, ob die Gesamtzahl der Arten einhunderttausend oder mehr als das Doppelte beträgt. Ein Drittel davon ist der Wissenschaft bisher vollkommen unbekannt. Bei Spinnen sogar bis zu achtzig Prozent.
Ich erwähne Insekten insbesondere deshalb, weil ich eine Geschichte über ein Krabbeltier namens Nothomyrmecia macrops erzählen will, die, wenn auch ein wenig indirekt, hervorragend zeigt, was für ein außergewöhnliches Land Australien ist.
Als im Jahre 1931 ein paar Amateurnaturforscher auf der Halbinsel Cape Arid an der Südküste in der struppigen Einöde herumwühlten, fanden sie ein Insekt, das noch nie jemand gesehen hatte. Es erinnerte vage an eine Ameise, war aber ungewöhnlich blassgelb und hatte seltsam starrende, eindeutig beunruhigende Augen. Sie nahmen ein paar Exemplare mit, die auf dem Schreibtisch eines Experten im National Museum of Victoria in Melbourne landeten und sofort als Nothomyrmecia identifiziert wurden. Das verursachte große Aufregung, weil ein solches Lebewesen nach menschlichem Ermessen seit einhundert Millionen Jahren gar nicht mehr existierte. Es war eine Ur-Ameise, ein lebendiges Relikt aus der Zeit, als sich die Ameisen aus den Wespen entwickelten. In der Insektenkunde war der Fund so fantastisch, als hätte man auf einer abgelegenen Grassteppe eine äsende Triceratops-Herde entdeckt.
Man organisierte sofort eine Expedition, doch trotz penibelster Suche fand man die Kolonie auf Cape Arid nicht wieder. Auch weitere Erkundungen verliefen erfolglos. Als fast ein halbes Jahrhundert später ruchbar wurde, dass ein US-amerikanisches Forscherteam eine erneute Suche nach der Ameise plante, und zwar garantiert mit all dem High Tech-Schnickschnack, dem gegenüber die Australier amateurhaft und schlecht organisiert ausgesehen hätten, bestellte die Regierung ein paar Wissenschaftler in Canberra, die den Amerikanern mit einem letzten Versuch zuvorkommen sollten, die Ameisen lebendig zu finden. Ein Konvoi machte sich quer übers Land auf den Weg.
Als sie am zweiten Tag durch die Wüste in Südaustralien fuhren, fing ein Fahrzeug an zu stottern und zu qualmen, und sie mussten in Poochera, einem einsamen Halt an der Straße, eine unvorhergesehene Übernachtung einschieben. Abends ging ein Mitglied des Suchtrupps, Bob Taylor, hinaus, um ein bisschen frische Luft zu schnappen, und leuchtete ohne besonderen Grund mit dem Strahl seiner Taschenlampe den Boden ab. Sie können sich seine Überraschung vorstellen, als er sah, wie über einen Eukalyptusbaumstumpf eine propere Marschkolonne ebender Nothomyrmecia krabbelte.
Bedenken Sie, wie die Chancen dafür standen. Taylor und seine Kollegen waren achthundert Meilen von der Stelle entfernt, wo sie suchen wollten. Auf den fast drei Millionen Quadratmeilen Wüste, aus denen Australien besteht, hatte ein Mann gerade eines der seltensten, am meisten gesuchten Insekten der Erde gefunden und erkannt – ein Insekt, das nur einmal, und zwar ein halbes Jahrhundert zuvor, lebend gesichtet worden war. Und das alles nur, weil zufällig an der Stelle ein Auto einen Motorschaden gehabt hatte. Die Nothomyrmecia ist im Übrigen bis zum heutigen Tage nicht mehr an dem ursprünglichen Fundort entdeckt worden.
Ich bin sicher, Sie wissen wieder ganz genau, worauf ich hinaus will. Dieses Land ist gleichzeitig atemberaubend leer und voll gepackt mit Zeugs. Interessantem Zeugs, uraltem Zeugs, Zeugs, das man nicht auf Anhieb versteht. Zeugs, das man sogar noch finden muss.
Glauben Sie mir, es ist ein interessantes Land.
II
Jedes Mal, wenn man von Nordamerika nach Australien fliegt und die internationale Datumsgrenze überquert, kriegt man einen Tag abgezwackt – ohne dass einen auch nur irgendjemand fragt, wie man das findet. Ich verließ Los Angeles am dritten Januar und kam vierzehn Stunden später am fünften Januar in Sydney an. Für mich hatte es keinen vierten Januar gegeben. Absolut keinen. Wo genau er sich hin verkrümelt hatte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich offenbar für einen Zeitraum von vierundzwanzig Stunden in der Weltgeschichte nicht existiert hatte.
Ich finde das ein wenig gespenstisch. Will sagen: Wenn Sie Ihre Reiseunterlagen durchblättern und eine Bemerkung folgenden Wortlauts läsen: »Wir möchten unsere Fluggäste darauf aufmerksam machen, dass bei einigen Flügen ein vierundzwanzigstündiger Existenzverlust eintreten kann« (Es wäre natürlich so formuliert, als geschehe es nur ab und zu.), würden Sie doch sicher am liebsten jemanden von der Fluggesellschaft energisch am Ärmel packen und »Moment mal« sagen.
Andererseits liegt ein gewisser metaphysischer Trost in dem Wissen, dass man aufhören kann, in materieller Form zu existieren, und dass es gar nicht wehtut, und man muss auch anstandshalber sagen, dass sie einem den Tag wiedergeben, wenn man auf dem Rückflug die Datumsgrenze in umgekehrter Richtung überfliegt und es dadurch irgendwie schafft, in Los Angeles anzukommen, bevor man Sydney verlassen hat, was auf seine Art natürlich ein noch pfiffigeres Kunststück ist.
Ich verstehe ja in etwa, worum es hier geht. Ich sehe ein, dass es eine gedachte Grenze geben muss, an der ein Tag endet und ein neuer beginnt, und dass notwendigerweise etwas Merkwürdiges mit der Zeit passiert, wenn man diese Grenze überschreitet. Trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, dass man auf jedem Trip zwischen Amerika und Australien eine Erfahrung macht, die unter allen anderen Bedingungen eine schiere Unmöglichkeit wäre: Denn wie hart man auch trainiert oder sich konzentriert oder Kalorien zählt; egal, wie viel Schritte man auf dem Stepper macht, man wird nie so fit, dass man vierundzwanzig Stunden lang keinen Raum beansprucht.
Man hat also schon, wenn man in Australien landet, ein gewisses Gefühl, etwas geleistet zu haben – mit Freude und Genugtuung stellt man fest, dass man aus dem Flughafengebäude in den blendenden australischen Sonnenschein tritt und all die vielen Atome, von denen man eben noch nicht wusste, wie und wohin sie verschwunden waren, beinahe normal wieder zusammengefügt sind (außer circa einem halben Pfund Gehirnmasse, die man beim Ansehen eines Bruce-Willis-Actionfilms verloren hat) . Unter diesen Umständen ist man natürlich froh, überhaupt irgendwo angekommen zu sein; dass es Australien ist, ist dann noch besonders schön.
Gleich hier möchte ich betonen, dass ich Australien liebe – über alle Maßen – und jedes Mal, wenn ich es sehe, von neuem hingerissen bin. Eben deshalb, weil man es so wenig beachtet, ist man bei der Ankunft immer wieder auf höchst angenehme Weise überrascht. Eigentlich erwartet man ja nach einer so weiten Anreise, zuallermindest Menschen auf Kamelen vorzufinden. Auf den Straßen- und Ladenschildern sollten unentzifferbare Buchstaben stehen und dunkelhäutige Männer in langen Gewändern aus fingerhutgroßen Tässchen Kaffee trinken und Wasserpfeifen schmauchen. Man stellt sich auf klapprige Busse und Schlaglöcher in den Straßen ein und dass man von allem, was man anfasst, die Seuche kriegt. Aber nein, so ist es nicht. Hier ist alles bequem, sauber und vertraut. Bis auf die Tatsache, dass Männer ab einem gewissen Alter mit Vorliebe Kniestrümpfe und kurze Hosen tagen, sind die Menschen wie du und ich. Prima! Klasse! Deshalb bin ich ja so gern in Australien.
Natürlich auch noch aus anderen Gründen, und die möchte ich hier einmal festhalten. Die Leute sind ungeheuer liebenswürdig – fröhlich, extrovertiert, schlagfertig und stets zuvorkommend. Ihre Städte sind sicher und sauber und fast alle am Wasser gebaut. Die Gesellschaft reich, wohlorganisiert und von Natur aus egalitär. Das Essen hervorragend. Das Bier kalt. Die Sonne scheint fast immer. An jeder Straßenecke gibt es Kaffee. Und Rupert Murdoch wohnt nicht mehr hier. Viel besser kann das Leben nicht werden.
Auf dieser – meiner fünften – Reise wollte ich zum ersten Mal das echte Australien sehen, das unendliche, brütend heiße Innere, die grenzenlose Leere, die zwischen den Küsten liegt. Ich habe nie ganz begriffen, warum einen die Leute, die einen drängen, ihr »echtes« Land zu sehen, immer in die verlassensten Gegenden schicken, wo kein Mensch, der seine fünf Sinne beisammen hat, freiwillig leben würde, aber bitte schön, so ist es. Man kann eben nicht sagen, man sei in Australien gewesen, wenn man nicht durch das Outback gefahren ist.
Am allerbesten war, dass ich es auf die smarte Tour, nämlich mit der Eisenbahn machen würde, der sagenhaften Indian Pacific von Sydney nach Perth. Zweitausendsiebenhundertundzwanzig Meilen lang windet sie sich gemächlich durch das untere Drittel Australiens, durch die Bundesstaaten New South Wales, South Australia und Western Australia. Sie ist zweifellos die Königin unter den Eisenbahnen der südlichen Erdhalbkugel. Nach Sydney klettert sie langsam durch die Blue Mountains, rumpelt dann durch endloses Schafsland, folgt dem Darling River bis zum Murray River und diesem Richtung Adelaide und durchquert anschließend die riesige Nullarbor Plain bis zu den Goldfeldern um Kalgoorlie, bevor sie zum wohlverdienten Halt in dem weit entfernten Perth kommt. Vor allem die Nullarbor Ebene, eine fast unvorstellbar weite, mörderische Halbwüste, wollte ich sehen.
Ich hatte schon seit längerer Zeit vorgehabt, herzufliegen und ein Buch zu schreiben, doch als die Farbbeilage der Mail on Sunday eine Spezialnummer über Australien plante und ich eine Reportage dazu beisteuern sollte, kriegte ich den Trip auch noch geschenkt – ich konnte das Land auf überaus bequeme Weise und auf Kosten von jemand anderem durchqueren. Das war ganz nach meinem Geschmack. Etwa eine Woche lang sollte ich zusammen mit dem aus London einfliegenden jungen englischen Fotografen Trevor Ray Hart reisen. Am Morgen nach meiner Ankunft wollten wir uns treffen.
Zuerst aber hatte ich einen Tag nur für mich allein, und das freute mich ungeheuer. Bisher war ich immer nur auf Lesereise in Sydney gewesen, meine Bekanntschaft mit der Stadt gründete sich fast ausschließlich auf Taxifahrten durch obskure Viertel wie Ultimo oder Annandale. Nur bei meinem ersten Besuch vor etlichen Jahren hatte ich überhaupt etwas von der Stadt gesehen. Ein freundlicher Vertreter meines australischen Verlages machte mit mir, seiner Frau und seinen beiden kleinen Töchtern einen Tagesausflug mit dem Auto. Ich saß vorn auf dem Beifahrersitz und blamierte mich bis auf die Knochen. Denn ich schlief ein. Glauben Sie mir, nicht aus Desinteresse oder mangelnder Wertschätzung, sondern weil der Tag warm und ich gerade erst angekommen war und mich zu einem unglücklichen und reichlich frühen Zeitpunkt der Jetlag übermannte. Hilflos sank ich in ein Koma.
Leider bin ich kein diskreter, reizender Schläfer. Die meisten Leute, die einnicken, sehen aus, als könnten sie eine Decke gebrauchen; ich, als bräuchte ich ärztlichen Beistand. Als hätte man mir aus Experimentiergründen ein starkes, Muskel entspannendes Mittel gespritzt, fallen meine Beine in einer grotesk einladenden Weise auseinander; meine Arme hängen affenartig bis zum Boden. Alles, was in mir ist – Zunge, feuchte Luftbläschen aus meinem Darm –, beschließt zu entweichen. Wie bei einem Wackeldackel kippt mein Kopf von Zeit zu Zeit nach vorn, ein Viertelliter zähflüssigen Sabbers ergießt sich auf meinen Schoß, dann fällt mein Kopf wieder nach hinten, und ich lade mich geräuschvoll auf wie ein Klo-Spülkasten. Dazu – ich kann nicht anders – schnarche ich lautstark wie eine Trickfilmfigur und stoße aus gummiartig flappenden Lippen ausgiebig Dampf aus. Lange Phasen bleibe ich unnatürlich ruhig, sodass die Zuschauer sich besorgte Blicke zuwerfen und über mich beugen, dann versteife ich mich dramatisch und beginne nach einer schier endlosen quälenden Pause mit dem ganzen Körper zu zucken und zu zappeln, als läge ich auf dem elektrischen Stuhl, kurz nachdem der Schalter umgelegt worden ist. Zum Schluss kreische ich ein-, zweimal gellend und tuntig und wache auf. Nur um festzustellen, dass in einem Umkreis von einhundertundfünfzig Metern alles menschliche Treiben zum Erliegen gekommen ist und sich sämtliche Kinder unter acht an die Rocksäume ihrer Mütter klammern. Es ist ein schweres Los.
Ich habe nie erfahren, wie lange ich damals in dem Auto geschlafen habe, aber kurz war es nicht. Ich weiß nur, dass ein bleiernes Schweigen in der Luft hing, als ich wieder zu mir kam – eben die Art Schweigen, das Menschen überkommt, die in ihrer Heimatstadt einen zusammengesackten, zuckenden Haufen von einer Sehenswürdigkeit zur anderen karren und er sie keines Blickes würdigt.
Einen Moment völlig unsicher, wer diese Leute waren, glotzte ich in die Runde, räusperte mich und hievte mich in eine aufrechtere Haltung.
»Wir haben gedacht, dass Sie vielleicht ein wenig zu Mittag essen wollen«, sagte mein Stadtführer leise, als er sah, dass ich fürs Erste meine dringenden Ambitionen aufgegeben hatte, seinen Wagen mit Spucke zu überschwemmen.
»Das wäre sehr schön«, erwiderte ich mit dünnem, demütigem Stimmchen und entdeckte zugleich mit einem mir vertrauten inneren Entsetzen, dass sich, während ich geschlummert hatte, offenbar eine Vierhundertpfundfliege über mir erbrochen hatte. In dem Versuch, die Aufmerksamkeit von dem unnatürlich feuchten Glanz auf mir abzulenken und gleichzeitig mein Interesse an der Stadtrundfahrt wieder kundzutun, fügte ich fröhlicher hinzu: »Ist das immer noch die Neutral Bay?«
Ich vernahm einen unwillkürlichen kurzen Japslaut, wie er einem entfährt, wenn ein Getränk den falschen Weg nimmt, und dann mit einer gewissen gezwungenen Artikuliertheit: »Nein, das ist Dover Heights. In Neutral Bay waren wir –« Eine Sekunde Pause, damit mir die Bedeutung dieser Aussage auch ganz klar war: »Vor einer ganzen Weile.«
»Aha.« Ich machte ein ernstes Gesicht, als versuchte ich herauszufinden, was in der Zwischenzeit passiert war.
»Das heißt, vor einer ziemlich langen Weile.«
»Aha.«
Den Rest des Weges bis zum Lunch legten wir schweigend zurück. Der Nachmittag verlief netter. Wir speisten in einem beliebten Fischlokal am Kai in Watsons Bay und betrachteten dann von den hohen, gischtgepeitschten Klippen über der Hafeneinfahrt den Pazifik. Auf dem Heimweg erwischten wir immer wieder einen Blick auf den fraglos schönsten Hafen der Welt – blaues Wasser, dahergleitende Segelboote, in der Ferne den stählernen Bogen der Harbour Bridge und das fröhlich daneben hockende Opernhaus. Aber ich hatte natürlich kaum was von Sydney mitgekriegt und musste früh am nächsten Morgen weiter nach Melbourne.
Wie erpicht ich darauf war, nun mehr zu sehen, können Sie sich leicht vorstellen. Und da offenbar alle Sydneysiders, wie sie drolligerweise genannt werden, das unstillbare Verlangen haben, Besuchern ihre Stadt vorzuführen, hatte ich wieder ein freundliches Angebot, diesmal von einer Journalistin des Sydney Morning Herald, Deirdre Macken, einer hellwachen, fröhlichen Dame um die vierzig. Sie holte mich zusammen mit dem jungen Fotografen Glenn Hunt im Hotel ab, und wir liefen zu Fuß zum Museum of Sydney, einer modisch schicken, neuen Einrichtung, die es schafft, interessant und lehrreich auszusehen, ohne es zu sein. Man starrt auf raffiniert schlecht beleuchtete Exponate – eine Kiste mit Gegenständen von Einwanderern, ein Zimmer, vollgekleistert mit Seiten aus beliebten Illustrierten der Fünfzigerjahre –, weiß aber eigentlich nie, was man daraus schließen soll. Doch wir tranken einen sehr leckeren Milchkaffee im Museumscafé, wo Deirdre uns ihre Pläne für unser umfangreiches Tagesprogramm darlegte.
Als Erstes wollten wir zum Circular Quay spazieren und mit der Fähre durch den Hafen zum Taronga Zoo-Pier fahren. In den Zoo selbst wollten wir nicht, sondern um die Little Sirius Cove herum und durch die steilen, üppig grünen Hügel von Cremorne Point zu Deirdres Haus hinaufwandern, wo wir ein paar Handtücher und Boogie Boards einpacken und mit dem Auto nach Manly fahren wollten, einem Vorort am Strand mit Pazifikblick. Dort wollten wir einen Happen zu Mittag essen, danach ein Stündchen Leibesertüchtigung, nämlich Boogie Boarding betreiben, uns trocken rubbeln und dann nach –
»Entschuldigung, wenn ich unterbreche«, unterbrach ich, »was genau ist Boogie Boarding?«
»Ah, es macht Spaß. Es wird Ihnen gefallen«, sagte Deirdre wohlgemut, wenngleich ein wenig ausweichend, fand ich.
»Ja, aber was ist es denn?« »Es ist eine Wassersportart. Macht irrsinnig Spaß. Macht es nicht irrsinnig Spaß, Glenn?«
»Ja, irrsinnig«, meinte auch Glenn, der, wie alle Leute, die ihre Filme bezahlt kriegen, unbekümmert drauflosknipste. Bi’siet, bi’siet, bi’siet, sang seine Kamera, als er drei rasche, kunstvoll identische Schnappschüsse von Deirdre und mir im Gespräch machte.
»Aber was genau muss man machen?« Ich ließ nicht locker.
»Man nimmt eine Art Miniatursurfbrett, paddelt aufs Meer hinaus, sieht zu, dass man eine schöne große Welle erwischt, und reitet damit zurück zum Ufer. Es ist leicht. Sie werden es toll finden.«
»Was ist mit Haien?«, fragte ich beklommen.
»Ach, die gibt’s hier kaum. Glenn, wie lange ist es her, dass hier jemand einem Hai zum Opfer gefallen ist?«
»Ewigkeiten«, sagte Glenn und überlegte genauer. »Mindestens ein paar Monate.«
»Monate?«, kreischte ich.
»Mindestens. Haie werden als Gefahr bei weitem überschätzt«, fügte Glenn hinzu. »Bei weitem. Die Strömungen, die haben’s in sich.« Er knipste noch ein paar Bilder.
»Strömungen?«
»Unterwasserströmungen, die schräg zum Ufer verlaufen und manchmal Leute ins Meer hinaustragen«, erklärte Deirdre. »Aber keine Bange. Das passiert Ihnen schon nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil wir auf Sie aufpassen.« Mit einem gütigen Lächeln trank sie ihre Tasse leer und ermahnte uns zur Eile.
Drei Stunden später, nachdem wir alles nach Plan erledigt hatten, standen wir auf einem gottverlassen wirkenden Strand namens Freshwater Beach bei Manly, an einer großen u-förmigen Bucht, eingerahmt von niedrigen, Gestrüpp überwucherten Hügeln und mit, wie ich fand, entsetzlich großen Wellen, die von einer unendlichen, launischen See hereindonnerten. Ungefähr in der Mitte surften ein paar tollkühne Geschöpfe in Taucheranzügen auf schaumbedeckte Felsvorsprünge am Rande der Bucht zu; näher am Strand ließ sich ein Häuflein Wasserfreunde, wie es schien, heitersten Sinnes, von krachenden Brechern verschlingen.
Gedrängt von Deirdre, die offenbar sehr erpicht darauf war, in das schaumige Nass zu kommen, zogen wir uns – ich langsam und bedächtig, sie in Windeseile – bis auf die Badeklamotten aus, die wir auf ihre Instruktionen hin unter der Kleidung trugen.
»Wenn Sie in eine Strömung kommen«, sagte Deirdre, »besteht der Trick darin, nicht in Panik zu geraten.«
Ich schaute sie an. »Sie wollen mir erzählen, ich soll ruhig ertrinken?«
»Nein, nein. Behalten Sie nur klaren Kopf und versuchen Sie nicht, gegen den Strom zu schwimmen. Schwimmen Sie quer durch. Und wenn Sie dann immer noch Probleme haben, winken Sie einfach. So.« Mit weit ausholender Bewegung, bei der nur ein Australier auf die Idee kommen konnte, man zeige damit auf angemessene Weise eine Seenotsituation an, wedelte sie lässig mit dem Arm. »Und dann warten Sie, bis die Rettungsschwimmer kommen.«
»Was ist, wenn die Rettungsschwimmer mich nicht sehen?«
»Die sehen Sie schon.«
»Aber was, wenn nicht?«
Doch Deirdre watete schon in die Brandung, ein Boogie Board unter den Arm geklemmt.
Genierlich ließ ich mein Hemd auf den Sand fallen und stand bis auf meine ausgeleierte Badehose nackt da. Glenn, der noch nie etwas so einzigartig Groteskes an einem australischen Strand erblickt hatte, jedenfalls nichts, das noch lebte, schnappte sich seinen Fotoapparat und begann aufgeregt, Nahaufnahmen von meinem Bauch zu machen. Bi’siet, bi’ siet, bi’ siet, bi’ siet, sang seine Kamera fröhlich, als er mir in die Wellen folgte.
Hier möchte ich eine kurze Pause machen und zwei kleine Geschichten einschieben. 1935 fingen nicht weit von dort, wo wir waren, Fischer einen vier Meter zwanzig langen Hai und brachten ihn in ein öffentliches Aquarium in Coogee, wo man ihn anschauen konnte. Ein, zwei Tage war der Hai in seinem neuen Zuhause herumgepaddelt, da spie er plötzlich und zu einer gewissen Überraschung der anwesenden Massen einen menschlichen Arm aus. Als man den zuletzt gesehen hatte, hing er an einem jungen Mann namens Jimmy Smith, der, da zweifelte ich nicht, seine Notlage mit einer weit ausholenden, lässigen Armbewegung signalisiert hatte.
Nun die zweite Geschichte: Drei Jahre später wälzten sich an einem sonnig klaren und ruhigen Sonntagnachmittag in Bondi Beach, auch nicht weit von unserem Aufenthaltsort entfernt, aus dem Nichts vier abnorme, extrem hohe Wellen herein, bis zu sieben Meter fünfzig hoch. In ihrem Sog wurden mehr als zweihundert Menschen ins Meer hinausgezogen. Gott sei Dank waren an dem Tag fünfzig Rettungsschwimmer im Einsatz, und sie schafften es, bis auf sechs Leute alle zu retten. Mir ist klar, dass wir hier über Vorfälle reden, die sich vor vielen Jahren zugetragen haben, aber das ist mir egal. Ich habe trotzdem Recht: Der Ozean ist hinterhältig.
Seufzend stapfte ich in die blassgrünen, gelblich weißen gesprenkelten Fluten. Die Bucht war überraschend flach. Nach dreißig Metern ging uns das Wasser immer noch kaum übers Knie. Doch es herrschte eine außergewöhnlich starke Strömung – so stark, dass es einem die Beine weghaute, wenn man nicht gut aufpasste. Nach weiteren fünfzehn Metern – da reichte uns das Wasser über die Taille – brachen schon die Wellen. Wenn man von ein paar Stunden an den lagunenstillen Gestaden der Costa del Sol in Spanien und einem eiskalten, sofort bereuten kurzen Bad vor Jahren in Maine absah, hatte ich so gut wie keine Erfahrung mit dem Meer und fand es deshalb, ehrlich gestanden, verstörend, in eine Aqua-Achterbahn zu waten. Deirdre kreischte vor Lust.
Dann zeigte sie mir das Boogie-Boarding. Im Prinzip sah es ganz einfach aus. Wenn eine Welle kam, sprang sie auf das Brett und glitt viele Meter weit auf dem Wellenkamm mit. Dann durfte Glenn auch mal und ritt noch weiter. Es sah wirklich aus, als ob es Spaß machte. Jedenfalls nicht allzu schwer. In Maßen neugierig, wagte ich einen Versuch.
Ich stellte mich für die erste Welle in Positur, sprang auf das Boogie Board und versank wie ein Klotz.
»Wie machen Sie das?«, fragte Glenn bass erstaunt.
»Keine Ahnung.«
Ich wiederholte die Übung. Mit demselben Resultat.
»Irre«, sagte er.
Es folgte eine halbe Stunde, während derer Deirdre und Glenn zuerst mit verhaltenem Amüsement, dann wachsendem Staunen und schließlich etwas, das an Mitleid grenzte, beobachteten, wie ich immer wieder zwischen den Wellen verschwand, über ein Stück Meeresboden von etwa der Größe von Polk County, Iowa, schrammte, beziehungsweise nach unterschiedlich langen, nie aber kurzen Phasen irgendwo in einer Entfernung von einem Meter bis zu einer Meile nach Luft schnappend und orientierungslos wieder auftauchte und sofort von der folgenden Welle mitgerissen wurde. Schon bald waren alle Leute am Strand auf den Beinen und fingen an zu wetten, weil man allgemein der Meinung war, dass das, was ich da machte, physisch unmöglich sei.
Aus meiner Sicht passierte immer wieder das Gleiche. Ich ahmte die zierlichen Tretbewegungen, die Deirdre mir gezeigt hatte, eifrig nach und versuchte die Tatsache zu ignorieren, dass ich nirgendwo ankam und die meiste Zeit ertrank. Da ich ja nicht wusste, wie es richtig ging, dachte ich, ich machte es ganz gut. Ich kann nicht behaupten, dass ich mich amüsierte, aber mir ist es ja ohnehin ein Mysterium, wie überhaupt jemand in ein so gnadenloses Element wie Wasser gehen kann und sich dabei amüsiert. Doch in dem Bewusstsein, dass es irgendwann vorbei sein würde, ergab ich mich in mein Schicksal.
Vielleicht war es der Sauerstoffmangel, jedenfalls war ich ganz in meiner eigenen kleinen Welt versunken, als Deirdre mich, bevor ich wieder einmal wegsackte, plötzlich am Arm packte und mit heiserer Stimme sagte: »Passen Sie auf! Das ist eine Bluey.«
Glenn war schon auf Alarmstufe Eins. »Wo?«
»Was ist eine Bluey?«, fragte ich, entsetzt, dass hier eine weitere Gefahr lauerte, die man mir verschwiegen hatte.
»Eine Bluebottle«, erklärte sie und deutete auf eine kleine Qualle, die auch als »Portugiesische Galeere« bekannt ist (wie ich später einem fetten Wälzer entnahm, der, wenn ich mich recht erinnere, den Titel trug: Pflanzen und Tiere, die Sie in Australien auf bestialische Weise umbringen). Mit zusammengekniffenen Augen beobachtete ich, wie das Viech an mir vorbeischwebte. Ein sonderlich gewinnendes Äußeres besaß es nicht, es sah aus wie ein blaues Kondom mit Schnüren.
»Ist es gefährlich?«, fragte ich.
Bevor ich die Antwort wiedergebe, die Deirdre mir, jenem wehrlosen und verschrammten, zitternden, halb nackten und halb ertrunkenen Häuflein Elend zuteil werden ließ, möchte ich aus dem Artikel im Herald zitieren, den sie danach schrieb.
»Der Fotograf hält fest, wie Bryson und das Boogie Board von einer Strömung vierzig Meter am Strand entlanggezerrt werden. Die Küstenströmung verläuft von Süden nach Norden, im Gegensatz dazu die Strömung weiter draußen von Norden nach Süden. Das weiß Bryson nicht. Er hat das Warnschild am Strand nicht gelesen.« (Anmerkung des Betroffenen: Das stimmt. Ich möchte freilich hier zu Protokoll geben, dass ich keine Brille auf hatte, meinen Gastgebern vertraute, das Meer nach Haien absuchte und mich die ganze Zeit bemühte, meine Badehosen nicht voll zu machen.) »Er weiß auch nicht, dass eine Portugiesische Galeere in seine Richtung getrieben wird, ja, nun weniger als einen Meter von ihm entfernt ist, ein glibbriger, übler Geselle mit einem Stachel, der Bryson zwanzig Minuten grässliche Qualen bereiten und, wenn er Pech hat, zu einer unschönen allergischen Reaktion führen kann, deren Hinterlassenschaft er sein Leben lang auf dem Leib tragen wird.«
»Gefährlich? Nein«, erwiderte Deirdre, als wir die Portugiesische Galeere anstarrten. »Aber vermeiden Sie jegliche Berührung.«
»Warum?«
»Könnte ein klitzekleines bisschen ungemütlich werden.«
Ich schaute Deirdre mit einem Interesse an, das schon an Bewunderung grenzte. Lange Busreisen sind ungemütlich. Holzbänke sind ungemütlich. Gesprächspausen sind ungemütlich. Der Kontakt mit einer Portugiesischen Galeere bedeutet – und das wissen selbst Leute aus Iowa – Todesqualen. Doch ich begriff, dass die Australier derart von Gefahren umgeben sind, dass sie ein völlig neues Vokabular entwickelt haben, um damit umzugehen.
»Hey, da ist noch eine«, sagte Glenn.
Auch die schwebte an uns vorbei. Deirdre inspizierte das Wasser genauer.
»Manchmal kommen sie in Scharen«, sagte sie. »Wär vielleicht nicht schlecht, wenn wir jetzt rausgingen.«
Das brauchte sie mir nicht zweimal zu sagen.
Weil ich laut Deirdre noch etwas sehen musste, damit ich überhaupt etwas von australischer Lebensart und Kultur begriff, fuhren wir, als der späte Nachmittag der blassen Abendröte wich, durch die weit sich hinziehenden, glitzernden Vororte Sydneys bis fast zu den Blue Mountains zu einem Ort namens Penrith. Unser Ziel war ein enorm großes, elegantes Gebäude, das von einem noch größeren, proppenvollen Parkplatz umgeben war. Ein Neonschild wies es als die Penrith Panthers World of Entertainment aus. Die Panthers, informierte mich Glenn, seien ein Rugby Club, der in der ersten Liga spielte.
Australien ist ein Land der Clubs – Sportclubs, Arbeiterclubs, Veteranenclubs, Clubs, die verschiedenen politischen Parteien nahe stehen –, und sie widmen sich formal und manchmal auch tatsächlich alle dem Wohlbefinden bestimmter Teile der Gesellschaft. Doch in Wirklichkeit sind sie dazu da, mit Alkohol und Glücksspiel immense Geldsummen zu verdienen.
Ich hatte schon in der Zeitung gelesen, dass die Australier die größten Zocker auf diesem Planeten sind. Eine der faszinierendsten Statistiken besagt, dass das Land weniger als ein Prozent der Weltbevölkerung, aber mehr als zwanzig Prozent der Spielautomaten hat, und dass die Australier zusammen im Jahr elf Milliarden australische Dollar oder fünfhundertundachtzig Dollar pro Kopf der Bevölkerung für Glücksspiele aller Art ausgeben. Doch wo sie diesem risikoreichen Hobby frönen, erfuhr ich erst, als ich die World of Entertainment betrat. Riesengroß, überwältigend und mit wahnsinnig vielen Spielautomaten ausgestattet. Hauptsächlich mit dem Typ, der im Volksmund Pokie heißt.
Ich hatte ja gedacht, dass wir tricksen müssten, um eingelassen zu werden, schließlich war es ein Club. Aber dann erlebte ich, wie gern man es in australischen Clubs sieht, dass alle Menschen Spaß und Unterhaltung mit den Pokies haben, und ihnen sofortige Mitgliedschaft gewährt. Man braucht sich bloß in ein Buch für Mitglieder auf Zeit einzuschreiben, und schwupps, ist man drin.
Die Oberaufsicht über die Massen führte ein Mann mit einem gütigen, fröhlichen Blick und einem Schildchen, das ihn als Peter Hutton, Dienst habender Manager, auswies. Wie fast alle Australier war er ein lockerer, umgänglicher Bursche. Der Club habe sechzigtausend Mitglieder, erzählte er mir, und von denen rückten an Hochbetriebsabenden wie zum Beispiel Silvester zwanzigtausend an. Bei unserem Besuch waren es wohl eher um die zweitausend. Es gab unzählige Kneipen und Restaurants, Sportanlagen, einen Kinderspielbereich, Nachtclubs und Theater. In Kürze sollten außerdem ein Kino mit dreizehn Leinwänden und eine Kinderkrippe für vierhundert Säuglinge gebaut werden.
»Wow«, sagte ich, mächtig beeindruckt. »Dann ist das wohl der größte Club in Sydney.«
»Der größte auf der südlichen Halbkugel«, sagte Mr. Hutton stolz.
Wir schlenderten durch die weiten, glitzernden Hallen. In langen, geraden Reihen standen hunderte von Pokies, und vor fast jedem saß eine Gestalt, die entschlossen das Geld hineinsteckte, das eigentlich für die nächste Rate auf das Haus bestimmt war. Im Prinzip funktionierten die Pokies wie alle Spielautomaten, sie besitzen ein verwirrendes Sammelsurium an Tasten und blitzenden Lämpchen, die einem eine Vielzahl von Optionen gestatten – eine bestimmte Farbe zu behalten, den Einsatz zu verdoppeln, einen Teil des Gewinns herauszunehmen, und weiß Gott, was sonst noch. Aus diskretem Abstand studierte ich etliche Leute beim Spielen, verstand aber ums Verrecken nicht, was sie da taten, außer eine Münze nach der anderen in eine flimmernde Kiste zu stopfen und grimmig auszusehen. Deirdre und Glenn waren gleichermaßen unvertraut mit dem Ganzen. Nur um zu sehen, was passierte, steckten wir eine Zwei-Dollar-Münze in einen Pokie und bekamen prompt siebzehn retour. Wir waren hocherfreut.
Erschöpft, aber überglücklich ging ich wie ein Junge nach einem sehr langen Tag auf dem Rummel ins Hotel zurück. Ich hatte die Todesgefahren des Meeres überlebt, einen hochfeudalen Club besucht, geholfen, fünfzehn Dollar zu gewinnen, und konnte zwei neue Freunde mein Eigen nennen. Dass ich das Gefühl hatte, Sydney wirklich gesehen zu haben, konnte ich nicht behaupten, aber der Tag würde auch noch kommen. Jetzt musste ich erst mal eine Nacht ausschlafen und am nächsten Morgen pünktlich am Zug sein.
Zweites Kapitel
Dass ich das australische Outback toll finden würde, merkte ich zum ersten Mal, als ich las, dass die Simpson Desert, eine Wüste, die größer ist als manches europäische Land, 1932 nach einem Waschmaschinenhersteller benannt worden ist, genauer: nach einem gewissen Alfred Simpson, der ihre Vermessung aus der Luft finanziert hat. (Das Jahr 1932 gibt der australische Historiker Geoffrey Blainey an; die National Geographic nennt 1929. Es gibt kaum einen Fakt über Australien, dem nicht von irgendjemandem irgendwo heftig widersprochen wird.) Mich allerdings beeindruckte weniger das angenehm Unheroische der Namensgebung als vielmehr die Tatsache, dass ein mehr als einhunderttausend Quadratmeilen großes Stück Australien bis vor knapp siebzig Jahren nicht mal einen Namen hatte! Ich habe nahe Verwandte, die schon länger einen Namen tragen.
Aber so ist das ja mit dem Outback, er ist derart riesig und unwirtlich, dass vieles kartografisch immer noch kaum erfasst ist. Selbst den Uluru hatte bis vor wenig mehr als einem Jahrhundert außer seinen Aborigine-Hütern niemand gesehen. Man kann nicht einmal genau sagen, wo das Outback ist. Für Australier ist alles auch nur annähernd Ländliche der »Busch« und ab irgendeinem nicht näher bestimmbaren Punkt wird aus dem »Busch« der »Outback«. Fährt man noch zweitausend Meilen weiter, kommt man schließlich wieder zum Busch und dann zu einer Stadt und dann zum Meer. Das ist Australien.
In Begleitung von Trevor Ray Hart, eines liebenswerten jungen Mannes in Shorts und ausgebleichtem T-Shirt, fuhr ich im Taxi zum Sydneyer Hauptbahnhof, einem imposanten Ziegelsteinklotz in der Elizabeth Street. Durch seine trüb beleuchtete, altehrwürdige Bahnhofshalle gingen wir zu unserem Zug.
Der Indian Pacific, der, fast einen halben Kilometer lang, am Bahnsteig stand, hielt alles, was die Prospektbilder versprachen; silbrig elegant, niegelnagelneu glänzend, verbreitete er mit seinem Summen dieses Gefühl unmittelbar bevorstehenden Abenteuers, das einen am Beginn einer Reise mit einer mächtigen Eisenbahn befällt. Wagen G, einer von siebzehn des Zuges, stand unter Obhut eines launigen Zugbegleiters namens Terry, der wohl bedacht jeder seiner Bemerkungen das nötige Lokalkolorit verlieh, indem er sie mit einer optimistischen Aussie-Wendung versah.
Man braucht ein Glas Wasser?
»Kein Problem, Kumpel. Kommt sofort.«
Man hat soeben erfahren, dass Mutter gestorben ist?
»Kein Drama. Geht in Ordnung.«
Er brachte uns zu unseren Schlafabteilen, zwei schmalen Einzelzellen zu beiden Seiten eines engen, holzverkleideten Gangs. Sie waren erstaunlich klein – wenn man sich vorbeugte, blieb man stecken.
»Das ist’s?«, sagte ich gelinde bestürzt. »In seiner Gänze?«
»Kein Problem«, strahlte Terry. »Es ist ein bisschen eng, aber Sie werden feststellen, dass alles da ist, was Sie brauchen.«
Und er hatte Recht. Alles, was man zum Leben in einem Raum nur brauchen konnte, war da. Er war lediglich sehr dicht zusammengestellt und nicht viel größer als ein Kleiderschrank. Aber ein Wunder an Funktionalität. Es gab einen bequemen Einbausessel, eine diskret verborgene Toilette mit Waschbecken, einen Minischrank, ein Regal über Kopfhöhe, auf dem man einen sehr kleinen Koffer unterbringen konnte, zwei Leselampen, zwei saubere Handtücher und einen Minikulturbeutel mit Shampoo und Seife. In der Wand befand sich ein schmales Klappbett, das nicht herunterkippte, sondern wie ein hastig verstauter Leichnam herausfiel, was ich und sicher auch viele andere experimentierfreudige, unbesonnene Fahrgäste entdeckten, nachdem ich nachdenklich die Tür betrachtet und überlegt hatte: »Was wohl dahinter ist?« Aber es war eine interessante Überraschung, und dass ich die diversen vorstehenden Teile meines Gesichts aus den Sprungfedern befreien musste, half mir, die halbe Stunde bis zur Abfahrt zu vertreiben.
Endlich ging es los. Der Zug fing an zu schnurren, und wir glitten majestätisch aus dem Sydneyer Hauptbahnhof hinaus.
In einem durch dauert die Reise nach Perth fast drei Tage. Trevor und ich allerdings wollten in der alten Bergarbeiterstadt Broken Hill aussteigen, um uns ein wenig im Outback umzutun und zu sehen, was geboten wurde. Wir würden die Fahrt in zwei Etappen machen: Über Nacht bis Broken Hill und dann in einer Zwei-Tagesreise durch die Nullarbor Plain.
Zuerst zockelte der Zug durch die endlosen westlichen Vororte Sydneys – Flemington, Auburn, Parramatta, Doonside und Rooty Hill (hinreißender Name) – und fuhr dann etwas schneller in die Blue Mountains, wo die Häuser allmählich weniger wurden und wir lange spätnachmittagliche Aussichten auf steile Täler und riesige Eukalyptuswälder genießen konnten, deren stilles Atmen den Bergen den Farbton verleiht, nach dem sie benannt sind.
Ich machte mich auf, den Zug zu erkunden. Unser Bereich, die erste Klasse, bestand aus fünf Schlafwagen, einem Speisewagen in samtig feudaler Ausstattung, die man als »Fin-de-Siècle-Bordellbesitzerstil« bezeichnen konnte, und einem Salonwagen in etwas modernerem Dekor. Dort gab es weiche Sessel, eine kleine, viel versprechende Bar und leise, aber gnadenlos vor sich hin nudelnde Musik aus einer zwanzigteiligen Kollektion, die wahrscheinlich »Songs, die Sie nie wieder hören wollten«, hieß. Als ich durchlief, erklang gerade ein Klageduett aus Phantom der Oper.
Nach der ersten kam die etwas billigere Holiday-Klasse; bis auf die Tatsache, dass der Speisewagen ein Büffetwagen mit nackten Plastiktischen war, war sie weitgehend identisch mit unserer. (Offenbar musste man den Leuten dort nach den Mahlzeiten hinterherwischen.) Der hintere Ausgang der Holiday-Klasse war durch eine fensterlose abgeschlossene Tür versperrt.
»Was kommt danach?«, fragte ich die Kellnerin im Büffetwagen.
»Personenwagenklasse«, sagte sie schaudernd.
»Ist die Tür immer verschlossen?«
Sie nickte mit ernster Miene. »Immer.«
Die Personenwagenklasse wurde zu meiner fixen Idee. Zunächst jedoch gab’s Abendessen. Über Lautsprecher wurde die erste Gruppe aufgerufen, und als ich durch den Ersterklassesalon zurückging, schmetterte Ethel Merman »There’s No Business Like Show Business«. Sie können sagen, was Sie wollen, die Frau hatte Lungen.
Trotz der kultivierten, altehrwürdigen Atmosphäre hat die Indian Pacific noch nicht viele Jahre auf dem Buckel. Sie wurde erst 1970 als neue normalspurige Strecke quer durchs Land gebaut. Davor benutzten australische Eisenbahngesellschaften aus vielerlei abstrusen Gründen, die alle was mit Misstrauen und Neid zwischen den Regionen zu tun hatten, verschiedene Spurweiten. In New South Wales betrug sie 14351 mm, Victoria entschied sich für großzügigere 16002 mm und Queensland und Western Australia, sparsam, wie sie waren, für 10668 mm – so ungefähr der Spurweite von Karussellbahnen auf dem Rummel. South Australia war mit allen drei Maßen besonders originell. Auf Reisen von der Ost- zur Westküste mussten Fahrgäste und Fracht fünfmal aus einem Zug ausgeladen und in den anderen wieder hineingepackt werden, ein langwieriges idiotisches Unterfangen. Schlussendlich obsiegte aber die Vernunft und eine völlig neue Strecke wurde gebaut. Nach der Transsibirischen ist das nun die zweitlängste Eisenbahnstrecke der Welt.
Das weiß ich alles, weil Trevor und ich zum Essen mit einem ruhigen Lehrerehepaar mittleren Alters aus dem ländlichen Norden Queenslands zusammensaßen, Keith und Daphne. Für sie mit ihren Lehrergehältern war das eine tolle Reise, und Keith hatte seine Hausaufgaben gemacht. Begeistert erzählte er von der Eisenbahn, der Landschaft, den Buschfeuern – wir fuhren durch Lithgow, wo erst kürzlich hunderte Morgen Busch verbrutzelt und zwei Feuerwehrleute umgekommen waren –, aber als ich ihn nach den Aborigines fragte (mögliche Landreformen wurden gerade viel in den Nachrichten diskutiert), wurde er plötzlich nervös und einsilbig.
»Das ist ein Problem«, sagte er und starrte angelegentlich auf sein Essen.
»In der Schule, an der ich unterrichte«, erzählte Daphne zögernd, »also, wenn die Aborigine-Eltern ihr Arbeitslosengeld bekommen, vertrinken sie es und gehen walkabout, das heißt wochenlang auf Wanderschaft. Und die Lehrer müssen… wir müssen den Kindern was zu essen geben. Aus unserer eigenen Tasche bezahlen wir das. Sonst würden sie schlichtweg nichts kriegen.«
»Es ist ein Problem«, wiederholte Keith, immer noch auf sein Essen konzentriert.
»Eigentlich sind sie richtig nett. Wenn sie nicht trinken.«
Und damit war das Gespräch mehr oder weniger beendet.
Nach dem Essen unternahmen Trevor und ich einen Ausflug in den Salonwagen. Während Trevor zum Tresen ging und bestellte, sank ich in einen Sessel und betrachtete die dämmrige Landschaft. Es war Farmland, ziemlich dürr. Die Hintergrundmusik hatte gewechselt. Nach »Beliebten Showmelodien« kam nun »Party im Pflegeheim«. Gerade verklang »Rolling Out the Barrel« und wurde rasch gefolgt von »Toot Toot Tootsie Goodbye«.
»Interessante Musikauswahl«, bemerkte ich trocken gegenüber dem jungen Paar mir gegenüber.
»Ja, wunderschön!«, erwiderten beide, aufrichtig begeistert.
Ich unterdrückte einen Aufschrei und wandte mich an den Mann neben mir – einen gebildet aussehenden älteren Herrn im Anzug, was auffällig war, weil alle anderen im Zug legerer gekleidet waren. Wir plauderten über dies und das. Er war pensionierter Anwalt aus Canberra und wollte seinen Sohn in Perth besuchen. Da er vernünftig und aufgeschlossen wirkte, erwähnte ich, streng vertraulich natürlich, mein verwirrendes Gespräch mit den Lehrern aus Queensland.
»Ach, die Aborigines«, sagte er und nickte ernst. »Ein großes Problem.«
»Kann ich mir denken.«
»Aufgeknüpft gehören die, alle miteinander.«
Erschreckt schaute ich ihn an und stellte fest, dass er richtig wütend war.
»Alle miteinander, diese Mistkerle«, sagte er mit zitternden Lefzen und entfernte sich ohne ein weiteres Wort.
Da wurde mir klar, dass ich mich mit dem Problem der Aborigines beschäftigen musste. Doch bis ich die Dinge genauer durchschaute, plauderte ich wohl besser über simplere Dinge: das Wetter, die Landschaft, beliebte Showmelodien.
Züge sind im Vergleich zu Hotels deshalb so toll, weil sich – wen wundert’s! – der Ausblick ständig ändert. Am Morgen erwachte ich in einer neuen Welt: rote Erde, Gestrüpp, ein riesiges Firmament, nur gelegentlich ragte ein skelettartiger Eukalyptus in den Horizont. Als ich verschlafen von meinem engen Hochsitz lugte, sprang gar nicht weit von mir, aufgeschreckt von dem Zug, ein Kängurupaar daher. Ein aufregender Moment. Nun waren wir definitiv in Australien!
Wir kamen kurz nach acht in Broken Hill an und stiegen blinzelnd aus dem Zug. Über dem Land hing eine luftlose Hitze – solch eine Hitze, die einem entgegenschlägt, wenn man den Ofen aufmacht, um nach dem schmurgelnden Puter zu sehen. Auf dem Bahnsteig wartete Sonja Stubbing, eine freundliche junge Dame von der regionalen Tourismusbehörde, um uns abzuholen und dorthin zu bringen, wo wir ein Mietauto für eine Fahrt durchs Outback abholen wollten.
»Wie heiß wird es hier?«, fragte ich schon keuchend.
»Also, der Rekord ist achtundvierzig Grad Celsius.« Sie nickte heiter. »Gestern waren es zweiundvierzig.«
»Das ist sehr heiß.«
»Zu heiß«, sagte sie.
Broken Hill war ein wirklich entzückendes kleines Gemeinwesen – sauber, ordentlich, wohlhabend optimistisch. Nur leider nicht das, was wir wollten. Wir wollten das echte Outback: wo Männer voll im Saft stehen und Schafe bei ihrem Anblick nervös werden. In Broken Hill dagegen gab es Cafés und einen Buchladen, Reisebüros, die verlockende Pauschaltouren nach Bali und Singapur anboten. Im Bürgerhaus spielten sie sogar ein Noel-Coward-Stück. Das war doch kein Outback. Das war ein verträumtes Provinzstädtchen mit hoch aufgedrehter Zentralheizung.
Etwas hoffnungsvoller gestalteten sich die Dinge, als wir uns zum Len Vodic Vehicle Hire begaben und einen Wagen mit Allradantrieb für unseren Zweitagestripp in die glühend heiße Wildnis abholten. Der Len aus dem Firmennamen war ein drahtiger alter Bursche, zupackend und freundlich, und sah aus, als habe er jeden Tag seines Lebens in der freien Natur hart rangeklotzt. Er sprang hinters Steuer und gab uns eine schnelle, gründliche Einführung, die einem die Leute geben, wenn sie davon ausgehen, dass sie es mit intelligenten, kompetenten Zuhörern zu tun haben. Das Wageninnere bot sich als verwirrende Vielfalt von Skalen, Hebeln, Knöpfen, Schaltern und Messinstrumenten dar.
»Also, angenommen, ihr bleibt im Sand stecken und müsst euer Abseits-Differenzial vergrößern«, sagte Len bei einer der wenigen Gelegenheiten, zu denen ich mich in den Vortrag einklinkte. »Dann bewegt ihr diesen Griff nach vorn, also so, wählt den Hyperantriebsquotienten zwischen zwölf und siebenundzwanzig, stellt die Querruder höher und zündet beide Antriebsmotoren – aber nicht den linken. Das ist sehr wichtig. Doch was ihr auch tut, achtet auf die Messinstrumente, und geht in der Brennkammer nicht über hundertachtzig Grad. Sonst fliegt euch das Ding um die Ohren, und ihr hängt da draußen fest.«
Er sprang heraus und übergab uns die Schlüssel. »Hinten drin sind fünfundzwanzig Liter zusätzlicher Diesel. Das sollte mehr als genug sein, wenn etwas passiert.« Dann schaute er uns noch einmal genauer an und sagte: »Ich hol euch noch ein bisschen Diesel.«
»Hast du irgendwas davon verstanden?«, fragte ich Trevor flüsternd, als Len weg war.
»Von der Stelle an, wie man den Schlüssel ins Zündschloss steckt, nichts mehr.«
»Was ist, wenn wir stecken bleiben oder uns verirren?«, rief ich Len hinterher.
»Dann sterbt ihr! Ist doch klar!« Na gut, das sagte er nicht, aber das dachte er. Ich hatte ja Berichte von Leuten gelesen, die sich im Outback verirrt hatten oder sonst wie dort hängen geblieben waren. Ernest Giles wanderte zum Beispiel tagelang ohne Wasser und halb tot herum, bis er zufällig auf ein Wallaby-Junges stieß, das aus dem Beutel seiner Mutter gefallen war. »Ich stürzte mich darauf«, berichtet Giles in seinen Lebenserinnerungen, »und aß es lebend, roh, sterbend – Fell, Haut, Knochen, Schädel und alles.« Und das war noch eine der fröhlicheren Geschichten. Glauben Sie mir, sich im Outback zu verirren ist kein Zuckerschlecken.
Allmählich beschlich mich ein ungutes Gefühl – das auch nicht verschwand, als Sonja beim Anblick eines Tierchens zu unseren Füßen einen entzückten Schrei ausstieß und rief: »He, schauen Sie, eine Rotrückenspinne!« Eine Rotrückenspinne ist, falls Sie das noch nicht wissen, der Tod auf acht Beinen. Während Trevor und ich uns, kläglich wimmernd Halt aneinander suchend, umklammerten, hob sie das Vieh auf und hielt es uns mit spitzen Fingern hin.
»Schon gut«, kicherte sie. »Sie ist tot.«
Vorsichtig inspizierten wir das kleine Ding auf ihrer Fingerspitze mit dem verräterischen roten Mal in Form einer Sanduhr auf dem glänzenden Rücken. Es kam uns absolut unwahrscheinlich vor, dass etwas so Winziges einem sofortige Todesqualen bescheren kann, aber es stimmt – ein einziger Biss mit den bösen Kauwerkzeugen einer Rotrückenspinne kann binnen Minuten zu »unkontrollierbaren Zuckungen führen, heftigem Erguss von Körperflüssigkeiten und beim Ausbleiben prompter ärztlicher Behandlung womöglich zum Tod«, weiß die Fachliteratur zu berichten.
»Draußen sehen Sie wahrscheinlich gar keine Rotrücken«, beruhigte Sonja uns. »Das größere Problem sind die Schlangen.«
Diese Information wurde mit vier erhobenen Augenbrauen und Mienen aufgenommen, die »Welche? Welche?« besagten.
»Gewöhnliche Schwarzotter,Westlicher Blätterteig, Bückviper, Gelbrückenkieferklemme, Östlicher Klötengrabscher…« Genau weiß ich nicht mehr, was sie alles aufzählte, doch die Liste war lang. »Nur keine Panik«, sagte sie zum Abschluss. »Die meisten Schlangen tun einem nichts. Wenn Sie im Busch sind und eine Schlange kommt daher, bleiben Sie stocksteif stehen, und lassen Sie sie über Ihre Schuhe gleiten.«
Donnerwetter, diesen Ratschlag würde ich ja nun von allen, die ich je bekommen hatte, am wenigsten befolgen.
Als wir unser zusätzliches Diesel verstaut hatten, kletterten wir an Bord. Mit knirschenden Gängen, ein paar Bocksprüngen und einem lebhaften, wenn auch versehentlichen Salut der Scheibenwischer machten wir uns auf den Weg. Unser Ziel war Menindee, einhundertundzehn Kilometer gen Osten, wo wir uns mit einem Mann namens Steve Garland treffen wollten. Die Fahrt nach Menindee stellte sich als einigermaßen enttäuschend heraus. Das Land war flimmernd heiß und sagenhaft unwirtlich, und wir sahen auch unsere erste willywilly, eine etwa dreißig Meter hohe, sich drehende Staubsäule, die sich links von uns über die endlose Ebene bewegte. Doch das war auch schon das Abenteuerlichste, das uns widerfuhr. Die Straße war neu und relativ stark befahren. Während Trevor Bilder machte, zählte ich vier vorbeikommende Autos. Hätten wir also einen Unfall oder Motorschaden gehabt, hätten wir nicht länger als ein paar Minuten dort gestanden.
Menindee war ein bescheidenes Dörflein am Darling River: ein paar schattenlose Straßen mit Bungalows, eine Tankstelle, zwei Läden, dem Burke and Wills Motel (nach zwei Forschern aus dem neunzehnten Jahrhundert benannt, die sich im gnadenlosen Outback um Kopf und Kragen brachten) und dem nicht ganz unbekannten Maidens Hotel, in dem selbige Burke und Wills ihre letzte Nacht in der Zivilisation verbrachten, bevor sie in der kargen Leere im Norden ihr unseliges Schicksal ereilte.
Wir trafen Steve Garland im Motel, und um unsere sichere Ankunft und jüngste Entdeckung des fünften Ganges zu feiern, gingen wir über die Straße ins Maidens und mischten uns unter die fröhlichen Zecher dort. Der lange Tresen war von Anfang bis Ende mit sonnengegerbten Männern in Shorts, schweißfleckigen Muskelshirts und breitkrempigen Hüten besetzt. Es war, als beträte man einen Film, in dem Paul Hogan mitspielte. Nun kamen wir der Sache schon näher.
»Und durch welche Fenster schmeißen sie die Schnapsleichen?« , fragte ich den liebenswerten Steve, als wir uns setzten. Denn vielleicht wollte Trevor ja rechtzeitig seine Gerätschaften aufbauen, damit er bei Feierabend ein paar gute Aufnahmen machen konnte.
»Ach, das passiert hier nicht«, sagte Steve. »Im Outback geht’s nicht so wild zu, wie die Leute immer meinen. Eigentlich eher zivilisiert.« Mit richtig liebevollen Blicken schaute er in die Runde und begrüßte ein paar staubige Burschen.
Garland war Fotograf in Sydney gewesen, aber als seine Partnerin Lisa Menke Chief-Ranger im Kinchega National Park gleich um die Ecke wurde, nahm er den Job als regionaler Tourismus- und Entwicklungsbeauftragter an. Sein Bereich umfasste sechsundzwanzigtausend Quadratmeilen, war also halb so groß wie England und hatte eine Einwohnerzahl von zweitausendfünfhundert. Garland oblag es zum einen, die Ortsansässigen davon zu überzeugen, dass es Menschen auf der Welt gab, die bereit waren, für Ferien in einem riesigen, trockenen, öden und grauenhaft heißen Land gutes Geld hinzulegen, und zum anderen, solche Menschen zu finden.
Die unbarmherzige Sonne und die Isolation machen die Leute im Outback nicht immer zu den begnadetsten Gesprächspartnern. So hörten wir von einem Ladenbesitzer, der, von einem lächelnden Besucher gefragt, wo die Fische bissen, erwiderte: »In dem Scheißfluss, Kumpel, wo denn sonst?«
Garland grinste nur und fragte uns, wie die Fahrt gewesen sei. Auf meine Antwort, ich hätte es ein wenig härter erwartet, sagte er nur: »Warten Sie bis morgen.«
Recht hatte er. Am nächsten Morgen fuhren wir in einem Minikonvoi – Steve und Lisa in einem Auto, Trevor und ich im anderen – nach White Cliffs, einer alten Opalbergwerksstadt, zweihundertfünfzig Meilen im Norden. Schon eine halbe Meile außerhalb von Menindee hörte der Asphalt auf, und die Straße bestand nun aus festgefahrener Erde voller Schlaglöcher, Furchen und zementharter Rillen, die einen durchrüttelten, als führe man über Eisenbahnschwellen.
Stundenlang holperten wir, riesige rote Staubwolken hinter uns herziehend, über gleißende, heiße, eintönige Hochebenen, stellenweise mit niedrigen Salzbüschen und stacheligem Spinifex bewachsen und hier und dort einem schlappen Eukalyptusbaum. Am Straßenrand lagen ab und zu Känguruleichen und manchmal ein sonnenbadender Goanna, ein hässlicher großer Waran. Der Himmel wusste, wie in dieser Hitze und Dürre überhaupt ein Wesen überlebte. Es gab Flussbetten, die seit fünfzehn Jahren kein Wasser gesehen hatten.
Die europäischen Siedler brauchten lange, um sich an die einzigartige Einöde Australiens, die provozierende Nutzlosigkeit einer solchen Masse Land, zu gewöhnen. Etliche der ersten Forschungsreisenden waren derart überzeugt, dass sie auf mächtige Flusssysteme oder sogar einen Binnensee stoßen würden, dass sie Schiffe mitnahmen. Thomas Mitchell, der in den Dreißigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts ausgedehnte Gebiete des westlichen New South Wales und des nördlichen Victoria erforschte, schleppte zwei Holzskiffs über dreitausend Meilen rappeltrockenen Busch, ohne dass sie einmal nass wurden, weigerte sich aber bis zum Schluss, sie liegen zu lassen. »Obgleich die Boote und deren Beförderung zuletzt eine große Beschwernis für uns darstellten«, schrieb er nach der dritten Expedition mit ein wenig Understatement, »war ich mitnichten bereit, auf derart nützliches Rüstzeug für eine Forschergruppe zu verzichten.«
Aus Berichten über die frühen Erkundungszüge wird allzu deutlich, dass die ersten Forscher oft grotesk wenig Ahnung hatten, wie sie zu Werke gehen sollten. 1802 beschrieb Lieutenant Francis Barrallier bei einer der ersten Expeditionen eine Temperatur von achtundzwanzig Grad Celsius als »brütend heiß«. Wir können also mit Fug und Recht annehmen, dass er gerade erst im Lande angekommen war. Als seine Männer tagelang erfolglos versucht hatten, Kängurus zu jagen, kamen sie endlich auf die Idee, dass sie sich vielleicht besser an die Viecher ranpirschen konnten, wenn sie sich vorher ihrer leuchtend roten Jacken entledigten. In sieben Wochen schafften sie gerade mal einhundertunddreißig Meilen, also im Durchschnitt eineinhalb Meilen pro Tag.