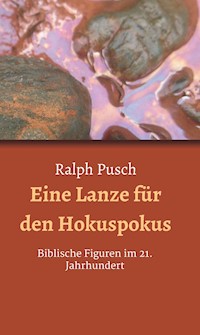
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ralph Pusch entwirft ungewöhnliche Zugänge zu bekannten und unbekannten biblischen Personen, assoziativ verwirbelt in moderner Sprache und biografisch mit der Dramatik eines Todkranken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
RALPH PUSCH
***
EINE LANZE FÜR DEN HOKUSPOKUS
Biblische Figuren im 21. Jahrhundert
© 2019 Ralph Pusch
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7482-4587-2
e-Book:
978-3-7482-4588-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Zu Beginn
Noah
Brüder und Ehefrauen – Konkurrenz und Unvermögen
Familie Lot
Simson
“Personal Jesus“ – the story of Mike
Naaman und Gehasi
Jezebel
D’Haram el Diir
Jesus als Teenager
Jesus an Regentagen
Bileam II – eine Lanze für den Hokuspokus
Johannes und Judas Iskarioth
Jesus am Kreuz – vom Lassen
Petrus und der Ungeist in der Pfingstgeschichte
Ein namenloser Kapitän
Anmerkungen zum Weiterdenken und für Gruppenlektüre
Zu Beginn
Ist’s Ihnen aufgefallen, werte Leser? Bestimmt. Der Untertitel. Biblische Figuren im 21. Jahrhundert – wie soll das gehen? Beim ersten Nachdenken wird klar: Im 21. Jahrhundert gibt’s keine biblischen Figuren. Es sei denn, man würde sie dorthin beamen, aber dies ist kein Science Fiction. Vielmehr versuche ich in diesem kleinen Buch, Figuren der Bibel mit den Denkprozessen und Empfindungen nachzuzeichnen, die ich selbst als Mensch des 21. Jahrhunderts denke und fühle. Der Ansatz ist also ein recht einfacher: Ich stelle mir die biblischen Figuren als Mitmenschen unserer Tage vor, deren Handeln und Reden ich mit den Mechanismen befrage, die ich von mir selbst und anderen kenne.
Dabei ist es dann nicht schlimm, dass ich nur Schmalspurtheologe bin, denn dies ist kein theologisches Fachbuch. Dagegen bin ich Experte für das Leben im 21. Jahrhundert. Und dieses Buch ist vor allem ein Protest gegen die Langeweile und Fremdheit, die mich so oft überkam und überkommt, wenn mir biblische Geschichten erzählt oder vorgelesen wurden und mich nicht erreichten – so platt und fremd, manchmal moralisierend. Brauche ich nicht. Braucht unsere Gesellschaft nicht, könnte man meinen. Vorschnell? Egal, für mich sind manche Geschichten nicht mehr die richtigen. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Und passiert auch nicht mehr. Oder?
Würde es helfen, sich mehr mit den Hintergründen zu beschäftigen? Ich weiß natürlich, dass die biblischen Texte „geworden“ sind. Sie sind nicht vom Himmel gefallen, ich ahne, dass die Verfasser auch ihre Interessen hatten, jedoch will ich dies hier nicht berücksichtigen, will stattdessen die Texte nehmen wie sie sind. Mit diesem Zugang setze ich mich freilich dem Vorwurf der „Eisegese“ aus, des „Hineinlegens“ neuzeitlicher Gedanken in alte Texte. Aber das Risiko muss ich eingehen. Sie werden merken: Die Motive und Strukturen, die ich in den Texten entdekke, sind nur allzu menschliche. Ich versuche die biblischen Figuren als menschliche, menschelnde Menschen ernst zu nehmen. Urteilen Sie selbst, ob es wirklich so weit weg ist von dem, was die Menschen damals empfunden haben müssen. Den Texten in solch einer Art zweiter Naivität zu begegnen ist für mich ein zu einem erfrischenden Zugang geworden. Und wer sagt denn, dass nicht Gott selbst das eine oder andere Mal kopfschüttelnd auf die Wirren der Protagonisten und die Mühen der Autoren hinabblickte, unter deren Irrwegen er selbst litt und deren Geschriebsel er nur mit einem abgründigen Humor ertrug. Alles andere hätte ihn schier um den Verstand bringen müssen. Und so mag denn dieses Kopfschütteln über den Texten die einzige Art sein, ihnen gerecht zu werden.
Ein Satz noch zum ungewöhnlichen Titel. Viele junge Menschen kennen den Ausdruck „für jemanden/etwas eine Lanze brechen“ gar nicht mehr. Was ist also gemeint? Nun, zum einen sehe ich in einer kleinen biblischen Episode, in der Jesus das Handeln eines zwielichtigen Typen, das man leicht als „Hokuspokus“abqualifizieren könnte, eben nicht verurteilt, sondern sagt: „Lasst ihn machen“, wie Jesus damit (und nicht nur hier) „eine Lanze für den Hokuspokus“ bricht. Und zum zweiten möchte auch ich mit den Gedanken dieses Buches eine Lanze brechen. Für den Mut zu unkonventionellen Zugängen zu biblischen Texten. Für kreative und experimentelle Versuche, sich biblischen Figuren zu nähern. Dabei kann nichts garantiert werden. Es mag von außen wie ein Hokuspokus erscheinen, aber vielleicht begegnet mancher so diesen Figuren in ganz neuer, existentieller Tiefe.
Zum Schluss ein Dank an Wolfgang Vorländer, Armin Kistenbrügge und Dr. Bernhard Kleibrink für ihre Rückmeldungen und an meine Krankenversicherung, die mir in der Zeit der ersten Chemotherapie das Krankengeld zahlte, so dass ich hier warm saß und tippen konnte. Den Impuls zu dem Buch gaben meine Frau und meine Schwester, die beide sagten: „Ralph, nun schreib doch mal, du kannst so schön schreiben“ (ob sie wussten, wo es hingehen würde, bezweifle ich, ihnen standen eher romantische Gedichte und Meditationen vor Augen). Ich widme dieses Buch all den Menschen, die mich auf meinem Weg des Zweifelns und Hinguckens begleiten.
Besonders dankbar bin ich dabei meiner geliebten Frau Anette.
Noah
Zu der Figur des Noah kann einem allerhand einfallen. Oder auch nicht. Und vielleicht ist gerade das auffällig, dass wir uns so leicht vom biblischen Text einlullen lassen. Ja, einlullen. Als Zentrum meines Ausblicks wähle ich den Moment, als der gute Mann aus der Arche steigt. Viele Wochen Regen, der Kahn schippert durch die Gegend, setzt dann knirschend irgendwo am Ararat in der Türkei auf, das Wasser läuft ab. Noah steigt aus. Was sieht der Mann da? Als Kind haben mir meine Eltern aus der Kinderbibel des holländischen Autors Anne de Vries vorgelesen. Und als ich lesen konnte, habe ich die Geschichten auch selber gelesen: Es begann schon wieder zu grünen, die Tiere sprangen fröhlich ins Feld. So ungefähr. Als Kind kann man sich das prima vorstellen. Mittlerweile wohne ich im Oberbergischen, zwischen Köln und Siegen. Das ist die Ecke, die auf den Wetterkarten im Diercke-Schulatlas immer dunkellila eingefärbt war. Da regnet es öfter. Sehr öfter. Und als ich die biblische Geschichte erzählt bekam, konnte ich mir gut vorstellen, was Noah empfunden haben musste, als er nach der langen Zeit aus seinem muffigen Pott kam: endlich frische Luft, wann wird’s mal wieder richtig Sommer? Guck mal, da, erste grüne Pflänzchen…
Doch das ist natürlich totaler Kitsch. Als Noah mit wuchtigen Schlägen die Planken weghämmerte, offenbarte sich ihm ein Bild des Grauens. Woher ich das weiß? Ich weiß es gar nicht. Aber, werte Leser, googeln Sie einfach mal nach Bildern von Flutkatastrophen, Sie werden schon sehen… Es war eine zähe, schlammig braune Masse, Geröll, versickernde Pfützen unter dräuend blaugrauem Himmel, verendete Ziegen und Schafe, halb mit Schlick bedeckt, Reste eines Gehöftes, Balken zwischen grauen Felsen, vielleicht in der Nähe im Geäst eines Strauches auch Leichen von Männern, Frauen, Kindern, die irgendwie dem Wasser zu entkommen suchten, in purer Verzweiflung auf irgendetwas geklettert waren, was erhöht war und vielleicht Rettung verhieß. Stille.
Als Noah aus der Arche trat, muss sich ihm ein Bild geboten haben, das ihn zutiefst erschüttern musste. Alles weg. All die Menschen, Geschichten. Und sein Kahn, hilflos ins Nirgendwo getrieben, gestrandet. Seit Ende des zwanzigsten Jahrhunderts werden Bilder des Grauens über das Fernsehen in die ganze Welt übertragen. (In dem wundervollen Film „Weiter als der Mond“ werden die Kinder einer Familie im Holland der 60er Jahre beim erstmaligen Einschalten des neuen Fernsehgerätes mit Bildern verhungernder Kinder in Äthiopien konfrontiert und reagieren hilflos: „Es gibt auch Zeichentrickfilme!“) Und heute sehen wir Bilder des Grauens im Minutentakt. Wie reagieren wir darauf?
Noah muss eigentlich erschüttert gewesen sein, schwer traumatisiert. Die biblische Geschichte versucht uns mit einer Dichotomisierung zu helfen: Zur Zeit Noahs waren die Menschen sehr böse. Alle böse, Noah gut. Das lässt sich denken. Ob und wie gut Noah war, dazu später mehr, aber egal, die biblische Geschichte verführt uns zu einem Verdienstdenken: „Jou, die Bösen sin alle dout.“ Die haben das auch verdient, schade ist’s nicht um die. Doch wie erging es Noah? War er auch froh, dass Nachbarn und Bekannte, Verwandte (Hatte er Brüder und Schwestern?) alle tot waren? Dann müsste man ihn sich als emotionalen Krüppel vorstellen, als sozialen Autisten, dem der Rückzug auf die eigene kleine Welt gut gefiel und dem das Verschwinden einer ganzen Kultur nichts ausmachte. Keine leichte Vorstellung. Der Musiker Sting schreibt es entschuldigend im Kommentar zu dem faszinierenden Song „When the world is running down, you make the best of what’s still around“ (fast zwölf Minuten, dazu müssen Sie mal tanzen, dann sparen Sie sich auf den Crosstrainer zu gehen; ich übersetze frei:) „Welch Eitelkeit, sich sich selbst als den einzigen Überlebenden eines Holocaust vorzustellen, … und alle Lieblingsdinge noch intakt. - Ich war halt jung.“ Recht hat er. Welch eine Hybris und Arroganz! Die Welt geht vor die Hunde, aber wir machen fröhlich weiter „unser Ding“. Dagegen helfen nur die zynischen Texte von Godley und Creme auf der Platte „Goodbye Blue Sky“, auf der sie Weltuntergang und Nuklearkatastrophe mit fröhlicher Mundharmonika kombinieren. „I’m gonna be famous. No! I’m gonna be rich! No, no! You’re gonna be one dead son-of-a-bitch!“ Amen.
Doch zurück zu Noah. Wenn er denn halbwegs normal war, so normal wie Sie oder ich, dann musste ihn der Anblick schwer treffen. Wie sollte er das alles wahrnehmen, aushalten? Alles kaputt. Alles weg. Noah muss schwer traumatisiert gewesen sein, der Bezugsrahmen seiner sozialen und beruflichen Existenz war verschwunden, alles weg. Reduziert auf Frau, Söhne, Schwiegertöchter. (Übrigens wussten Sie, dass in der Vorstellung des Mittelalters mit dem T-Schema der Erde und den 3 Kontinenten deren Besiedelung eben auf die drei Söhne Noahs zurückgeht? Jeder Sohn wurde der Stammvater - Frauen wie so oft namenlos, schmückendes Beiwerk - einer kontinentalen Völkerfamilie, z.B. Sem für die semitischen Völker in Asien). Aber Sie und ich, wir haben Nachbarn, Kollegen, Freunde, Handelspartner, Frisöre, Tankstellenkassiererinnen und so weiter. Alle weg. Dort im Matsch noch eine Sandale. Ohne Besitzer. Wer den biblischen Bericht soweit ernst nimmt, muss sich Noah als einen schwer traumatisierten Menschen vorstellen. Damit sind wir freilich schon lange nicht mehr bei Anne de Vries’ Kinderbibel.
Ich bin kein Traumaforscher, aber vermute, dass in einer solchen Situation der Körper und die Seele Zuflucht zu ganz alten, archaischen Strukturen nehmen, die der Mensch im Laufe seiner Lebensgeschichte (oder vielleicht sogar Gattungsgeschichte?) erworben hat. Und genau das scheint bei Noah auch zu passieren. Das traumatische Erlebnis, die Bilder der Verwüstung überfordern seine matte Seele. Es ist nicht auszuhalten, muss verdrängt werden. Und was tut Noah? Der biblische Text berichtet von einer dreigeteilten Verdrängungsreaktion. Man kann es freilich auch anders sehen und Noah als Helden stilisieren, aber eigentlich geht das im einundzwanzigsten Jahrhundert nicht mehr. Dazu sind wir denn doch von Idealvorstellungen geprägt, in denen (auch) Männer ihre Gefühle wahrnehmen und aussprechen.
Doch Noah lebte früher. Und Noah verdrängte. Verstehen Sie mich richtig, es steht mir überhaupt nicht an, das zu werten oder gar zu verurteilen. Aber aus der Sicht des einundzwanzigsten Jahrhunderts kann ich nur konstatieren: er ist überfordert, er muss das schreckliche Erlebnis verdrängen.
Zuerst äußert sich das Verdrängen in einer unangemessenen Religiosität. Noah baut einen Altar und dankt für die Rettung. Als Kind schien mir das durchaus logisch. Alle tot, Noah und seine Familie haben überlebt. Aber heute? Der Schriftsteller Eli Wiesel lässt in seiner Erzählung „Der Prozess von Schamgorod“ den einzigen Überlebenden eines Pogroms sagen, dass das Überleben für ihn kein Grund zur Dankbarkeit gegen Gott sei, sondern ein Zeichen der Grausamkeit Gottes. Alle weg. Alle tot, außer ihm. Keine Gnade, sondern Hohn Gottes. Wie mag es für Noah gewesen sein? Vermutlich war er dankbar, der Flut entkommen zu sein. Aber ein Altar und ein Dankopfer? Zwischen den toten Ziegen im Morast? Hätte er nicht schreien müssen? Oder schweigen? Oder alles zusammen. Für mich – und Sie können das gerne anders sehen, liebe Leser – ist dieses Dankopfer ein erster Ausdruck der Verdrängung eines höchst traumatischen Ereignisses. Eines Ereignisses, so schrecklich, dass es verdrängt werden musste. Bilder beim Gang aus der Arche, die man nicht aushalten konnte.
Und Noah nimmt Zuflucht zu einem Ritual, das er von seinen Vorfahren gelernt hatte: dem Brandopfer. (Ich verzichte hier auf hämische Fragen, welche Tiere er denn opferte, vermutlich solche, die sich in der Arche über die Maßen vermehrt hatten oder halt… ja, ja, die Dinosaurier, ach, was weiß ich…). In dumpfem Schmerz tut er, was alle tun, wenn sie von Kummer und Grauen überwältigt werden: Opfer an die grausamen Götter, die wild um sich schlagend, schicksalsmäßig bald tausende umbringen und den einen verschonen. Wer will ihm das verübeln? Ich nicht. Aber dieses Dankopfer ist kein versöhntes, reflektiertes Danken, das den Schmerz miteinschließt. Sondern ein betäubtes und betäubendes Stammeln. Alles andere wäre auch komisch und vielleicht zu viel verlangt. (Liebe Leser, da kann ich derzeit ein Lied von singen, ich kriege es halbwegs hin, für meinen Körper dankbar zu sein, jedoch nicht für die Krebserkrankung. Das wäre denn doch zu viel.)
Der zweite Ausdruck der Verdrängung ist für mich, dass Noah einfach wieder Ackerbau betreibt. Die Bibel erzählt, er baute Wein an. Es muss ja weitergehen. Immer weiter. Für wen? Wozu? Egal, es muss. Und es ist ja auch etwas dran, in Zeiten der übermächtigen Verzweiflung Zuflucht zu nehmen bei dem gleichmäßigen Ratschen des Pflugs, dem Graben, der Wanderung mit den letzten (und ersten) beiden Schafen. Wie gesagt, kein Urteil über Noah, steht mir nicht zu.
Und schließlich wird der Wein geerntet, gekeltert und Noah lässt sich mit dem Wein zulaufen, betrinkt sich richtig. In diesem rauschhaften Handeln versucht er den Schmerz zu betäuben. Er hat Wein gekeltert, doch mit wem soll er ihn trinken? Mit wem soll er Handel betreiben, um für sein Produkt einen Erlös zu erzielen? Könnte es nicht sein, dass er die Bilder der Flutkatastrophe längst vergessen hatte? Nein, er wollte die Bilder vergessen, doch vermutlich waren sie wie bei vielen (allen?) traumatisierten Menschen tief in sein Gehirn eingebrannt. Er wollte andere Bilder dagegensetzen, den Schlamm und die braune Soße in tiefere Schichten abdrängen, doch nachts, wenn alles still war, kamen sie immer wieder hoch.
Kurz anfügen will ich aus heutiger Sicht vielleicht auch noch, dass Noah natürlich laut dem Bibeltext nicht mit seiner Frau über seinen Schmerz redet. Das mag für die biblischen Autoren völlig okay sein, nur darf es eben heute nicht dazu führen, alles wie zu biblischen Zeiten zu machen. Die Stummheit der biblischen Helden heute zu wiederholen, wäre eine anachronistische Dummheit.
Diese Mechanismen der Verdrängung, das religiöse Ritual, die Flucht in die Arbeit, in die Normalität und der Rausch sind also schon alt, uralt. Und deswegen kann ich auch nur demütig feststellen, dass sogar der Urvater Noah es nicht anders hingekriegt hatte, ein müdes, trauriges Eingeständnis.
Traurig, weil eben die Bibel erzählt, dass diese Verdrängung des Schmerzes weiteres Elend erzeugt. Die Geschichte nimmt den erstaunlichen Fortgang dahingehend, dass Noah im Suff nackt auf der Erde liegt. Und der Anblick des nackten Vaters überfordert den Sohn Ham. Natürlich kommt auch hier dazu, dass in frühen Gesellschaften der Anblick der Scham tabu war. Irritiert erzählt Ham das seinen Brüdern, die rückwärtsgehend einen Mantel über Noah breiten, nur um ihn nicht nackt sehen zu müssen. Und als Noah seinen Rausch ausgeschlafen hat und davon erfährt, dass Ham ihn nackt gesehen hat – im Luther-Original „bloß“, wie im Kirchenlied „…er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein….“, – da verflucht Noah seinen eigenen Sohn Ham und generiert eine Herrschaftsordnung: die Söhne Sem und Japhet als Herren, Ham als Diener. Dass die Israeliten dann Ham mit Kanaan identifizierten und der Bruderzwist zwischen Israeliten und Palästinensern vorprogrammiert war, damit einen prominenten Vorläufer hatte, die Israeliten Sem und Japhet als Herren, der kanaanäische Palästinenser Ham als Knecht, das lässt einen schon nachdenklich werden. Danke, Noah, das brauchten wir gerade noch! Dass du deine eigene Überforderung nicht aussprechen konntest, dass du den Schmerz verdrängtest und nachher den eigenen Sohn mit seinen Brüdern entfremdest – welch segensreiches Handeln, du Glaubensheld! Hier scheint sich eine Unheilslinie durchzuziehen, vom traumatisierten Noah über die vielen Ham-Schicksale (Afrika ist der Erdteil Hams) der Sklaverei früherer Jahrhunderte bis hin zu den Palästinensern und den modernen Sklaven Afrikas. Der traumatisierte Vater versorgt seinen Sohn mit einer traumatischen Erfahrung. Wie das wohl Flüchtlinge aus Syrien heute erleben werden?
So ist es also mit dem Verdrängen Noahs bei weitem nicht getan. Es ist nicht so, dass das nur ihn etwas anginge, eine Sache zwischen Gott und Mensch, sondern der Schmerz, die Wut, die Noah heruntergeschluckt und weggebetet hat, die er totgeopfert hat, fortgearbeitet und ersoffen, dieser Schmerz ließ ihn hart und ungnädig und verständnislos seinen Sohn verfluchen. Und von diesem Tun geht weiteres Unheil aus. Die Bibel – deren Autoren ja deutlich nicht aus dem 21. Jahrhundert stammten – kann den Bericht dann sachlich schließen, dass Noah 950 Jahre alt wurde, davon 350 Jahre nach der Flut. 350 Jahre Wut auf Ham. Aber das interessierte die Autoren nicht.
Leider ist aus der Geschichte des Glaubenshelden Noah eine ziemliche Tragödie geworden, die Tragödie des verdrängenden Menschen, um nicht zu sagen, des verdrängenden Mannes. Allerdings steckt mitten in der Geschichte noch ein kleiner Funke der Hoffnung, den die biblischen Autoren vielleicht gar nicht so gesehen haben, den ich aber für mich entdeckt habe.





























