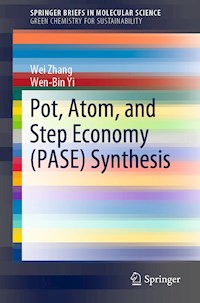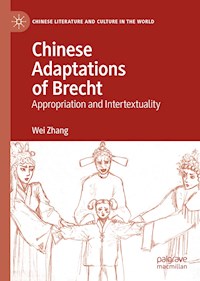Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Salis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
China 1968. Kulturrevolution. Das Leben ist geprägt von materiellem Mangel und extremer Politisierung. Durch den zunächst naiv wirkenden Blick der fünfjährigen Yingying demaskiert die Autorin die Absurdität des Alltagsgeschehens. Wei Zhang gelingt mit "Eine Mango für Mao" eine zeitlose, kritische und persönliche Betrachtung von Zwischenmenschlichem in Diktaturen. Yingying ist fünf, als sie verstehen muss, dass selbst ein Konto mit einem verschwindend geringen Kindersparbetrag als Hochverrat gelten kann: Als das Pfahlhaus ihrer Großmutter Nainai enteignet wird, versucht sie, ihr Geld abzuheben – aber setzt sie damit nicht ein Signal, das ihrer Familie schadet? Privateigentum ist schließlich verboten! Das Mädchen lebt mit ihren Eltern in einer kleinen Wohnung auf dem Areal ihrer Schule. Hier spielt sich ihr ganzes Leben ab: rivalisierende Cliquen in der Nachbarschaft, regimekritische Lehrer, der Tod des Onkels, die Mango als Kultobjekt und eine erste Liebe. Yingyings unbefangener Blick auf den Alltag in einer Diktatur entlarvt deren Absurdität. Ein großer Roman über die Menschlichkeit in totalitären Systemen, geschildert aus den Augen eines Kindes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Wir danken dem Kanton Zürich und der Stadt Zürich für die Unterstützung dieses Buches.
Der Salis Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
Wei Zhang
Eine Mango für Mao
Roman
Verlag
Salis Verlag AG, Zürich
www.salisverlag.com
Lektorat
Kristina Wengorz für www.torat.ch
Korrektorat
Patrick Schär für www.torat.ch
Satz
Peter Löffelholz für www.torat.ch
Umschlaggestaltung
André Gstettenhofer für www.torat.ch
Umschlagfoto
Vitrine mit Mango-Nachbildung, Mao-Bildnis und Standard-Aufschrift. 1968–1969, Glas, rote Emailfarbe und Pappmaschee. 20,3 × 14,0 × 9,0. Museum Rietberg Zürich. Geschenk Alfreda Murck. Foto: Rainer Wolfsberger
Foto Autorin
Goran Basic
1. Auflage 2018
© 2018, Salis Verlag AG
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-906195-68-1
Für Roland, Sebastian und Laurence
Inhalt
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
DANK
ZUR AUTORIN
KAPITEL 1
»Papa ist zu Nainai gefahren«, sagte Mama.
»Warum hat er mich nicht mitgenommen?«
»Yingying, hör mal, ich habe alle Hände voll zu tun. Dein Mittagessen ist bei Frau Zhang in der Wohnung. Sei brav, wenn du allein zu Hause bist.«
»Fährst du auch zu Nainai?«, fragte ich extralaut.
»Ich werde so schnell wie möglich wieder da sein.« Mama klang zerstreut.
»Darf ich mitkommen?«
»Nein, diesmal nicht. Du kannst ein andermal mit Papa zusammen hinfahren.«
»Mama, fährst du auch zu Nainai?«
»Ich komme schnell wieder zurück, habe ich dir doch gesagt.«
»Aber Papa und ich waren doch erst am Wochenende bei Nainai!«
»Yingying, ich muss mich jetzt auf den Weg machen.«
»Warum fährst du auch zu Nainai, Mama?«
»Ich muss jetzt wirklich los.«
Mama war eine ungeduldige Frau, worüber Papa sich oft lustig machte: »Am liebsten hättest du direkt nach dem Aufstehen schon alles erledigt.«
Für Mama war Papa eine langsame Schnecke.
Mir wurde klar, warum Papa so viel früher aufbrechen musste: Die schnellere Mama würde ihn ohnehin unterwegs überholen, und beide würden gleichzeitig bei Nainai eintreffen.
Nainai war eigentlich nicht Papas Mutter, sondern nur eine jüngere Schwester meiner echten Nainai, die aber schon lange tot war. Die neue Nainai hatte selbst auch eine Tochter und einen Sohn.
Von Tante Yun wusste ich nur, dass sie genau wie Mama ein Lehrerseminar besucht, aber nicht so viel Glück wie Mama gehabt hatte und gleich nach ihrem Abschluss zur Umerziehung aufs Land verschickt worden war.
»Du hast deine Tante Yun schon einmal getroffen, als du klein warst.« Mama machte wohl Witze! Ich war noch ein Baby gewesen – wie sollte ich mich daran erinnern?
Und Onkel hatte noch weniger Glück als seine Schwester gehabt. Trotz seines brillanten Abgangszeugnisses war er nicht zum Studium an der Hochschule zugelassen worden.
»Nur dank Papa hat er die Zimmermannsstelle in seinem Geschäftskollektiv bekommen.« Mama war echt stolz auf Papa.
Ich wusste aber selbst, dass ein Geschäftskollektiv viel weniger Ansehen genoss als eine staatliche Firma – Papas staatliche Firma.
Papa sei zwar kein echter Sohn von Nainai, aber er schulde ihr mindestens so viel Kindspietät wie Onkel, sagte Mama. Papa hatte mir zwar schon erklärt, was das hieß, aber ganz genau hatte ich es nicht verstanden. Auf jeden Fall fuhren er und ich jeden ersten Sonntag des Monats, nach dem Zahltag also, zu Nainai und brachten ihr zehn Yuan vorbei.
Unterwegs fragte Papa mich fast jedes Mal: »Willst du eine Geschichte hören, Yingying?«
Natürlich wollte ich!
»Ich war damals so alt wie du jetzt. Unsere Heimatstadt Wuhan ist durch japanische Bomber komplett zerstört worden. Wir waren auf der Flucht den Yangzi aufwärts. Die Straßen waren gerammelt voll. Es gab Flüchtlinge wie Sand am Meer.«
»In Chongqing hast du dann mit meiner echten Nainai zusammen Großvater aus den Augen verloren«, sagte ich zu Papa. Diese Geschichte hatte er mir schon oft erzählt.
»Yingying, deine neue Nainai ist auch deine echte Nainai. Ohne sie und ihren Mann wären meine Eltern und ich schon zu Beginn unserer Flucht im Yangzi ertrunken. Weißt du, in der Familie lässt man sich gegenseitig niemals im Stich.«
Ich nickte. »Blut ist dicker als Wasser«, war Papas liebstes Sprichwort. Oft sagte er auch: »Gutes soll mit Gutem vergolten werden.«
Was konnte ich dagegen einwenden? Ich sagte besser gar nichts.
Mama ermahnte uns immer: »Ihr könnt der alten Dame doch nicht nur Bargeld geben.« Darum besorgte sie jedes Mal Obst, das wir Nainai mitbringen sollten.
Früher hatte ich Mama oft auf den Markt begleitet, wo sie geschickt mit den Verkäufern verhandelte. Wenn sie den Preis tief genug heruntergehandelt hatte, trug sie stolz die vier leuchtenden Orangen in ihrem selbst gestrickten Einkaufsnetz nach Hause. Dann strahlte Papas schmales Gesicht hinter der Fensterscheibe immer wie eine frisch eingeschraubte Glühbirne. Doch seit Obst- und Gemüsemarken eingeführt worden sind, gab es nichts mehr zu verhandeln.
Letzte Woche gingen wir in den einzigen Laden in der Gegend, den staatlichen Laden an der Hauptstraße. Auf dem Verkaufstisch lagen nur ein paar Birnen.
Mama wollte doch nicht etwa Birnen für Nainai kaufen?
»Das Wort für ›Birnen‹ klingt wie das für ›verlassen‹«, hatte sie früher immer gesagt. »Diese Früchte eignen sich nicht als Geschenk. Deine Nainai könnte auf die Idee kommen, dass wir ihr mit den Birnen wünschen, sie möge bald die Welt verlassen.«
Als Mama ihre Hand ausstreckte, wie sie es immer auf dem Markt getan hatte, um die Qualität der Birnen zu ertasten, fuhr die boshafte Verkäuferin sie an: »Na, hallo, was glauben Sie denn, wer Sie sind, dass Sie die Birnen selbst aussuchen können?«
Mamas Gesicht lief bis zu den Ohren tiefrot an, als hätte man es in einen Färbebottich getunkt.
Nachher gingen wir still mit vier Birnen heimwärts, ich sagte keinen Mucks.
Auf dem Schulhof stießen Mama und ich unerwartet auf Papa. Er hielt ein Geschenk von seiner Firma in der Hand, sein allererstes.
»Zeig mal, Papa!«
Mamas Gesicht hellte sich auf Anhieb auf. Der Anstecker war fast so groß wie eine Nudelschale. Der Hintergrund leuchtete in tiefem Pfingstrosenrot und das Gesicht des Großen Vorsitzenden Mao glänzte davor golden. Papa zeigte mir, wie sich je nach Lichteinfall die hohen Silberwogen darunter veränderten.
»So ein Stück hat einen hohen Sammlerwert«, sagte Mama glücklich.
»Darf ich den Anstecker morgen tragen, Mama? Bitte?«
»Das ist aber Papas Auszeichnung, Yingying. Die Stadt hat Papa damit für den Bau der Yangzi-Brücke ausgezeichnet.«
Die Brücke interessierte mich nicht, was ich aber nicht zugab. »Papa, darf ich den Anstecker morgen tragen, nur dieses eine Mal, wenn wir zu Nainai fahren? Ich will ihn Nainai zeigen.«
»Mal sehen, Yingying, ob Mama ihn an deinem Kleid befestigen kann. Der Anstecker ist wirklich sehr groß.«
Zum Glück fand Mama heraus, wie sie mit der Sicherheitsnadel auf der Rückseite direkt durch meine zwei Unterhemden stechen musste, damit der schwere Anstecker mir die Bluse nicht bis zum Bauchnabel herunterzog und keine sichtbaren Löcher zurückblieben.
Ich legte meine Hand behutsam auf die glatte Oberfläche. Sie fühlte sich glitschig wie Aalhaut an. Die Rillen der Wogen kitzelten an den Fingerkuppen, als ob ich über einen feinen Kamm hinwegfahren würde. Ich war ein Glückspilz!
»Fahrt doch morgen mit dem Zug zu Nainai«, schlug Mama vor. »Ich habe gestern von einer Kollegin gehört, dass morgen die Fernzüge in unserem Bahnhof den Gegenverkehr abwarten. Da erwischt ihr bestimmt einen.«
»Ja, lass uns morgen mit dem Zug fahren, Papa!«, rief ich voller Freude aus.
»Nein«, lehnte Papa die Idee sofort ab: »Morgen nehmen wir auf der Hinfahrt die Fähre und den Bus. Auf dem Rückweg können wir aber mit dem Zug fahren.«
Ich war enttäuscht, denn ich mochte Fähren überhaupt nicht – außerdem musste man Hunderte von steilen Treppen steigen, um zu den Anlegeplätzen zu kommen. Und wenn wir mit dem Bus zu Nainai fuhren, mussten wir sogar zweimal die Fähre nehmen!
Plötzlich aber fragte Mama: »Dürfen die Busse denn jetzt die Yangzi-Brücke überqueren?«
Und Papa, der während einer Bauphase als Ingenieur herangezogen worden war, nickte stolz.
Ich glaubte ihm nicht. Die Brücke war schon lange fertig, wurde aber noch immer getestet. Warum sollte ausgerechnet dann ein Bus dort fahren, wenn wir den Zug nehmen wollten?
»Wir werden sicher mit dem Zug nach Hause fahren«, versprach Papa mir wenigstens.
Am nächsten Morgen sprang ich früh aus dem Bett. Ich fragte mich, wohin Papas Riesenanstecker verschwunden war. Wollte er doch nicht, dass ich damit zu Nainai fuhr? Mein Blick fiel auf die vier Birnen in Mamas Einkaufsnetz auf dem Tisch. Warum brachte man Nainai ein Geschenk, das ein schlechtes Omen bedeutete? Wir könnten sie selbst …
»Yingying, die Birnen sind nicht für uns. Die sind für Nainai«, hörte ich Mama hinter mir sagen.
Ich zog meine ausgestreckte Hand zurück.
Langsam wurde Mama ungeduldig. Sie fing an, Papa zur Eile anzutreiben. »Später sind die Fähren zu voll«, sagte sie und reichte mir zugleich meine Bluse mit dem Riesenanstecker daran.
Mama hatte Papa in Schwung gebracht, und ich freute mich, dass er mal nicht so langsam wie eine Schnecke war.
Als wir an der Tür standen, lachte Mama wie eine Sonnenblume. Sie drückte Papa das Birnennetz in die Hand und ermahnte uns: »Passt auf, dass die Birnen nicht zerdrückt werden.« Ich hielt es weiterhin für eine schlechte Idee, Nainai Birnen zu schenken. Warum sollten wir ihr wünschen, die Welt zu verlassen? Das war kein gutes Geschenk.
Bei der Fahrt musste ich mich voll und ganz auf meinen Anstecker konzentrieren. Es war sehr schwierig, mit so einem Riesenanstecker in den gerammelt vollen Bus und in die Fähre einzusteigen und wieder auszusteigen. Ich musste ihn die ganze Fahrt über festhalten und ununterbrochen mit den Fingern daran herumspielen.
Als wir uns der Brückenauffahrt näherten, war Papa mit einem Mal ganz aufgeregt. Es gab nichts anderes mehr auf der Welt als seine Brücke. Mich faszinierte mehr, dass ich Nainais Stelzenhaus von der Flussseite her sehen konnte.
Voller Begeisterung schrie ich: »Guck mal, Papa! Nainais Haus sieht aus wie eine große Eidechse, die auf dem Ufer liegt.« Vom Anblick bekam ich eine Gänsehaut. Die Bambusstangen wirkten zerbrechlich, und nur sie bewahrten Nainais Haus vor den messerscharfen Kanten der Klippen.
Gleich darauf forderte Papa mich auf: »Yingying, mach dich bereit. Wir steigen an der nächsten Haltestelle aus.«
Kaum hatte ich mich aus dem vollen Bus befreit, fragte Papa verwundert: »Wo ist denn dein Anstecker?«
Ich konnte es nicht fassen. Eben war er noch da gewesen! Ich heulte los, aber Papa tröstete mich nicht.
Er fuchtelte mit den Händen in der Luft herum und machte sich schreckliche Sorgen, seine Firma könnte herausfinden, dass er den Anstecker verloren hatte, und ihm das als feindlichen Akt gegen den Vorsitzenden Mao auslegen.
Papa hatte sonst immer das Temperament einer Schnecke, aber wenn er einmal in Fahrt kam, war es besser, den Mund zu halten. Erst kurz bevor wir Nainais Stelzenbeinhaus erreichten, hörte er auf zu schimpfen, und auch ich hatte mich wieder beruhigt.
Das Haus gehörte Nainai und war das schönste, das ich je gesehen hatte.
Mama aber machte es oft schlecht. »Alles hängt von diesem baufälligen Gestell ab«, sagte sie. Mama glaubte, dass wir ohne Nainais großes Haus mit den zehn Zimmern von Papas Firma schon längst eine geräumigere Wohnung zugeteilt bekommen hätten.
»So einfach ist es nicht«, entgegnete Papa ihr. »Privatbesitz ist durch die Revolution offiziell abgeschafft worden, und die Hausbesitzer sind enteignet worden. Nainais Haus ist eine Seltenheit, eine Perle im Sandhaufen.«
»Wird Nainai irgendwann auch durch die Revolution enteignet?«, fragte ich dazwischen.
Aber typisch Papa! Ab diesem Zeitpunkt erwähnte er in meiner Anwesenheit Nainais Haus nicht mehr, und wann immer ich ihn später darüber ausfragen wollte, bekam ich zu hören: »Yingying, frag den Erwachsenen kein Loch in den Bauch.« Und das, obwohl er früher genau das Gegenteil gesagt hatte: »Was ein Kind nicht versteht, muss es fragen, sonst lernt es nicht.« Und das sollte ich nun verstehen. Aber Mama verstand Papa auch oft nicht. »Dein Papa ist ein tiefer Brunnen, in dem alles, was schwer genug ist, bis auf den Grund hinabsinkt«, sagte sie. Allerdings war ich mir nicht ganz sicher, ob Mama dasselbe meinte wie ich.
Mama regte sich jedes Mal furchtbar auf, wenn sie das Gefühl bekam, dass wir nur wegen Nainai noch immer in unserer winzigen Einzimmerwohnung wohnten, die zur Primarschule Nummer zwei gehörte, an der sie unterrichtete: »Die alte Dame hat noch immer nicht kapiert, dass man mit Privatbesitz bloß ein durch das Netz geschlüpfter Fisch ist, der früher oder später auch darin zappeln wird. Und von wegen stattliches Haus mit zehn Zimmern!«, spottete Mama. Das sagte sie, weil Nainai allein die Zweizimmerwohnung im obersten Stockwerk ihres viergeschossigen Stelzenhauses bewohnte.
Nainai musste uns durch ihr Fenster gesehen haben, denn sie erwartete uns an der Tür. Was sie Papa zur Begrüßung sagte, verstand ich nicht. Hatte sie vielleicht die Birnen kommentiert?
Nainai lebte seit fast vierzig Jahren in Chongqing, aber »sie ist nie angekommen«, wie Mama behauptete. Sie sprach weiterhin Wuhan-Dialekt und unterhielt sich fast ausschließlich mit Papa und Onkel. Aber auch mit ihnen redete sie nicht viel.
Papa und ich stiegen in die Wohnung im vierten Stock hinauf, während Nainai sich in die ein Stockwerk tiefer gelegene Küche begab, um für uns Reisklöße zu holen.
In der Wohnung forderte Papa mich auf, die Birnen vorsichtig auf Nainais Esstisch zu legen. Er goss inzwischen dampfend heißes Wasser für mich aus der Thermosflasche in Nainais Emaillewaschbecken. Vor dem Essen sollte ich mir das tränenverschmierte Gesicht und die Hände waschen.
Während ich mir das Gesicht wusch, bemerkte ich auf Nainais Kommode ein mittelgroßes schwarz-weißes Bild, um das ein schwarzes Seidenband gebunden war. Das war mir noch nie aufgefallen.
»Ist das Großvater?«, fragte ich Papa.
»Mmh«, knurrte er etwas gequält.
Ich hätte ihn gern gefragt, ob das Foto schon immer auf der Kommode gestanden hatte.
Genau so eins hatte ich schon einmal bei Tiantian zu Hause gesehen. Tiantian wohnte in einer Siedlung außerhalb der Mauer der Schule Nummer zwei. Wir hatten uns vor dem Tor kennengelernt, wo sie mich gefragt hatte, ob ich mit ihr Federfußball spielen wolle. Ihr Hahn sei kürzlich geschlachtet worden, und ihre Mutter habe ihr aus den großen Hahnenfedern den Federfußball genäht. »Du darfst ihn mit mir ausprobieren!«, hatte sie vorgeschlagen. Dann hatte mich Tiantian in ihre Wohnung eingeladen, um mir noch schönere Hahnenfedern zu zeigen. An der Wand neben der Tür hatte ein großes Schwarz-Weiß-Bild gehangen. »Das ist ein Trauerfoto von meinem Großvater«, hatte sie gesagt, als ich fragte, und mir dann erzählt, dass ihr Vater jeden Tag einmal davor niederknie, damit der Großvater ihre Familie vom Himmel aus beschütze.
»Ist Großvater gestorben?«, fragte ich Papa.
Er reagierte nicht.
»Papa, ist das Großvaters Trauerfoto?«
»Nein, sag das bloß nicht, Yingying. Nainai wird sehr traurig, wenn sie das hört.«
»Lebt Großvater?«
»Yingying, du bist zu jung dafür.«
Da hörten wir Nainai die Treppe hochkommen. Papa beeilte sich, ihr dabei zu helfen, das Tablett auf den Tisch zu stellen. Er war sicher froh, nicht mehr weiter mit mir über den Tod von Großvater reden zu müssen.
Ich sollte mich neben Nainai setzen, die ihren Platz auf dem Bambussessel einnahm, Papa setzte sich uns gegenüber. Ich bemerkte, dass Nainais Sessel so hingestellt war, dass ihr Blick direkt auf das Foto fiel. Auch ich musste darauf gucken, obwohl ich das gar nicht wollte. Also schaute ich ein wenig seitwärts, während ich mein Ei und die zwei mit Sesam gefüllten Reisklöße herunterschlang.
Auf einmal standen Nainai Tränen in den schmalen Augen. In ihrem verworrenen Dialekt fing sie an, Papa zu schildern, dass sie geglaubt habe, der heftige Gewittersturm in der vergangenen Nacht würde sie mitsamt dem Haus auf den Yangzi hinunterblasen. Vor lauter Angst sei sie die ganze Nacht hindurch aufgeblieben.
Papa legte den Löffel, mit dem er die Reisklöße aß, zur Seite und umfasste Nainais feingliedrige Hände. »Ich werde nachher der Gemeinde-Parteisekretärin einen Besuch abstatten und ihr die Birnen als Geschenk überreichen.« Wenn er die Gemeinde um Hilfe ersuche, repariere diese bestimmt das beschädigte Dach des Hauses und ein Sturm könne ihm nichts mehr anhaben.
Warum wollte er ausgerechnet die Birnen, die wir Nainai gerade mitgebracht hatten, der Gemeinde-Parteisekretärin schenken? Was, wenn die verstand, dass Papa ihr wünschte, sie möge bald aus der Welt scheiden?
Erst als Papa sich mit den Birnen auf den Weg zur Gemeinde-Parteisekretärin machte, durfte ich zu Yang Lang spielen gehen. Der wohnte mit seiner Mutter zur Miete im untersten Geschoss, direkt über den Stelzen, und seine Mutter erlaubte uns, in der Wohnung Flugzeug zu spielen. Zusammen stiegen wir auf einen Hocker, stellten uns auf die Zehenspitzen und steckten die Köpfe zum Fenster hinaus. Von hier oben ließen wir unsere Papierflugzeuge in die braunen Fluten des Yangzi hinuntersegeln. Die zahlreichen Flugzeuge Chiang Kai-sheks, des Feindes des Vorsitzenden Mao, und der imperialistischen Japaner zerschellten an den scharfen Klippen. Anschließend schlug ich vor, im Treppenhaus Verstecken zu spielen. Yang Lang, der Trottel, jagte Hals über Kopf hinter mir die schwankende Wendeltreppe hinauf und hinunter, traute sich aber nie, bis zu Nainais Wohnung hinaufzusteigen. Ich konnte seine Furcht vor Nainai gut verstehen, ich verstand sie und ihren Dialekt ja auch nicht.
Seit ich von der Brücke aus Nainais Haus gesehen hatte, wünschte ich mir, den Balkon, der schief und wie an einem Faden in der Luft hing, zu erkunden. Ich würde frei im Wind flattern wie die an Bambusstangen unter dem Dachvorsprung zum Trocknen aufgehängte Wäsche.
Jetzt schlüpfte ich in Nainais Wohnung. Hier würde Yang Lang mich nie finden, und ich könnte allein auf den Balkon gehen, was mir keiner erlaubt hatte. Nainai war unten in der Küche. Einen besseren Zeitpunkt gab es nicht. Durch die verglaste Holztür sah es aus, als ob dicke Dunstschwaden in dem Balkonzimmer schwebten. Ich zögerte ein letztes Mal, als die Türklinke beim Hinunterdrücken Knackgeräusche von sich gab. Mein Herz pochte heftig.
Fürchtete Nainai, dass ihr Balkonzimmer über den Fluss wegfliegen würde, wenn es donnerte und stürmte? Wohnte sie deshalb lieber in dem Zimmer zur Straßenseite, auch wenn dort das Gerüst bei jedem Bus, der am Haus vorbeifuhr, erzitterte? Ich schlich zur Balkontür. Der Boden schwankte und quietschte so laut, als ob ich aus Versehen auf eine Maus getreten wäre. Mein Blick fiel auf einen Schrank, dessen Türen ein wenig offen standen. Ich traute meinen Augen nicht: Was für schöne Kleidungsstücke darin versteckt waren! Ich strich mit zitternden Fingern über den smaragdgrünen Samt einer Jacke, die mir zu groß vorkam für die schmalgliedrige Nainai. Und die Farbe! Ich hatte Nainai noch nie etwas anderes tragen sehen als Weiß und Schwarz. Ich streifte die Jacke vom Bügel, aber die zahlreichen Stoffknöpfe ließen sich nicht so ohne Weiteres öffnen, weshalb ich mich mit dem Kopf voran hineinzwängte.
In diesem Moment packten mich von hinten zwei Hände, sodass ich laut aufschrie.
Yang Lang war es, dieser Tölpel! Vor Wut hätte ich ihn am liebsten direkt in den Fluss hinuntergestoßen.
Jetzt hörten wir, wie Nainai mit winzigen Schritten, wie ein Käfer, die knarrende Treppe emporgestiegen kam. Stumm betrat sie das Zimmer. Ich versuchte abzuschätzen, ob sie sehr wütend auf uns war. Von ihren mit Schmetterlingen bestickten schwarzen Stoffschuhen schweifte mein Blick zur schwarz schimmernden Seidenhose und weiter hinauf zu ihrer weißen Bluse. Nainais finstere Miene wunderte mich nicht. Ihr Gesicht war so glatt wie das knitterfreie Leintuch auf ihrem Bett. Ihr Schweigen, das bedrohlich im Raum schwebte, flößte mir eine riesige Angst ein. Es war schließlich Yang Lang, der mich auf Zehenspitzen gehend aus dem Zimmer zog. Als wir hinter der Tür stehen blieben, hörten wir plötzlich, wie Nainai zu schluchzen begann. Am liebsten hätte ich den Kerl sofort auf den Kopf gehauen, aber stattdessen blieb ich vernünftig und folgte ihm zu seiner Wohnung. Dort bestand er darauf, dass er mir nur aus der Klemme hatte helfen wollen.
»Wie denn?«, brüllte ich ihn an.
Niemand dürfe das Balkonzimmer von Nainai betreten, erklärte er mir.
Ich glaubte ihm kein Wort. Woher wollte er das wissen? Nicht einmal ich wusste das.
Er schwor mir hoch und heilig, jeder im Stelzenhaus wisse das. Großvater sei aus dem Balkonzimmer verschwunden.
»Du lügst!«
»Wenn ich lüge, springe ich vom Fenster aus in den Fluss.«
Zum Glück war Papa schnell wieder da. Er sprach noch kurz mit Nainai, aber ich glaube nicht, dass sie ihm etwas von unserem Ausflug in das Balkonzimmer erzählt hat. Gut, dass sie nicht besonders gesprächig war.
Als Papa und ich uns verabschieden wollten, kam es zum üblichen Theater. Papa versuchte, Nainai einen Zehn-Yuan-Schein in die Hand zu drücken.
Sie wiederum versuchte, Papa davon abzuhalten: »Ich habe genug zum Leben«, sagte sie.
Papa beharrte: »Bitte nimm unsere gut gemeinte Geste an.«
Die beiden sahen aus, als würden sie ernsthaft miteinander streiten. Papa legte den Geldschein auf einen Schrank, damit Nainai nicht sofort darankam.
Kaum hatten Papa und ich das Haus verlassen, öffnete Nainai das Fenster und warf den Geldschein kurzerhand zu uns herunter. Wir ließen ihn liegen.
Auf dem Weg zum Bahnhof erklärte mir Papa: »Die Kindespietät ist eine alte chinesische Sitte. Konfuzius lehrte uns, dass Kinder sich für all die Mühen der Erziehung bei ihren Eltern bedanken sollen, indem sie ihnen gehorchen und ihnen so viel Liebe zurückschenken, wie sie von ihnen bekommen haben.«
Ich war noch nie Zug gefahren, und Papa freute sich, mir etwas Neues zeigen zu können. Er malte mir den ganzen Weg über die Freuden des Zugreisens aus: »Man erlebt unterwegs viel mit den anderen Reisenden. Ich habe oft tagelang mit Fremden Schach gespielt. Für Mama wäre so eine Zugfahrt bestimmt auch schön. Sie fände sicher jemanden, der sich mit ihr über einen Roman unterhält. Heute fahren wir zwar nicht so weit, aber auch wenn du nur ein oder zwei Stunden in einem Zug gesessen hast, kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn man die vollen vierzig Stunden bis in unsere Heimatstadt Wuhan fährt.«
Als wir am Bahnhof ankamen, verflog Papas gute Laune. »Es ist nicht einmal ein Fahrplan der vorbeifahrenden Züge ausgehängt«, brachte er lautstark seinen Ärger zum Ausdruck.
»Komm, Papa. Wir warten einfach.«
Nachdem wir eine Stunde gewartet hatten, fand Papa mit einem Mal, es reiche jetzt aber. Er wollte sich bei jemandem erkundigen, damit wir endlich entscheiden könnten, ob sich das weitere Warten überhaupt lohne. Und wir hatten Glück: Ziemlich bald kam ein Zug. Die Waggons waren halb leer.
»Papa, spielen wir jetzt Fingerknobeln?« Das war unser Lieblingsspiel, mit dem die Zeit wie im Fluge verging.
Der Zug traf im nächsten Bezirksbahnhof ein und kam mit einem Ruck zum Stillstand.
»Der hält hier höchstens zehn Minuten. Sobald wir den entgegenkommenden Zug abgewartet haben, fahren wir weiter«, sagte Papa. Er hob dabei nicht einmal den Blick von unseren Fingern.
Aber er täuschte sich. Der Zug blieb lange, sehr lange stehen, bevor er endlich weiterfuhr.
»Papa, wir fahren ja am Yangzi entlang!«, freute ich mich. »Darf ich jetzt eine Zeichnung vom Fluss machen?«
»Das ist eine gute Idee. Du kannst ein Bild für Nainai zeichnen, das wir ihr das nächste Mal mitbringen.«
Geschwind packte ich einen Papierbogen aus und die Stifte, die Papa für mich mitgenommen hatte. Für die Darstellung der Wellen versuchte ich, die gerillten Wogen auf Papas gestohlenem Anstecker als Vorlage zu nehmen. Die langweilige Landschaft außerhalb des Fensters blendete ich aus und fügte stattdessen einige bunte Hügel hinzu, die ich reichlich mit Gemüse und Obst bepflanzte. Das Kohletransportschiff auf dem Fluss verwandelte ich in ein Gemüsetransportschiff. Ich freute mich an der Vorstellung, wie Mama mitten in das Bild hineinspazierte, ohne Gemüsemarken in der Hand, denn die brauchte sie hier wirklich nicht. Hier konnte sie sich so viel Gemüse kaufen, wie sie wollte.
Papa wachte aus seinem Nickerchen auf und fragte mich, mit dem Finger auf mein Bild deutend: »Yingying, was soll denn das sein?«
»Guck mal«, geduldig versuchte ich, ihm alles zu erklären, »sieht das Flussufer nicht genauso idyllisch aus wie in den alten Gedichten, die du mir so oft vorgetragen hast?«
Aber Papa verstand nicht: »Dein Bild zeigt überhaupt nicht das, was du wirklich siehst.« Das schien ihn enorm zu stören.
Ich war enttäuscht, denn es war schließlich seine Idee gewesen, dass ich Nainai ein Bild zeichne. Viele Sitznachbarn hatten mir dabei zugesehen und mich überschwänglich gelobt. Jetzt hielten sie trotz Papas Kritik weiter zu mir. »Das Bild vermittelt viel Behaglichkeit«, sagten sie.
Allein wurde es mir allmählich langweilig zu Hause. Als ich mich nach einem Stift und Papier umschaute, weil ich malen wollte, sah ich mein Bild noch immer an seinem Platz auf dem Schreibtisch liegen. Papa war oft vergesslich. Oder hatte er es etwa heute Morgen absichtlich zu Hause liegen lassen, weil ihm nicht gefiel, dass mein Yangzi nicht so langweilig wie ein vergilbtes altes Foto aussah?
Irgendwann kam Mama nach Hause, aber allein.
»Was machst du da, Yingying?«
»Ich male Nainais Stelzenbeinhaus. Ihr habt heute vergessen, mein Yangzi-Bild für Nainai mitzunehmen. Warum ist Papa nicht mit dir zurückgekommen, Mama?«
»Papa kommt nächste Woche nach Hause. Er ist mit Nainai zusammen weggefahren.«
»Hat denn ein Sturm Nainais Haus weggeblasen?«
»Nein, das nicht. Nainai ist nur weggefahren.«
»Wohin denn?«
»Weit weg.«
»Ist sie zu Tante Yun gefahren?«
»Hm.«
»Gehen wir sie besuchen?«
»Nicht jetzt.«
»Wann kommt sie zurück?«
»Das weiß ich nicht. Und jetzt ist Schluss, Yingying. Du hast genug gefragt, geh spielen. Ich rufe dich, wenn ich mit dem Abendessen fertig bin.«
Ich war mir ganz sicher, dass Nainai bald zurückkehren wurde.
KAPITEL 2
Die Lücke, die Nainais Reise hinterließ, wurde von Großmama gefüllt. Großmama war die echte Mutter meiner Mama. Sie war eine Bäuerin, die morgens mit dem Krähen des Hahns aufstand und abends mit den Hühnern ins Bett ging. »Das machen wir Landmenschen so«, sagte sie.
Großmama war schon vorher mehrmals zu uns gezogen, hatte aber jedes Mal am Schluss aufs Land zurückgemusst, weil sie keine Wohnberechtigung in der Stadt hatte. Ihr längster Aufenthalt bei uns war der Sommer, in dem ich mit der Schule anfing.
Als ich eines Tages vom Spielen nach Hause kam, saß Großmama unter dem Banyanbaum vor unserer Tür. »Ich bin extra wegen deines ›fa mao‹ gekommen«, erklärte sie mir – dem »ersten Haarwuchstag«, so nannten wir in Chongqing den ersten Schultag.
Na ja, ich fand bald heraus, dass Großmama auch wegen Mamas Schwangerschaft gekommen war.
Es gebe noch zwei wichtige Aufgaben in ihrem Leben, sagte Großmama oft. Erstens würde sie alles für mich tun, und zweitens erwarte sie einen Enkel von Mama.
Das war eben der große Unterschied zwischen Großmama und Nainai. Bei Nainai, die ich bisher viel öfter besucht hatte, konnte ich nicht sagen, was sie sich wünschte. Nainai kam mir vor wie Nebel, Großmama hingegen so klar wie Wasser. Verschieden wie Himmel und Erde waren Nainai und Großmama.
An sich war der erste Schultag weder für mich noch für Papa und Mama ein großes Thema. Weil Mama selbst an der Schule unterrichtete, wusste ich schon lange, wie eine Schulantrittsfeier ablief. Großmama erzählte, schon mein Großvater habe früher solche Feiern veranstaltet.
»War das auf der Dreschtenne?«, fragte ich. Mir gefiel die Vorstellung, dass die Schüler zwischen den Feldern um meinen Großvater versammelt saßen.
Mama blickte gereizt zu uns herüber. Alles, was Großvaters einstige Tätigkeit als Dorflehrer betraf, erwähnte man in unserer Familie am besten gar nicht.
Papa erklärte mir später, mein Großvater habe als Dorflehrer nicht zum Proletariat, sondern zur Ausbeuterklasse gehört. Das habe auch für Mama gegolten. Mehr wollte er aber absolut nicht herausrücken. »Du bist zu jung, Yingying, dich für solche Dinge zu interessieren«, sagte er bloß.
»Großvater hat also bestimmt keine Schulwohnung zugewiesen bekommen«, stellte ich fest. Im Gegensatz zu Großvater, der sein Haus selbst hatte bauen müssen, wohnten wir in Mamas Schulwohnung, seit ich mich erinnern konnte. Der Schulhof war immer mein Spielplatz gewesen. Bis hinauf zu dem kleinen Hügel hinter dem Teich, über den verstreut viele wilde Gräber lagen, gab es auf dem Schulareal keinen Winkel, den ich nicht schon erkundet hatte. Auch deshalb übte mein erster Schultag keinen besonderen Reiz auf mich aus.
Großmama wohnte bereits drei Wochen bei uns, und es war seit Tagen über vierzig Grad heiß. Großmama und ich waren damit beschäftigt, den Vorplatz vor unserer Wohnung zu besprengen, wo wir unter dem Banyanbaum zu Abend aßen. Der Platz kühlte auch in der Abenddämmerung nicht ab, wenn wir ihn nicht rechtzeitig nass machten. Großmama brachte mir bei, wie man mit dem Schlauch den Boden so behutsam besprühte, dass das Wasser in der Hitze nicht gleich wieder verdampfte.
Ich hatte gerade entdeckt, welchen Spaß es machte, an einem brütenden Hitzetag mit einem Wasserschlauch herumzuspritzen, als Frau Zhang, meine künftige Lehrerin, aus ihrer Wohnung zu uns herüberkam und mir mitteilte, dass ich bei der Eröffnungsfeier an meinem ersten Schultag vom Podium aus eine Rede an alle Erstklässler halten dürfe.
Großmama konnte ihren Stolz kaum verbergen. Wie eine Henne, die gerade ein Ei gelegt hat, streckte sie ihren Busen heraus. »Komm, wir hören mit dem Wasser auf«, erklärte sie. »Geh rasch zu Papa und bitte ihn, eine Rede für dich zu schreiben. Das ist jetzt viel wichtiger.«
In den folgenden Tagen schärfte sie mir unablässig ein: »Du musst deine Aufgabe besonders ernst nehmen, damit du Mama nicht vor ihren Kolleginnen blamierst.«
Wichtiger als die Rede war mir meine erste Schultasche. Mama hatte mich schon nach meiner Schulanmeldung gefragt, ob ich mir eine mit Mao-Porträt oder eine mit dem Spruch »Dem Volke dienen« wünschte. Ich musste damals nicht lange überlegen: Ich wollte am liebsten beides, das Porträt auf der Lasche und den Spruch auf der Tasche. Irgendwann zeigte sie mir eine langweilige, reizlose Tasche, auf der weder ein Porträt noch der Spruch Maos war. Mama behauptete, die Taschen mit Porträt oder Spruch würden derzeit nicht mehr geliefert, weil die dafür gebrauchte Druckfarbe für höhere Zwecke benötigt würde.
Ich schaute ihr argwöhnisch in die Augen, denn ich verdächtigte sie, dass sie nur Geld sparen wollte, um davon auf dem Schwarzmarkt Lebensmittelbezugsscheine für Großmama zu kaufen. Dass sie das tat, wusste außer ihrer besten Freundin Frau Zhang bestimmt niemand.
Ich hatte es auch nur zufällig herausgefunden, als ich Mama eines Abends bei Frau Zhang abgeholt hatte, bei der sie sich gerade darüber beschwerte, wie viel Geld sie brauche, um die zusehends schwieriger zu beschaffenden Reismarken für Großmama auf dem Schwarzmarkt bezahlen zu können. Als ich sie später zu Hause darüber auszufragen begann, setzte sie eine ernste Miene auf. In ihrem strengen Lehrerinnenton ermahnte sie mich, das für mich zu behalten. Es handele sich um eine ernste Erwachsenenangelegenheit. Wenn ich es ausplauderte, würde ich damit Großmama kränken.
Ich wollte mich jedenfalls nicht damit zufriedengeben, dass die militärgrüne Schultasche weder ein Porträt noch einen Schriftzug des Großen Vorsitzenden trug und brach in Tränen aus. Ich hatte Papa und Großmama auf meiner Seite, und schließlich gab Mama nach und versprach, mir mit rotem Faden den Schriftzug »Dem Volke dienen« auf die Tasche zu sticken.
Am nächsten Abend beklagte Mama sich darüber, wie dürftig im Laden die Auswahl an farbiger Seide geworden sei und wie teuer die Tasche sie wegen der Stickerei zu stehen komme. Sie werde am Ende mehr kosten als eine mit Aufdruck!
Eine Woche später hatte sie die Stickerei endlich fertig, aber statt Seidenfaden hatte sie grobes Baumwollgarn verwendet. Außerdem waren die gestickten Schriftzeichen winzig. Niemand aus unserem Viertel ging mit etwas Derartigem zur Schule. Das schrie ich Mama ins Gesicht.
Doch auch Mama hielt sich nicht länger zurück: »Was für ein verwöhntes Einzelkind du doch bist! Was habe ich bloß falsch gemacht mit dir?«
Ich aber bestand darauf, an meinem ersten Schultag die alte Schultasche von Papa in die Schule zu tragen. Sie sah verwaschen aus und war nicht richtig militärgrün, sondern eher braun, aber dafür waren das Mao-Porträt und der Spruch »Dem Volke dienen« unübersehbar.
Nach kurzem Zögern gab Mama nach.
Schon Mamas Schuljahr hatte an einem 1. September begonnen. Das sei eine alte Tradition, sagte sie.
Als ich mich an dem Morgen mit der viel zu großen Tasche und einer darin klappernden Schachtel mit Stiften unserem Klassenzimmer näherte, wimmelte es vor der Tür schon von Schülern. Frau Zhang kam nach dem zweiten Klingeln mit einem Schlüsselbund in der Hand. Sie hatte ihr Lehrerinnengesicht aufgesetzt, und wir mussten uns nach Jungen und Mädchen getrennt und nach Größe geordnet in Zweierreihen aufstellen. In der Klasse setzten wir uns der Größe nach in die Bänke, die Kleinsten zuvorderst.
Als Erstes lernten wir zu gehorchen. Solange wir im Unterricht saßen, sollten unsere Blicke auf die Lehrerin gerichtet sein. Dann zählte Frau Zhang weitere Verhaltensregeln im Schulzimmer auf, Punkt für Punkt. Plötzlich hörte ich meinen vollständigen Namen: Huang Xuanying. Diesen Namen hörte ich sonst fast nie, denn alle nannten mich bei meinen Kosenamen Yingying oder Yingzi. Ich sollte aufstehen. Sie erklärte, wann immer sie einen von uns beim Namen rufe, solle der Betreffende auf der Stelle »stramm wie eine Tanne« aufstehen. »Stramm wie eine Tanne« wiederholte sie und streckte ihren Rücken. In Chongqing hatte ich allerdings noch nie eine Tanne gesehen. Papa erklärte mir später, dass bei uns in Chongqing keine Tannen wüchsen. Dann bestimmte sie zu meiner großen Verblüffung mich zur Klassensprecherin. Endlich durfte ich mich wieder setzen. Und wen erblickte ich da aus den Augenwinkeln? Es war Großmama! Zusammen mit zahlreichen älteren Geschwistern, Großeltern und Müttern meiner Mitschüler stand sie vor dem Fenster.
Frau Zhang kam endlich auf die letzten zwei wichtigen Punkte zu sprechen: Am Nachmittag müssten wir unser Schulgeld in die Schule mitbringen. Unsere Eltern sollten selbst einschätzen, ob sie es sich leisten könnten, die fünf Yuan zu bezahlen. Bei bedürftigen Familien reichten auch drei Yuan. Und zum Schluss schärfte sie uns ein, dass die Eröffnungsfeier pünktlich um ein Uhr auf dem Schulhof stattfinde. Jeder von uns müsse unbedingt rechtzeitig in weißem Hemd und blauer Hose dort erscheinen.
Ich hob die Hand und fragte, ob ich dann meine Rede halten würde.
Frau Zhang lächelte zum ersten Mal und sagte nur: »Selbstverständlich.«
Auf dem Heimweg war Großmama ganz aus dem Häuschen vor Aufregung und begann, an den Fingern abzuzählen, wie wenige Stunden uns blieben, bis ich meine Rede halten müsse, aber gemeinsam würden wir das schon schaffen.
Um halb elf setzte sie mir das Mittagessen vor, ein Schälchen Nudeln mit einem gekochten Ei. Das Ei ließ sie über den Tisch rollen, um mir zu zeigen, wie rund und reibungslos die Rede verlaufen würde. Großmama bereitete sonst Eier nur als Rührei oder gedämpft zu, weil dann ein Ei nach der zwei- oder dreifachen Menge aussah.
»Iss schnell, Yingying, damit wir genügend Zeit haben für die Probe.«
Nach dem Essen wusch sie mir sorgfältig das Gesicht. Während sie das Geschirr abräumte, musste ich mich kurz aufs Bett legen und ein Weilchen die Augen schließen.
Dann putzte sie mich richtig heraus. Mit einem nassen Tuch feuchtete sie zuerst mein Haar an, das sie als Nächstes gründlich mit ihrem altmodischen Kamm aus Rinderhorn kämmte, bevor sie es zu zwei hübschen Zöpfen flocht und die weiße Bluse holte, die Mama mir für die Feier genäht hatte.
Ich war gespannt, ob die Reissuppe wirklich gewirkt hatte. Großmama hatte meine Bluse zweimal darin getränkt, damit sie glatt und schön aussah. In den Rest der Suppe hatte sie ihre eigene weiße Bluse getaucht, die sie heute eigens wegen mir anziehen würde.
Die Reissuppe bestand aus den Reisresten des Vortags, und normalerweise hätte Großmama sie als Zwischenmahlzeit aufgespart. Am Nachmittag hätten wir sie zusammen mit einem Tellerchen eingemachtem Ingwer unter dem Banyanbaum gegessen. Wir liebten die dickflüssige Suppe, die mit dem würzig-scharfen Ingwer einfach lecker schmeckte. Wir passten immer sehr auf, dass Papa uns nicht sah, sonst verzog er das Gesicht und meinte, es lohne sich doch nicht, die paar Reiskörnchen in so viel Wasser zu schlürfen, obwohl er genau wusste, dass Großmama keine Reisbezugsscheine bekam, weil sie keine Berechtigung hatte, in der Stadt zu wohnen. Aber niemals hätte er Großmama als den »schwarzen Mund« unserer Familie bezeichnet, wie unser Nachbar es tat, und mit »schwarz« meinte er »illegal«. Dabei aß sie nur die Reissuppe auf, die wir sonst in die Latrine geschüttet hätten, und aß daher auch kein »schwarzes Getreide«, wie man die illegalen Esser oft beschuldigte. Beim Abendessen schob sie sich auch nur ein paar Stäbchen von dem Klebereis in den Mund. Dann behauptete sie immer: »Ich bin schon alt und brauche nicht mehr so viel wie du. Ich muss schließlich nicht mehr wachsen.«
Diesmal aber hatte sie ihre Reissuppe für meine Bluse aufgespart.
»Yingying!«, rief Großmama mich zu sich. Sie trug die brandneue Bluse, glänzend und steif, auf den Händen vor sich her. »Nun darfst du sie anziehen.«
»Soll ich mein Unterhemd ausziehen?« Ich wollte die schöne weiße Bluse direkt auf meiner Haut tragen.
»Nein, das geht nicht. Der Stoff wurde zweimal in Reissuppe getunkt und ist so hart, dass er deiner zarten Haut wehtun würde. Beeil dich jetzt, Yingying.«
Dann holte Großmama den Redetext, den Papa und Mama für mich geschrieben hatten, aus der Schreibtischschublade.