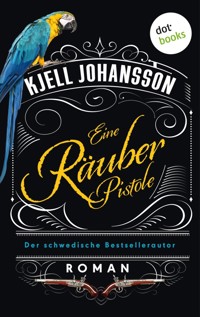
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für alle Fans von Käpt'n Blaubär und Jack Sparrow: "Eine Räuberpistole" vom schwedischen Bestsellerautor Kjell Johansson jetzt als eBook bei dotbooks. Gerade noch schläft Kapitän Efraim Schwarzbart selig seinen Brandyrausch aus – schon weckt ihn ein spitzer Schrei. So kommt es, dass er auf hoher See ein Mädchen namens Maria aus den tosenden Wellen rettet. Ob das die beste Idee des Schreckens der sieben Weltmeere und König aller Hafenkneipen war? Denn ein Weibsbild, und sei es noch so winzig, hat an Bord eines Piratenschiffs nun wirklich nichts zu suchen … Verrückt, vogelwild und immer wieder überraschend: Eine höchst ungewöhnliche Freibeuterposse, die so schwungvoll erzählt wird, dass zartbesaitete Gemüter womöglich seekrank werden! "Ein Ausbund an freiem Fabulieren, wie man es in der Erwachsenenliteratur nur selten findet. Unwiderstehlich lustig und mitreißend. Es ist eine Befreiung, Kjell Johansson zu lesen." Svenska Dagbladet, eine der größten Tageszeitungen Schwedens Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Eine Räuberpistole" von Kjell Johansson. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Gerade noch schläft Kapitän Efraim Schwarzbart selig seinen Brandyrausch aus – schon weckt ihn ein spitzer Schrei. So kommt es, dass er auf hoher See ein Mädchen namens Maria aus den tosenden Wellen rettet. Ob das die beste Idee des Schreckens der sieben Weltmeere und König aller Hafenkneipen war? Denn ein Weibsbild, und sei es noch so winzig, hat an Bord eines Piratenschiffs nun wirklich nichts zu suchen …
Verrückt, vogelwild und immer wieder überraschend: Eine höchst ungewöhnliche Freibeuterposse, die so schwungvoll erzählt wird, dass zartbesaitete Gemüter womöglich seekrank werden!
Über den Autor:
Kjell Johansson, geboren 1941, gilt als einer der wichtigsten schwedischen Autoren der Gegenwart. Nach dem Studium der Philosophie veröffentlichte er 1973 seinen ersten Roman, dem viele weitere – häufig preisgekrönte – folgen sollten.
Bei dotbooks erschienen bereits seine Romane Der Geschichtenmacher und Die Traumseglerin.
***
Neuausgabe Januar 2018
Die schwedische Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel En Rövarhistoria bei Norstedts Förlag, Stockholm.
Copyright © 2000 by Kjell Johansson
Copyright © der deutsprachigen Erstausgabe 2002 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Bildmotivs von shutterstock/Eric Iselee, shutterstock/ivangal und shutterstock/Stepan Bormotov.
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-065-4
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Räuberpistole an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Kjell Johansson
Eine Räuberpistole
Roman
Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann
dotbooks.
Kapitel 1 EINE WUNDERBARE RETTUNG
Das ganze Meer tobt. Ein schwarzes Schiff mit roten Segeln bahnt sich einen Weg durch die Wogen. Und sieh doch, da balanciert einer auf der Reling! O weh und ach, jetzt fällt er ins Wasser … An dem Kerl muss guter Treibspeck sein, denn untergehen tut er nicht. Was macht er denn? Er schläft, kaum traut man seinen Augen.
Das ganze Meer tobt noch schlimmer. Was ist denn das, was da auf den siebenunddreißig Meter hohen Wellen angeschaukelt kommt, ein Korb oder eine Wiege oder was? Und darin ein kleines Mädchen, das verzweifelt versucht, sich festzuklammern. Wie lange wird es sich noch festhalten können? Das kann ich leicht sagen: Sicher nicht lange. Schon verliert es den Halt, schon wird es aus seinem kleinen Bötchen geworfen.
Alles hat einen Sinn, das Schreien des Mädchens weckt zwar nicht den schlafenden Mann, aber es schnitzt ein schönes Lächeln in sein Gesicht, denn er liebt von hochbusigen Primadonnen vorgetragene Opernarien, und das Schreien lässt ihn die Arme ausstrecken, um eine ebensolche Primadonna zu umarmen. Doch zwischen den Pranken hat er stattdessen etwas Kleines und Nasses und Mageres, ein kleines Mädchen, wenn’s hochkommt, ein Jahr alt.
Der Mann ist kein anderer als Kapitän Efraim Schwarzbart, der, beduselt vom Brandy und gewiegt von den Wellen der Nordsee, so schön eingeschlummert war. Und das Mädchen heißt Maria, zumindest steht das auf dem Zettel, der an seinem Hemd festgemacht ist. Und als das Mädchen das bärtige und pockennarbige Gesicht sieht, das Schwarzbart gehört, stößt es einen neuerlichen Schrei aus, und dieses Mal so laut, dass es Schwarzbart weckt und zum Glück auch die Mannschaft auf dem Schiff Die Hoffnung.
Kapitän Schwarzbart bekommt ein Tau mit einem Palstek um den Bauch und mit dem Mädchen in der Faust wird der mächtige Seebär an Bord gewinscht. Schwarzbart ist ein gutes Stück über zwei Meter groß und hat ein Idealgewicht von einhundertfünfundsiebzig Kilo, er ist also nicht irgendein Bär, er ist ein Mythos, er ist der Herrscher der Meere und der König der Hafenkneipen.
An der Reling steht Oskar Seatwig, Pastor in Hamburg, der von seinem Freund, dem Kapitän, eine Mitreisegelegenheit von Stockholm her erhalten hat, nachdem er der Abteilung Lebenswandel der Seemannspfarrer im Ethischen Rat, die sich mit dem Wandel des Seemannpastors als solchem beschäftigt, Rede und Antwort gestanden hat. Als er sieht, wie Efraim an Bord gehievt wird, durchnässt, aber lebendig, bricht er natürlich in Danksagungen und Gebete aus. Herrlich ist der Erdkreis.
Die Hoffnung rollt heftig in den Wogen und der Rumpf des Schiffes knarrt und kracht beunruhigend. Der Sturm reißt an allen Segeln, und das sind viele: Rahsegel, Gaffelsegel, Stagsegel, Lateinersegel, Guntersegel, Bermudasegel in einer einzigen herrlichen Mischung. Die Dieselmotoren dröhnen und die Dampfmotoren, ohne die sich die Hoffnung nicht S/S nennen könnte, stampfen gewaltsam, doch es besteht keine Gefahr, dass sie in einem Sturm in der Nordsee Schiffbruch erleiden könnte, sie ist ein sehr außergewöhnliches Schiff.
Mit ihrem Schrei hat Maria das Leben von Kapitän Schwarzbart gerettet und damit ihr eigenes. Ihre Zeit war noch nicht abgelaufen und wie hätte das auch ausgesehen? Wenn sie auch keine Hauptperson ist – so etwas leisten sich die Räuberpistolen des zwanzigsten Jahrhunderts nicht –, so ist sie doch eine VIP, eine sehr wichtige Person in diesem Abenteuer hier. Davon gibt es allerdings noch mehr, Schwarzbart und Seatwig zum Beispiel. Und in den Kulissen stehen schon Leffe Carlsson und Mutter Mama und Schnaub und andere bereit und treten ungeduldig von einem Fuß auf den anderen.
Maria erwachte am nächsten Morgen im Laderaum der Hoffnung von einem kratzenden Geräusch. Dort oben wurde die Luke geöffnet und viele Menschen drängten sich dicht an das Schott, die Gesichter erwartungsvoll zum Himmel gewandt. Das waren die blinden Passagiere. Kapitän Schwarzbart drückte ein Auge zu, wenn sich solch einer in irgendeinem Hafen an Bord schlich. Selbst einmal blinder Passagier gewesen, zeigte er Mitgefühl für diese Filous, und das ging sogar so weit, dass sie die Reise nicht einmal abarbeiten mussten. Einem Teil der blinden Passagiere gefiel es so gut auf der Hoffnung, dass sie dort geblieben waren und eine kleine Kolonie gegründet hatten. Hierher also hatte das Schicksal die kleine Maria verschlagen und hier sollte sie auch sechs lange Jahre verbringen.
»Fresst!«
Zwiebeln und Steckrüben wurden hinuntergeschmissen und die blinden Passagiere stürzten sich nach vorn, fluchten und fauchten und schlugen sich um das Essen. Der Streit wurde von donnernden Lachsalven der Besatzungsleute auf Deck begleitet.
Die Kost auf der Hoffnung war ein wenig einseitig, doch der Grund dafür war nicht Geiz, sondern Menschenliebe. Kapitän Schwarzbart liebte Zwiebeln und Steckrüben, ja, er aß im Grunde nichts anderes. Und als guter Mensch, der er zu sein glaubte, wollte er seinen Mitmenschen dieselben Köstlichkeiten schenken. Dass jemand mit einer solchen Diät überleben konnte, dünkt unwahrscheinlich, und der Kapitän pflegte seine Kost denn auch mit Brandy zu strecken. Die blinden Passagiere wiederum überlebten, weil sie Schwalbennester, Nüsse, Bohnen, Reis, Rucolasalat und anderes aus der Ladung stahlen.
Aber Maria, noch nicht einmal ein Jahr alt, wie konnte sie nur überleben? Tagsüber hielt sie sich in ihrem Loch versteckt, doch nachts kroch sie hinaus und ging auf die Jagd nach Essen und Wasser. Sie konnte in der Nacht sehen wie eine Katze, doch sie hörte schlechter als ein Seetaucher, war fast taub, und deshalb geschah es eines Nachts, dass ein alter Kerl sie einfing. Er begutachtete sie, vor allem das Haar, und dann spuckte er darauf und fing an, seine Füße damit zu schrubben. Das ist die Erklärung: Als Putzlumpen konnte Maria überleben. Der alte Kerl und bald auch die anderen blinden Passagiere fanden Marias Haar so putzig, dass sie darauf achteten, sie am Leben zu erhalten. Oh, wie sehr sie ihr weiches, lockiges Haar liebten, dessen Eigenschaften denen eines modernen Zauberlappens in nichts nachstanden. Sie benutzten das Haar als Waschlappen, aber auch als Staubtuch, Putzlappen oder Feudel, und manche nahmen es als Schmusetuch.
Manchmal schlichen sich die blinden Passagiere auf Deck, um mal eine andere Umgebung zu sehen. Doch das konnte sie teuer zu stehen kommen, denn die Besatzung bestand aus einer Horde außerordentlich rauer Gesellen, und sahen die einen blinden Passagier, so wurde der ohne Pardon ins Wasser geworfen. Die Männer von der Besatzung hatten sogar einen Sport daraus gemacht, wer einen blinden Passagier am weitesten werfen könnte.
Für die, die in der Dunkelheit leben, zum Beispiel im Laderaum eines Schiffes, ist das kleinste Licht eine Freude und ein sternklarer Himmel ein großer Feiertag. An warmen Abenden in südlichen Breiten kam es vor, dass Kapitän Schwarzbart die Luke öffnen ließ, damit die blinden Passagiere etwas kühle Luft bekamen. Da vergaßen sie allen Groll und versammelten sich in der Mitte des Laderaums, standen andächtig da und sahen zum sternübersäten Mittelmeerhimmel hinauf. Und wenn der Kapitän gut aufgelegt war, dann konnten sie auch an der Poesie irgendeines Seemannsliedes teilhaben, das der Kapitän mit seiner mächtigen Stimme vortrug:
Ein Seemann hatte eine Frau, Kuddeldidu und kuddeldidau, Sie wohnte in Qinhuang-dao, Kuddeldidu und kuddeldidau, Sie kuddelten mit den Tauen, schau, Kuddeldidu, schau, schau!
Da war das Leben schön, da war es eine Freude, auf der Welt zu sein. Einige zehrten lange von diesem Moment, doch andere, und zu ihnen gehörte Maria, empfanden hinterher eine solche Wehmut, dass sie sich fragten, ob das den kurzen Moment des Glücks, den sie erlebt hatten, wert war.
Manchmal wurde die Luke auch geöffnet, wenn Oskar Seatwig zu Besuch kam, so dass dieser Diener der Kirche eine kurze Andacht halten konnte. Das geschah, wenn die Hoffnung Hamburg anlief, aber auch auf See bei einer der nicht seltenen Gelegenheiten, wenn Seatwig sich an Bord befand, auf dem Weg nach Schweden, wo er der Abteilung Lebenswandel der Seemannspfarrer im Ethischen Rat Rede und Antwort stehen sollte. Vielleicht waren es seine kleinen Fehltritte, die bewirkten, dass die Chemie zwischen ihm und Schwarzbart so gut stimmte. Ansonsten waren sie ein ungleiches Paar, der riesige Kapitän, der aussah, als könnte er einen erwachsenen Mann mit einem Haps verschlingen, und der kleine magere Pastor, der so fromm wirkte, dass jeder, sofern er ihn überhaupt bemerkte, sogleich dachte: Das ist ein Mensch, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann.
Wenn die Luken geöffnet waren, gab Oskar Seatwig einige kurze Bonmots aus der Bibel von sich, und dann war es Zeit für das Psalmsingen. Das trieb Käpt’n Schwarzbart jedes Mal die Tränen in die Augen, und danach mussten fröhlichere Tonarten her und der Kapitän stimmte »Wenn die Temperatur im Körper steigt« an, und dann schaukelte bald das ganze Schiff. Der Kapitän, Seatwig, die Besatzung und auch die blinden Passagiere sangen, dass die Gaumensegel flatterten. Je kraftvoller Letztere einfielen, desto zufriedener wurde der Kapitän und desto länger blieb die Luke offen. Sogar für Maria, die schlecht hörte, war es ein ohrenbetäubender Klang. Und die blinden Passagiere hakten sich beieinander ein und schunkelten im Takt des Refrains.
»Noch einmal! Wir rollen, wir rollen …«
Während sie singen, will ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen, was die Personen angeht, einen kleinen Hintergrund zu verschaffen. Marias Geschichte ist schnell erzählt, Vater wie Mutter unbekannt. Zurückgelassen, ausgesetzt in einem morschen Boot, wir wollen mal hoffen, nicht zum Sterben, sondern um gefunden und versorgt zu werden.
Über ihren Retter Kapitän Efraim Schwarzbart gibt es mehr zu erzählen und einiges davon dürfte sogar wahr sein. Er wurde am Strandvägen in Stockholm als Sohn reicher, aber ehrwürdiger Eltern geboren. Der Vater war Kapitän zur See und schwadronierte gern über seine gefahrvollen Abenteuer auf den sieben Weltmeeren, und je mehr er log, desto größer wurde Efraims Wunsch, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Aber ach, in einem Sturm vor Sumatra ging das Schiff des Vaters mit Mann und Maus unter. Das war das erste Unglück. Das andere war, dass ein gewisser Rechtsanwalt Svintrinius, der seine Kanzlei eine Tür weiter hatte, sich anbot, das Inventar der Familie zu verwalten. Wie auch immer, als Ergebnis war von dem ansehnlichen Vermögen plötzlich nichts mehr übrig. Die Witwe und der Sohn waren gezwungen, aus der großen Wohnung am Strandvägen in eine Einzimmerwohnung am Lövholmsvägen im Vorort Gröndahl zu ziehen. Den Traum, einmal Kapitän zur See zu werden, hielt Efraim aber dennoch lebendig, indem er Flöße baute, mit denen er sich am Ufer des Sees Trekanten entlangstocherte. Das war kein großer See, im Gegenteil. Wenn wir einmal das Gedankenexperiment unternehmen, dass die S/S Hoffnung aus irgendeinem unerfindlichen Grunde dort gelandet wäre, dann hätte sie innerhalb von zehn Sekunden von der einen Seite zur anderen fahren können.
Efraim dehnte seine Flößerstündchen bald auf die Insel aus, die in dem See lag und die Räuberinsel genannt wurde. Da geschah noch ein Unglück, Efraim verlor nämlich sein rechtes Bein. Doch der Junge war hart im Nehmen, er biss die Zähne zusammen und ging weiter – auf der Prothese, die er im Krankenhaus bekam, und später auf dem Holzbein, das er im Werkunterricht schnitzte.
Als die Mutter starb, schlich sich der dreizehnjährige Efraim am Stadsgården an Bord der M/S Montezuma. Er wurde entdeckt, doch der Kapitän ließ den blinden Passagier seine Reise durch Schiffsjungendienste abbezahlen. Der erste Schritt zum Kapitänspatent war getan.
Es vergingen einige Jahre, Maria wuchs, aber das war mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Sie war immer noch so klein und dünn, dass sie sich ohne Schwierigkeiten in ihr Loch zwängen konnte, und da hielt sie sich die meiste Zeit auf. Sie war es leid, ein Putzlumpen zu sein, und sie dachte darüber nach, wie sie ihre Haare loswerden könnte. Sie abzuwetzen war nicht möglich, sie musste sich eine Schere beschaffen.
Sie lagen in Göteborg und sollten endlich die Ladung Fischmehl löschen, die ihnen mit ihrem widerwärtigen Gestank das Dasein verpestet hatte. Außerdem nahm das Fischmehl fast den gesamten Laderaum ein, so dass die blinden Passagiere gezwungen waren, sich in dem kleinen Raum, der noch zwischen Ladung und Decksplanken übrig war, zusammenzudrängen. Doch jetzt gruben die großen Baggerschaufeln tiefe Löcher in den Mehlberg. Der Gestank würde dem Laderaum zwar noch lange anhaften und die guten Düfte daran hindern durchzudringen, aber es würde wenigstens mehr Platz geben.
Jetzt kam die Gelegenheit für Maria. Der Schiffsjunge Jansson hatte sich in den Laderaum hinuntergeschlichen. Er sah sich um und dann schlitzte er einen Karton auf, der unter dem Mehl zum Vorschein gekommen war. Aus dem mopste er eine Dose mit Ananas, die er mit dem Messer öffnete. Er steckte die Finger in die Dose und schlang gierig die Ananasscheiben in sich hinein. Dann schlich er davon. Das Messer blieb zurück.
Im nächsten Moment schon war Maria da. Sie griff sich das Messer und huschte schnell wie ein kleiner Troll zu ihrem Loch zurück. Dort schnitt sie die Haare, die zu diesem Zeitpunkt schon sehr verfilzt waren und einem einzigen langen Rastazopf glichen, so dicht am Kopf wie möglich ab. Sie nahm den Zopf, schlich sich hinaus und warf ihn in einen der großen Eimer. Jetzt war Schluss mit ihrem Leben als Putzlumpen, jedenfalls glaubte sie das.
Ein schreckliches Gebrüll ertönte von den blinden Passagieren, als sie sahen, was Maria getan hatte. Sie hätten sie in Stücke geschlagen, wäre nicht im selben Moment eine Reihe Schaufeln angeflogen gekommen, wie rettende Engel vom Himmel. Nach den Schaufeln kamen die Schauermänner, um das Fischmehl vorzuschieben, das so weit hinten am Schott lag, dass die Baggerschaufeln nicht hinkamen.
Schon bald hatten die frischen Göteborgjungs fertig gelöscht, und während sie das Fallreep enterten, gaben sie ein kleines Abschiedslied zum Besten: »O boy, o boy, o boy …«
Maria hatte sich in Sicherheit gebracht, doch sie begriff, dass sie ohne ihre Haare nicht darauf rechnen konnte, von den anderen Hilfe zum Überleben zu bekommen. Fürderhin hatte sie nur noch ihre List und ihre flinken Beine, auf die sie sich verlassen konnte.
Das war viel Action, das hier Unvermittelt muss ich an die große Schlägerei denken, die viele Jahre zuvor im Devil’s Inn in Hamburg abging, ein Zweikampf, aus dem Schwarzbart als Sieger hervorgegangen war. Damals war er ein erwachsener Mann. Er hatte sich einen Vollbart, pockennarbige Haut und eine lange Narbe über der Nase zugelegt und glich aufs Haar einem Seeräuberkapitän, für den er wahrscheinlich auch gehalten wurde, denn nach dem Streit wurde er von der Bruderschaft angesprochen.
Bruderschaft? Leider bin ich kein allwissender Erzähler, so dass ich nicht sagen kann, was die Bruderschaft ist. Sowohl das eine als auch das andere, würde ich wagen zu behaupten. Aber mehr weiß ich nicht, möge ein jeder seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen.
Die Repräsentanten dieser Organisation, drei dunkel gekleidete Männer mit Steingesichtern, luden Schwarzbart an ihren Tisch ein. Das Erstaunliche war, dass sie bereits das meiste von ihm zu wissen schienen und mithin auch seinen Traum kannten, Kapitän auf großer Fahrt zu werden.
Nur wenig später legte Efraim Schwarzbart als Kapitän auf eigenem Schiff, nämlich der S/S Hoffnung, ab. Jetzt folgten Reisen über die ganze Welt, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen und gewiss auch entgegengesetzt. Kapitän Schwarzbart lenkte sein Schiff hin, wo immer die Ladung gelöscht werden sollte. Es war offizielle und inoffizielle Ladung, und manchmal war sie so geheim, dass man nicht einmal wusste, dass es sie gab.
Den Befehl über das Ziel der Reise erhielt Schwarzbart per Telegramm von der Bruderschaft und, als die Zeit kam, über einen PC mit Internetzugang. Der Apparat wurde von einem jungen Übeltäter bedient, der auf der kriminellen Hackerlaufbahn entgleist und dazu verurteilt worden war, seine Strafe so weit wie möglich von allen verführerischen Computern entfernt auf einem Schiff abzusitzen. Micke Jansson hieß er, der Schiffsjunge Jansson also, der Ananasdieb.
Maria sehnte sich nach jemandem, mit dem sie reden konnte, am liebsten eine Mama oder ein Papa, aber Hauptsache irgendjemand. Nachts schlich sie sich hinaus, um wenigstens einen Menschen schnarchen zu hören. In einer Nacht verirrte sie sich auf die Backbordseite des Schiffs, wo der alte Müllhaufen lag und sich niemand gern aufhielt, weil dort die größten Ratten wohnten. Sie waren so groß wie Welpen und raubgierig wie Bluthunde, doch in jener Nacht waren sie glücklicherweise aufs Deck gekrabbelt, wo eine ihrer Späherinnen ein Fass mit Sirup entdeckt hatte, das leckte. Als Maria ein paar alte Kleiderfetzen hochhob, fand sie einen Gang, der zwischen die Lumpen führte, und von Neugier getrieben, folgte sie dem verschlungenen Weg zwischen Haufen alter, kaputter Kaffeesäcke aus Kolumbien und leerer Apfelsinenkisten aus Sevilla hindurch. Nach etwa zehn Metern stieg der Gang steil an, und Maria kletterte so weit hinauf, bis sie sich direkt unter dem Deck befand. Plötzlich hielt sie inne, hörte sie da nicht Laute, sprach da nicht jemand? Vorsichtig kroch sie tiefer in den Gang hinein. Im Sternenlicht, das durch die Decksplanken fiel, sah sie vor sich eine alte zusammengesunkene Frau sitzen. Das Licht glänzte in ihrem schütteren, grau schimmernden Haar. Sonst war niemand zu sehen, die Alte hatte mit sich selbst geredet. Jetzt wandte sie sich Maria zu, die sie zwar hören, aber nicht sehen konnte, denn sie war blind.
»Wer bist du?«, fragte die Alte.
»Maria.«
»Ach so, ich dachte, es wäre Rutan.«
»Wer ist das?«
»Das ist die Rattenkönigin.«
Maria schwieg. Die Alte fing wieder an zu sprechen, doch nicht mit Maria, sondern mit sich selbst. Es fiel Maria mit ihrem schlechten Gehör schwer, zu verstehen, was die Alte sagte, doch aus dem, was sie hörte, schloss sie, dass da eine sehr gelehrte Frau sprach.
Das kann schon sein, denn sie sprach Finnlandschwedisch. Ihr Name war Cirka Taikon und sie stammte aus Abo, wo sie vor vielen Jahren Professorin für Philosophie oder auch Putzfrau gewesen war. Mit dem guten Recht des Alters hatte sie das meiste vergessen und den Rest durcheinander gebracht, aber es klang doch so, als wisse sie, wovon sie spräche, und für die lauschende Maria war das hier eine Feierstunde. Zum ersten Mal in ihrem Leben hörte Maria jemanden von Dingen reden, über die sie selbst viel nachgedacht hatte. Woraus besteht die Welt? Was ist der Ursprung aller Dinge? Was ist der Sinn des Lebens?
Wo ist mein Ursprung?, dachte Maria. Woher bin ich gekommen? Wer sind meine Eltern und wer hat mich auf dem Meer ausgesetzt und warum?
Von nun an verbrachte Maria viele Nächte in der Gesellschaft der Alten. Die Rattenkönigin Rutan und ihre Untertanen hatten begriffen, dass Maria die Freundin der Alten war, und sie pflegten heranzukommen, uni sich hinter den Ohren kraulen zu lassen. Die alte Cirka redete mit sich selbst und Maria lauschte aufmerksam ihren philosophischen Auslegungen. Während der langen Pausen, die die Alte einlegte, konnte Maria auch die Gespräche mithören, die durch die Decksplanken von oben herunterdrangen. Sie befand sich ja direkt unter dem Dach des Laderaums und konnte deutlich Kapitän Schwarzbart, Fritiof Andersson, Schiffsjunge Jansson und andere von der Besatzung reden hören. Trotz der Gesellschaft der Alten fing Maria an, sich immer mehr aus der begrenzten Welt des Laderaums nach oben zu sehnen. Sie wollte mit eigenen Augen sehen, wie die Welt beschaffen war.
Die Besatzungsmitglieder hatten so großen Spaß an dem Spiel, blinde Passagiere ins Meer zu werfen, dass sie manchmal auch einander hineinwarfen. Da nur wenige von ihnen des Schwimmens kundig waren, entstand ein gewisser Schwund. Ein eifriger Hafenarbeiter war die Liste mit Zu- und Abgängen durchgegangen und hatte festgestellt, dass während der Reise eine ganze Menge Seeleute verloren gegangen waren. Wenn es etwas gab, das die Bruderschaft nicht wünschte, dann war es, Aufsehen zu erregen. Es wurde deshalb sogleich eine Mail an den Befehlshaber der Hoffnung abgesendet, mit einem unmissverständlichen Befehl.
Man könnte jetzt meinen, dass Kapitän Schwarzbart der Besatzung befahl, mit dem Über-Bord-Werfen Zurückhaltung zu üben, doch diese einfache Lösung fiel ihm schlichtweg nicht ein. Wäre das der Fall gewesen, dann würde diese Erzählung völlig anders aussehen. Schwarzbart ordnete vielmehr an, dass alle Schwimmen lernen sollten, und als guter Lokalpatriot wendete er sich an die Arbeitsvermittlung in Stockholms südlichen Vororten, wo eine gewisse Anna Ehrlich Dienst tat, wenn sie nicht gerade mit ihrer Blitzkarriere als Lokalpolitikerin beschäftigt war. Diese begriff, dass hier nur das Beste gut genug war, und deshalb schickte sie eine Bademeisterin, die schon an Selma Lagerlöfs Whirlpool gearbeitet hatte, zurzeit aber als Schwimmlehrerin in den Schulen Südstockholms tätig war, auf Schwarzbarts Schiff.
Olga Josefsson, eine grobschlächtige Frau Ende fünfzig, kam mit dem Flugzeug nach Bombay, wo die Hoffnung vor Anker lag. Sobald sie an Bord gegangen war, begann sie mit dem Unterricht. Auch die blinden Passagiere nahmen auf Befehl des gutherzigen Schwarzbart daran teil. Nach einer kurzen Einweisung in die Theorie des Trockenschwimmens sollten die Schüler ins Wasser, das war der Gedanke und bald auch der Befehl des Kapitäns, und die blinden Passagiere machten sich, wenn auch zögernd, daran, ihn zu befolgen. Doch die Besatzungsmitglieder, denen die Order eigentlich galt, weigerten sich. Und zwar nicht aus Furcht vor dem Wasser, sondern aus Scheu, sich nackt zu zeigen.
»Ich habe durchaus schon einmal nackte Männer gesehen!«, brüllte Olga – ein so kräftiges Brüllen, dass sich in Schwarzbarts schwarzen Augen ein Funken des Interesses entzündete, doch auf die Besatzungsmitglieder zeigte das Brüllen überhaupt keine Wirkung, sie rührten keine Miene und noch weniger eine Flosse.
»Runter mit den Kleidern!«, donnerte der Kapitän.
Da zeigte sich eine Reaktion, aber keineswegs die erwartete.
Ein knarrendes Geräusch lässt sich vernehmen, ein missgelauntes Murmeln, das immer lauter und von hasserfüllten Blicken begleitet wird. Jetzt bewegen sich die Kerle wie ein Mann auf Kapitän Schwarzbart zu. Maria starrt auf die Szene, es ist wirklich ein kritischer Moment, nicht weit von dem entfernt, was man Meuterei nennt.
Wie ein Löwenbändiger im Zirkus geht der Kapitän auf seine Männer zu, und vor seiner mächtigen Erscheinung, dem wilden Brüllen und nicht zuletzt vor dem nachfolgenden scharfen und stechenden nach Schmieröl stinkenden Atem weichen sie zurück. Mit dem Brüllen wächst der Kapitän, und je mehr er wächst, desto mächtiger wird das Brüllen und desto kleiner werden die vorgeblichen Meuterer. Ihr Murren geht in ein kleines Keifen vor diesem Ungeheuer in Menschengestalt über, mit dem sich nicht einmal der Ruf des Käpt’n Schwarzbart messen kann.
Doch sie keifen immer noch wütend. Es ist nicht das Brüllen, das die Meuterer am Ende völlig verstummen und dem Befehl nachkommen lässt, sondern es ist die Stille, die entsteht, als Kapitän Schwarzbart abrupt sein Brüllen abbricht. In der Bugwelle des Misslautes entsteht eine Stille, stiller und schrecklicher als alles andere. So furchterregend ist sie, dass die Besatzungsmitglieder ihre Lumpen voller Panik von sich werfen. Und Maria beobachtet, lernt und merkt sich.
»Der Kapitän auch!«
Käpt’n Schwarzbart starrt auf die barsche Bademeisterin, wird rot, sieht sich um, als suchte er nach Hilfe. Doch die gibt es nicht, stattdessen blicken ihm ausgesprochen schadenfreudige Gesichter entgegen. Der eben noch so riesenhafte Mann sieht mit einem Mal so klein und jämmerlich aus, dass jeder gutherzige Mensch es als seine Pflicht ansehen würde, augenblicklich zur Rettung des armen Mannes zu eilen.
»Der Kapitän wird sich ja wohl nicht selbst ins Wasser stürzen«, hört man eine Stimme.
Das ist Logik, also das Vermögen, logische Schlussfolgerungen zu ziehen, wie es einer Professorin in theoretischer Philosophie, Cirka Taikon zum Beispiel, würdig wäre. Doch nicht einer solchen wenden sich alle Blicke jetzt zu, sondern der unterwürfigen kleinen Rotznase, soll heißen, Maria.
»Ich werde mich ja wohl nicht selbst ins Wasser stürzen!«, ruft der Kapitän und hat damit wieder die Initiative an sich gerissen. »Fangt mit dem Unterricht an!«, beordert er.
Fräulein Olga Josefsson war nach dem gängigen Schönheitsideal hässlich, das war sie immer schon gewesen, so ungewöhnlich hässlich, dass jeder, der sie ansah, daran denken musste, wie eine schöne Frau aussah. Und weil das Hässliche und das Schöne trotzdem in Verbindung miteinander stehen, konnte es geschehen, dass sich das gängige Schönheitsideal sozusagen davonmachte und sich an Olga heftete; es ersetzte nicht das Hässliche, sondern ging in gewisser Weise darin auf und verwandelte sie tatsächlich in eine viel attraktivere als nur eine schöne Frau. Genau das geschah, als der Kapitän sie ansah, wie sie ganz unten auf der Strickleiter stand, den Bootshaken bereit zum Schlag und lauthals Anweisungen verkündend.
Wie ging es denn mit dem Schwimmunterricht selbst voran? Danke der Nachfrage, ziemlich gut. Wenngleich es einige Anfangsschwierigkeiten gab, Schüler gingen unter und verschwanden in der Tiefe des Meeres, und so war das unmittelbare Resultat das, welches zu vermeiden die Schwimmschule begonnen worden war. Daraufhin ließ Kapitän Schwarzbart einen Metallkäfig anfertigen, der zwölf Meter lang und drei Meter breit war, mit einer Tiefe von zwei Metern; wenn jetzt jemand unterging, dann nicht bis auf den Meeresgrund, sondern nur auf den des Käfigs, und dorthin konnte die Schwimmlehrerin sich mit dem Bootshaken vortasten, bis sie die Haut am Nacken zu fassen bekam und den Untergegangenen auffischte.
Blutige Wunden und Schmerzen tauchten auf. Furcht machte sich breit, und das fand Fräulein Olga ganz vortrefflich, denn es gehörte zu ihrem pädagogischen Credo, dass Angst Fähigkeiten hervorbrachte. Doch offenbar gab es eine Ausnahme, und mit wachsendem Zorn betrachtete sie die Einzige auf dem Schiff, die am Ende außer Kapitän Schwarzbart nicht schwimmen konnte, diesen kleinen mageren Lumpen von einem Mädchen Maria, den Olga immer noch nicht auf die Strickleiter bekommen hatte. Schließlich war Fräulein Olga es müde und handelte so wie auf dem Schiff üblich. Sie warf Maria vom Deck ins Meer, glücklicherweise jedoch in den Käfig. Diese ging unter, wurde nach einigem Suchen vom Bootshaken wieder eingefangen und bewusstlos hochgezogen.
Maria lag völlig durchnässt in ihrem Loch. Sie versuchte, sich trockenzureiben, strich sich mit den Händen übers Gesicht, steckte die Finger in die Ohren, um die furchtbare Feuchtigkeit wegzubekommen. Und da passierte es … Sie erinnern sich doch noch, wo Maria sich zu Beginn dieser Erzählung befand, oder? Genau, in der Nordsee, noch dazu an dem Punkt, wo das Meer am allersalzigsten war. Das Salz war einfach wie eine dünne Haut in den Ohren zurückgeblieben, und diese Haut war es, die bewirkte, dass sie so schlecht hörte.
Doch als Maria jetzt in ihren Ohren bohrte, verschwand die Haut und sie hörte! Flüstern und Murmeln, das sie früher nicht mitbekommen hätte, hörte sie plötzlich und es rauschte und dröhnte wie ein Wasserfall in ihren Ohren, und in dem Lärm konnte sie plötzlich Oskar Seatwigs Stimme ausmachen, was sie erschreckte, da dieser sich auf einem völlig anderen Erdteil befand. Die Stimme musste jemand anders gehören.
Ganz und gar nicht, es war wirklich die Stimme von Seatwig, obwohl er nicht zugegen war. Die Erklärung dafür ist, dass fünf Jahre zuvor, als sie halb ertrunken an Bord der Hoffnung gerettet worden war, ein Satz von ihm in das Salz eingetrocknet war. Jetzt war er frei geworden und konnte gehört werden: »Alles hat einen Sinn.«
Da Maria diese einfache Erklärung für das Phänomen nicht kannte, fasste sie das Geschehene als ein Wunder auf und meinte, die Worte müssten etwas Besonderes bedeuten. Aber was ist der Sinn von allem?, dachte sie.
Maria besaß keine besondere Lebenserfahrung, doch sie hatte schon einige Gemeinheiten erlebt und sich darüber hinaus etwas philosophische Dialektik von Cirka zugelegt, so dass es wohl ganz natürlich war, dass sie meinte, der Sinn sei, dass man gut oder, wie sie es in ihren Gedanken ausdrückte, »nett« sein solle.
Die S/S Hoffnung setzte ihr Reise fort. Entlang der Küste von Malabar ging die Fahrt dann weiter um das Kap Comorin, durch den Golf von Mannar und die Meerenge von Palk.
Fräulein Olga hatte noch nie Schiffbruch erlitten, wenn es darum ging, jemandem das Schwimmen beizubringen, und Maria wäre sicher der erste Fall gewesen, wenn Fräulein Olga nicht von einer Erkältung heimgesucht worden wäre. An einem heißen Tag vor der Koromandelküste, wohin das Schiff inzwischen auf seiner Fahrt nach Madras gekommen war, schlug der Schnupfen zu, die Nase lief und die Stimme war fast nicht mehr zu hören. Das hielt Maria für Freundlichkeit, und in weniger als fünf Minuten konnte sie schwimmen, denn sie war sehr lernfähig, wenn die Lehrmethode die richtige war. Jetzt endlich konnte die feierliche Schwimmvorführung stattfinden, die dann solch fatale Folgen haben sollte.
Der Hafen von Madras. Der Kapitän stand auf Deck und soff in sich hinein, was hineingesoffen werden konnte. Auch die blinden Passagiere waren ausnahmsweise auf Deck und sie genossen die Sonne und das Licht und die Wärme. Auf Planken, die über großen Tonnen ausgelegt worden waren, thronten Steckrüben und Zwiebeln in einem geschmackvollen Arrangement. Es waren gelbe Zwiebeln, rote Zwiebeln, Knoblauchzwiebeln, Schalotten und zur Feier des Tages auch kleine, leckere Silberzwiebeln. Eine lange Schlange wand sich um das Schiff, zunächst die Mannschaftsmitglieder in der Reihenfolge, in der sie das Schwimmen gelernt hatten, und dann die blinden Passagiere in derselben Ordnung, als Letzte von allen folglich Maria. In dem Dingi unter der Strickleiter saß die stolze Schwimmlehrerin und neben ihr stand ein Korb mit Korken, ein kleiner Ehrenpreis, der jedem überreicht werden sollte, wenn die Schwimmprüfung abgelegt war. Das sollte ohne Käfig geschehen. Zwar war das Wasser haiverseucht, doch so weit in den Hafen hinein wagten sich die Haie nicht. Außerdem musste sich an diesem Tag niemand schämen, alle hatten ihre Kleider an, weil die Prüfung unter möglichst realistischen Bedingungen abgelegt werden sollte.
Käpt’n Schwarzbart warf den Schwimmkundigen über Bord; in einem weiten Bogen sauste er durch die Luft und schlug dann mit einem hörbaren Platschen auf. Wieder an der Wasseroberfläche, schwamm dieser zu dem Dingi zurück, wo Fräulein Olga den Korken ausgab. Dann das triumphierende Entern an der Strickleiter hinauf, unter dem Jubel des Volkes, hinauf aufs Deck, wo die Kleider in der Hitze innerhalb weniger Minuten trockneten.
Der Tag war schon weit fortgeschritten, als Maria an die Reihe kam. Kapitän Schwarzbart wollte aus dem letzten Wurf ein bisschen was Besonderes machen und so griff er sie an den Waden, schwang sie wie ein Hammerwerfer herum und ließ sie exakt im richtigen Moment los, so dass der Bogen, in dem sie flog, höher und weiter wurde als der aller anderen. Alle auf der Hoffnung jubelten laut und am Kai brachen die Bewohner von Madras in einen spontanen Applaus aus.
Weiter hinaus als alle anderen … Ich ahne, was Sie denken. Bis ins Reich der Haie, das befürchten Sie vielleicht. Nun ja, die Haie beschäftigten sich noch ein Stück weiter in der Bengalischen Bucht mit einem Wasserspiel, aber … Aber jetzt kommt unglücklicherweise ein Ringelnatterich vorbeigeschwommen, auf dem Weg zu einem Liebestreffen in einer Schlangengrube vor Madras, wo es herrlich wild zuging. Unglücklicherweise kommt der Ringelnatterich zufällig an dem übellaunigsten der Haie vorbei, der auf das Spiel, das die ganze Aufmerksamkeit der anderen Haie beansprucht, keine Lust mehr hat. Und unglücklicherweise gehört der launische Kerl zur Gruppe der Kummeresser, und als er des Mahles ansichtig wird, nimmt er Fahrt auf. Der Ringelnatterich flieht um sein Leben, in den Hafen hinein, wo Maria nach dem Schwimmgang erschöpft am Dingi hängt, es aber nicht schafft, sich hochzuziehen, obwohl Fräulein Olga sich mit den Beinen über die Reling gesetzt hat, um das Boot hinunterzudrücken.
Weder Maria noch die Schwimmlehrerin merken, was unter der Wasseroberfläche geschieht, dass nämlich der Hai im selben Augenblick, als er den Ringelnatterich verschlingen will, Marias Fuß sieht. Und gerade als er die Zähne in den hauen will, entdeckt er einen noch größeren Leckerbissen, das Bein von Olga Josefsson.
Olga bekommt Maria in das Dingi, sie bekommt auch den Natterich hinauf, aber ihr linkes Bein bekommt sie nicht hinauf, zumindest nicht das Stück, das vom Knie bis zu den Zehen reicht. Olga gibt einen schrillen Laut von sich, so laut, dass er eine Gänsehaut des Wohlbefindens über das Rückgrat des Kapitäns sendet, ehe dieser begreift, was geschehen ist. Die Schwimmlehrerin liegt auf dem Rücken im Dingi. Das Blut schießt heraus, färbt die Bilge rot und ist nahe daran, Maria zu ertränken.
Die Besatzungsmitglieder stehen an der Reling und glotzen blöd. Nicht einmal Kapitän Schwarzbart zeigt sonderlich große Tatkraft. Alles, was er tut, ist, auf sein Holzbein zu zeigen und tröstend zu rufen, dass man nicht einbeinig zu sein braucht, nur weil man holzbeinig ist.
»Ein Seil«, schreit Olga, »werft ein Seil runter, damit ich den Blutfluss stoppen kann!«
Die wenigen, die reagieren, laufen natürlich herum und suchen, scheinen aber nicht so richtig zu wissen, wonach sie suchen. Die Einzige, die Geistesgegenwart besitzt, ist Olga Josefsson selbst. Da das Seil auf sich warten lässt, greift sie sich den schlagenden Ringelnatterich, bindet ihn um das Bein und zieht so fest zu, wie sie kann. Dann sinkt sie in Ohnmacht.
Es trifft sich, dass der Hafendoktor nicht weit entfernt ist, weshalb es nicht lange dauert, bis die verletzte Olga versorgt und in das Krankenhaus Der Schönen Blumen gebracht werden kann. Auf der Hoffnung wird das Büfett in gedrückter Stimmung abgehalten und schon bald werden die blinden Passagiere in den Laderaum gescheucht.
Oben auf Deck steht Kapitän Schwarzbart und blickt über die Bucht, hinüber zu den Zinnen und Türmen der Stadt und zum Krankenhaus Der Schönen Blumen, dessen Dach in den allerletzten Strahlen der untergehenden Sonne rot wie Gold leuchtet. Übrigens ist alles rot, es ist wie ein roter Nebel vor dem Gesicht des Kapitäns. Das ist das Blut, ich kann kein Blut sehen, auf jeden Fall nicht in solchen Mengen, denkt er, der sonst so hartgesottene Seebär. Er nestelt seine Medizinflasche aus dem Apothekenköfferchen hervor und genehmigt sich ein paar anständige Schluck Brandy. Doch gegen den roten Nebel hilft das nicht. Es kann doch wohl nicht sein, dass ich verliebt bin und deshalb alles rosarot sehe?, denkt der Kapitän.
Von widerstreitenden Gefühlen zerrissen, grübelt Kapitän Schwarzbart weiter und denkt unweigerlich auch an sein eigenes halbes Bein. Genau dasselbe ist es natürlich nicht, denn in seinem Fall handelt es sich ja um das rechte Bein. Doch sein Mitgefühl mit Olga wächst, je mehr er sich selbst bemitleidet. Glück im Unglück auf alle Fälle, dass sie es noch geschafft hat, allen an Bord das Schwimmen beizubringen, denkt Schwarzbart und späht weiter in die Stadt.
Da das hier eine Erzählung ist, die den Mythos oder die Schablone oder die Lüge oder das Gedicht oder gar das, was man die Wahrheit zu nennen pflegt, nicht scheut, darf ich verraten, dass das Spähen des Kapitäns noch einen anderen Grund hatte als den, zum Krankenhausdach Der Schönen Blumen zu blicken. Er wartet auf eine geheime Lieferung.
Am Ende kommt sie zusammen mit einer Order, Madras zur Weiterfahrt nach Singapur sogleich zu verlassen. Käpt’n Schwarzbart kann also das verletzte Fräulein Olga nicht besuchen, doch er schickt ihr ein Präsent, eine Flasche Brandy vom besten Jahrgang.
Es dauerte fast ein Jahr, bis die S/S Hoffnung wieder in Madras festmachte. Kapitän Schwarzbart begab sich da sogleich zum Krankenhaus Der Schönen Blumen.
»Lebt sie noch, Olga Josefsson, die mit dem Bein, oder vielmehr ohne Bein?«, stammelte Schwarzbart.
»Sind Sie ein Verwandter?«, fragte der Arzt und betrachtete das Holzbein von Kapitän Schwarzbart.
»Nein, ich bin ein Kapitän.«
»Freilich lebt sie«, sagte der Arzt. »Vor ein paar Monaten hat sie das Krankenhaus verlassen. Sowohl sie als auch das Kind erfreuten sich damals zumindest des allerwünschenswertesten Wohlbefindens.«
Kapitän Schwarzbart schüttelte den Kopf, überzeugt, dass hier eine Verwechslung vorliegen müsse, doch eine Menge Fragen und vor allem Antworten später begriff er, dass das nicht der Fall war. Neun Monate nach dem Unglück war von einer einbeinigen Schwedin namens Olga Josefsson ein kleiner Junge geboren worden.
»Aber wie ist denn das möglich? Sie kann ja wohl nicht mehr …«
»Offenbar kann sie das«, unterbrach ihn der Arzt.
Der Arzt hatte Recht, doch Kapitän Schwarzbart hatte auch Recht, was ohne Frage sehr widersprüchlich wirken kann. Die Erklärung lautet wie folgt:
Lange ehe Olga Josefsson eine barsche Bademeisterin und Schwimmlehrerin wurde, war sie eine gute Repräsentantin der schwedischen Sünde, ein junges, wildes Mädchen, das sich alles gönnte, was das Leben bot. Eine ideale Mutter war sie folglich nicht, und es war, als hätte die Natur das begriffen, denn obwohl sich Olga einige Hörnerpaare abstieß, war sie niemals schwanger geworden, jedenfalls nicht richtig schwanger, nicht einmal, nachdem sie ihr sündiges Leben aufgegeben hatte. Das grämte sie vor allem, als sie nach den Gesetzen der Natur zu alt geworden war, um Kinder zu haben. Und dann bekam sie doch ein Baby, wie um Himmels willen war das möglich?
Man spricht von den Launen der Natur, doch das ist Quatsch. Die Natur ist nicht launisch, sie ist an Gesetze gebunden. Sie hat viele Möglichkeiten anzubieten, unter anderem die von der Unzerstörbarkeit der Energie, also dass nichts zerstört, sondern alles nur umgewandelt wird, auch in ein neues Leben. Als Olga ihr Bein verlor, wurde sie mit einem Kind bedacht. Das Ei, das Jahrzehnte zuvor befruchtet worden war, als sie die mütterliche Reife noch nicht besessen hatte, wurde nun von dem rasenden Hormonsturm, der auf den Schock folgte, ins Leben gepustet. Die Befruchtung hatte am Ende doch noch Früchte getragen und neun Monate später also gebar Olga Josefsson im Krankenhaus Der Schönen Blumen in Madras einen kleinen Jungen mit einer ungewöhnlich großen Nase, was wahrscheinlich etwas mit dem schwänzelnden Ringelnatterich zu tun hatte. Ansonsten aber war der Junge einigermaßen wohl gestaltet. Vater unbekannt, das gab Olga an, und noch selten hatte eine Angabe mehr der Wahrheit entsprochen.
»Sind Sie der Vater?«, erkundigte sich der Arzt, und seine Stimme hatte einen vorwurfsvollen Ton, den Schwarzbart von ähnlichen Fragen in anderen Häfen kannte. Der Ton gefiel ihm nicht, und als er die Sache verneint hatte, machte er sich schnell davon, und damit kann man sagen, dass dieser Teil der Erzählung an seinem Ende angelangt ist …
Aber nein, halt. Ich habe festgestellt, dass einige Menschen viel über solche Dinge nachdenken, die andere als belanglos bezeichnen, und so lassen Sie mich abschließend erzählen, was mit dem Ringelnatterich geschah. Noch in der Jolle wurde er vom Hafendoktor entknotet und ins Wasser geworfen und konnte ein wenig gerädert seine Reise zur Schlangengrube wieder aufnehmen, wo er derart von einem kleinen Schlangenfräulein verzaubert wurde, dass er seine Krämpfe völlig vergaß. Beide sahen schnell ein, dass keiner von ihnen eigentlich in diesen Sündenpfuhl passte, weshalb sie sich aufmachten und auf der Suche nach einem anständigeren Ort davonringelten. Während der Reise überzeugten sie sich dann endgültig davon, dass sie beide eins sein sollten. Sie ließen sich unter einem Zimtbaum vor dem Dorf Lange der Weil nieder und dort lebten sie glücklich und zufrieden. Ende gut, alles gut.
Für sie schon, ja. Aber für Maria war das Dasein hart. Die einzige Freude, die sie hatte, war, sich zu der Alten zu schleichen und zuzuhören, wenn diese mit sich selbst sprach. Doch auch diese Freude sollte ihr genommen werden.
Eines Nachts, als Maria kam, war die ganze Rattenschar mit Rutan an der Spitze bei der alten Cirka. Die strichen um sie herum wie verschmuste Katzen, sie piepsten traurig, und Maria begriff schnell, dass sie sich zu einem letzten Abschied versammelt hatten. Maria dachte an alles, was die Alte gesagt hatte, und überlegte, was es wohl für einen Sinn hatte, dass Menschen starben. Doch es gab noch eine andere Frage, die sie der Alten ins Ohr flüsterte.
»Ist es der Sinn des Lebens, dass man nett sein soll?«
Die Alte antwortete nicht, doch sie nickte, das dachte zumindest Maria. Der Kopf der Alten war nach vorn gefallen, sie war tot.
Als das Morgenlicht zwischen den Decksplanken hindurchsickerte, hatte Maria einen Entschluss gefasst: Bei der ersten Gelegenheit würde sie fliehen. Eine Flucht musste es sein, denn Kapitän Schwarzbart drückte zwar ein Auge zu, wenn sich jemand auf das Schiff schlich oder wieder hinunter, doch die Besatzung tat das nicht. Maria fing sofort an, aus den alten Lumpenresten ein Tau zu flechten. Die Ratten nagten dazu Stofffetzen in der passenden Länge und Breite ab.
Wer hat noch nicht von Devil’s Inn, der traditionsreichen Kneipe, gehört? Jedes Mal, wenn Kapitän Schwarzbart in Hamburg war, schaute er dort vorbei. Das tat er auch dieses Mal und bekam den Schreck seines Lebens. Seit seinem letzten Besuch hatte Devil’s Inn den Eigentümer gewechselt. Der neue Wirt war kein anderer als Schwarzbarts einziger Rivale um den Titel »Herrscher der Meere« und somit sein Todfeind, Kapitän Rodney MacRotbart! Kapitän a. D., sollte ich besser sagen. MacRotbart war an Land gegangen und hatte die Kneipe gekauft, vielleicht mit dem Hintergedanken, Schwarzbart rausschmeißen zu können, wenn dieser sich nicht benahm. Ob er das an diesem Abend tat, darüber kann man streiten.
Am nächsten Tag gelang es Maria, aufs Deck hinaufzukommen und, ohne dass sie jemand bemerkte, das Tau festzumachen und sich hinunterzulassen, dann in das Magazin für Kurzwaren zu schlüpfen und auf der anderen Seite hinaus. Glückselig hüpfte sie anschließend durch das Hafenviertel, frei und jubelnd vor Glück.
MacRotbart hingegen hatte schlechte Laune. Die Freude des Vortags, nämlich den Ärger seines meistgehassten Feindes über den Wirtswechsel zu sehen, hatte sich in Wut verwandelt. Zwar hatte Schwarzbart getreu seiner Gewohnheit mehrere Tausender ausgegeben, doch ein Teil des Verdienstes war wieder aufgefressen worden, weil Schwarzbart so ein schlechter Verlierer war und jede Menge Glas und Porzellan zerschlagen hatte. Aber noch schlimmer war der Verlust seiner Spülfrau, die einfach genug gehabt hatte, nachdem sie sich an einem zerbrochenen Bierkrug geschnitten hatte. Als MacRotbart sie nicht gehen lassen wollte, hatte sie ihm mit der Gewerkschaft gedroht. Außerdem hatte sie die Spülbürste mitgehen lassen, von der sie behauptete, sie sei ihr Eigentum. Das waren widrige Zeiten für einen ehrenhaften Arbeitgeber.
Wenn die Not am größten ist, ist die Rettung nah. Denn was sahen MacRotbarts alte Augen, wenn nicht eine lebende Spülbürste, einen kleinen Mädchenputzlumpen, der fröhlich summend durch die Gasse hüpfte? Als Maria am Devil’s Inn vorbeikam, wurde sie von einer riesigen Faust im Nacken gepackt und starrte im nächsten Augenblick in ein grauenerregendes Gesicht, verunstaltet von einem wie ein Dornbusch aussehenden feuerroten Vollbart, der an diesem Tag ein paar gelbe Streifen vom Frühstücksei trug. Aus den Mundwinkeln guckten ein paar schwarze zerfressene Eckzähne heraus, lang wie die Beißerchen eines Säbelzahntigers.
»Wohin ist denn dieses kleine Mädelchen unterwegs?«, brüllte Rotbart und entsandte einen ekelhaften Mundgeruch, der dem nach Schmieröl stinkenden von Schwarzbart in nicht viel nachstand, direkt in das schutzlose Gesicht von Maria.
Maria schlug und fuchtelte mit den Armen, spuckte und fluchte, doch sie kam nicht los, bis der Riese sie in das Lokal schleuderte. Sie sauste wie eine Bowlingkugel über den Fußboden und hätte fast Bloody Mary umgeworfen, die vor ihrer Servierschicht die populäre Kabarettsängerin des Devil’s Inn und zugleich die Bettgefährtin von Rotbart gewesen war.
»Lass sie arbeiten«, rief Kapitän Rotbart Bloody Mary zu, und damit war Marias Flucht zu Ende, ehe sie ernsthaft begonnen hatte.
Bloody Mary warf Maria einen Stuhl zu, auf dem sie stehen sollte, um bis an das Spülbecken heranzureichen, und befahl ihr anzufangen, es hatten sich nämlich Türme von Gläsern und Tellern angesammelt, seit die vorige Spülfrau verschwunden war.
»Womit soll ich denn spülen?«, fragte Maria.
»Use your head!«, antwortete Bloody Mary, die wie Rotbart ihre borstige Frisur bemerkt hatte.





























