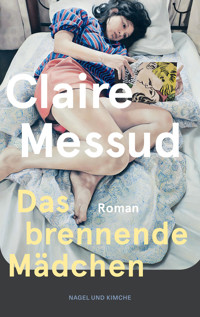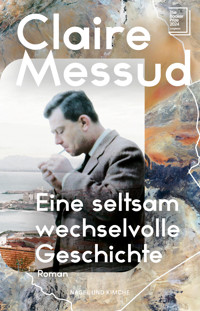
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Getrennt in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, leben die Cassars über sieben Jahrzehnte hinweg, von 1940 bis 2010, zwischen Saloniki und Algerien, den USA, Kuba, Kanada, Argentinien, Australien und Frankreich. Sie reisen hin und her auf der Flucht vor einer komplizierten kolonialen Herkunft und nach der algerischen Unabhängigkeit ganz ohne Heimat. »Eine seltsam wechselvolle Geschichte« erzählt von Gaston und seiner Frau Lucienne, die am Mythos ihrer vollkommenen Liebe festhalten; von den Geschwistern François und Denise, die durch die Fremdheit ihrer Familie verbunden sind; von François' Beziehung zu Barbara, einer Frau, die sich kulturell so sehr von ihm unterscheidet, dass sie einander kaum verstehen können; und von Chloe, dem Ergebnis dieser Verbindung, die glaubt, dass das Erzählen dieser verborgenen Geschichten ihnen allen Frieden schenken wird.
Messud durchquert in ihrem Roman Jahrzehnte, Kontinente und verschiedenste Schauplätze, um die Geschichte einer französisch-algerischen Familie über drei Generationen hinweg zu schildern, der Familie Cassar. Tief verwoben mit den gesellschaftspolitischen Umwälzungen des zwanzigsten Jahrhunderts und inspiriert von der eigenen Familiengeschichte der Autorin, ist diese mitreißende Erzählung ebenso intim wie vielschichtig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 758
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Getrennt in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, leben die Cassars über sieben Jahrzehnte hinweg, von 1940 bis 2010, zwischen Saloniki und Algerien, den USA, Kuba, Kanada, Argentinien, Australien und Frankreich. Sie reisen hin und her auf der Flucht vor einer komplizierten kolonialen Herkunft und nach der algerischen Unabhängigkeit ganz ohne Heimat. »Eine seltsam wechselvolle Geschichte« erzählt von Gaston und seiner Frau Lucienne, die am Mythos ihrer vollkommenen Liebe festhalten; von den Geschwistern François und Denise, die durch die Fremdheit ihrer Familie verbunden sind; von François‘ Beziehung zu Barbara, einer Frau, die sich kulturell so sehr von ihm unterscheidet, dass sie einander kaum verstehen können; und von Chloe, dem Ergebnis dieser Verbindung, die glaubt, dass das Erzählen dieser verborgenen Geschichten ihnen allen Frieden schenken wird.
Messud durchquert in ihrem Roman Jahrzehnte, Kontinente und verschiedenste Schauplätze, um die Geschichte einer französisch-algerischen Familie über drei Generationen hinweg zu schildern, der Familie Cassar. Tief verwoben mit den gesellschaftspolitischen Umwälzungen des zwanzigsten Jahrhunderts und inspiriert von der eigenen Familiengeschichte der Autorin, ist diese mitreißende Erzählung ebenso intim wie vielschichtig.
Zur Autorin
Claire Messud, geboren 1966, stammt aus einer kanadisch-französischen Familie und wuchs in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien auf. Sie studierte an der Yale University sowie an der Cambridge University. Ihr Großstadtroman »Des Kaisers Kinder« war ein weltweiter Erfolg. Auf Deutsch erschienen außerdem »Das brennende Mädchen« (2018) und »Wunderland« (2021). Sie unterrichtet Kreatives Schreiben an verschiedenen Colleges und ist mit dem britischen Literaturkritiker James Wood verheiratet; das Paar hat zwei Kinder und lebt in Washington, D.C. und in Somerville, Massachusetts.
Claire Messud
Eine seltsam wechselvolle Geschichte
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Anke Caroline Burger und Patricia Klobusiczky
NAGEL UND KIMCHE
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel This Strange Eventful History bei W. W. Norton & Company, New York / London.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren.
Sollte uns dies im Einzelfall nicht möglich gewesen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.
© 2024 Claire Messud. All rights reserved
Deutsche Erstausgabe
© 2025 für die deutschsprachige Ausgabe
NAGEL UND KIMCHE
in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH
Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch
Coverabbildung von © Claire Messud, IMAGO / UIG / Bridgeman Images
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783312014385
www.nagel-kimche.ch
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheberinnen und des Verlags bleiben davon unberührt.
Dieser Roman ist inspiriert von meiner eigenen Familiengeschichte. Es handelt sich allerdings um ein Werk der Fiktion, für das die gewohnten Regeln eines Romans gelten. Sämtliche Personen und Ereignisse geben die Vorstellung der Autorin wieder und dürfen nicht als Darstellung realer Personen oder Ereignisse verstanden werden.
Für meine Familie
Die ganze Welt ist Bühne,
Und Schauspieler nur all die Fraun und Männer.
Sie treten auf und gehn auch wieder ab,
Und mit der Zeit spielt einer viele Rollen
Durch sieben Lebensakte hin.
William Shakespeare,Wie es euch gefällt
Sein Leben, in dem nichts, gar nichts geschehen ist. Er ist auf keine Abenteuer ausgezogen, er war in keinem Krieg. Er war nie im Gefängnis, er hat niemand getötet. Er hat kein Vermögen gewonnen und hat keines verspielt. Alles was er getan hat, war, dass er in diesem Jahrhundert gelebt hat. Aber das allein hat genügt, um seinem Leben – in der Empfindung und im Gedanken – eine Dimension zu geben.
Elias Canetti, Nachträge aus Hampstead. Aus den Aufzeichnungen 1954 – 1971
Prolog
Ich bin Schriftstellerin, ich erzähle Geschichten. Dabei will ich in Wirklichkeit natürlich Leben retten. Oder einfach: das Leben retten.
Sieben Jahre, hatte die Hellseherin gesagt, an jenem lang zurückliegenden Sommernachmittag. Sieben Jahre im Tal des Schattens. Das Sonnenlicht im Fenster hinter ihrem Kopf verwandelte ihre rostbraunen Locken in einen goldenen Heiligenschein. Wir saßen einander an einem Kartentisch im Wohnzimmer ihres kitschig eingerichteten, historischen Saltboxhauses gegenüber, eine Meile vom Strand entfernt, in einem Urlaubsort in Neuengland. Wie die meisten ihrer Kundinnen war auch ich nur auf der Durchreise. Ich hatte ihr zwar meinen Beruf verraten, Schriftstellerin, aber sie beharrte darauf, ich sei Heilerin. Kaum hatte sie das ausgesprochen, wünschte ich, das wäre wirklich so. Beziehungsweise wurde mir klar, dass ich mir immer gewünscht hatte, heilen zu können, auch wenn uns viel zu oft gesagt wird, Dichtung könne nichts bewirken: Ist das nicht der innigste Wunsch der Menschheit von Anfang an: dass Worte wirklich etwas bewegen können?
Sieben Jahre Wanderung durch den Schatten des Todes: Zum Zeitpunkt ihrer Prophezeiung hatte ich die Hälfte fast hinter mir, wenn man mit dem Familienurlaub im Haus meiner verstorbenen Großeltern im französischen Toulon anfing, wo wir den Fünfundsiebzigsten meines Vaters begingen – die Feier das Resultat kolossaler Planungen, ein Beisammensein, das zugleich ein Auseinanderbrechen war: mein Vater kurz vor dem körperlichen Zerfall, meine Mutter abgemagert und geistig verwirrt, meine Tante, die in immer engeren Kreisen um die Whiskyflasche tanzte, unsere noch kleinen Kinder, Wildkätzchen unter der Mittelmeersonne. Aber man könnte auch früher anfangen zu zählen – ab dem Zeitpunkt, an dem meine Mutter nicht mehr in der Lage war, eine komplette Mahlzeit zuzubereiten, oder, lange zuvor, als sie die Geburtstage der Kinder nicht mehr wusste oder, sogar noch früher, als sie die Kinder nicht mal auch nur für eine Stunde beaufsichtigen konnte … Aber wenn ich vom Ende her rückwärts zähle – mit dem Ende meine ich den letzten Todesfall, den meiner Tante, kurz nach dem meiner Mutter, und beide nicht lang nach dem meines Vaters –, dann hielt mir die Hellseherin am Cape wirklich zur Halbzeit die zitternde Hand.
Ich bin Schriftstellerin. Ich erzähle Geschichten. Und ich will die Geschichten dieser Leben erzählen. Im Grunde spielt es keine Rolle, wo ich anfange. Wir stehen immer in der Mitte und können nur einen Teil des Weges überblicken. Alles steht in Verbindung miteinander, gemeinsam bewegen sich die Konstellationen unseres Lebens durch Zeiten der Harmonie und des Streits. Wirbelnd verbinden sich Vergangenheit und Gegenwart, und um uns existiert alle Zeit zugleich. Ebbe und Flut, Harmonie und Dissonanz – die Musik erklingt, ob wir sie nun beschreiben oder nicht. Eine Geschichte ist nicht linear, sie ist viel komplexer, sie beschreibt Kreise und Strudel, ein ständiges Auf und Ab, ewige Wiederholungen.
Und so gibt es für diese Geschichte – die Geschichte meiner Familie – entweder viele mögliche Anfangspunkte oder gar keine: Mare Nostrum, der heilige Augustinus, Abd el-Kader, Charles de Gaulle, meine Großeltern, L’Arba, mein Vater, meine Tante, Zohra Drif, meine Mutter, Albert Camus, Toronto, Cambridge, Toulon, Tlemcen, oh, Tlemcen: Alle sind sie Teil des riesigen intrikaten Gewebes. Jede Version ist unvollständig.
Ich könnte auch mit meiner Geburt beginnen, oder der Geburt meines Vaters oder der seines Vaters, der Geburt meiner Mutter oder Großmutter. Ich könnte mit den vielen Geheimnissen und der Scham beginnen. Der unsäglichen Scham der Familiengeschichte, in die wir hineingeboren worden sind, dieser Verletzung, die ich durch das Erzählen endlich heilen möchte. (Wie soll ich jemals vergessen, wie mein bereits ältlicher Vater bei der Geburt seines ersten Enkels auf dem Gehweg stolperte und wie ein umgekippter Berg auf die Straße stürzte, und als er, weiße Daunen auf dem fast kahlen Kopf, in der dreckigen Gosse lag, nicht »Hilfe!« rief, sondern »Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid« murmelte?) Natürlich könnte ich auch mit der Einsamkeit beginnen.
Oder ich könnte mit der Tatsache beginnen, dass der Besitzer unserer nächstgelegenen Pizzeria ein Algerier ist, dessen Nachname zugleich der Name der algerischen Provinzstadt seiner Vorfahren ist, derselben Stadt, in der meine pied-noir-Großmutter an der Mädchenschule unterrichtete, in den Jahren vor ihrer Eheschließung – was in ihrem Fall viele Jahre waren, weil sie erst Mitte dreißig heiratete, damals ein Alter, in dem eine ledige Frau als hoffnungsloser Fall galt. Vielleicht hatte sie ja sogar die Großmutter oder Urgroßmutter meines Nachbarn unterrichtet. Oder ich könnte mit der Tatsache beginnen, dass zu den geliebten libanesischen Freunden meines Großvaters aus der Zeit seiner Stationierung in Beirut auch der Großonkel einer guten Freundin von mir, hier in Amerika fast ein Jahrhundert später, gehört. Ihre Tochter hat schon mit unserem Sohn zusammen gespielt, als die beiden pausbäckige Krabbelkinder waren. Oder ich könnte mit den Engeln auf der letzten Reise meines Vaters beginnen, die Zeugen seiner vielen Leben wurden und als Wächter und Wegweisende auf jenem letzten Gang erschienen und ihn, den Heimatlosen, in seine ewige Heimat führten …
Es spielt keine Rolle, wo diese Geschichte beginnt, Hauptsache, sie beginnt. Und wenn sich diese Geschichte endlos weiter ausdehnt, keine Linie, kein Faden ist, dann ist mein Ausgangspunkt nichts als das – nicht der Anfang, sondern ein einzelner Augenblick, eine Art Ereignis, ein Mund.
Erster Teil
Juni 1940: L’Arba, Algerien
JUNI 1940
L’ARBA, ALGERIEN
Den Brief an seinen abwesenden Vater verfasste François nicht in Schreibschrift, sondern in Druckbuchstaben: nur für den Fall, dass Papa noch nichts von den schlechten Nachrichten mitbekommen hatte – er war immerhin weit weg, in Griechenland, nicht in Frankreich. Aber von seinem Sohn würde er sie jetzt erfahren. Sehr sorgfältig schrieb er in Großbuchstaben: DIE DEUTSCHEN HABEN DIE TORE VON PARIS ÜBERRANNT UND SIND IN DER HAUPTSTADT EINMARSCHIERT. DAMIT HAT MAMAN MICH HEUTE MORGEN GEWECKT.
François wusste, dass Paris das Herz ihrer glorreichen Nation war, auch wenn er die Stadt natürlich noch nie besucht hatte. Er war fast neun Jahre alt und erst vor Kurzem mit seiner Mutter, seiner Tante Tata Jeanne und seiner kleinen Schwester Denise, genannt Poupette, aus Saloniki, wohin sein Vater als Marineattaché des französischen Konsulats entsandt worden war, zu ihren entfernten Verwandten nach Algerien zurückgekehrt – an den Ort, den Maman und Papa ihre »Heimat« nannten! Der Junge kannte Bilder von Paris – die Champs-Élysées, den Eiffelturm, Notre Dame –, und als Maman die »Tore« der Stadt erwähnte, hatte er den Arc de Triomphe vor Augen. Aber dann fiel ihm ein, dass der Triumphbogen in diesem Fall ja ein Niederlagebogen beziehungsweise Hitlers Triumphbogen war, was schlimm, ganz, ganz schlimm war. Er würde den Triumphbogen in diesem Brief an Papa also nicht zeichnen, weil das alle traurig machen würde, auch Papa. Und Maman hatte gesagt, sie müssten alle fröhlich sein für Papa, müssten la famille du sourire sein, weil er sich solche Sorgen um sie machte, weil er so schrecklich weit weg war und sie, des Krieges wegen, nicht mit ihm telefonieren oder telegrafieren konnten. Er sollte wissen, dass es ihnen ausgezeichnet ging, und fröhliche Grüße und Fotos von ihnen bekommen. Maman hatte Tata Paulette, die Frau von Papas Bruder, gebeten, sie zu fotografieren, Maman, Poupette und ihn, damit sie ihm das Bild schicken konnten. Auf dem einen Foto blickten sie alle ernst, auf dem anderen lächelten sie und schnitten Grimassen, jedenfalls standen auf beiden Bildern François’ Ohren ab wie Topfhenkel, und das war ihm schrecklich peinlich.
Durfte er denn wirklich nichts über die Deutschen schreiben? Das waren keine guten Neuigkeiten, nicht la famille du sourire, aber war Ehrlichkeit nicht das Wichtigste? Du darfst nicht lügen, hatte er gelernt. Aber was, wenn die famille du sourire gar nicht wirklich glücklich war? Was, wenn Maman krank und ständig müde war und es nirgendwo einen Platz für ihre Familie zu geben schien und sie kein Geld hatten und manchmal nicht genug zu essen? Sollten sie Papa vorflunkern, dass sie ein angenehmes Leben in L’Arba führten und alles in bester Ordnung war?
Vor ihrer Abreise hatten sie fast ein Jahr lang als Familie zusammen in Saloniki gelebt; aber Frankreich wurde von den Deutschen bedroht, die Europa überrannten, und als Papa sie voller Eile in Saloniki in den Zug setzte, stand das Italien Mussolinis kurz davor, aufseiten der Nazis in den Krieg einzutreten. Der Zug musste jedoch Italien durchqueren – rasch, rasch, bevor es offizielles Feindesland war –, und dann noch ganz Frankreich bis Marseille, wo sie das Schiff nach Hause bestiegen, nach Algier.
»Zu Hause«! Maman und Papa redeten immer davon, wie sehr sie Algier liebten, wie sehr es Teil von ihnen sei, dass Denise und er es ganz genauso lieben würden, die schönste Stadt der Welt mit den leuchtend weißen Häusern, die in einem Halbmond um das glitzernde Mittelmeer standen. Aber als sie dort eintrafen, bekamen sie kaum etwas vom Stadtbild mit, nur, dass es sehr heiß war. Keiner ihrer Verwandten wollte sie bei sich aufnehmen, weswegen sie am Ende in der staubigen Kleinstadt L’Arba bei Tata Baudry landeten, sie war die Tante seines Vaters oder seiner Mutter oder vielleicht auch die Tante seiner schon verstorbenen Großmutter, auf jeden Fall uralt. Wenigstens war sie lieb.
Auf der Rückseite des Briefbogens zeichnete François für seinen Vater den Graben, den sie am Vortag im Garten ausgehoben hatten. Wie er den Matsch malen sollte, wusste er nicht, es hatte über Nacht geregnet, und in dem Graben stand jetzt das Wasser, deswegen machte er nur eine einfache Skizze, die er mit viel braunem Buntstift ausmalte. Als sie den Graben ausgehoben hatten – eigentlich nur Maman und er, weil Tata Baudry zu alt war, Tata Jeanne ging es nicht gut, und Poupette war zu klein und konnte sowieso gar nichts; eigentlich im Grunde nur er, weil Maman schon bald Kopfschmerzen bekam und sich wie so oft drinnen hinlegen musste –, hatte der Graben gigantisch ausgesehen, auf jeden Fall groß genug, damit sie sich alle hineinlegen konnten, wenn die Flieger kamen. Aber am nächsten Morgen, nach dem Regen, wirkte der Graben geschrumpft, und man sah deutlich, dass er noch viel tiefer werden musste. Vielleicht reichte der Platz nicht mal für Poupette und ihn. François war verdrossen und entmutigt; aber dann lobte ihn Maman, der Graben sei trotzdem wunderbar, er habe etwas für Frankreichs Kriegsanstrengungen getan, und ob er sich jetzt bitte an den Tisch setzen und Papa davon berichten könne, weil Papa Frankreich weit weg in Saloniki verteidigte und alles wissen wolle.
Maman zwang Poupette, sich neben ihn zu setzen und auch etwas an Papa zu schreiben, was einfach nur albern war, da sie gerade mal ihren Namen krakeln konnte – die Hälfte der Buchstaben schrieb sie rückwärts –, und jetzt hatte sie tatsächlich die Katzen gemalt, die noch nicht mal Tata Baudrys Katzen waren! Sie gehörten der Frau von oben mit den riesig dicken Puddingarmen, die fast jedes Mal, wenn sie draußen im Garten spielten, aus dem Fenster zu ihnen herunterschimpfte. Eine Katze war schwarz-weiß, die andere Schildpatt, was gar nicht einfach zu malen war, und Poupette malte die Katze, mit Namen Nanette, orange aus. Das war falsch. Das wollte François Poupette nur erklären, aber sie brach sofort in Tränen aus, und ihre Augen hinter der dicken Brille sahen riesig, die Wimpern nass und klebrig aus.
»Hör auf zu flennen«, zischte er, damit Maman nichts mitbekam, die sich wieder im Schlafzimmer von Tata Baudry hingelegt hatte, woraufhin Poupette laut zu schluchzen anfing.
»Wusstest du eigentlich?«, sagte er mit seiner liebenswürdigsten Großer-Bruder-Stimme. »Nanette muss ein Mädchen sein, weil es nur weibliche Schildpattkatzen gibt.«
Poupette tat so, als wolle sie das Blatt Papier zerknüllen. »Du hast gesagt, ich hab alles falsch gemacht. Warum kann die Katze nicht orange sein? Es könnte doch auch eine orange Katze sein.«
Er legte die flache Hand auf ihr Bild. »Dein Bild ist schön. Papa wird sich sehr darüber freuen. Wir dürfen Maman nicht aufwecken, und wir haben kein Papier mehr, also mach es bitte nicht kaputt. Du willst doch nicht etwa dein Geschenk für Papa kaputt machen, oder?«
Poupette schüttelte den Kopf und steckte den schmutzigen Daumen in den Mund. Mit der anderen Hand fingerte sie am Ende ihres blonden Zopfes herum, drehte den Zopf langsam und streichelte die losen Spitzen. Daran merkte François, dass die Katastrophe abgewendet war. Als er sein Bild des selbst ausgehobenen Grabens betrachtete, seufzte er: Der Graben hatte im frühen Morgenlicht unbefriedigend gewirkt, und das Bild zeigte eher einen braunen Kasten, keinen Graben. Er überlegte, ob er Gras drum herum zeichnen sollte; aber das wäre unzutreffend, da der Garten zum größten Teil aus blanker Erde, roter Erde, und ein bisschen Unkraut bestand, in der einen Ecke ein Hochbeet für Gemüse und hinten am Zaun ein Stall mit drei Hühnern darin. Das konnte er alles nicht malen, erst recht nicht auf diesem einen Briefbogen. Würde er Gras malen, nur um anzudeuten, dass der Graben sich von der Umgebung abhob, würde er sich genauso einer Lüge schuldig machen wie Poupette, als sie die Katze orangefarben anmalte.
Musste Papa denn alles ganz genau wissen? Wäre es unehrlich, gelogen gar, wenn François etwas malte, das nicht da war? Er beschloss, den Graben so allein mitten auf der Seite stehen zu lassen und stattdessen mit Worten zu beschreiben. »Voilà«, schrieb er, »das ist der Graben, den wir ausgehoben haben, zum größten Teil ich allein. Aber dann hat es geregnet, und jetzt ist er voller Schlamm. Vielleicht passen wir gar nicht hinein.« Er überlegte und kaute auf dem Stift. Seine Schwester war vom Stuhl gerutscht und unbemerkt zum Sofa geschlichen, wo sie, an Tata Baudrys schwarzes Sergekleid gekuschelt, weiter gedankenversunken am Daumen lutschte und ihren Zopf zwirbelte. François wusste, dass sie Tata Baudry beim Stricken störte, denn Poupettes Kopf lag schwer auf deren Arm.
François hatte Hunger. Er wusste, dass noch ein kleiner Knust vom Mittagsbaguette im Brotkasten lag, und er wusste haargenau, wie viel Honig noch in dem Glas im Küchenschrank war. Aber hier war es anders als in Saloniki oder in Beirut, wo sie davor viele Jahre lang gewohnt hatten. Seine Freunde und seine schönsten Erinnerungen waren in Beirut angesiedelt. Wenn er dort aus der Schule nach Hause gekommen war, hatte ihm die Haushälterin Monica oder seine Tata Jeanne, die invalide Schwester seiner Mutter, die bei ihnen wohnte, eine dicke Scheibe Toastbrot mit Butter und Marmelade gemacht, nur als kleinen Appetithappen, und wenn er Lust hatte, durfte er noch eine Scheibe essen, denn er war ein Junge und musste wachsen. Wenn er die Augen schloss, sah er sich wieder in der Beiruter Küche sitzen – Beirut war sein Traum, viel besser als Saloniki –, zusammen mit Guy und Jérémy, seinen besten Freunden aus der Schule, wie sie sich vollstopften und lachten, Pläne schmiedeten, vielleicht würden sie im Club schwimmen gehen, oder vielleicht gab François sogar mit dem Sommercamp für die Angehörigen der Offiziere an, in den Bergen, wo er bei Sonnenaufgang erwachte und ins Tal hinausblickte, auf die Stadt und dahinter aufs Meer, wo die frische Brise seine Wangen und Unterarme küsste, bevor die Sonne heiß am Himmel stand. Wie lang und frei waren diese Sommertage gewesen, alle Kinder der Marinesoldaten spielten zusammen, bauten Forts, führten Krieg, gingen auf Expeditionen, unterbrachen ihr Spiel nur kurz zum Mittagessen, das alle miteinander, Kinder wie Erwachsene, an den langen Tischen in der Messe einnahmen, wo sie von den niederen Rängen in weißer Uniform bedient wurden, die große, runde Tabletts auf der Schulter balancierten, als sei das Servieren ein einstudierter Tanz, bei dem ihre weiten Hosen elegant raschelten … und die hausgemachte Limonade, die François so liebte, mit genau der richtigen Menge Zucker darin und nicht zu viel Fruchtfleisch – so gut schmeckte sie sonst nirgends. Beim Gedanken daran lief ihm das Wasser im Mund zusammen, aber es war nichts als eine Erinnerung. Hier gab es Zitronen, aber keinen Zucker, und der Honig war zu kostbar, hatte Maman ihm erklärt, als dass man ihn für Limonade hätte verschwenden dürfen.
»Hier« war Frankreich – Algerien natürlich, aber Algerien war ja Frankreich –, angeblich war das seine Heimat, und François sollte sich hier zufrieden und aufgehoben fühlen, so gut das momentan ging, sagte Maman, womit sie sich, wie er wusste, auf den Krieg bezog. Hier gehörte ihre Familie hin, hier waren sie seit hundert Jahren zu Hause, erklärte ihm Maman, und Papa hatte ihm einen Brief geschickt, nur für ihn, in dem er schrieb, wie sehr er hoffe, dass es François in Algier gefalle und er sich dort zu Hause fühle, weil das ihre Heimat sei, der Teil Frankreichs, wo sie hingehörten, den sie immer noch aufbauten und besser und schöner machten. Bisher konnte François nicht das kleinste bisschen Gute oder Schöne daran erkennen.
Seit sie Papa und Saloniki verlassen hatten, bestand sein Leben nur noch aus Angst und Mühe und dem Versuch, für Maman und Poupette so zu tun, als mache ihm das alles nichts aus. Doch er merkte, dass Maman auch nur so tat, als sei alles in Ordnung. Wem machten sie dann eigentlich etwas vor? Poupette wahrscheinlich, die ein schrecklicher Angsthase war und eine solche Heulsuse, dass er sie nur mit gerunzelter Stirn anzuschauen brauchte, und schon brach sie in Tränen aus. Manchmal starrte er sie an, auch wenn er das gar nicht wollte, und wenn sie dann heulte, hatte er Schuldgefühle. Er wünschte, mit ihr zu spielen, würde ihm mehr Spaß machen; aber sie war zu klein, zu ängstlich, sie hatte nie irgendwelche Ideen und tat zwar meistens, was er von ihr verlangte (»Ich bin der General, und du bist mein Soldat, einverstanden?«), aber sie probierte nie irgendwas aus, wozu man ein bisschen Kraft oder Mut brauchte, wie auf eine Mauer klettern oder hinunterspringen oder drinnen ein richtiges Fort aus Sitzkissen bauen. Hier bei Tata Baudry gab es nicht mal dafür genug Platz und genügend Sitzkissen auch nicht. Die Wohnung war schrecklich klein, nur zwei Zimmer, vollgestopft mit Zeug – aufgetürmte Kartons und kaputte Stühle zusätzlich zu den normalen Stühlen, mindestens drei kaputte Stühle, nicht eingerechnet der Sessel am Fenster, bei dem man mit dem Sitz auf den Boden fiel, wenn man sich nicht ganz vorsichtig hineinsetzte, außerdem mehr Tische, als der Mensch brauchte, als sei es ein Lagerraum und keine Wohnung –, und es roch nicht gut, nach Staub und alter Frau, irgendwie fischig. Maman hatte ihm zugeflüstert, es sei dreckig hier und sie müssten mal gründlich reinemachen, aber sobald sie versuchte, in der Wohnung etwas zu verrücken oder aufzuräumen oder sauber zu machen, flatterte Tata Baudry mit den schwarz gewandeten Armen heran, als sei sie ein flügelschlagendes Huhn, und protestierte: »Mais non, mais non, ihr seid doch meine Gäste!«, was offiziell hieß: »Ihr braucht nicht zu arbeiten, solange ihr bei mir wohnt«, aber eigentlich heißen sollte: »Lasst meine Sachen in Ruhe.«
Nichtsdestominder hatte Maman sich am ersten Tag auf dem Klosett eingeschlossen – fließendes, kaltes Wasser, eine Hocktoilette, ein gefliester Boden, ein verklebtes Fenster – und alles wie eine Wahnsinnige geschrubbt, damit Poupette wenigstens keine Angst vor dem Toilettengang zu haben brauchte. Die Fugen zwischen den Fliesen waren zwar nicht wesentlich weniger schwarz geworden, aber die Fliesen glänzten schön weiß, es roch nach Putzmittel und war auf jeden Fall besser als vorher.
Die kurz vor ihrem fünfundachtzigsten Geburtstag stehende Tata Baudry war sehr klein, im Grunde nicht größer als François, und trug ihre spärlichen grauen Haare in einem straffen Dutt. Weil sie nicht mehr viele Zähne im Mund hatte und ihr Gebiss nur zu besonderen Anlässen einsetzte, fiel der Mund oft ein, die Lippen verschwanden, und das Kinn wurde in Richtung Nase hochgezogen. Ihre Haut war faltig und dunkelbraun, so braun wie bei einem Beduinen, die dicken Stummelfinger vom Rheuma knotig und verkrümmt. Wenn Tata Baudry lachte, klang es, als hätte sie keine Stimme, sondern nur einen schwarzen Hohlraum in der Kehle. Sie trug immer dasselbe, einen langen schwarzen Rock und eine schwarze Bluse mit Puffärmeln, deren Kragen und Manschetten mit der Zeit rostbraun geworden waren. Selbst in der größten Hitze trug sie dieses Kleid, oder diese Kleider, falls es mehrere waren, jedenfalls sahen sie alle gleich aus. Ihre winzigen Füße, klein wie die von Poupette, steckten in abgetragenen schwarzen Stiefelchen, waren aber nur selten zu sehen. Tata Baudry ähnelte einer Fee – oder einer Hexe –, irgendetwas aus dem Märchenbuch. François erschien sie unvorstellbar alt: Wahrscheinlich war sie immer schon alt gewesen. Bisher hatte er Tata Jeanne, Mamans ältere Schwester, für alt gehalten, aber jetzt war ihm klar, dass Tata Jeanne neben Tata Baudry wie ein junges Mädchen aussah, da sie volles Haar, runde Wangen und feuchte Lippen hatte. Alt zu werden, hieß auszutrocknen, vermutete er, wie die Blätter im Herbst oder die Blüten, die Maman in ihrer Bibel presste. Tata Baudry hatte keinerlei Saft mehr in sich.
L’Arba war langweilig, und sie fühlten sich in der winzigen, vollgestellten Wohnung wie in einem Käfig. Es gab keine Schule, keine Betätigung, keine Fußballspiele. Manchmal saßen Poupette und er auf der Hintertreppe und veranstalteten einen Wettlauf mit Ameisen oder Käfern: François baute aus Zweigen und Steinchen eine Rennstrecke mit zwei Bahnen, die Geschwister fingen sich ein Insekt und ließen es loswetzen. Wenn Poupette und er zum Einkaufen mit in den Ort gingen, sah er manchmal Kinder in ihrem Alter, meist Kinder von Einheimischen, seit Neuestem auch französische Kinder wie sie selbst, aber sie bewegten sich durch die Straßen, als gingen sie hinter einer Trennwand, er konnte nicht zu ihnen durchdringen. Ein- oder zweimal starrte ein Junge zurück, einmal sogar ein hübsches Mädchen mit kastanienbraunen Rattenschwänzen und einem blauen Bubikragen über dem karierten Kleid, aber alle Kinder, auch er, schienen von ihren Müttern wie Hunde an der Leine herumgezerrt zu werden. Als müssten sie schnell irgendwohin. Als könnten sie sich anstecken, wenn sie stehen blieben und sich unterhielten.
Nach L’Arba hatte es die anderen aus verschiedenen Gründen verschlagen. Ein Grund war die Angst vor Bombardements in der Stadt – deswegen trafen jeden Tag mehr Mütter mit Kindern in dem kleinen Ort ein, auf der Flucht vor etwas, das passieren könnte, aber noch nicht passiert war. Die italienischen Flugzeuge waren über Algier hinweggeflogen, als wollten sie angreifen; aber jetzt war Hitler ja in Paris einmarschiert, insofern würden vielleicht auch die Engländer angreifen. Maman hatte ihm erklärt, die Engländer seien die ganze Zeit mit ihnen verbündet gewesen, aber jetzt ständen sie auf der anderen Seite. Das kapierte François nicht. Maman sagte, die Deutschen seien nach wie vor der Feind – das brauchte man François nicht zu erklären: Les Boches waren nicht nur im Geschichtsunterricht und in echt die Bösen, sondern auch bei jedem Spiel, das sie je gespielt hatten, außer natürlich, wenn Jérémy und Guy und er Cowboy und Indianer spielten. So leicht ließen sich Tatsachen nicht ändern. Die Engländer nervten und mussten manchmal zurechtgestutzt werden – sie verstanden nicht, was Liberté, Égalité, Fraternité bedeutete, weil es bei ihnen nie eine Revolution gegeben hatte. Aber im Großen und Ganzen wussten sie, was Sache ist, wie Papa es ausgedrückt hatte, sie kannten den Unterschied zwischen Gut und Böse. Warum sollten also sie Algier bombardieren? Und was würde so ein Bombardement bedeuten? Mit seinem Cousin Jacky hatte François Air Force gespielt – wie die Flieger waren sie in großen Bögen durch den Park gerannt und hatten dabei »rat-tat-tat-tat-ta« geschrien (die Maschinengewehre) und kreischende Geräusche (die fallenden Bomben) gemacht. Aber in echt hatten sie noch nie eine Bombe gehört. Ein bisschen neugierig war François schon, auch wenn er es nicht zugegeben hätte, weil man das Wort »Bombe« in Poupettes Gegenwart nur auszusprechen brauchte, und schon wurden ihre Augen hinter den Brillengläsern riesig, und ihre Lippen fingen an zu zittern wie Wackelpudding.
Natürlich hatten sie Algier vor allem deswegen verlassen, weil sie dort nirgends unterkommen konnten. Niemand schien sie zu erwarten, als sie völlig erschöpft, ohne Poupettes Koffer, am Hafen eintrafen und vom Fährschiff taumelten, das bei der nächtlichen Überfahrt so stark geschwankt hatte, dass François sich dreimal übergeben musste (Poupette hatte fünfmal gekotzt!). Er konnte sich kaum an die Reise erinnern. Bei ihrer Ankunft aus Saloniki im Mailänder Hauptbahnhof hatte er sich gefürchtet, weil er sah, dass Maman sich fürchtete und sogar Tata Jeanne, die sonst gar nichts mitbekam, vor lauter Angst hellwach war, und das in einem Bahnhof voller Faschisten – sie sahen ganz normal aus, das Böse war ihnen nicht anzumerken –, als der Mann am Fahrkartenschalter ihnen mitteilte, ihre Fahrkarten seien ungültig, es gebe keine Züge nach Frankreich mehr und die Grenze sei geschlossen. Der Mann machte ein höhnisch triumphierendes Gesicht. In Mamans Augen stand etwas, das François bis dahin noch nie gesehen hatte: der Blick eines gejagten Tiers. Das hatte ihm Angst gemacht, und er hatte nach ihrer Hand gefasst und beschlossen, stark zu sein. Dann war ein kleiner, magerer Gepäckträger mit seinem Karren zu ihnen getreten, hatte etwas auf Italienisch gesagt, Maman hatte den Kopf geschüttelt, und der Gepäckträger hatte etwas in einem Singsang geflüstert, auf Französisch, das wie beim Spaghettikoch im italienischen Restaurant in Beirut klang. Der Mann hatte ihr Gepäck aufgeladen und sie schweigend durch die Menschenmenge in der riesigen Bahnhofshalle zu einem der am weitesten entfernten Gleise geführt. Er war nicht von ihrer Seite gewichen, bis sie sicher in ihrem Eisenbahnabteil saßen, und hatte ihnen bei der Abfahrt zugewinkt und gelächelt. »Ich konnte ihm nicht mal einen Centime geben«, hatte Maman geklagt, »weil man jetzt keine Francs mehr in Lire umtauschen darf.«
François war schrecklich hungrig gewesen, hatte aber nichts gesagt. Er musste auch dringend mal, aber verkniff es sich, bis der Zug losgefahren war, weil er wusste, welche Sorgen Maman sich machen würde, wenn sie nicht alle zusammensaßen. Er spielte endlose Runden Schere, Stein, Papier mit Poupette und las ihr dann aus den Fables de La Fontaine vor, bis sie einschlief und ihr der spuckefeuchte Daumen aus dem offenen Mund rutschte. In Marseille half er auch mit und trug Poupette auf dem Rücken zum Taxi – er erlaubte ihr, dass sie ihn an den Ohren zog, um ihn nach rechts und links zu lenken, was sie zum Lachen brachte –, aber im Gewühl auf dem Bürgersteig – alle wollten ein Taxi, und mit dem vielen Gepäck brauchten sie ein besonders großes – hatte sich jemand mit Poupettes Koffer davongemacht, was sie fast umgehend bemerkten, Poupette begann laut zu schluchzen – ihre Lieblingspuppe Henriette mit dem Porzellangesicht, dem echten Haar, den Porzellanhänden und einem Damastkleid hatte sicher verpackt zwischen ihren Unterhosen und Nachthemden gelegen! – und schluchzte noch stundenlang weiter.
Zu viert übernachteten sie in einem Zimmer im Select, das WC befand sich am Gang. Wieder musste François dummerweise mitten in der Nacht auf die Toilette und wagte sich mutig allein aus dem Zimmer, ohne Maman zu wecken. Der Teppichbelag auf dem Flur klebte ein wenig unter seinen bloßen Füßen, und die Lampe an der Wand flackerte schwächlich. Das Herz hämmerte mit Donnerschlägen in seiner Brust, als er an der Kette des weit oben befestigten Spülkastens zog und das Wasser mit lautem Getöse herunterrauschte. Mit angehaltenem Atem rannte er zurück ins Zimmer, voller Angst vor Mördern, Monstern und schlechten Gedanken. Maman und Tata Jeanne schnarchten beide, aber nicht im Gleichtakt, was fast lustig klang, und in der Mitte zwischen ihnen lag Poupette – im dünnen Licht aus dem offenen Fenster konnte er ihre Umrisse im großen Bett erkennen. Er schlich zurück zu der Pritsche, die in der Ecke für ihn aufgestellt worden war, lag still da und versuchte, sein Herz zu überreden, langsamer zu schlagen, während allmählich die Dämmerung in den Raum sickerte. Jedem Tag musste er erneut voller Mut ins Auge blicken, und der Rest der Welt merkte noch nicht mal etwas davon.
Bei der Ankunft in Algier erwartete sie niemand am Hafen, obwohl Maman am Vortag, in Marseille, ein Telegramm an Papas Bruder geschickt hatte, an Onkel Charles – innerhalb Frankreichs konnten noch Telegramme verschickt werden –, also bestiegen sie wieder ein Taxi, diesmal zur Wohnung von Charles und Paulette. Das Fährschiff war mit Rückkehrenden und Neuankömmlingen überfüllt gewesen, die aus Frankreich flohen und bei Verwandten in Algerien unterkommen wollten, manche waren vielleicht sogar ohne Kontakte hergekommen; zu diesem Zeitpunkt war es kein Geheimnis mehr, wie schnell die Deutschen vorrückten. Als François auf dem Schiff in der Schlange zur Cafeteria stand, hörte er eine Frau sagen: »Ich glaube einfach nicht, dass unsere Armee schon so weit ist«, aber ihre Begleiterin brachte sie zum Schweigen: »So was darfst du noch nicht mal denken. Wir haben keine Wahl, wir müssen sie besiegen.«
»Und warum sind wir dann auf diesem Schiff?«, fragte die erste.
»Psst«, erwiderte die andere wieder. »Ich nehme den Fisch. Und du?«
Die zwei Frauen hatte er in der Schlange am Taxistand wiedergesehen, die erste hielt eine große, runde Hutschachtel in der Hand, als sei sie auf dem Weg zu einer Hochzeit. Sie zwängten sich auf den Rücksitz eines schwarzen Wagens, und das Letzte, was er von ihnen sah, waren ihre beachtlichen Hinterteile.
Als François und seine Familie bei ihren Verwandten ankamen, machte sein Cousin Jacky die Tür auf, ein Junge, der nur wenig älter war als François – achtzehn Monate, wie sich herausstellte –, er hatte Sommersprossen, eine Schmalzlocke in den fettigen schwarzen Haaren und etwas Affenartiges an sich. Anfangs öffnete er die Tür nur einen Spaltbreit, misstrauisch, obwohl er zu wissen schien, wen er vor sich hatte.
»Maman«, rief er nach hinten in die Wohnung, ohne den Kopf dabei umzudrehen, »die Cousins sind da. Die Cousins von Papa.«
»Lass sie rein, lass sie rein«, hörten sie von hinten, aber der Affenjunge blieb noch einen langen Augenblick in der Tür stehen und musterte sie von Kopf bis Fuß regungslos, als seien sie Einbrecher; François bedachte er mit einem besonders misstrauischen Blick. Erst als seine Mutter hinter ihm auftauchte und sich die Hände an einem Küchenhandtuch abtrocknete, trat er zurück und ließ die Gäste eintreten.
Im Vergleich zur Villa in Saloniki oder ihrem Heim in Beirut wirkte diese Wohnung sehr klein, die Wände zu nah, die Böden bestanden aus dunkelroten, sechseckigen Fliesen statt aus hellem Marmor wie bei ihnen und ließen die Zimmer noch enger wirken. Tata Paulette führte sie durch einen kurzen Flur ins Wohnzimmer, das auf François düster und vollgestellt wirkte. Die Düsternis wurde nur durch einen gleißenden Lichtstreifen auf dem Boden durchbrochen – die Sonne von draußen. Die Eisenjalousien waren heruntergelassen, aber nicht völlig, daher der überbordende Sonneneinfall.
Paulette, eine kloßförmige Frau mit einer dicken Brille, gab ihnen allen forsche Küsse auf die Wangen, auch Poupette, die sich wand. Paulette hielt das Kinn von Denise kurz fest. »Wem sieht die Kleine hier ähnlich? Der Junge schlägt nach dir und seinem Vater natürlich, aber sie hier?«
»Sie sieht sich selbst ähnlich«, sagte Maman lächelnd, aber François merkte genau, dass sie Tata Paulette nicht leiden konnte. Jedenfalls nicht sehr. Er spürte Jacky hinter sich an der Tür; als er sich umdrehte, hatte Jacky sich an den Türrahmen gehängt und starrte ihn direkt und ohne zu lächeln an.
»Habt ihr unser Telegramm nicht bekommen?«, fragte Maman, unsicher, ob sie sich setzen durfte. In Marseille war ihr gesagt worden, das Telegramm werde ausgeliefert, aber in diesen Zeiten konnte man sich auf nichts mehr verlassen. Erschöpft setzte Tata Jeanne sich unaufgefordert hin, dann Tata Paulette und schließlich Maman. Poupette schmiegte sich an sie wie ein Hündchen. François stand allein mitten im Zimmer.
»Doch, das Telegramm ist gestern gekommen. Wir sind nur – äh, wir –« Tata Paulette richtete den Blick auf ihren feixenden Sohn. »Steh da nicht so rum«, fuhr sie ihn an. »Was ist das für ein Benehmen! Geh und mach den Gästen einen Kaffee!« Mit einem aufgesetzten Lächeln drehte sie sich wieder zu Maman um. »Verzeiht, wir sind ein wenig durcheinander.«
»Ja, die Nachrichten –«
»Nein, nicht deswegen.« Sie sah erst François und dann Poupette an, die ihr Zopfende zwirbelte. »Vielleicht können die Kinder ja Jacky in der Küche beim Kaffeekochen helfen?«, sagte sie.
»Natürlich«, erwiderte Maman und schickte die beiden weg, obwohl es natürlich ein absurder Vorschlag war, da keiner von beiden wusste, wie man Kaffee kochte.
François nahm seine Schwester an die Hand und folgte dem Geräusch der Kaffeemühle in die enge Küche, wo Jacky nicht erstaunt über ihr Erscheinen wirkte.
»Ihr seid also die Marineschnösel«, sagte er über die Schulter hinweg. »Ei, wie fein!«
»Wie bitte?«
»Und wo kommt ihr jetzt her?«
»Aus Griechenland«, antwortete François. »Aus Saloniki. Das liegt in Mazedonien. Sehr weit weg, drei Züge und ein Schiff.«
Poupette starrte ihren Cousin nur an.
Fast aggressiv schlug Jacky die Kaffeemühle seitlich gegen den Kochtopf, damit der gesamte Kaffee herausfiel. »Und jetzt seid ihr rechtzeitig für den Krieg wieder nach Hause gekommen?«
»Hoffentlich nicht«, erwiderte François. »Ich hoffe nicht, dass es Krieg gibt.«
»Der Krieg hat schon lange angefangen, du Depp. Und Frankreich steckt schon mittendrin. Und wir verlieren, nur falls du noch nichts davon weißt.« Jacky stellte den Topf auf den Herd und zündete das Gas mit einem Wusch an. Poupette zuckte zusammen. »Da hat unsere tolle Marine wohl auch nichts gebracht, was?«
François konnte diesen Jungen nicht ausstehen, genauso wenig wie seine Mutter die Mutter von Jacky. Er hatte mal gehört, dass Maman Paulette als »pièce rapportée« bezeichnet hatte, was bedeutete, dass sie nicht wirklich zur Familie gehörte, sondern als Fremdkörper dazugekommen war. François wusste außerdem, dass sie die zweite Frau von Onkel Charles war und dass die erste Frau von Onkel Charles, einem Lehrer, an tuberkulöser Spondylitis gestorben war (der arme Mann, aber die Krankheit hatte trotzdem einen lustigen Namen), woraufhin er viele Jahre vor François’ Geburt Paulette geheiratet hatte. Wie er wusste, wurde nicht darüber gesprochen, dass sie eine zweite Frau war, aber für ihn hatte es immer bedeutet, dass Onkel Charles seine erste Frau nicht genug geliebt hatte, um sie am Leben zu erhalten – wie konnte er dann die zweite wirklich lieben? Und Jacky, dieser böse Junge, war vielleicht deswegen so böse, weil er unter einem schlechten Stern geboren war. François wusste, dass Charles vorher schon eine ganze andere Familie gehabt hatte – drei oder vier Kinder, die schon erwachsen waren. Eines davon lebte in Paris. François glaubte, Charles habe Paulette seinen eigenen Kindern vorgezogen, was ihm fast kriminell erschien. Der Vater von Papa und Onkel Charles hatte seine Familie auch im Stich gelassen, als Papa im selben Alter war wie François jetzt. Charles war Papas ältester Bruder, zehn Jahre älter, aber das war keine Entschuldigung: Er wusste, wie schwierig es für grand-mère und Papa gewesen war, als der Vater sie verließ – sein Name wurde niemals ausgesprochen –, und daher wusste er auch, dass so etwas sehr, sehr schlimm war. Was hieß, dass Jacky und dessen Mutter quasi in ein Verbrechen verwickelt waren.
»Seid ihr katholisch?«, fragte François. Er hätte nicht genau sagen können, warum er das fragte, aber er wusste, dass es seinen Eltern wichtig war.
»Ich bin Kommunist«, antwortete Jacky. »Wie mein Dad. Wir glauben nicht an Religion. Religion ist Quatsch.«
François sagte erst mal nichts, aber Poupette hielt die Luft an. »Das sage ich Maman«, jaulte sie. »So was darf man nicht sagen!«
»Mir egal, kannst deiner Mutter sagen, was du willst.« Jacky knallte Kaffeetassen auf ein Tablett. »Petze.«
Sie blieben nur eine Nacht bei Tata Paulette und Jacky. Onkel Charles war nicht da. François bekam mit, dass Onkel Charles etwas Schlimmes mit einer Frau gemacht hatte – er hörte, wie Tata Paulette etwas über »cette garce« sagte, als sie meinte, er höre es nicht – und deswegen nicht mehr zu Hause wohnen durfte. Sie führten ihren eigenen Krieg. Nach der ersten Nacht zog Maman mit ihnen zu den Cousinen Breloux, drei alten Damen, mit denen sie auch irgendein Verwandtschaftsverhältnis verband, die aber so uralt waren, dass ihm die Verbindung nicht recht einleuchtete – »Tata« wurden sie nicht genannt, es waren also keine Tanten; sie waren Cousinen, aber quasi aus der Antike! Wessen Cousinen mochten sie sein? Die drei antiken Wesen bewohnten jedenfalls eine viel größere Wohnung als Tata Paulette und Jacky, und alles war mit gebügelten weißen Spitzenschonern bedeckt – die Tische, die Sessel, das Sofa –, und es ging mucksmäuschenstill zu wie in der Kirche. Genau wie in der Kirche roch es nach Bohnerwachs. Poupette und er strengten sich sehr an, brav zu sein, aber sie waren erst etwa eine Woche dort, da verfolgte er Poupette im Wohnzimmer, beide bemühten sich, nicht laut zu quietschen – die Alten lagen in ihren Betten, das Ende der endlosen Mittagsschlafzeit stand kurz bevor –, und Poupette stieß eine Porzellanlampe auf dem Beistelltisch um, die in tausend Stücke zerbrach.
Maman schrie nur selten. Auch an diesem Nachmittag schrie sie die beiden nicht an, wurde aber sehr, sehr ernst, als sie die Scherben zusammenkehrte. »Wisst ihr, was ihr getan habt, Kinder? Habt ihr irgendeine Vorstellung? François, ich erwarte mehr von dir.«
Maman zu enttäuschen, war das Schlimmste. Wie es Papa ging, wussten sie nicht: War er noch in Saloniki? War er irgendwo anders? Auf dem Weg zu ihnen oder in die entgegengesetzte Richtung? Und weil Papa nicht da war, war François der Mann im Haus, so hatte Papa es angeordnet. Seine Aufgabe war es, Maman zu beschützen, und er hatte versagt.
Aber er verstand nicht, was sie damit meinte, bis sie zwei Tage später unter dem reuigen, aber entschlossenen Blick der ältesten Cousine Breloux wieder ihre Koffer packten, sich auf den Weg zum Busbahnhof machten und den überfüllten Bus nach L’Arba bestiegen. François musste auf dem Knie von Tata Jeanne sitzen, obwohl er kaum zwischen ihren Schoß und den Sitz vor ihnen passte und sich an die verschmierte Fensterscheibe drücken musste, weil zwischen ihnen und dem Gang ein unrasierter Mann saß, dessen Schenkel so dick waren, dass die Nähte seiner Hose jeden Moment zu platzen drohten, und der so stark nach Schweiß stank, dass Tata Jeanne sich ihr mit Eau de Cologne getränktes Taschentuch über das Gesicht breitete und François die ganze Fahrt nur durch den Mund zu atmen wagte.
Sie waren auf dem Weg nach L’Arba, weil der Schulunterricht in ganz Algerien seit dem Vormonat nicht mehr stattfand und es insofern keine Rolle spielte, dass sie nicht in Algier wohnten. Papa hatte sich so gewünscht, François könne das Schuljahr beenden und im September in die nächste Klasse kommen. In Saloniki war er der Klassenbeste gewesen, und die Lehrerinnen in der Mission Laïque hatten ihn mitten im Schuljahr eine Klasse weiterversetzt. Papa wollte, dass er diesen Vorsprung wahrte – dass er ein Jahr jünger war als seine Klassenkameraden. Denn es gab nur eins, was besser war, als Klassenbester zu sein: gleichzeitig Klassenbester und der Jüngste zu sein. Papa hatte erklärt, er selbst sei auch der Jüngste und der Beste gewesen, und für seinen Sohn erhoffe er sich dasselbe. Insofern war es eine große Enttäuschung, als Maman sich an die Schulbehörde in Algier wandte – bevor Poupette und er die Lampe kaputt gemacht hatten – und herausfand, dass kriegsbedingt kein Unterricht mehr stattfinden würde und unter keinen Umständen Schüler, die noch nicht zehn waren, in die siebte Klasse aufgenommen würden. Was hieß, dass François, der Ende Juni erst neun wurde, im September nicht in die Siebte durfte. Die Kinder sollten sich glücklich schätzen, wenn sie überhaupt zur Schule gehen durften – als Maman von dem Gespräch berichtete, machte sie den Mann nach, wie er »ÜBERHAUPT« sagte, als sei das Wort zugleich kursiv und in Großbuchstaben geschrieben –, dann würde François eben die sechste Klasse wiederholen, und fertig.
Als sie bei Tata Baudry ankamen, wo es viel enger und schmutziger war als bei Tata Paulette, und rötlicher Staub, der immer in der Luft lag und wie Zimt überall haftete, auch auf ihrer Haut, alles bedeckte, beabsichtigte Maman noch, eine kleine Wohnung für sie drei zu mieten, bescheiden, nur ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer wie bei Tata Baudry, Tata Jeanne sollte bei der Alten bleiben und ihr helfen. Aber es wurde schnell deutlich, dass es in L’Arba nichts mehr zu mieten gab, außerdem hätten sie es sich sowieso nicht leisten können. Vaterlose Familien aus der Stadt hatten das Dorf überrannt; selbst in den Vierteln des Ortes, in denen traditionell nur Moslems wohnten, waren jetzt gelegentlich weiße Gesichter zu sehen. Bei der Metzgerei erfuhr Maman, dreihundert Kinder seien in der Schule untergebracht worden, die auf Feldbetten in den Klassenzimmern schliefen und von ihren Lehrerinnen, die ebenfalls aus der Stadt mitgekommen waren, beaufsichtigt wurden.
Angesichts derart vieler Unwägbarkeiten wurden Mamans Migräneanfälle häufiger, was auf so engem Raum große Schwierigkeiten verursachte. Nachts schliefen Tata Baudry und Tata Jeanne im Schlafzimmer und Maman, Poupette und François im Wohnzimmer – Maman auf dem Sofa und die Kinder auf Kissen auf dem Boden –, aber wenn Maman krank war, überließen die anderen Frauen ihr tagsüber und abends das Schlafzimmer, und sie und die Kinder waren die heißen, reglosen Nachmittage über zwischen den Kartons und kaputten Möbeln eingesperrt. Tata Baudry wollte den Arzt kommen lassen, damit er Blutegel bei Maman ansetzte, aber Maman war dagegen.
François hatte einen solchen Hunger, dass er glaubte, bald ohnmächtig zu werden. Er grübelte darüber nach, wie er an etwas zu essen kommen könnte, ohne jemanden zu verärgern, und beschloss, die Alte zu fragen.
Tata Baudrys Augen in dem schrumpeligen Gesicht waren immer noch klar, er wusste, dass sie Kinder mochte – sie war Hebamme und half nach wie vor bei der Geburt von Kindern im Ort oder auf den umliegenden Höfen. Als er sie fragte, ob er den letzten Baguettezipfel essen dürfe, lächelte sie ihn mit den Augen an, ließ ihre Handarbeit sinken und zog ein paar Kupfermünzen aus den Tiefen ihres rostigen Rocks. »Ich weiß was Besseres als das bisschen Kruste. Warum geht ihr euch nicht ein schönes pain au chocolat kaufen?«, schlug sie vor. Sie schubste Poupettes weichen Körper neben ihr ein wenig an: »Und nimm die Kleine mit. Rauszukommen wird euch guttun.«
»Ist das nicht zu teuer?«
»Das spendiere ich euch, eure Mutter braucht nichts davon zu wissen. Heute Morgen hat mir eine Berberfamilie khobz als Dank gebracht, dass ich letzten Monat ihren Sohn mit zur Welt gebracht habe, da haben wir Brot genug für heute Abend und morgen. Die Croissants kosten auch nicht mehr als das Baguette morgen früh. Der himmlische Vater wird uns ernähren. Und jetzt raus mit euch. Viel Spaß.«
Diesen letzten Satz verstand François als Aufforderung, sich ein wenig umzusehen. Poupette war natürlich lästig, aber sie würde tun, was er von ihr verlangte. Die boulangerie lag nur zwei Ecken entfernt im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Auf den Straßen war es sehr still, Siestazeit, und glühend heiß. Nichts deutete darauf hin, dass es in der Nacht zuvor geregnet hatte; sogar die Bürgersteige schienen runzlig vor lauter Hitze, wie die Hände von Tata Baudry. Lustlos schlurfte Poupette hinter ihm her.
»Mach schon.«
»Warum?«
»Weil wir uns was kaufen dürfen. Wann hast du das letzte Mal ein pain au chocolat gegessen?«
»Ich mag aber lieber pain au raisin.«
»In der Not schmeckt jedes Brot, du dumme Pute. Erst mal sehen, was sie haben.«
Außer der boulangère in der weißen Schürze und ein paar Fliegen, die laut gegen das Glas brummten, war der Laden leer. Auf den Blechen hinter der Auslage lag fast nichts mehr – ein paar angebrannte Hefezöpfe, ein einsames Stück Pizza und drei Wurstbrötchen. Und es gab noch ein paar Croissants und ein einziges pain au chocolat.
»Was willst du?«, fragte er Poupette.
»Die haben nicht das, was ich will.«
Er sah, wie die Bäckersfrau die Lippen schürzte.
»Was willst du von dem, was sie haben?«, und dann: »Verzeihen Sie, Madame, sie ist noch klein.«
»Wenn ihr eine bessere Auswahl haben wollt, müsst ihr morgens kommen«, erwiderte die Frau. »Außerdem backen wir momentan eine Menge gar nicht. Normalerweise backen wir mit Butter, aber momentan gibt es nur Schmalz.« Sie zuckte die Achseln.
»Wir hätten gern zwei Croissants und das pain au chocolat, bitte.«
Die Verkäuferin verpackte alles in ein Stück braunes Papier und zwirbelte beide Enden kräftig zu einem kleinen Paket zusammen. Als François bezahlt hatte, war immer noch ein Geldstück übrig, damit kaufte er eine Flasche stilles Wasser. Sie stand auf einem Regal, und das Wasser war sicher warm, aber das Gebäck wäre sonst zu trocken.
Als sie wieder draußen standen, gingen sie zum Dorfplatz und setzten sich auf den Rand des Brunnens in der Mitte. Ein kaum merkliches Rinnsal grünlichen Wassers tröpfelte aus dem Ausfluss des Brunnens, wie ein Schlafender, dem der Speichel aus dem Mund sickert, und produzierte ein leises, nasses Geräusch, das wenigstens an Abkühlung erinnerte. Im Schatten des Bogengangs gegenüber saß ein einzelner alter Mann in weißer djellaba auf einem Holzstuhl, fächelte sich Luft zu und betrachtete die Kinder. François fühlte sich beobachtet, wie dumm, dass sie nicht mal einen Sonnenhut aufgesetzt hatten – würde Poupette einen Sonnenbrand kriegen? Sie hatte so helle Haut –, aber man konnte sich sonst nirgendwo hinsetzen.
»Croissant?«
»Du hast gesagt, ich kriege das pain au chocolat.«
»Du hast gesagt, du magst das nicht.«
»Doch, nur nicht so gern wie pain au raisin.«
François seufzte. Er stellte die Wasserflasche vor seine Füße und schlug das Papierpaket auf dem Schoß auseinander. »Guck, wir haben zwei Croissants und ein pain au chocolat. Ich kann es in der Mitte teilen.«
»Aber ich will das pain au chocolat.«
»Die Hälfte.«
»Aber ohne Marmelade ist das Croissant zu trocken«, maulte Poupette.
»Deswegen habe ich das Wasser gekauft.« François schloss die Augen. Sie nervte so wahnsinnig. Aber er wollte Maman nicht enttäuschen. Sie sollte nicht glauben, er habe sich kindisch oder egoistisch verhalten. »Wie wär’s, wenn du erst mal die Hälfte vom pain au chocolat isst?«
»Nein! Ich will das haben! Gib’s mir! Bitte?«
Er sah seine aufdringliche kleine Schwester mit der schmierigen Brille an. »Von mir aus.« Er hielt das pain au chocolat hoch. »Du kriegst das ganze, wenn du zwei Sachen versprichst. Erstens, ich kriege beide Croissants, okay? Alle beide.« Er fand nicht, dass das zu viel verlangt oder ungerecht war, weil er nicht genug gegessen und schrecklichen Hunger hatte. »Und dann kommst du mit auf Abenteuer. Abgemacht?«
Sie fasste nach ihrem Gebäck. »Abenteuer wo?«
»Wo ich es sage. Versprochen?«
»Versprochen«, sagte sie wenig überzeugt. Und nach einem Bissen mit vollem Mund: »Aber wenn ich nicht mehr kann, trägst du mich, ja?«
»Weiß noch nicht. Ich bin der General, und du bist mein Soldat, ist das klar?«
Sie salutierte mit der freien Hand. »Bien sûr, mon général.«
Als sie alles aufgegessen und die Hälfte des Wassers getrunken hatten – »Warum dürfen wir es nicht austrinken? Ich habe noch Durst!« »Weil wir es vielleicht bei unserem Abenteuer noch brauchen.« »Können wir sie nicht am Brunnen auffüllen?« »Nein, du Doofi. Tiere können das vielleicht trinken, aber uns macht das krank.« –, standen sie auf, bürsteten sich die Krümel ab, und François zeigte auf eine der staubigen Straßen, die vom Platz wegführten. In weiter Ferne waren Berge zu sehen, deswegen entschied er sich für diese Richtung: Mutige Entdecker bestiegen Berge! Poupette sagte er lieber nichts davon, weil sie meckern würde, dass es zu weit war, bevor sie auch nur losgingen.
Auf der schmalen Straße war es still. Hinter offenen Fenstern waren manchmal Stimmen zu hören oder Bewegungen zu sehen, aber sie begegneten niemandem, abgesehen von zwei schlafenden Katzen, die sich eingerollt hatten, und einem kleinen weißen Hund mit braunen Ohren, der hinter einem blauen Transporter wie ein Schweinchen im Müll herumschnoberte. Wenigstens warfen die Häuser Schatten auf die Straße. Am Ende stießen sie auf eine viel breitere Straße, und wieder schlug François die Richtung ein, in der sich die Berge am Horizont abzeichneten. Mehrere Autos fuhren an ihnen vorbei, allmählich wurde der Weg ein bisschen lang, und als sie an einer Gruppe arabischer Männer vorbeikamen, die vor einem kleinen Café saßen, spürte François die neugierigen Blicke und fragte sich, ob sie umkehren sollten. In dem Augenblick packte ihn Poupette mit ihren klebrigen Fingern am Ellbogen und jammerte: »Mir ist so heiß. Lass uns heimgehen«, und ihre hundertprozentig vorhersagbare Schwäche ärgerte ihn so sehr, dass er den Kopf schüttelte. »Wir bestehen ein Abenteuer«, sagte er. »Du hast es versprochen. Du hast das ganze pain au chocolat gekriegt und hast es versprochen.«
»Aber François –«
»Du musst ›mon général‹ zu mir sagen.«
»Du bist gemein!«
»Komm«, sagte er. »Nur noch ein bisschen weiter. Das wird wunderbar.« Er hoffte nur, dass er nicht log. Aber so schnell konnten sie nicht aufgeben. Poupette murrte und ließ die Füße wieder schleifen, also fasste François nach ihrer Hand, obwohl sie beide schrecklich schwitzten und eine schmatzende Schweißschicht ihre Hände zusammenklebte. »Vertrau mir«, sagte er.
Als sie auf der Route d’Aumale an den Ortsrand kamen, endete der Gehweg, und die Straße wurde zur Allee. Auf beiden Seiten standen statt Häusern hohe Platanen, deren Äste ein zusammenhängendes Schattendach schufen, die Blätter raschelten im heißen Wind. Hinter den Bäumen erstreckten sich zu beiden Seiten grüne Felder, erst die ordentlichen Reihen der Weinberge, die Blätter glänzend grün über der lehmigen Erde, als seien sie frisch gewaschen, perfekt wie auf einem Gemälde, und dann, dahinter, der hoch stehende Weizen, der sich wie im Tanz wiegte. Weit weg sahen sie Feldarbeiter beim Sicheln und einen Lastwagen; aber zu hören waren nur die lauten Zikaden und das tiefe Bellen eines Hundes in weiter Ferne. Ohne die direkte Sonnenhitze war die Temperatur erträglich, und François lächelte seine Schwester an. »Ist das nicht schön?«
Sie schüttelte den Kopf und sah zu Boden, aber er stieß sie an. »Da, guck dir doch die Bäume an! Und riech die Luft – sie riecht grün.«
Am Ende des zweiten Weinbergs – selbst François kamen die Weinberge sehr ausgedehnt vor – führte zu ihrer Linken ein Feldweg von der Route d’Aumale weg. Ohne jedes Zögern bog François ab und zog Poupette hinter sich her.
»Das ist zu weit«, jammerte sie. »Ich kann nicht mehr.«
»Sei ein guter Soldat. Wir sind bald da.«
Nach einer Weile hörten sie schwaches Gluckern, das lauter wurde, und am Ende des Weinbergs sahen sie, wo das Geräusch herkam: ein schmaler Bach, eher ein Bewässerungsgraben, in dem Wasser zwischen Baumwurzeln und Felsen über Steine floss.
»Guck doch – gleich sind wir da!« Es war wie in einem Traum. Beide zogen die Schuhe aus und durchquerten den Bach, dessen herrlich kühles, weiches Wasser François fast bis an die Knie ging und wie ein Glockenspiel über die Steine zu plätschern schien. Er hielt Poupette ganz fest an beiden Händen, weil das Wasser an ihrem Körper natürlich höher stand – er hatte dafür gesorgt, dass sie ihr Kleid in den Schlüpfer steckte – und weil die Steine rutschig und uneben waren. Als sie auf der anderen Seite am Ufer hochkletterten, fanden sie sich in einem alten Olivenhain wieder, in dessen Mitte eine Lichtung mit silbrigem Schatten und moosigem Untergrund lockte.
Dort ließ François sich auf den Rücken fallen, riss sich Schuhe und Strümpfe vom Leib und bedeutete Poupette, dasselbe zu tun. Das Zwitschern der Sandflughühner am Wasser und der schockierend laute Gesang eines irgendwo zwischen den Olivenzweigen versteckten Rothals-Ziegenmelkers erfüllten die Luft. Der Himmel über ihnen hatte sich mit dem Sinken der Sonne von einer brennenden Leere wieder in leuchtendes Blau verwandelt, und über ihnen trieben drei wattige weiße Wolken.
»Guck mal, da sind die weißen Lämmer, die wir vom Zug aus gesehen haben, als wir in Saloniki losgefahren sind!«, sagte François, nach oben zeigend. Er meinte eine Schafherde, die sie auf einer ähnlich urbaren Ebene aus dem Fenster beobachtet hatten.
»Sag das nicht.« Poupette redete um den fest in ihrem Mund steckenden Daumen herum.
»Warum nicht? Das ist doch niedlich.«
»Gar nicht. Weil das heißt, die Lämmer sind im Krieg gestorben und jetzt im Himmel. Und dann haben die Deutschen unseren Papa vielleicht auch umgebracht.«
Der Ziegenmelker lachte heiser.
»Erzähl doch keinen Mist. Das sind keine echten Lämmer. Das sagt man nur so.« François schloss die Augen, damit seine kleine Schwester nicht sah, wie sich Tränen darin sammelten. Er zog mit den Fingern an den zarten Grashalmen, als wolle er sich verzweifelt an der Erde festklammern, als könne er sonst in den riesigen Himmel stürzen. »Papa ist sehr stark«, beruhigte er seine Schwester. »Kein dreckiger Deutscher kann ihn töten. Außerdem ist er sowieso in Griechenland, da sind keine Deutschen. Wahrscheinlich ist er schon längst auf dem Weg zu uns.« Er holte Luft. »Dann hat Maman keine Kopfschmerzen mehr, und es gibt ganz viel zu essen – du kannst so viele pains aux raisins essen, wie du willst. Und dann mieten wir uns eine schöne neue Villa in Algier, nur für uns, von da können wir aufs Meer gucken und unseren Freunden in Beirut und Saloniki zuwinken. Wir sind alle wieder zusammen, und Frankreich bringt alle Boches um, na schön, vielleicht mit der Hilfe von England, und dann gewinnen wir den Krieg und kehren zurück nach Beirut, und da leben wir glücklich und zufrieden.«
Das Sandflughuhn zwitscherte, der Ziegenmelker höhnte. Der bespeichelte Daumen fiel Poupette aus dem Mund, sie drehte den Kopf zu ihm, ihre Wange lag auf dem Gras, die wässrig blauen Augen hinter ihrer schief sitzenden Brille fielen zu. Mon général. Er würde sie auf dem Rücken nach Hause tragen müssen, doch er würde sich nicht darüber beklagen.
Juni 1940: Saloniki, Griechenland
JUNI 1940
SALONIKI, GRIECHENLAND
Am 14. Juni 1940, einem Freitag, dem Tag, an dem die Deutschen Paris einnahmen, sollte Gaston Cassar, der französische Marineattaché in Saloniki, zusammen mit seinem Kollegen, Monsieur le Consul Clouet, einem Abendempfang in der Residenz des rumänischen Konsuls beiwohnen.
Als Gaston die Einladung vor über einem Monat erhielt, wohnte seine ganze Familie, seine Frau Lucienne und die Kinder, der achtjährige François und die kleine Denise, erst sechs, noch mit ihm zusammen in der angemieteten Villa in der Rue Reine Olga 175, außerdem Luciennes invalide ältere Schwester, Tata Jeanne. Am 21. Mai hatte er seine Familie in den Zug gesetzt – quer durch Griechenland, quer durch Italien, quer durch Frankreich, damit sie das Schiff nach Algerien besteigen konnten, nach Nordafrika, auf die andere Seite des Mittelmeers. Aus Algerien stammten sie, und dort würden sie in Sicherheit sein. Seit Gaston seine Familie auf dem Bahnsteig verabschiedet hatte, hatte er kein Wort von ihnen gehört: Das Chaos des Kriegs erfasste das gesamte Leben, die Kommunikation brach weitgehend zusammen, keine Briefe oder Telegramme erreichten ihn mehr. Gaston machte sich schreckliche Sorgen und verfiel sogar bisweilen in Panik; aber er war ein disziplinierter Soldat und wusste, dass seine Pflicht dem Vaterland gegenüber – dem armen, geliebten Frankreich – Vorrang vor allem anderen hatte.
Vor der Entsendung nach Saloniki hatte Gaston Cassar vier Jahre lang als Marineattaché im Konsulat des nicht weit entfernten Beirut gedient – eine beachtliche Leistung für einen Soldaten, der aus so bescheidenen Verhältnissen stammte wie er. Seine Vorgesetzten hatten ihn im September 39 nach Kriegsbeginn aus dem Libanon nach Griechenland versetzt, wo er sich für sie umsehen und umhören, im Grunde also spionieren sollte: Was, wollten sie wissen, hatten die faschistischen Italiener in Albanien vor? In der Ägäis? Welche Spione hatten sich eventuell in der mazedonischen Hafenstadt Saloniki versammelt, die seit der Antike von strategischer Bedeutung war? Anfangs hatte Gaston es nicht direkt für eine Beförderung, aber immerhin für eine wichtige Aufgabe in der französischen Marineaufklärung gehalten. Jetzt, da die ihm bekannte Welt in sich zusammenstürzte – Deutsche, die durch die Straßen von Paris marschierten! –, kam er sich allerdings nutzlos vor, gefangen auf einem weit entfernten, unwichtigen Außenposten, allein, ohne seine geliebte Lucienne und die Kinder, die ihm Halt gaben.
Als er sich am Morgen des 14. Juni ankleidete – Gaston legte großen Wert auf eine stets blütenweiße und frisch gebügelte Uniform mit polierten Knöpfen –, hatten sich die Nachrichten von Frankreichs Demütigung bereits allgemein herumgesprochen. Die beiden Hausangestellten in seiner Villa hielten den Blick gesenkt und verbreiteten Grabesstimmung. Beschämt – wie hätte es auch anders sein sollen? – ging Gaston die kurze Strecke zum Büro. So leicht ließ er sich nicht unterkriegen. Irgendeine Möglichkeit zum Widerstand musste es doch geben.
Im Konsulat, wo die hohen Fensterflügel zum Garten hin geöffnet waren, aus dem ihm der Vogelgesang lauter entgegenschallte als der Verkehr, brachte ihm sein Untergebener Cotigny einen doppelten Espresso und ein Glas Wasser.
»Clouet?« Gaston hatte gesehen, dass die Tür zur Suite des Konsuls geschlossen war.
»Ist nicht da, Monsieur. Madame Turner« – Clouets Sekretärin – »hat angerufen, um mitzuteilen, dass wir heute offiziell geschlossen haben.«
»Na, so etwas.« Fast hätte Gaston gelächelt. »Und trotzdem sind wir hier, Sie und ich. Es gibt uns noch. Wir sind immer noch Franzosen. Frankreich ist nicht vom Angesicht der Erde verschwunden.«
»Wenn ich recht verstanden habe – ich kann mich auch irren –, dann möchte der Konsul herausfinden, wo wir stehen. Ich meine, als diplomatische Vertretung … wo Frankreich steht …«
»Ja, natürlich. Der Konsul möchte Klarheit erlangen.« Natürlich zog Clouet, dieser Waschlappen, den Kopf ein, versagte im entscheidenden Augenblick, wie so oft. Wenn es am allerwichtigsten war, Frankreich zu verteidigen, verkroch Clouet sich in einer dunklen Ecke. Gaston wünschte, er könnte seiner Frustration Luft machen, aber nicht vor Cotigny. »Was steht heute im Kalender?«