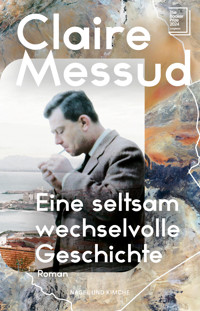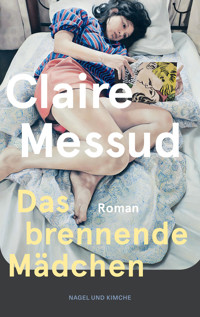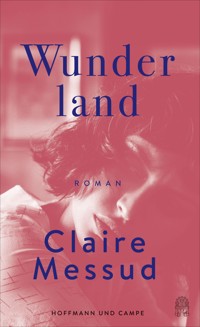
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein süchtig machender Pageturner, mit solcher Kunstfertigkeit geschrieben, dass man gar nicht anders kann, als ihm zu erliegen. Selten hat das Alltägliche so geschillert." The Guardian Nora Eldridge, 42, Grundschullehrerin, ist eine verlässliche Freundin und Nachbarin und eine geschickte Unterdrückerin ihrer eigenen künstlerischen Ambitionen. Sie hat sich damit abgefunden, dass das große Leben woanders stattfindet. Doch dann betritt ein so liebenswerter wie charmanter Schüler ihre Klasse, und als auch dessen weltgewandte, glamouröse Eltern – eine erfolgreiche italienische Künstlerin und ein angesehener libanesischer Wissenschaftler – Nora in ihrer Welt willkommen heißen, weckt das alte Sehnsüchte und Hoffnungen. Bald liebt und lebt sie mit der Familie, wächst in diesem unerwarteten Glück über sich selbst hinaus. Bis ein gründlicher Verrat ihr Selbstwertgefühl umso grausamer erschüttert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Claire Messud
Wunderland
Roman
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Monika Baark
Hoffmann und Campe
Für Georges und Anne Borchardt und – wie immer – für J. W.
Ognuno vede quello che tu pari, pochi sentono quello che tu sei.
Niccolò Machiavelli, Der Fürst
Sicher begreifen nur wenige Menschen, welch rein subjektiven Charakter das Phänomen der Liebe besitzt und dass sie sich aus Elementen, die in ihrer Mehrzahl aus uns selber stammen, eine regelrechte und deutlich von derjenigen, die im wirklichen Leben den gleichen Namen trägt, unterschiedene Ersatzperson erschafft.
Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Scheiß auf löbliche Ideologien.
Philip Roth, Sabbaths Theater
Erster Teil
1
Wie wütend ich bin? Das wollen Sie gar nicht wissen. Niemand will das wissen.
Ich bin ein liebes Mädchen, ich bin ein nettes Mädchen, ich bin die strebsame, sittsame, brave Tochter, ich gehe fleißig zur Arbeit, ich habe nie einer anderen den Freund ausgespannt und nie eine Freundin im Regen stehenlassen, ich habe den ganzen Mist mit meinen Eltern und den ganzen Mist mit meinem Bruder ausgehalten, und außerdem bin ich überhaupt kein Mädchen, ich bin verdammt noch mal über vierzig, ich mache meinen Job gut, und ich kann gut mit Kindern, ich habe meiner Mutter die Hand gehalten, als sie starb, nachdem ich vier Jahre lang ihre Hand gehalten hatte, während sie am Sterben war, ich telefoniere jeden Tag mit meinem Vater, jeden Tag wohlgemerkt – und, was habt ihr für Wetter da drüben am anderen Ufer?, hier bei uns ist es nämlich ganz schön grau und auch ein bisschen schwül. Auf meinem Grabstein hätte eigentlich mal »große Künstlerin« stehen sollen, aber wenn ich jetzt sterben würde, stünde dort stattdessen »eine ganz tolle Lehrerin/Tochter/Freundin«; und was ich wirklich laut schreien und auch in großen Lettern auf meinem Grabstein lesen will, ist: IHRKÖNNTMICHALLEMAL.
Geht es nicht allen Frauen so? Der einzige Unterschied ist, inwieweit uns bewusst ist, dass es uns so geht, wie sehr wir mit unserer Wut im Einklang sind. Wir alle sind Furien, bis auf diejenigen, die einfach zu blöd dazu sind, und meine jetzige Sorge ist, dass wir sie von Geburt an einer Gehirnwäsche unterziehen, und am Ende werden selbst die Schlauen zu blöd sein. Wen ich damit meine? Ich meine die Zweitklässlerinnen an meiner Schule, Appleton Elementary, manchmal sogar die Erstklässlerinnen, und wenn sie dann schließlich bei mir in der Dritten landen, sind sie schon nicht mehr zu gebrauchen – haben nur noch Lady Gaga und Katy Perry im Kopf, Maniküren und süße Klamotten, und sie machen sich verrückt wegen ihrer Frisur! In der dritten Klasse. Haare und Schuhe sind ihnen wichtiger als Galaxien oder Raupen oder Hieroglyphen. Wie hat uns das ganze revolutionäre Gerede der Siebziger dahin bringen können, dass Weiblichkeit bedeutet, sich blöd zu stellen und gut auszusehen? Schlimmer noch, als »pflichtbewusste Tochter« auf dem Grabstein stehen zu haben, wäre »Sie sah gut aus«; früher war uns das ganz klar. Aber heute irren wir durch eine Welt von Äußerlichkeiten.
Deshalb bin ich eigentlich so wütend – nicht wegen der vielen Aufgaben, des Schönwettermachens und der Pflichten einer Frau oder besser der Pflichten des Ichseins –, denn das ist vielleicht die Last, die wir alle als Menschen tragen. Eigentlich wütend bin ich, weil ich mir solche Mühe gegeben habe, diesem Spiegelkabinett zu entkommen, dieser Farce und diesem Theater von der Welt oder meiner Welt, an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika im ersten Jahrzehnt des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Und hinter jedem Spiegel tut sich wieder ein verfluchter Spiegel auf und am Ende jedes Korridors wieder ein Korridor, und das Gruselkabinett ist nicht mehr gruselig und nicht mal lustig, aber es scheint keine Tür zu geben, über der AUSGANG steht.
Jeden Sommer auf dem Jahrmarkt, als ich ein Kind war, gingen wir ins Gruselkabinett mit seinem unheimlich grinsenden Gipsgesicht, zwei Etagen hoch. Man ging hinein durch den Mund, zwischen gigantischen Zähnen hindurch, über die leuchtend rosa Zunge. Das Gesicht sagte eigentlich schon alles. Es sollte ein Spaß sein, aber es machte einem Angst. Der Fußboden wackelte oder schlingerte, die Wände waren schief und die Räume so gestrichen, dass die Perspektiven sich verzerrten. Es blitzte und tutete in den engen vibrierenden Gängen mit den Spiegeln, die einen in die Breite zogen und in die Länge zogen, und den Spiegeln, die einen zugleich auf links drehten und auf den Kopf stellten. Manchmal senkte sich die Decke herab, oder der Boden hob sich oder beides auf einmal, und ich fürchtete, zerquetscht zu werden wie ein Käfer. Das Gruselkabinett war viel gruseliger als das Geisterhaus, nicht zuletzt weil ich es lustig finden sollte. Ich wollte immer nur den Ausgang finden. Aber die Türen, über denen AUSGANG stand, führten nur in noch verrücktere Zimmer, in endlos wackelnde Korridore. Es gab nur einen Weg durchs Gruselkabinett, gnadenlos bis zum Ende.
Inzwischen bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass das Leben selbst ein Gruselkabinett ist. Man will eigentlich nur diese eine Tür, den Ausgang, finden, um dorthin zu gelangen, wo das wahre Leben stattfinden wird; und man kann sie einfach nicht finden. Nein, lassen Sie mich das korrigieren. In den letzten Jahren gab es eine Tür, es gab Türen, und ich öffnete sie, ich glaubte fest an sie und glaubte eine Zeit lang, ich hätte es geschafft, in die echte Welt zu entkommen – mein Gott, was für eine Wonne war das, was für ein Schrecken, es ging mir durch und durch: Es fühlte sich so anders an –, bis mir plötzlich dämmerte, dass ich die ganze Zeit im Gruselkabinett festgesessen hatte. Ich war ausgetrickst worden. Die Tür, über der AUSGANG stand, war überhaupt kein Ausgang gewesen.
Ich bin nicht verrückt. Wütend, ja; verrückt, nein. Ich heiße Nora Marie Eldridge, und ich bin zweiundvierzig Jahre alt – was dem mittleren Alter schon sehr viel näher kommt als vierzig oder einundvierzig. Ich bin weder alt noch jung, weder dick noch dünn, weder groß noch klein, weder blond noch brünett, weder hübsch noch hässlich. Es gibt Augenblicke, da sehe ich ganz nett aus, so lautet wohl der Konsens, ein bisschen wie die Heldinnen der Groschenromane, die ich in meiner Jugend verschlungen habe. Ich bin weder verheiratet noch geschieden, sondern alleinstehend. Früher nannte man so jemanden eine alte Jungfer, aber heute nicht mehr, weil es bedeutet, dass du vertrocknet bist, und das wollen wir ja alle nicht. Bis zum vergangenen Sommer habe ich an der Appleton Elementary School in Cambridge, Massachusetts, eine dritte Klasse unterrichtet, und vielleicht fange ich dort wieder an, ich kann’s einfach noch nicht sagen. Vielleicht jage ich alles in die Luft. Ja, gut möglich.
Es sei Ihnen gesagt, dass ich trotz meines losen Mundwerks niemals vor den Kindern fluche – mit ein oder zwei Ausnahmen, wo mir mal das Wort »Scheiße!« rausgerutscht ist, aber nur ganz leise und weil es nicht anders ging. Wenn Sie jetzt denken, wie kann man als ein so wütender Mensch kleine Kinder unterrichten, seien Sie versichert, wir alle sind imstande, Zorn zu empfinden, manche von uns haben einen regelrechten Hang dazu, aber um eine gute Lehrerin zu sein, muss man ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung haben, und die habe ich. Sogar mehr als ein gewisses Maß. Ich bin so erzogen worden.
Zweitens bin ich keine Frau aus dem Untergrund, die gegen die ganze Welt einen Groll hegt, weil sie so unglücklich ist. Besser gesagt, es ist nicht so, dass ich nicht in gewisser Weise eine Frau aus dem Untergrund wäre – sind wir das nicht alle, die wir ständig andere vorlassen und anderen Platz machen und für andere zur Seite treten, ohne Anerkennung, Bewunderung oder Dank? In unseren Zwanzigern und Dreißigern sind wir schon zahlreich vertreten, in unseren Vierzigern und Fünfzigern bilden wir geradezu eine Legion. Allerdings sollte die Welt verstehen, ginge es ihr nicht am Arsch vorbei, dass Frauen wie wir nicht im Untergrund dümpeln. Für uns gibt es keinen Glühbirnenkeller wie bei Ralph Ellison, kein Kellerloch wie bei Dostojewski. Wir sind immer oben. Wir sind nicht die Verrückte auf dem Dachboden – die Verrückten können sich austoben, auf die eine oder andere Weise. Wir sind die ruhige Frau im Obergeschoss, am Ende des Flurs, letzte Tür, die mit den ordentlichen Mülltüten, die im Treppenhaus strahlend lächelt und fröhlich grüßt, die hinter ihrer Tür nie einen Laut von sich gibt. In unserem Leben stiller Verzweiflung sind wir genau das: die Frau von oben, ob nun mit getigerter Katze oder nervig tapsigem Labrador oder ohne, und keine Menschenseele kriegt mit, dass wir wütend sind. Wir sind vollkommen unsichtbar. Ich habe es nie für wahr gehalten, zumindest nicht in meinem Fall, aber inzwischen habe ich erkannt, dass ich kein bisschen anders bin. Die Frage jetzt ist: Wie geht man damit um, wie nutzt man diese Unsichtbarkeit, um Feuer zu legen?
Im Leben geht es darum zu entscheiden, worauf es ankommt. Es geht um die Phantasie, die die Realität bestimmt. Haben Sie sich jemals gefragt, ob Sie lieber fliegen können oder lieber unsichtbar sein möchten? Ich stelle den Leuten diese Frage seit Jahren und dachte immer, ihre Antwort würde verraten, wer sie sind. Ich bin umgeben von Fliegern. Kinder sind fast immer Flieger. Und die Frau von oben, auch sie ist eine Fliegerin. Die Gierigen fragen manchmal, ob nicht beides ginge; und ein paar wenige – ich habe sie immer für die Gehässigen, die Machthungrigen, die Kontrollfreaks gehalten – entscheiden sich fürs Verschwinden. Die meisten von uns aber wollen fliegen.
Erinnern Sie sich an diese Träume? Ich selbst habe sie nicht mehr, aber sie waren die Freude meiner Jugend. In einer Notlage – Hunde sind mir auf den Fersen oder ein wütender Mann mit erhobener Faust oder Keule – einfach mit den Armen schlagen und mich langsam in die Luft erheben, senkrecht wie ein Hubschrauber oder eine Apotheose, und dann schwebte ich in Freiheit. Ich streifte über die Dächer, nahm große Schlucke Wind, glitt auf dem Luftstrom dahin wie ein Wellenreiter, ich flog über Felder und Zäune, den Strand entlang, hinaus über das aufgewühlte indigoblaue Meer. Und das Licht des Himmels, wenn man fliegt – erinnern Sie sich noch daran? Die Wolken wie erleuchtete Kissen, dicht und feucht, wenn man sich hineinwagte – und ah! die Offenbarung, wenn man auf der anderen Seite herausschoss. Fliegen war das Größte, früher einmal.
Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es die falsche Entscheidung ist. Denn man denkt, es gehört einem die Welt, in Wirklichkeit aber fliegt man immer nur vor irgendetwas davon; die Hunde, die einem auf den Fersen sind, der Mann mit der Keule – sie verschwinden ja nicht, nur weil man sie nicht mehr sieht. Sie sind die Realität.
Und was die Unsichtbarkeit angeht, sie macht die Dinge realer. Man kommt in einen Raum, in dem man selbst nicht ist, und man hört, was die Leute achtlos von sich geben; man beobachtet, wie sie sich bewegen, wenn man nicht dabei ist. Man sieht sie ohne ihre Masken – oder mit ihren diversen Masken, denn plötzlich kann man sie überall beobachten. Es mag schmerzhaft sein zu erfahren, was passiert, wenn man hinterm Vorhang steht, aber lieber Gott, dann weiß man Bescheid.
All diese Jahre hatte ich unrecht, wissen Sie? Die meisten Leute um mich herum auch. Und vor allem – jetzt, wo ich verstanden habe, dass ich wirklich unsichtbar bin –, ich muss unbedingt aufhören, fliegen zu wollen. Ich möchte aufhören, unbedingt fliegen zu wollen. Ich will alles, noch mal von vorn, aber zugleich auch nicht. Ich möchte, dass mein Nichtssein zählt. Denken Sie nicht, das ist unmöglich.
2
Das Ganze begann mit dem Jungen. Mit Reza. Selbst als ich ihn das letzte Mal – zum endgültig letzten Mal – sah in diesem Sommer, als er nicht mehr derselbe war, und das schon seit Jahren, fast ein junger Mann inzwischen, mit den unlogischen Proportionen, der langen Nase, den Pickeln und dem Stimmbruch des Erwachsenwerdens, sah ich in ihm immer noch das vollkommene Wesen. Er leuchtet vor meinem inneren Auge, acht Jahre alt, ein Junge, wie er im Buche steht, ein märchenhaftes Kind.
Verspätet betrat er am ersten Schultag das Klassenzimmer, ernst und unsicher, mit großen grauen Augen und flatternden Tausendfüßerwimpern, trotz seines sichtlichen Bemühens, sie unter Kontrolle zu halten, nicht zu blinzeln und vor allem nicht zu weinen. Die anderen Kinder – von denen ich die meisten aus dem vorherigen Jahr vom Schulhof kannte, sogar namentlich kannte – waren überpünktlich gekommen und gut vorbereitet, mit Büchertaschen und Lunchpaketen und einem Elternteil, der winkend in der Tür stand, einige noch mit den Lippenstiftspuren der Mutter an der Wange; sie hatten ihren Platz gefunden, und wir hatten uns vorgestellt, und jedes Kind durfte eine Besonderheit aus seinen Sommerferien zum Besten geben (die Zwillinge Chastity und Ebullience hatten zwei Monate bei ihrer Großmutter auf Jamaika verbracht, sie hatte Hühner – das war eine Information pro Kind; Mark T. hatte einen Gokart gebaut und war damit im Park Rennen gefahren. Shi-shis Familie hatte einen achtjährigen Beagle namens Superior aus dem Tierheim aufgenommen [»er ist genauso alt wie ich«, sagte sie stolz]; und so weiter), und wir stellten ein paar erste Regeln für unser Klassenzimmer auf (»Furzen verboten«, rief Noah aus der Bank am Fenster und löste damit allgemeines Gejohle und Gekichere aus), als die Tür aufging und Reza in den Raum trat.
Ich ahnte schon, um wen es sich handelte: Alle anderen Kinder auf meiner Liste waren bereits da. Er zögerte. Er stellte einen Fuß in den braven geschlossenen Sandalen sehr vorsichtig vor den anderen, als würde er auf einem Schwebebalken balancieren. Er sah nicht aus wie die anderen Kinder – was aber nicht am olivfarbenen Teint, an seinen grimmigen kleinen Augenbrauen oder an der Art und Weise lag, wie er die Lippen zusammenpresste, sondern daran, dass seine Kleidung so ordentlich, so förmlich und fremdländisch war. Er trug ein blauweiß kariertes, kurzärmliges Hemd und lange dunkelblaue Leinenbermudas, von unsichtbarer Hand gebügelt. Er trug Socken in den Sandalen. Er hatte keine Tasche dabei.
»Reza Shahid?«
»Woher wissen Sie das?«
»Kinder«, ich legte meine Hände auf seine Schultern und drehte ihn in Richtung Klasse, »das ist unser letzter neuer Schüler. Reza Shahid. Willkommen.«
Alle riefen: »Willkommen, Reza«, sehr laut, und selbst hinter ihm stehend konnte ich sehen, wie er versuchte, nicht zurückzuzucken; seine Schädeldecke zog sich zusammen und seine Ohrmuscheln bebten. Schon in diesem Moment liebte ich seinen Nacken, die sorgsam gebändigten schwarzen Locken, die ungleichmäßig gegen den glatten, zerbrechlichen Vorsprung seines Halses brandeten.
Denn ich kannte ihn schon, verstehen Sie? Mir war nicht klar gewesen, dass er Reza war, ich hätte nie vermutet, dass er zu mir in die Klasse kommen würde, in die 3e; aber ich hatte ihn in der Woche davor schon gesehen, hatte ihn angestarrt und war von ihm angestarrt worden, ich hatte sogar ein Lachen mit ihm ausgetauscht, dort im Supermarkt. Ich war an der Kasse mit meinen Einkaufstüten zugange gewesen – bei einer der Tüten war der Henkel abgerissen, und ich versuchte, die Tüte mit einer Hand von unten zu packen, während ich mit der anderen die restlichen Lebensmittel einsammelte, was bloß dazu führte, dass sich meine Äpfel über den ganzen Fußboden verteilten. Die leuchtend roten Früchte rollten bis in den Cafébereich unterm Fenster. Ich hastete ihnen hinterher und bückte mich und hatte die beiden Tüten und meine Handtasche mitten auf dem Gang zur Eingangstür liegen gelassen. Ich war auf allen vieren, um den letzten abtrünnigen Apfel unter einem Tisch hervorzuangeln, mit dem linken Arm drückte ich ungeschickt vier zerbeulte Äpfel gegen meine Brust, als ein einzelner, alles erhellender Lacher mich aufblicken ließ. Über der Rückenlehne der benachbarten Sitznische hing dieses wunderschöne Kind mit seinen ungezähmten, tanzenden Locken, das T-Shirt schmuddelig vom Spielen und frisch mit blutroter Soße bekleckst.
»Was gibt’s denn da zu lachen, verdammt noch mal?« – »Verdammt noch mal« war mir rausgerutscht.
»Du«, erwiderte er nach kurzem Schweigen. Sein Mund war ein ernster Strich, doch seine Augen blickten fröhlich. Er hatte einen starken Akzent. »Du bist sehr lustig, mit deinen Äpfeln.«
Irgendetwas war da in seinem Gesicht, die matte Glätte seiner Wangen mit ihrem Hauch von Rosa, die Wildheit seiner schwarzen Haare, Brauen und Wimpern, die heitere Intensität dieser gefleckten grauen Augen – wider Willen musste ich lächeln, warf einen Blick zurück auf meinen Lebensmittelhaufen vor der Kasse, stellte mir meinen Hexentanz auf dem Boden vor, sah mich selbst mit seinen Augen. »Da hast du wohl recht.« Ich stand auf. »Willst du einen?« Ich bot ihm den jüngsten meiner aus dem Staub aufgeklaubten Äpfel an. Er rümpfte die Nase und stieß erneut sein kurzes bellendes Lachen aus.
»Nicht mehr gut.«
»Nein«, sagte ich. »Wahrscheinlich nicht.«
Während ich auf den Ausgang zuging, sah ich noch einmal hinüber an seinen Tisch. Er saß nicht mit seiner Mutter oder seinem Vater dort. Seine Babysitterin, jung mit gewaltigen Brüsten, hatte einen tätowierten Arm – irgendein keltisches Muster – über die Rückenlehne der Sitznische gehängt. Ihre Haare waren feuerrot, und etwas, das nach Sicherheitsnadel aussah, funkelte an ihrer Unterlippe. Gelangweilt stocherte sie in ihrem Salat, Blatt für Blatt, und glotzte, als wäre der Laden ein Fernseher. Der Junge ließ das Gezappel und starrte mich kühn und lange an, aber mit ausdrucksloser Miene, und als ich ihn anlächelte, sah er weg. Das also war Reza.
Es stellte sich bald heraus, dass sein Englisch furchtbar dürftig war, aber ich machte mir keine Sorgen um ihn. An diesem ersten Abend warf ich nach der Schule einen Blick in seine Unterlagen und stellte anhand seiner Adresse fest, dass er in einem der nobelsten Wohnblocks der Universität an einem Wendehammer unten am Fluss zu Hause war. Das hieß, seine Eltern waren nicht mal mehr Promotionsstudenten, sondern Gastdozenten oder irgendwelche wichtigen Fellows. Sie, oder zumindest einer von ihnen, würden Englisch können, würden ihm helfen können; und es wäre ihnen ein Anliegen, da sie selbst Akademiker waren, was schon mal die halbe Miete war. Auch er selbst hatte Lust zu lernen. Schon am allerersten Tag sah ich es. Wenn er ein Wort nicht wusste, fragte er die anderen Kinder: »Wie heißt?«, um ihre Antworten mit seinem lustigen fremden Akzent und der leicht rauchigen Stimme mehrmals zu wiederholen. War es ein abstrakter Begriff, versuchte er ihn pantomimisch darzustellen, was die anderen zum Lachen brachte, doch er blieb vollkommen sachlich und unbeirrt. Dank Noah hatte er bis zum Mittag bereits »furzen« und »Arsch« gelernt. Ich mischte mich ein, um klarzustellen, dass »Po« oder »Hinterteil« als höflicher galten, aber er hatte Schwierigkeiten, das Wort »Hinterteil« auszusprechen, es klang nach »Tête-à-Tête«; auf mich wirkte selbst das anrührend, weil er so ernsthaft bemüht war.
Und das war der dritte Grund, der mich überzeugte, dass er es schaffen würde: sein Charme. Ich war nicht die Einzige, die dem Zauber erlag – ich sah die kleinen Mädchen gucken und tuscheln, ich konnte spüren, wie der Argwohn der Jungen dahinschmolz, weil Reza sich als prima Kumpel entpuppte, furchtlos beim Spielen und auf fröhliche Art sportlich, genau die Art von Kind, die man bei sich in der Mannschaft haben will.
Und sogar die Lehrer: Estelle Garcia, die Sachkunde unterrichtet, erklärte bei unserer ersten Lehrerversammlung: »Manchmal scheint es gar nicht so wichtig zu sein, wie viel Englisch ein Kind kann, oder? Wenn es genug Leidenschaft mitbringt, lässt sich die transzendieren.«
Ich hatte da meine Bedenken und erinnerte sie an Ilja, den russischen Jungen, an Duong aus Vietnam und noch ein halbes Dutzend anderer Kinder, die schon in der Grundschule unter Stottern und Stocken fast gescheitert waren und die wir nur mit der großen Sorge auf die Mittelschule schicken konnten, dass sie sich zu Schlägern, Schulabbrechern oder Schlimmerem entwickeln würden. Was manchmal zwangsläufig auch geschah.
»Du machst dir doch nicht etwa Gedanken, jetzt schon, in der ersten Woche? Dieser Junge saugt alles auf wie ein Schwamm.«
»Um den Jungen mache ich mir überhaupt keine Gedanken«, sagte ich. »Aber er ist eine Ausnahme.«
Außergewöhnlich. Anpassungsfähig. Mitfühlend. Großzügig. So intelligent. So schnell. So lieb. So humorvoll. Was bedeutete unser Lob anderes, als dass wir uns allesamt ein wenig in ihn verliebt hatten, von ihm bezaubert waren? Er war acht, einfach ein achtjähriges Kind wie jedes andere, aber wir alle erhoben Anspruch auf ihn. Über Eric P., Darren oder den mondgesichtigen Miles, dessen Augenringe Trübsal ausstrahlten wie in permanenter Trauer, sagten wir solche Dinge nicht. Jedes Kind ist auf seine Weise stark, erzählten wir ihnen. Jeder hat irgendeine Begabung. Wir alle können gute Entscheidungen treffen, wenn wir uns Mühe geben. Aber Reza strafte das alles Lügen, mit seinem bestrickenden Charme und seiner Schönheit.
Als er in der ersten Woche versehentlich bei einem übermütigen improvisierten Fußballspiel auf dem Pausenhof Françoise umrannte, legte er den Arm um ihre zitternde Schulter und setzte sich mit ihr auf den Bordstein, bis sie sich wieder gefasst hatte. Er hatte Tränen in den Augen, das habe ich gesehen. Als er erfuhr, dass Aristide, dessen Eltern aus Haiti stammten, Französisch sprach, strahlte er übers ganze Gesicht, und die beiden schnatterten die ganze Mittagspause hindurch, bis Mark T. und Eli sich beschwerten, sie fühlten sich ausgeschlossen; worauf er pflichtschuldig nickte, kurz die Augen schloss und zu seinem gebrochenen Englisch zurückkehrte, seinem unvollkommenen Medium. Ich musste ihn nicht dazu auffordern. Von da an sprachen er und Aristide erst nach Schulschluss miteinander Französisch, auf dem Weg aus der Tür. Als die Kinder, auch dies noch in der Anfangszeit, einen besonders ausgelassenen Nachmittag verlebten – es regnete in Strömen, sie waren den ganzen Tag eingesperrt gewesen, der Himmel war stockfinster, und wir hatten über Stunden in aufreibendem Neonlicht gebadet – und als es dann während des Kunstunterrichts (meinem vermeintlichen Lieblingsfach, da ich ja vermeintlich selbst Kunst mache) den Jungen einfiel, die Temperafarben in den Plastikflaschen erst auf ihr Malpapier zu spritzen und dann, zumindest bis ich darauf aufmerksam wurde, auch auf die Möbel, den Boden und einander, und als ich trotz meiner beträchtlichen und vielgepriesenen Selbstbeherrschung laut wurde und mich mit donnernder Stimme als sehr enttäuscht zu erkennen gab, an jenem Tag also blieb Reza nach Schulschluss, eine volle Stunde später, vor meinem Pult stehen und legte seine kleine Hand auf meinen Unterarm, zart wie ein Blatt.
»Tut mir leid, Miss Eldridge«, sagte er. »Tut mir leid, dass wir uns schlecht benommen haben. Nicht böse sein.«
Seine Babysitterin lauerte mit glitzernder Lippe in der Tür. Sonst hätte ich ihn vielleicht umarmt: Er wirkte für einen Moment so sehr wie mein eigenes Kind.
Kinder. Ich und Kinder. Kinder und ich. Wie habe ausgerechnet ich es geschafft, zur Lieblingslehrerin aller Drittklässler der Appleton Elementary School zu werden? April Watts, die Lehrerin, die die Parallelklasse unterrichtet, wirkt wie einem viktorianischen Roman entsprungen: Ihre braunen Zuckerwattehaare sind zu einem hauchzarten, verhinderten Stück Naschwerk aufgeschäumt, und auf der Nase sitzen Glasbausteine, die ihre blauen Augen vergrößern und verzerren wie Fische in einem Aquarium. Obwohl sie erst Anfang fünfzig ist, trägt sie Stützstrümpfe wegen ihrer Krampfadern und hat, das arme grausliche Ding, absolut gar keinen Sinn für Humor. Nicht wegen der Haare, der Brille oder der Krampfadern gibt man mir den Vorzug, sondern wegen der letzten Eigenschaft. Ich bin dafür bekannt – und ich sage das keineswegs stolz –, so sehr zu lachen, dass ich vom Stuhl kippe, was meine donnernden Wutanfälle offenbar kompensiert. Sagen wir so: Meine Gefühle in ihrer ganzen Bandbreite sind für die Kinder erkennbar, was mir pädagogisch wertvoll erscheint.
Es war sowohl ein großes Kompliment als auch ein Schlag ins Gesicht, als vor ein paar Jahren einer der Väter zu mir sagte, ich entspräche bis aufs i-Tüpfelchen seiner Vorstellung von einer Lehrerin. »Sie sind das Idealbild einer Lehrerin«, genau das sagte er. »Der Prototyp.«
»Und das heißt, Ross?«, fragte ich mit einem dicken künstlichen Lächeln. Es war auf unserem Abschlusspicknick, und drei oder vier Eltern scharten sich in der grellen Sonne des Schulhofs um mich, hielten sich an ihren kleinen Plastiklimoflaschen fest und tupften sich oder ihren Kindern mit Papierservietten die Ketchupflecken vom Kinn. Die Hotdogs und Tofuwürstchen waren bereits verzehrt worden.
»Ich weiß genau, was er meint«, sagte Jackie, die Mutter von Brianna. »Er meint, als wir Kinder waren, hätte jeder gern so eine Lehrerin gehabt wie Sie. Enthusiastisch, aber streng. Voller Ideen. Eine Lehrerin, die versteht, wie Kinder ticken.«
»Meinten Sie das, Ross?«
»Wahrscheinlich nicht ganz«, sagte er, und staunend ging mir auf, dass er mit mir flirtete. Dergleichen kommt bei den Eltern an meiner Schule eher selten vor. »Aber so in etwa. Es sollte ein Kompliment sein.«
»Na dann, danke.«
Ich suche immer nach dem, was die Leute eigentlich sagen wollen. Wenn sie mir erzählen, ich würde verstehen, wie Kinder »ticken«, dann befürchte ich, dass sie eigentlich sagen wollen, ich wirke nicht richtig erwachsen. Der Mann einer Bekannten, ein Uniprofessor, hat Kinder mal mit Verrückten verglichen. Daran muss ich oft denken. Er sagt, dass Kinder am Rande des Wahnsinns leben, dass in ihrem anscheinend unmotivierten Verhalten dieselbe Traumlogik herrscht wie in dem von Verrückten. Das leuchtet mir ein. Und da ich gelernt habe, mit Kindern geduldig zu sein und die Logik hervorzukitzeln, die immer irgendwo steckt und unwiderlegbar ist, sobald sie erklärt wird, bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass Erwachsenen, ob verrückt oder klar im Kopf, eigentlich derselbe Respekt entgegengebracht werden sollte. Insofern ist niemand wirklich verrückt, nur unverstanden. Wenn Briannas Mutter sagt, dass ich verstehe, wie Kinder ticken, spreize ich mich wie ein Pfau, denke aber gleichzeitig, sie hält mich für verrückt. Oder zumindest, dass sie mich nicht zum Stamm der echten Erwachsenen zählt. Und das würde dann wiederum erklären – wenn nicht mir, dann jedenfalls den großen Sehern unter uns –, warum ich keine eigenen Kinder habe.
Hätten Sie mich bei meinem Highschool-Abschluss gefragt, wo ich mit vierzig sein würde – und es wird ja wohl jemand gefragt haben, oder? In dem verschollenen Jahrbuch wird doch irgendwo ein Artikel stehen, in dem wir unsere Pläne für das spätere Leben darlegen –, hätte ich ein seliges Bild von mir selbst gezeichnet, von der Künstlerin im Malerkittel bei der Arbeit in ihrem luftigen Atelier, während die Kinder – mehrere, vielleicht im Alter von fünf, sieben und neun – in einem sonnengesprenkelten Garten herumtollen, zweifellos mit ein bis zwei Hunden, großen Hunden. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, die Geldquelle für diese Vision zu benennen, ebenso wenig den zu den Kindern gehörigen Vater: Zu der Zeit hingen Männer anscheinend nur indirekt mit dem zusammen, was das pralle Leben darstellte. Ebenso wenig brauchten die Kinder irgendeine Form von Betreuung: Sie spielten wunderbar friedlich, ohne sich zu zanken, ohne das geringste Bedürfnis, die Künstlerin zu unterbrechen, bis diese so weit war; und dann kam das obligatorische entzückende Picknick unter den Bäumen. Kein Geld, kein Mann, keine Hilfe – aber in der Picknickszene damals waren sämtliche Notwendigkeiten vorhanden: das Licht, die Arbeit, der Garten und, als wesentlicher Faktor, die Kinder. Wenn Sie mich gebeten hätten, die Phantasie zu sichten und alles Verzichtbare wegzulassen, dann hätte ich das Picknick gestrichen, die Hunde, den Garten und notfalls das Atelier. Für die Kunst würde es auch ein Küchentisch tun, ein Dachboden oder eine Garage. Aber Kunst und Kinder – diese Posten waren nicht verhandelbar.
Es ist ja nicht so, dass ich gar keine Kunst machen würde und dass ich gar keine Kinder hätte. Ich habe es einfach nur hinbekommen, die Dinge sehr schlecht zu arrangieren, oder sehr gut, je nachdem, wie man’s betrachtet. Ich lasse die Kinder zurück, wenn die Schule aus ist; ich mache meine Kunst – ich muss nicht mal meinen Küchentisch benutzen, ich habe ein Gästezimmer, sogar mit zwei Fenstern, genau zu diesem Zweck – abends und an den Wochenenden. Das ist nicht viel, aber besser als nichts. Und in dem Jahr mit Sirena, als ich mein luftiges Atelier hatte, unser gemeinsames Atelier, als ich es kaum erwarten konnte, dort zu sein, als mir bei der Aussicht darauf das Blut in den Adern prickelte, war alles perfekt.
Ich dachte immer, ich würde es mal zu was bringen. Ich gebe gern der Welt die Schuld für alles, was mir nicht gelungen ist, doch das Scheitern – das Scheitern, das mich manchmal in Gestalt von Wut wie eine Welle überschwemmt, mich so wütend macht, dass ich spucken könnte – ist am Ende hausgemacht. Die Unbezwingbarkeit der Hindernisse, die Verurteilung zur Mittelmäßigkeit habe ich mir selbst eingebrockt und sonst niemand. Ewig lange habe ich gedacht, ich wäre stark genug – oder aber ich habe den Begriff Stärke missverstanden. Ich dachte, ich könnte etwas Großes werden, zu eigener Größe finden, indem ich weitermache, indem ich jedes Chaos beseitige, das sich mir in den Weg stellt, ähnlich wie man lernt, zuerst das Gemüse zu essen, bevor es Nachtisch gibt. Aber wie sich zeigt, ist das eine Regel für Mädchen und Memmen, denn der Gemüseberg ist hoch wie der Mount Everest, und die Schale Eiscreme am hinteren Ende des Tisches schmilzt mit jeder Sekunde ein bisschen mehr. Bald kommen die Ameisen. Und dann wird alles abgeräumt. Welche Hybris zu denken, ich könnte ein anständiger Mensch sein und ein wertvolles Mitglied meiner Familie und der Gesellschaft und trotzdem Kunst schaffen! Absurd! Für wie stark habe ich mich gehalten?
Nein, Stärke war offensichtlich die ganze Zeit nur die Fähigkeit, »Ihr könnt mich mal« zu allem und jedem zu sagen, dem ganzen Elend den Rücken zu kehren und unbeirrt vor allem die eigenen Wünsche im Auge zu behalten. Männer haben seit Generationen Übung darin. Sie haben spitzgekriegt, wie man Kinder zeugt und anderen das Aufziehen überlässt, wie man deren Mütter einfach mit einem Anruf aus der Ferne besänftigt, wie man seelenruhig, als bestünde man auf der Sonne und dem Himmel, als wäre alles andere glatter Irrsinn, darauf besteht, dass es vorrangig ihre Arbeit ist, die erledigt werden muss – und zwar als Erstes. Eine solche Stärke, aus jugendlicher Sicht, kennt keine Hunde, Gärten oder Picknicks, keine Kinder, keinen Himmel: Sie konzentriert sich nur auf eine Sache, sei es Geld oder Macht oder Pinsel und Leinwand. Genau genommen ist es eine Fehlsicht – wer halbwegs bei Verstand ist, wird das erkennen. Es ist Kurzsichtigkeit. Aber nur so geht es. Man muss alles andere – alle anderen Menschen – als verzichtbar sehen, weniger wichtig als man selbst.
Ich bin wie die Kinder: Meine Motivation und meine Gründe sind nicht immer klar. Aber wenn ich mich erklären darf, wird alles deutlich; vielleicht beweist schon die Erklärung meine Größe, wie klein auch immer. Alles erzählen und wie es sich anfühlt, wenn möglich. Vielleicht verstehen Sie es dann auch.
3
Ich beginne ganz vorn, aber ich fasse mich kurz. Ich wurde in eine normale Familie hineingeboren, in einer Küstenstadt namens Manchester-by-the-Sea, eine Autostunde nördlich von Boston. Die sechziger Jahre gingen mehr oder minder an uns vorbei, dort am Ende der Pendlerstrecke. Es muss unser perfekter Strand gewesen sein – genannt Singing Beach, wegen seines feinen, blassen, quietschenden Sandes, aber womöglich auch deswegen, weil er so lange schon von allen Seiten gepriesen wird –, der meinen Größenwahn erzeugte. Es leuchtet ein, dass der Mensch, der fast täglich von einer perfekt gebogenen Uferlinie aus den freien Blick auf die Unendlichkeit hat, einen anderen Begriff von der Möglichkeit entwickelt als jemand, der in einem bewaldeten Tal oder in den Straßenschluchten einer Großstadt aufwächst.
Oder vielleicht, wahrscheinlicher noch, kam der Größenwahn von meiner Mutter, die erbittert, eigen und verloren war. Ich hatte eine Mutter und einen Vater, einen großen Bruder – allerdings acht Jahre älter, insofern schienen wir kaum aus ein und derselben Familie zu kommen: Als ich neun wurde, war er schon aus dem Haus –, eine Schildpattkatze namens Zipper und einen räudigen kleinen Mischlingshund aus dem Tierheim, der Sputnik hieß und aussah wie ein Wischmopp auf Beinen, mein Vater arbeitete in Boston bei einer Versicherung – er nahm jeden Morgen den Zug um 7:52 Uhr – und machte das sehr anständig, aber offenbar nicht besonders erfolgreich, denn meine Eltern schienen nie Geld zu haben.
Meine Mutter war Hausfrau, rauchte Zigaretten und schmiedete Pläne. Eine Zeit lang testete sie Rezepte aus Kochbüchern für einen Verlag. Sie wurde dafür bezahlt, und monatelang servierte sie uns aufwendige Drei- bis Vier-Gänge-Menüs mit Soßen aus gequirltem Ei und, wenn ich mich recht entsinne, Marsalawein. Eine – für mich schmachvolle – Weile versuchte sie sich als Modedesignerin und brachte mehrere Monate an der Nähmaschine im Gästezimmer zu, umnebelt von Tabakqualm (oft steckte eine Zigarette zwischen ihren Lippen, während sie einen Saum nähte; ich hatte immer Angst, die Asche könnte auf den Stoff fallen). Ihre Werke waren zugleich ungewöhnlich und nicht ungewöhnlich genug: Sie nähte für Mädchen meiner Größe Minikleider aus Jersey mit Paisleymuster, auf den ersten Blick denen von der Stange nicht unähnlich (»Komm mal her, süße Maus«, rief sie dann, hielt ein Schnittmuster gegen meine vorpubertäre Brust, schnippelte mit ihrer riesengroßen Schere nachlässig am Papier herum, eine Haaresbreite über meiner Hüfte oder meinem Nacken); aber dann sah man, dass sie Bullaugen in die Taille geschnitten und mit Zackenlitzen gesäumt hatte, sodass der weiße Bauch des Mädchens zum Vorschein kommen würde; oder dass sie die Ärmel nicht angenäht, sondern mit einem wirren Geflecht aus bunten Schleifen befestigt hatte, die schon nach der ersten Wäsche zerlumpt aussehen würden. Munter und völlig talentfrei schusterte sie bestimmt zwei Dutzend Outfits in diversen Ausführungen zusammen, in meinem neunten Sommer, und mietete dann in einem Nachbarort einen Stand auf dem Jahrmarkt, um sie anzupreisen.
Ich weigerte mich, an einem strahlenden Samstag im Juli dort mit ihr auf dem Präsentierteller zu sitzen, und begleitete stattdessen meinen Vater bei seinen öden Rundgängen – Reinigung, Schnapsladen, Baumarkt –, erstickte im Auto fast vor Hitze, war aber ungemein erleichtert, dass ich nicht Gefahr lief, unter dem scheußlichen selbstgemalten Schild meiner Mutter von meinen Mitschülern gesehen zu werden. Meine Mutter war eine inniglich geliebte Peinlichkeit.
Sie verkaufte ein paar von den Kleidern, fand aber offenbar nicht, das Experiment sei hinreichend gelungen, und so landete der Koffer samt Inhalt auf dem Dachboden. Es dauerte nicht lang, da wanderte auch die Nähmaschine nach oben, und meine Mutter trat in eine ihrer dunkleren Phasen ein, bis die nächste Erleuchtung über sie kam.
Natürlich flößte mir meine Mutter, anders als mein Vater, das Gefühl ein, dass Unberechenbarkeit eine Tugend sei – »Anders sein als der Nachbar, darum geht es«, sagte sie immer –, und deswegen, weil sie hell wie eine Flamme leuchtete, habe ich sehr lange gebraucht, um zu erkennen, dass auch sie vorsichtig und bürgerlich war, dass auch sie Angst hatte vor dem Unbekannten und selbst so unsicher war, dass sie es kaum ertragen konnte, ein Zeichen zu setzen. Wie sonst hätte sie konsequent mit der Normalität schlechthin verheiratet sein können, mit meinem Vater, mit dem sorgsam geregelten und immer gleichen Alltag von Manchester-by-the-Sea?
Und es erklärt auch viel über mich, über die Grenzen meiner Erfahrung, über die Tatsache, dass der Mensch, der ich in meinem Kopf bin, weit entfernt ist von dem Menschen, der ich in der Welt bin. Anhand meiner eigenen Beschreibung meines Selbst würde mich niemand wiedererkennen; weshalb ich auch, wenn jemand mich nach mir selbst fragt (was zugegeben selten vorkommt), meinen Bericht zurechtschneidere und anpasse, versuche, ein Profil zu entwerfen, das annähernd mit dem übereinstimmt, das mir unterstellt wird – und das ich vermutlich zu dem Zeitpunkt tatsächlich habe. Aber die Frau, die ich in meinem Kopf bin, bekommen sehr wenige zu Gesicht. Fast niemand. Es ist mein kostbarstes Geschenk, diese Frau aus ihrem Versteck zu holen. Vielleicht habe ich gelernt, dass es ein Fehler ist, sie überhaupt sichtbar zu machen.
Von unserer normalen Familie in unserem normalen Haus, einem Holzhaus mit mittigem Portal, Geranientöpfen auf der steinernen Veranda und einer zauberhaft ungepflegten Eibenhecke vor den Fenstern, bahnte ich mir meinen Weg in die normale Welt, in die örtliche Grundschule, die örtliche Mittelschule, die örtliche Highschool. Ich war einigermaßen beliebt, die Mädchen mochten mich im Allgemeinen, die Jungen sogar auch, wenn sie mich bemerkten, allerdings nicht auf romantische Art. Ich war lustig – aber eher platt, nicht eigenwillig. Es war eine bescheidene Währung, wie Kleingeld: prosaisch, etwas mühsam, aber auch Geld. In der Öffentlichkeit war ich lustig, meist auf meine eigenen Kosten.
Schule war damals anders, und ich war gut darin, deshalb übersprang ich die neunte Klasse, ging direkt von der achten in die zehnte, was erst mal freundeskreismäßig etwas schwierig war und mein Schicksal als Katastrophe in Mathe besiegelte – ich habe nie die Quadratformel und andere wichtige Tipps aus dem Matheunterricht der Neunten gelernt; genau wie ich die ersten Datingversuche verpasste sowie die Stunden, wo einem beigebracht wurde, wie man bewegungstechnisch einen Schulball übersteht. Damals aber war mir das nicht peinlich: Es war mir nicht peinlich, nach dem Motto »Friss oder stirb« ins zweite Highschool-Jahr geworfen zu werden, mit nichts, keinem Plan, wie man zur Cafeteria kommt, und ohne Basiswissen über Cliquenbildung, ja nicht einmal mit einer Liste der Namen meiner neuen Mitschüler, die sich alle untereinander kannten, während ich für einige nur die Freundin ihrer kleinen Schwester war. Nein, ich war stolz, weil ich wusste, dass meine Eltern stolz waren, denn es war ein Aufstieg und eine Offenbarung, die besagte, dass ich etwas Besonderes war. Seit langem schon hatte ich es geahnt, und jetzt wusste ich es mit Sicherheit: Ich war für Großes bestimmt.
Als Mädchen lässt du nie durchblicken, dass du stolz bist oder weißt, dass du in Geschichte, Bio oder Französisch besser bist als deine Nachbarin, die achtzehn Monate älter ist als du. Stattdessen schwärmst du davon, wie toll sie Nägel lackieren oder mit Jungs reden kann, und du verdrehst die Augen angesichts des sauschweren Geschichte-/Bio-/Französisch-Tests und sagst: »O Gott, das wird ein Fiasko! Ich hab solche Angst!«, und du machst dich klein, wo immer es geht, damit sich andere nicht von dir bedroht fühlen und damit sie dich mögen, denn sie sollen nicht wissen, dass du tief drinnen stolz bist, vielleicht sogar hochnäsig und zerrissen von Gedanken, deren Bloßlegung allen zeigen würde, was für ein Ekel du eigentlich bist. Du lernst, auf ganz andere höfliche Art mit den Leuten zu reden, damit sie dich bloß nicht klar erkennen, und du weißt – du kriegst es von anderen mit –, dass du für wahnsinnig süß gehalten wirst, und du spürst den Schauder des Triumphs: »Ja, ich bin gut in Geschichte/Bio/Französisch, und auch hierin bin ich gut.« Es kommt dir gar nicht in den Sinn, während du deine Maske so sorgsam zurechtformst, dass sie mit dir verwachsen könnte, dass es dir irgendwann vorkommen wird, als ginge sie nicht mehr ab.
Wenn du dir Josh ansiehst, den Jungen, der mit dir zusammen die Klasse übersprungen hat, und wenn du siehst, wie er sich die Nase am Ärmel abwischt und wie schmächtig er wirkt mit seinem Akneteppich am Kinn, neben den anderen Zehntklässlern mit ihrem breiten Brustkorb und der klaren eckigen Kinnpartie, wenn du beobachtest, dass er immer noch mit seinen alten Kumpels aus der Neunten zu Mittag isst – lauter Jungen in schwarzen T-Shirts mit KISS oder AC/DC in Glitzerschrift, allesamt mit pickligem Kinn, feuchten Lippen und schlaffen Haaren wie Seetang –, dann siehst du in ihm überhaupt nichts Triumphales. Er scheint eindeutig verloren zu haben, verloren zu sein, ein Verlierer; denn schließlich weiß jeder, dass in der Herausforderung, vor die du mit dem Überspringen einer Klasse gestellt wurdest, der Erfolg bei den Mitschülern – bescheidener Erfolg, ja, aber dennoch – die halbe Miete war. Als Frederica Beattie dich auf ihre Geburtstagsparty einlädt – ein Segeltörn auf dem Boot ihres Vaters, zusammen mit sechs anderen Mädchen, von denen zwei zu den beliebtesten gehören –, hast du Mitleid mit Josh, der niemals in einen solchen Genuss kommen wird.
Aber warte: Niemand hat dich je darauf hingewiesen, dass Josh in seiner Verpeiltheit außerordentlich glücklich war. Er hatte sich die Quadratformel schon selbst beigebracht; er würde sich keine schulischen Steine in den Weg legen lassen. Er würde sogar später am MIT studieren und irgendwann Neurobiologe werden mit einem Labor, das weitgehend von den NIH finanziert wurde und ihm ein enormes Budget zur Verfügung stellte. Er würde eine leidlich attraktive, wenn auch ziemlich x-beinige Frau heiraten und mehrere x-beinige bebrillte Nerds zeugen, Abbilder seines Selbst. Es wird alles mehr als gut für ihn laufen, und in ihm wird nie auch nur für eine Sekunde der Verdacht aufkeimen, es hätte anders laufen können. Er wird weder wissen, dass es einen Beliebtheitstest gab, noch, dass er durchgefallen ist. Nein, ein Segeltörn mit dem Boot von Frederica Beatties Vater war eine Ehre, die ihn gar nicht interessierte; und sein Drang nach Geselligkeit, soweit vorhanden, wurde vollkommen befriedigt durch seinen alten Clan, der jetzt einen Jahrgang unter ihm war. Es lag ihm ebenso fern, sich eine Maske zu modellieren, wie zum Mond zu fliegen; also blieb er, wer er war, für immerdar. Weiblichkeit als Maskerade, tja.
Es war auf der Highschool, da beschloss ich – oder, wie ich damals gesagt hätte, da erkannte ich –, dass ich Künstlerin werden würde. Ich hatte eine Gruppe gleichgesinnter Freunde aufgetan, die genau unser Nichterwachsensein feierten, eine Handvoll Mädchen und Jungs, die bei einem Platzregen in die Pfützen sprangen und sich in der Abenddämmerung auf dem Spielplatz versammelten, um auf den Schaukeln zu schaukeln, aber ebenso gut hinter der Kuppel Gras zu rauchen. Unsere Clique fand sich nach der Schule immer öfter im Kunstsaal ein – mit dem stillschweigenden Segen des Kunstlehrers. Er war ein stämmiger Typ in kniehohen Jagdstiefeln und mit Lederwams, üppiger schulterlanger Mähne und rötlichem Spitzbart: Er sah aus wie einer Shakespeare-Aufführung an irgendeinem Provinztheater entflohen, und sein Name war, wie herrlich, Dominic Crace.
Obwohl der Raum offiziell geschlossen war, ließ er Malzubehör für uns draußen stehen, ließ die Schränke offen, ließ Farben und Pinsel am Waschbecken liegen und manchmal sogar auf dem Arbeitstisch den Schlüssel zur Dunkelkammer. In diesem trüben roten Licht erfuhr ich als ängstliche Elftklässlerin meinen ersten echten Kuss, ein nasses Züngeln mit einem Zwölftklässler namens Alf, der vor allem durch seine Lederjacke mit den vielen Reißverschlüssen bestach. Ich fand ihn schon lange gut, doch er entpuppte sich – überraschenderweise, wie ich feststellen musste – als genauso unbeholfen wie ich selbst, was dazu führte, dass der Kuss weder wiederholt noch jemals wieder zur Sprache gebracht wurde. An unserer Freundschaft, soweit vorhanden – eher etwas wie eine ferne Verwandtschaftsbeziehung –, änderte sich nichts; es war einfach, als hätte der Kuss nie stattgefunden, und später fragte ich mich manchmal, ob es ihn überhaupt gegeben hatte.
Wir, die wir uns für subversiv hielten, schmachtend nach den abenteuerlichen Zeiten, die wir qua später Geburt so knapp verfehlt hatten, blieben dort im Kunstsaal, bis es dunkel wurde, malten Poster und beschrifteten großformatiges Malpapier, das wir in den Gängen mit Klebestreifen an der Wand befestigten. REBELLIERE!, stand dort in knalligen Primärfarben, MEIDEDIEBEQUEMLICHKEIT!, WEISSTDU, WODEINESEELEIST? und VERGISSDENKONSUM! KÜSSEEINENANARCHISTEN!
Während Dominic Crace auf unserer Seite war, waren die Hausmeister paradoxerweise – ein nützliches Lehrstück in Sachen Revolution – der Feind: Nachts streiften sie durch die Flure und hatten die Aufgabe, vor der Schulversammlung am nächsten Morgen unsere unautorisierten Plakate von den Wänden zu reißen. Unser Trick war es, die besten Werke in Ecken aufzuhängen, wo die Hausmeister sie nicht finden würden, oder zumindest nicht, bevor sie von möglichst vielen gesehen worden waren. Wir waren mit Begeisterung dabei, sie zu malen, sie aufzuhängen, am nächsten Tag nach Hinterbliebenen zu suchen: LIEBEDEINENNÄCHSTENWIEDICHSELBST, mit der himmelblauen Silhouette eines sich umarmenden Pärchens; das Zitat THEY F- YOUUP, YOURMOMANDDAD war ein Beitrag meiner Mutter und überlebte eine ganze Woche in der Turnhalle auf der Innenseite der Tür des Basketballschranks. Aber der ehrlichste Spruch – SCHULE: WOZUDASGANZE? – wurde von Mr Evers, unserem Direktor, in der Schulversammlung stirnrunzelnd hochgehalten. Er sagte, wir seien zwar alle für freie Meinungsäußerung, aber derlei Sprüche dienten unserer Schulgemeinschaft wenig und seien demoralisierend. Zudem machten sie einen schlechten Eindruck auf Besucher. So etwas sei kein gutes Aushängeschild für die Manchester High School. Er legte uns nahe, es gebe vielerlei Wege, seine Meinung kundzutun, und diejenigen, die Fragen aufwerfen oder Kritik zum Ausdruck bringen wollten, könnten sich gern bei der Schülerzeitung engagieren. Damit hoffte er dem Spuk ein Ende zu setzen.
Dominic Crace, der genau wusste, wer wir waren, hielt dicht, und er schloss auch fortan die Malsachen nicht ein; und wir, die uns über Mr Evers’ selbstgefällige Ansprache lustig machten, saßen nichtsdestotrotz wie Fliegen in einer Falle, angelockt durch die Wonnen des Kunstsaals. Im Jahr darauf, meinem letzten Schuljahr, schrieben sich alle, die noch auf der Schule waren – Alf hatte zusammen mit ein paar anderen seinen Abschluss gemacht, und wir waren nur noch zu zehnt, eine Gruppe aus diversen Jahrgängen –, für die Kunst-AG ein.
Unsere erste Hausaufgabe bestand darin, eine Biene in einer Geige in einer Birne zu zeichnen. Alle nahmen Crace beim Wort und fertigten quälend kleinteilige Bleistiftzeichnungen an, die immer kleiner wurden wie die Puppe in der Puppe. Niemand war besonders gut im perspektivischen Zeichnen, aber manche kriegten es besser hin als andere. Ich machte nicht mal den Versuch zu zeichnen. Ich ging nach Hause und baute eine große Pappmascheebirne aus einem Kleiderbügel – zwei getrennte Hälften, die ich später zusammenfügte – und schlug sie mit Goldfolie aus. Ich bastelte eine Geige aus einer Streichholzschachtel und dem ausgeschnittenen Bild aus einem Hochglanzmagazin, und ich fing mit dem alten Kescher vom Dachboden eine Honigbiene, die im Lavendel meiner Mutter unterwegs war. Ich erstickte sie in einem Glas.
Nachdem ich sie mit Schellack schön glänzend angestrichen hatte, legte ich die schlafende Biene in die halb geöffnete Streichholzschachtelgeige, klebte diese in die Birne und baute dann mit Hilfe meines großen Bruders (er muss zu der Zeit schon in Tucson gelebt haben, war aber wohl gerade mit Tweety, seiner späteren Frau, zu Besuch) eine kleine Glühlampe, ähnlich wie ein Nachtlicht, in die Birne ein, bevor ich sie versiegelte, und zog das Kabel diskret aus dem Boden der Birne. Das Wichtigste aber war, ich bohrte ein Guckloch durch die Schale, durch die Pappmascheewand, damit man hineinsehen konnte; und noch heute muss ich sagen, wenn man den Schalter betätigte und die Goldfolie im Innern der Birne erstrahlte, war die glänzende Biene in ihrer Streichholzschachtelgeige von eigenartiger Schönheit. Ich beschloss, dass es eine rote Birne sein sollte, und malte die Außenseite in herrlichen Rottönen an, mit vielen Lagen Farbe, bis sie dick und glänzend war. Ich gab mir sehr viel Mühe – ich liebte die Sinnlosigkeit des Unterfangens; es war so erfüllend und zugleich eine Antwort auf meine früheren Plakate. Dazu, Mr Evers, dachte ich damals, dazu ist das Ganze gut. Und als ich meine Arbeit in den Unterricht mitbrachte und neben die vielen Bleistiftzeichnungen stellte, erlebte ich in einem Rausch, wie Mr Crace die Finger unter dem Kinn zusammenlegte (und damit diskret an seinem teuflischen Spitzbart zupfte) und hörbar in sich hineinlachte.
»Dies hier«, verkündete er und sah uns nacheinander an mit schelmischem Blick, der plötzlich weniger an Petruchio als an Willy Wonka erinnerte, »dies hier ist ein wahres Kunstwerk.« Er hielt inne, beugte sich vor und spähte hinein zu meiner Biene in ihrer Kammer, richtete sich auf und fuhr herum. »Von wem ist es? Von wem? Von dir? Ich hab’s gewusst. Gut gemacht, Nora Eldridge«, sagte er. »Gut gemacht, meine Liebe.«
4
Sirena war Künstlerin – ist Künstlerin. Richtige Künstlerin, was immer das bedeutet. Jetzt ist sie sogar bekannt, in bestimmten, wichtigen Kreisen. Obwohl sie in Paris lebt, ist Sirena keine Französin; sie ist Italienerin. Das liegt nicht auf der Hand, denn ihr Nachname ist Shahid, und der Vorname ihres Mannes ist Skandar, und ihr Sohn hat denselben Namen wie der letzte Schah von Persien – nicht dass einer von ihnen auch nur annähernd persisch wäre. Sie mochten einfach den Namen. Skandar stammt aus dem Libanon, aus Beirut. Okay, irgendeiner seiner Vorfahren stammte aus Palästina, aber das ist lange her; und zumindest ein Teil der Familie, ich glaube, väterlicherseits, hat immer in Beirut gelebt. Skandar ist halb Christ, halb Moslem, was sicherlich manchen Leuten einiges sagt, nur nicht unbedingt mir. Außerdem wollte ich gar nicht von Skandar erzählen, der erst sehr viel später in der Geschichte auftaucht, sondern von Sirena, mit der er verheiratet war – und ist – und die Italienerin und Künstlerin ist.
Man hätte durchaus denken können, dass auch Sirena aus dem Nahen Osten stammte, und zwar wegen ihrer zarten olivfarbenen Haut, die bei ihrem Sohn aussah, als wäre er mit Puder bestäubt, sie mit ihrem edlen Körperbau jedoch alt und jung zugleich wirken ließ. Jung, weil ihre Wangen so voll und glatt waren wie eine Frucht. Sie hatte keine Falten, nur in den Augenwinkeln eindrucksvolle Krähenfüße, als hätte sie ihr Leben damit zugebracht, zu grinsen oder in die Sonne zu blinzeln. Und sie hatte Furchen von der Nase bis zu den Mundwinkeln, aber das waren keine richtigen Falten, das war nur Mimik. Ihre Nase war gebogen, ausgeprägt, italienisch, nehme ich an, und die zarte Haut spannte sich darüber und glänzte manchmal ein wenig. Dort auf dem Nasenrücken waren ein paar Sommersprossen wie ein kleiner Sprühregen aus Sand. Sie hatte die Augen, Rezas Augen, und seine grimmigen schwarzen Brauen und glattes, seidig glänzendes schwarzes Haar mit silbernen Strähnen. Sie war nicht jung – selbst als ich sie kennenlernte, Reza war acht, muss sie um die fünfundvierzig gewesen sein; aber man hätte sie jünger geschätzt. Es waren die Augen – das Lebendige in den Augen – und die Krähenfüße. Paradoxerweise machten sie sie jünger.
Eigentlich hätte ich sie beim Begrüßungsabend Ende September kennenlernen sollen – wenn die Eltern am frühen Abend in die Klassenzimmer kommen, nachdem sie sich auf rätselhafte Weise ihres Nachwuchses entledigt haben, um sich in die Schulbänke ihrer Kinder zu quetschen und zuzuhören, wie die Lehrerin mit ansteckender Begeisterung die Freuden des Einmaleins und die mysteriöse Wichtigkeit des Erlernens von Schreibschrift darlegt. Dieser Präsentation folgen eine Rede vonseiten der Direktorin Shauna McPhee in der Aula und die obligatorische laue, gallertartige Pizza und warme Cola, die wir, die belagerten und mittlerweile ausgelaugten Lehrer, am Ende auch noch wegräumen müssen.
Wäre ich Sirena früher begegnet, hätte ich mir die Mühe gemacht, sie anzusprechen, das weiß ich; aber so, wie es war, kannte ich sie ja schon, weil Reza verprügelt wurde. Na ja, das stimmt nicht ganz: Ich neige schon immer zur Übertreibung. Aber angegriffen wurde er, und verletzt wurde er auch.
In der dritten Schulwoche, an einem Mittwoch, dem ersten wirklich frischen und herbstlichen Tag in dieser Jahreszeit, gingen nach der Schule auf dem Pausenhof drei Fünftklässler auf Reza los, während er allein – oder »einzelnd«, wie es die Kinder manchmal bezaubernderweise formulieren – auf dem Klettergerüst turnte. Erst bewarfen sie ihn mit Bällen – nicht mit kleinen Bällen, sondern mit Basketbällen, und nicht zum Spaß, sondern fest, und sie zielten in böser Absicht auf ihn. »Ich dachte, die spielen Völkerball«, sagte ein anderes Kind, das in der Nähe war; aber leider hatte niemand Reza zu diesem Spiel aufgefordert, wobei er damit ohnehin nichts hätte anfangen können. Und irgendwie eskalierte die Sache. Einer der Jungen, Owen, ein großer Junge und keine Leuchte, wie ich leider sagen muss, nachdem ich ihn ein Jahr lang im Unterricht hatte und meine liebe Not, ihn am Ende des Schuljahres zu versetzen, packte Reza am Kragen, drückte ihn gegen das Gerüst und schlug ihm mit der Faust aufs Ohr. Er beschimpfte Reza als »Terroristen« und sagte, der Pausenhof sei nur für Amerikaner. Es dauerte eine Weile, bis der Ablauf des Vorfalls geklärt war, und in dem Zusammenhang stellte sich heraus, dass Owens Onkel im Irak gewesen war und an einer posttraumatischen Belastungsstörung litt; aber ehrlich gesagt, nichts davon konnte das schreckliche Ereignis entschuldigen oder erklären.
Ich sah gerade die Aufsätze der Kinder durch – na ja, »Aufsätze« klingt etwas hochtrabend, es waren drei Absätze zum Thema »Unser Schulausflug zum Apfelgarten«. Jedenfalls saß ich im Klassenzimmer an meinem Pult, als Bethany, eine der drei blutjungen Collegeabsolventinnen, die auf dem Pausenhof Aufsicht führen, wenn die Kinder nach Schulschluss Spielzeit haben, ihn zu mir brachte. Sie war so geistesgegenwärtig gewesen, ihm eine kalte Kompresse auf sein rot geschwollenes Ohr zu packen, aber Reza war blass und zitterte, dicke Tränen hingen in seinen Wimpern. Bethany war zu jung oder zu schüchtern, um das zu tun, was nötig gewesen wäre, nämlich sich mit ihm hinzusetzen, den Arm um ihn zu legen, mit ihm zusammen zu atmen und ihn zu beruhigen und dann, ohne sich aus seinem Blickfeld zu bewegen, das Handy und seine Akte zu holen, seine Mutter anzurufen und sie zu bitten, ihn abzuholen.
Erst ärgerte ich mich über Sirena, denn mit langsamer, fremder und leiser Stimme gab sie mir zu verstehen, dass Maria, seine Babysitterin, in einer Dreiviertelstunde ohnehin da sein würde. Ich atmete – absichtlich – hörbar ein und aus und sagte: »Unter diesen Umständen, Mrs Shahid, wäre es, glaube ich, eine gute Idee, wenn Sie selbst kommen würden, und zwar so bald wie möglich.«
»In zehn Minuten bin ich da. Viertelstunde höchstens.«
»Wir warten hier im Klassenzimmer«, sagte ich. »Kommen Sie, so schnell Sie können.«
Und ich setzte mich wieder zu Reza, legte den Arm über seine Stuhllehne, um ihm ein Gefühl von Sicherheit zu geben, und sagte: »Magst du eine Limonade? Ich hab eine in meiner Tasche. Und wie wär’s mit einem Oreo-Keks?« Ich drängte ihm Zuckerwasser und Kekse auf und entlockte ihm die Geschichte, und so kannte ich zumindest die nackten, unentschuldbaren Fakten, als Sirena eintraf. Trotz der besagten Tränen in den Wimpern, wie Regentropfen in einer Spinnwebe, weinte Reza nicht, er hatte nur ein bisschen Schluckauf, und sein Atem wie auch seine kleinen Schultern bebten.
Ich war stinksauer – auf die drei Schläger, auf Bethany, Margot und Sarah, die es irgendwie geschafft hatten, überhaupt nichts mitzukriegen, und irgendwie auch auf Rezas mir noch unbekannte Mutter, weil sie ihn in einem fremden Land schutzlos und allein gelassen hatte, weil sie ihn einem System und Menschen anvertraut hatte, über die sie nichts wusste. Wäre er mein Sohn, hätte ich das niemals getan. Ich hätte ihn auf Händen getragen und beschützt, auch – aber nicht nur – aus Prinzip, sondern vor allem, weil er Reza war, dieser strahlende kostbare Junge.
Als sie dann mit vorsichtigem Klopfen durch die Scheibe sah und die Tür einen Spaltbreit aufschob, sprang ich auf, bereit für eine gesalzene Standpauke, aber sie nahm mir sofort den Wind aus den Segeln. Der Schmerz in ihren Augen, die ja seine Augen waren, und ihr kleiner Sprint durch den Raum, um ihn in den Arm zu nehmen – ihre Gegenwart, kurz gesagt –, reichten vollkommen aus. Ich kann nur raten, was sie sagten. Sie sprachen Französisch; sie hatte ihn in den Arm genommen, er schmiegte das Gesicht an ihre Brust, als wäre es Balsam für seine Seele, ihren Duft einzuatmen. Er war eigentlich schon zu groß für eine solche Geste – den meisten meiner Drittklässler wäre es unangenehm gewesen, vor der Lehrerin ihre Gefühle auf diese Art zu zeigen, und ich bewunderte Sohn und Mutter für die Gleichgültigkeit mir gegenüber. Es dauerte gut ein bis zwei Minuten, bis sie den Kopf hob, einen Arm herauswand und ihn mir hinstreckte. »Miss Eldridge«, sagte sie. »Schön, Sie endlich kennenzulernen.«
»Tut mir leid, dass es nicht unter besseren Umständen geschieht.«
Andeutungsweise zuckte sie mit den Achseln. »Ich bin froh, dass Sie angerufen haben.«
»Es gab einen Vorfall, auf dem Pausenhof.«
»Das dachte ich mir.«
»Ich war nicht dabei, aber nach dem, was Reza sagt, trifft ihn keinerlei Schuld.«
Sie verzog das Gesicht, als wollte sie sagen: Wie auch?
»An unserer Schule wird Mobbing nicht geduldet, Mrs Shahid –«
»Das glaube ich.«
»Und wir werden dieser Sache genauestens nachgehen und die Jungen bestrafen.«
»Natürlich.«
»Es tut mir besonders leid, dass die Jungen offenbar gesagt … dass die Jungen offenbar beleidigende und anstößige Dinge gesagt haben. Sie müssen wissen, dass wir hier an unserer Schule bisher keine … Wir haben noch nie … So etwas ist ganz und gar unüblich. Und wir werden dafür sorgen, dass es auf keinen Fall –«
»Ich verstehe.« Sie stand auf und Reza mit ihr, als wären sie an der Hüfte zusammengewachsen. Dann lächelte sie – kam es, weil es sein Lächeln war? Vielleicht, wobei das in dem Moment nicht mein Gedanke war. Was mir durch den Kopf ging, so klar und deutlich, als hätte ich es laut ausgesprochen, war: »Ach, du