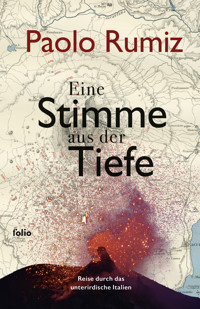
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Transfer Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Stimmen aus der Tiefe, wo es brodelt, bebt, giftige Dämpfe und Erinnerungen aufsteigen. Auf der Reise zu den Grundfesten Italiens, von Sizilien bis Neapel, über den Apennin bis ins Friaul, tut sich ein Inferno an Verwerfungslinien auf. Das ist der Stoff für Rumiz' leidenschaftliche Erkundungen in der Welt des Minotaurus. Er besteigt zerklüftete Berge auf den Äolischen Inseln und die Krater des Ätna, erkundet unterirdische Quellen im Karst, Höhlen der Eremiten in Kalabrien und frühchristliche Katakomben in Rom. Er befragt alte und neue Kulte und Mythen, spricht mit Menschen aus Wissenschaft, Politik und von der Straße und erzählt so vom Alltag im Schatten des Unvorhersehbaren. Wie leben auf so unsicherem Terrain? Geschichten von Katastrophen, Unwägbarkeiten und Wundern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DER AUTOR
Foto © Alessandro Scillitani
Paolo Rumiz, geboren 1947, lebt in Triest und im slowenischen Karst. Segler, Wanderer, Autor eigenwilliger Bücher. Korrespondent aus Krisenregionen, schreibt er seit 1998 Reportagen von seinen Radtouren nach Istanbul, den Bus-, Anhalter- und Fußreisen zu den Rändern Europas oder in die Arktis. Er segelte entlang der alten Handelsrouten Venedigs und verbrachte drei Wochen auf einem einsamen Leuchtturm im Adriatischen Meer.
Bei Folio sind erschienen: Der Leuchtturm (2017),Die Seele des Flusses (2018), Via Appia (2019), Der unendlicheFaden (2020), und Europa. Ein Gesang (2023).
DIE ÜBERSETZERIN
Karin Fleischanderl übersetzt aus dem Italienischen und Englischen, u. a. Gabriele D’Annunzio, Pier Paolo Pasolini, Melania G. Mazzucco, Giancarlo De Cataldo.Österreichischer Staatspreis für literarische Übersetzung.
„Dieses Buch erzählt von Echos und Dröhnen, Zischen und Fauchen. Es will Sie zu einer akustischen Reise einladen. Über Laute lässt sich am besten beschreiben, was in der dunklen Welt unterhalb der Erde vor sich geht, in dem geheimnisvollen Universum von Hephaistos und Hades, wo Kontinentalplatten entlang verzweigter Verwerfungslinien aufeinanderprallen, Vulkane explosive Magmakammern speisen und in Höhlen menschlich anmutende Rufe ausgestorbener Lebewesen ertönen.„
Paolo Rumiz
Eine Stimme aus der Tiefe
Reise durch dasunterirdische Italien
Aus dem Italienischenvon Karin Fleischanderl
Für Roberto De Simoneund das Land, das ihn geprägt hat.
Inhalt
Vorwort für die Leser jenseits der Alpen
Und der Wind spielte Ziehharmonika
1.Ein Feuer mitten auf dem Meer
2.Das Donnern der Sonne bei Sonnenuntergang
3.Schwefellichter
4.Der Schlüsselexorzismus
5.Wo man ohne Musik tanzt
6.Der Herr der Strömungen
7.Chöre im Namen Persephones
8.Bier und Crostini alla ’Nduja
9.Die Höhlen der Waldheiligen
10.Eine auf den Kopf gestellte Pyramide
11.Die Pignatta der Zauberin
12.Ein Brummen im Keller
13.Trommeln und Schellen
14.Ein Klavier auf halber Höhe in der Luft
15.Rebellische Mönche und Banditen
16.Auf dem Berg mit den Mädchen
17.Das Bergwerk von Brosso
Die uralte Stimme der Erde
Vorwortfür die Leser jenseits der Alpen
Aber nun schweigt still und hört einfach zu. Dieses Buch erzählt von Echos und Dröhnen, Zischen und Fauchen. Es will Sie zu einer akustischen Reise einladen. Über Laute lässt sich am besten beschreiben, was in der dunklen Welt unterhalb der Erde vor sich geht, in dem geheimnisvollen Universum von Hephaistos und Hades, wo Kontinentalplatten entlang verzweigter Verwerfungslinien aufeinanderprallen, Vulkane explosive Magmakammern speisen und in Höhlen menschlich anmutende Rufe ausgestorbener Lebewesen ertönen. Um von all dem erzählen, es evozieren zu können, benötigt man ein Arsenal von Gleichnissen und Metaphern, dessen die Welt an der Oberfläche kaum bedarf.
Stromboli, der perfekte Kegel, der mitten im Tyrrhenischen Meer unaufhörlich grollt und Lava ausspuckt: Erst nach Erscheinen dieses Buches im italienischen Original war ich dort. Einige wenige Tage auf Stromboli haben mir bestätigt, wie richtig die akustische Lesart ist. Vielleicht vermag nur sie die unterirdische Unruhe meines Landes schlüssig zu deuten: das Erschauern eines Italien, in dem sich Geschichte, Legende und Geologie Schicht um Schicht überlagern und Impulse aus der Tiefe dafür sorgen, dass die Oberfläche ständig verrutscht, sich windet, absackt, bebt und Vulkane ausbrechen und dröhnen. Eine Welt, die den Bewohnern der alten, mittlerweile zur Ruhe gekommenen Landstriche Nordeuropas fremd ist.
In Stromboli muss man unbedingt übernachten. Erst wenn das letzte mit Touristen vollbesetzte Tragflügelboot abgelegt hat, der Kontakt zum Festland abgebrochen ist, kann man sich der Insel ausliefern, sich ihrer tiefschwarzen Silhouette überlassen. Erst wenn sich Dunkelheit und Stille auf die Insel herabsenken, erhebt die Bestie ihre Stimme. Man braucht nicht mal ins Freie gehen. Es genügt, das Ohr wie ein Stethoskop auf das Kopfkissen zu legen und aufmerksam zu lauschen. Manchmal nicht einmal das. Man muss nur wach bleiben und Geduld haben.
Schlaflos habe ich mir Notizen gemacht, geduldig alle Tonlagen, -nuancen und Frequenzen, die mein Ohr wahrzunehmen vermochte, registriert. In manchen Momenten glaubte ich, vor den Toren eines riesigen Stahlwerks zu stehen und die Geräusche von Entlüftungsventilen, Hammerschläge, das Zischen schmelzenden Metalls und das dumpfe Krachen von Blech zu vernehmen. Auf Intervalle der Stille folgte immer wieder ein Dröhnen, als würde ein Brontosaurus gähnen. Dann änderte sich alles: ein Lärm, als würde etwas über den Boden geschleppt, als würden schwere Gegenstände verschoben, wie wenn im Stockwerk über uns jemand Hals über Kopf auszieht. Woher sollte die griechische Idee von einem Gott des Feuers und der Schmiedekunst stammen, wenn nicht von diesen Klängen?
Gewiss, es ist herrlich, auf Stromboli die Sciara del fuoco zu bewundern, die beeindruckende Nordwestflanke des Vulkans, auf der Unmengen glühender Lava, Lapilli und Schlacke ins Meer rutschen. Und es ist ein einzigartiger Anblick, wenn diese Ströme bei der Berührung mit Wasser ein pyrotechnisches Inferno entfesseln: Die Dämpfe ballen sich unvermittelt zu rotgrauen, blumenkohlartigen Kumuluswolken zusammen. Aber das ist nur Theater, ein spektakuläres Bühnenbild an der Oberfläche. Etwas, das auf den Handy-Bildschirmen landet und nichts mit dem Stoffwechsel der Erde zu tun hat.
Orte werden bei Tag betrachtet und bei Nacht verstanden. In den dunklen Stunden reinen Lauschens, wenn die Bilder erloschen sind, verbeugt sich der Mensch vor der Macht der Natur, verliert jegliche Art von Anmaßung. In diesem Augenblick, bevor die Hähne krähen, wird er sich seiner Begrenztheit bewusst. Dann geht er hinaus, um auf den nachtschwarzen Klippen den Sonnenaufgang zu erwarten und dem Donnern der Brandung zu lauschen, angesichts des Meeres, das ebenfalls unermesslich ist.
An solchen Orten überwältigt uns die Welt der Wahrnehmungen und verändert uns zutiefst. Ich vertrieb mir die Zeit auf der Insel damit, streunende Hunde und wildernde Katzen zu beobachten. Eingerollt auf einem Mäuerchen oder reglos in der Heide liegend, erfassten ihre Ohren wie ein Radar selbst in Momenten der tiefsten Ruhe die Geräusche des Universums. Auf der Nordseite der Insel sah ich auf dem Grab eines namenlosen Schiffbrüchigen einen Kormoran stehen, der, wie man an seinen aufgerissenen Augen erkennen konnte, Wache am Krater hielt, aus dem Luftströme drangen. Diese Geschöpfe Gottes bringen eine Art vollständiger Akzeptanz des Lebens als Unsicherheit und ständiger Übergang zum Ausdruck; eine wertvolle Lektion für uns Menschen.
Am 25. Mai 2022 verursachte ein italienisches Fernsehteam einen riesigen Brand oberhalb des Dorfes Stromboli, dem ein ganzer Wald aus Sträuchern und ein paar Bäumen zum Opfer fiel. Ironie des Schicksals: Das Team sollte eine Doku-Fiction über Katastrophen- und Brandschutz drehen. Das Feuer war im Rahmen der Dreharbeiten gelegt worden, um zu zeigen, wie es durch menschliches Eingreifen gelöscht werden konnte.
Die Inselbewohner hatten davor gewarnt, dass ein solches Unterfangen angesichts des heftigen Windes an diesem Tag riskant wäre. Doch das Fernsehteam hielt an seinem Vorhaben fest, und die rasch außer Kontrolle geratenen Flammen verwandelten den Vulkan in eine riesige Fackel mitten im Meer. Nicht die Protagonisten der Doku verhinderten, dass das Feuer auf die Häuser übergriff, sondern die unerschrockenen Inselbewohner, die noch vor Eintreffen der Feuerwehr eine Menschenkette bildeten und mit allem, was sie zur Verfügung hatten, auf die Flammen einschlugen.
Auch das war, abgesehen von Rauch und Flammen, ein akustisches Erlebnis. Die harzreichen Pflanzen knisterten und wanden sich wie Seelen in einem dantesken Höllenfeuer. Das Prasseln des Feuers, das sich deutlich von dem Bariton-Grummeln des Vulkans abhob, warnte davor, dass die größte Gefahr auf der Insel vielleicht nicht von der Natur, sondern vom Menschen ausging.
Einen Höllenkrach verursachte auch die Schlammflut, die Stromboli in der Folge des Brandes heimsuchte. Das Feuer hatte die Vegetation vernichtet, die das bewohnte Gebiet schützte. Vor dem Erdrutsch ertönte über der ganzen Insel ein Grollen, das nicht von einer Eruption stammen konnte. Es waren Felsbrocken, die, von sintflutartigen Regenfällen ausgeschwemmt, zu Tal rollten.
Von einer solchen Erfahrung, bei der man Wasser, Erde, Feuer und Wind zugleich erschallen hört, kehrt man verändert zurück. Man versteht mit einem Mal den Griechen Empedokles und seine Theorie der vier Elemente. Man versteht den Fatalismus jener, die sich weigern, die bebende Erde zu verlassen, die Hartnäckigkeit derer, die darauf bestehen, in unmittelbarer Nähe eines Vulkans zu leben. Man möchte im Augenblick verharren, möchte Höhlen erforschen und dort Zuflucht suchen wie ein Eremit. Man lernt, auf das zu hören, was sich unter uns befindet, statt auf die Oberfläche zu starren. Man wird zum Seismografen. Und versteht, dass sich die wahre Hölle an der Oberfläche befindet.
Und der Wind spielte Ziehharmonika
Um zwei Uhr nachts ertönte plötzlich ein Jaulen wie von Hunden. Ein langes, nervtötendes Heulen, wie von Seelen im Fegefeuer. Es kam von mehreren Teilen der Insel: von der Mole, an der die Fähren anlegten, aber auch vom Krater. Ich lag in diesem Augenblick auf der Terrasse, hellwach. Gemeinsam mit Irene hatte ich die Matratze hinausgeschleppt, um unter dem Sternenhimmel zu liegen und den Westwind zu genießen. Doch wir waren noch nicht eingeschlafen. Für Neuankömmlinge war es schwierig, in einem Haus zu schlafen, das an einem Vulkan mitten im Meer klebte.
Auf Alicudi, der abgelegensten der Liparischen Inseln, misst man Entfernungen in Stufen, und an diesem Tag waren wir etwa ein halbes Tausend hinaufgestiegen, auf labyrinthischen Pfaden und in der Sonne glühenden Terrassen – ein Maultier hatte unser Gepäck getragen –, bis wir zu einem winzigen gelben Haus in der Contrada Pianicello gelangten; pertuso wird so ein Häuschen in Sizilien genannt. Ein Loch. Aber auch ein idealer Schlupfwinkel.
Das Jaulen dauerte eine Minute, höchstens zwei. Allmählich wurde es kühl, und zwischen uns und dem Himmel befand sich nur eine grobe Wolldecke. Auf dem dreißig Meilen östlich gelegenen Stromboli blinkte ein Licht, und in diesem Augenblick dachte ich, die Inseln vor uns lägen wie Pünktchen im Meer, wie die Euganeischen Hügel in der Landschaft des Veneto, wo Irene zur Welt gekommen war. Auch sie waren vulkanischen Ursprungs und lagen in der Po-Ebene, die ebenfalls einmal ein Meer gewesen war.
Nach dem Heulen wurde es wieder still. So still, dass uns das Zirpen der Zikaden nahezu betäubte und das Blut in den Ohren hämmerte. Nach drei sehr windigen Tagen breitete sich das nunmehr glatte und ruhige Meer unter uns aus, so weit das Auge reichte, glänzend wie eine Stahlplatte. Über uns kreiste der Tierkreis samt seinen Prophezeiungen.
Bergwind, Rauschen, Flüstern. Die Stimme eines Nachtvogels ertönte in der Macchia, wurde leiser, verstummte und ertönte aufs Neue.
Kurz vor zwei war eine rötliche, nahezu durchscheinende Mondsichel über Kalabrien in einem von Diademen übersäten Himmel aufgegangen. Die Sterne des Südens mit ihrer Aureole wirkten wie brennende Fackeln. Kein Handyempfang. Auf der Insel genoss man eine luxuriöse Abgeschiedenheit und Kargheit. Alles Notwendige war da: Wasser, etwas Essen, Notizblöcke, Kugelschreiber, Taschenlampe. Zum Frühstück Feigen, man brauchte nur die Hand auszustrecken und sie von hohen natürlichen Kandelabern zu pflücken.
In der ungeheuren Stille wurde das in den Grundfesten der Erde verankerte Land der Arcudari für einen Moment zu einem Katapult, das uns abschoss wie einen Asteroiden, der furchtlos durchs All fliegt, sich von seinem Mutterstern entfernt und dabei zischt wie ein Falke im Sturzflug. Er hinterließ eine Tonspur im Nichts.
Wir hatten mit Luciano zu Abend gegessen, einem Piloten, der seit einigen Monaten im Ruhestand war. Ich glaube, er hatte Alicudi zu seinem Wohnsitz erkoren, um … weiterzufliegen. Tatsächlich war sein Leben ein langes, leises Landen gewesen, wie das eines Segelflugzeuges, und sein Haus in der Contrada Serro Pagliaro war ein großartiges Cockpit. Es klammerte sich in einer Höhe an den Berg, von wo man, wie er sagte, die Erdkrümmung sehen konnte.
Fast schon in der Dunkelheit war er mit seinem Hund gekommen, auf verschlungenen Pfaden auf halber Höhe des Hügels, die er auswendig kannte. Er lebte weit entfernt von der Hölle des Tourismus, doch er war kein wirklicher Einsiedler. Seine Gefährtin wohnte auf Filicudi, der Insel gegenüber, eine Ausländerin, der ein grauer, unglaublich fauler Esel Gesellschaft leistete. Mit einem guten Fernglas konnte er sie sogar sehen. Zwischen ihnen lag eine halbstündige Fahrt mit dem Tragflügelboot; eine Entfernung, die ausreichte, um jede Begegnung zu etwas Besonderem zu machen.
Spaghetti mit Oliven, Kapern und getrockneten Tomaten: eine einfache Mahlzeit. Luciano hatte kalten Weißwein aus Lipari mitgebracht, der Geschichten über eine Insel voller Wunder sprudeln ließ.
Auf Alicudi, so erfuhr ich, kann einem das Brot zu Kopf steigen: Der Weizen ist von einem Mutterkornpilz namens Erba Jonica, einem Verwandten von LSD, und einem parasitären Pilz namens Claviceps Purpurea befallen. Eine jahrhundertealte psychedelische Tradition der Brotherstellung, die heute nicht mehr üblich ist, aber nach wie vor Halluzinationen erzeugen kann.
Wir befanden uns in einer Welt, wo Frauen „fliegen“ können, denn während der Überfälle der Osmanen wurden die Mädchen, um sie vor Vergewaltigung zu schützen, mit Seilen in eine Höhle am Steilufer hinuntergelassen, in das sogenannte „Weiberloch“.
In dieser Gegend erzählte man auch noch die Legende der mahare, angeblicher Hexen, die sowohl verzaubern konnten als auch über den bösen Blick verfügten, sich in Tiere verwandeln und die Rückkehr der Fischer begünstigen oder verhindern konnten. Angeblich waren es Frauen aus der Fremde, die den Hexensabbat unter dem berühmten Nussbaum in Benevent gefeiert hatten.
„Frauen von auswärts“, sagte man.
Doch auch die ansässigen Frauen hatten zur Mystik der Insel beigetragen und taten das noch immer. Starke Frauen, Frauen aus Stein. Sie überlieferten den alten Glauben. Hochverehrte Frauen, die Alicudi zu einem weiblichen Universum machten. Matriarchinnen wie Rosina, die elf Kinder von mehreren Männern bekommen hatte, oder Großmutter Peppa, die ihre Suppen mit Steinen aus dem Meer kochte, damit sie würziger schmeckten.
„Hin und wieder bekommt man hier einen heillosen Schrecken“, sagte der einsame Pilot. „Als ich eines Nachts zu Hause war, hörte ich in der totalen Stille eine Mundharmonika im Garten spielen. Mit zitternden Knien habe ich nachgesehen, doch es war nur der Wind, der in die Löcher meiner Mundharmonika eindrang, ich hatte sie auf einem Mäuerchen liegen lassen.“
Auf Alicudi fällt es einem leicht, sich in einer eigenen Welt zu wähnen. Selbst ein Fremder wie Luciano empfindet Menschen „von außerhalb“ als Fremde. Wenn die Arcudari am Festland an Land gehen, erkennt man sie sofort an ihrem verlorenen Blick, als würden sie aus einer anderen Zeit stammen.
Das liegt nicht nur an der extremen Abgeschiedenheit, sondern auch an dem Wissen, dass man auf einem schlafenden Vulkan wohnt, nah am Großen Feuer. Doch es liegt auch an der Vertrautheit mit dem Aufruhr der Elemente und den Meeresungeheuern, ganz zu schweigen von der nahezu absoluten Finsternis der Nacht.
Bis in die Achtzigerjahre gab es auf der Insel einen einzigen Stromgenerator, der um Mitternacht abgeschaltet wurde und die Insel in absolute Dunkelheit versetzte, die Halluzinationen verhieß.
Hephaistos war ein Bewohner der Liparischen Inseln gewesen, wie auch Poseidon, der Gott der Stürme und Erdbeben.
Äolus, den Gott der Inseln, hörte man sogar aus dem Inneren der Berge pfeifen.
„Fast jedes Haus, das am Hang klebt, hat auf der Rückseite Zugang zu einer Höhle oder einem vom Menschen geschaffenen Tunnel, der das Haus belüftet. Eine Luftströmung, die sommers wie winters als natürliche Klimaanlage wirkt.“
Der Vulkan schien noch immer zu brummen: Nachts, wenn rundherum Stille herrschte, hörte man seine Stimme.
Eine halbe Stunde, nachdem der Pilot gegangen war, hörte man das erste Heulen von der Contrada Montagna, in der Nähe des Kraters. Kurz darauf antwortete ein Heulen von den Häusern rund um den Giardino dei Carrubi und der Mole am Strand, wo die Tragflügelboote anlegten. Der ganze Vulkan schien nervöse Signale zu den Sternen emporzusenden.
„Da zog der Herr vorüber: Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elija es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle.“ (Erstes Buch der Könige, Kapitel 19, 11–13)
Dann herrschte Windstille. Und die Stille rief die Stimme aus der Tiefe. Eine schwache Baritonstimme erhob sich aus dem Nichts, kroch durch die Matratze und füllte den Brustkorb, wo sie sich immer mehr ausbreitete. Sie machte „uuuh“, und erinnerte mich an das Rieseln von Kieselsteinen im Flussbett. Für einen langen Augenblick wirkte es wie etwas viel Düstereres, ein schmerzvoller Ruf. Oder vielleicht wie ein Frauenchor, der nur aus Altstimmen bestand. Tief und brüllend.
Wir waren gelähmt, wie am Rand eines Strudels. Der Ton war dumpf, ein leiser, immer lauter werdender Trommelwirbel. Wir dachten, er kündige eine Eruption an, doch man spürte weder Beben noch Vibrationen. Wir standen in direktem Kontakt mit der Erde, und die Erde schickte uns ein Zeichen.
Die sternlose Welt rief uns. Ihr kalter Hauch stieg aus Abgründen auf. Aus einem unverletzlichen Anderswo, in das Elon Musks Satelliten noch nicht ihre Nase stecken konnten.
In diesem Augenblick blinkte der Stromboli hinter Filicudi und Panarea noch heftiger, und im Südosten erhob sich der schneebedeckte, schwach vom Mond beleuchtete Kegel des Ätna. Die Landschaft in einem Umkreis von Meilen schien sich zu bewegen.
Danach verstummte das Brummen.
Wir schwiegen lange. Und in diesem Schweigen erinnerte ich mich an meine Volksschulfreundin Marina. Sie hatte jeden Sommer auf der Insel verbracht, und das zu einer Zeit, als hier noch niemand Urlaub machte. Zwischen ihren Schulterblättern hing ein dicker blonder Zopf, und bei Kerzenlicht faszinierte sie uns mit Geschichten aus ihren Schulaufsätzen voller Gewitterstürme und Meeresböden, die nach Jules Verne klangen. Oft umrundete sie schwimmend ihren Vulkan.
Eines Tages erzählte mir Marina, sie habe den Bauch des Berges dumpf grummeln hören. „Es klingt wie ein Gesang“, sagte sie, „man hört ihn aber nur, wenn es still ist. Nachts.“
Ihre Geschichte hatte mich bezaubert, und jetzt, mehr als sechzig Jahre später, tauchte sie wieder ganz deutlich auf, wie eine Verschollene aus einem unerforschten Meeresgrund.
Am Tag darauf wurde das Geheimnis gelüftet. Silvio, ein Fischer mit zerfurchtem Gesicht, der als lebendes Gedächtnis der Insel galt, servierte uns unter der Pergola einen Teller Linguine mit meisterlich zubereitetem Hummer, der gleichzeitig ligurisch und phönizisch schmeckte. Hin und wieder trat eine Frau mit frischen Tellern durch die Tür. Die Küche war eine Höhle, das ausschließliche Reich der Frauen. Nur Silvio, der Fischer, hatte Zutritt.
Als ich die Geschichte des nächtlichen Polterns erzählte, meinte der Pilot, eine gewisse Nunziatina, Gattin eines gewissen Angelino Barbuto, höre diese Stimme oft. Sie wohnte etwas höher in der Nähe des Friedhofs und sagte, die Stimmen kämen aus dem Jenseits. Ein Ruf der Toten.
Silvio fügte hinzu, die Sache käme ziemlich oft vor und die Ortsansässigen hätten dem Laut sogar einen Namen gegeben: u trenu – der Zug. Ein merkwürdiger Begriff, denn das Grollen des Berges klang fürs Erste überhaupt nicht wie das Rattern eines Zuges. Das Grollen in Moll erinnerte allenfalls an das Knirschen von Wägelchen, die in einem dunklen Bergwerk Erze transportierten, oder an etwas Ähnliches.
Luciano brachte uns auf den Boden der Tatsachen zurück und erklärte uns, ein banaler Temperaturunterschied sei für das Phänomen verantwortlich. Der Berg war von Höhlen durchzogen, und die Luftströmungen in diesen Höhlen waren so stark, dass sie die Steine bewegten, die sich in unerreichbarer Tiefe befanden. Felsbrocken, die von der Nähe zum Magma erhitzt wurden, wurden nach oben geschleudert, erkalteten und fielen wieder nach unten, worauf sie sich erneut erhitzten. Eine endlose Strömungsbewegung.
Tja, aber warum „der Zug“? Die Frage wurde nicht beantwortet und wir unterhielten uns über etwas anderes. Über Themen wie „das Privileg der Langeweile“, die in unserem hektischen Leben keinen Platz hatte – ein Recht, das man auf Alicudi jedoch zur Gänze in Anspruch nehmen konnte. Oder „der Luxus der Wettervorhersage“, der jede Überfahrt zu einem kleinen Abenteuer machte. „Das Schönste“, sagte eine Frau aus Bergamo, die mit uns am Tisch saß, „ist, dass man nicht weiß, ob die Fähre ablegen kann oder nicht. Der Genuss des Wartens. Der Genuss, sich dem Wind, ánemos, zu unterwerfen, dem Atem der Erde.“
Dieses Philosophieren war sehr griechisch und machte mich Mitteleuropäer zu einem mehr als überzeugten Südländer. Hier in Alicudi verspürte ich immer deutlicher, dass ich das Recht hatte, mir den Kopf leer zu machen und – warum nicht – bei einem Glas Malvasier über das Nichts zu philosophieren.
Viel später erfuhr ich von einem Kalabresen, dass trénos ein griechisches Wort ist und „Klage“ oder vielmehr „Totenklage“ bedeutet. Die griechische Sprache war in dieser Gegend weitverbreitet. Es gab auch brontidi – ebenfalls ein schönes Wort, das auf brontòs, Donner, zurückgeht und die kleinen Erdbeben im Inneren der Vulkane bezeichnet. Sie waren auch an anderen Orten, in der Nähe des Monte Amiata in der Toskana oder im Bauch des Vulture in der Basilikata zu spüren.
Allmählich wurden wir Visionäre. Und unter dem Eindruck dieser Offenbarungen wurde die Oberfläche des Tyrrhenischen Meeres zu einer winzigen Isohypse, angesichts der riesigen Wassermenge, die den viertausendfünfhundert Meter tiefen Meeresgrund bedeckte, sieben Millionen Jahre alt und von merkwürdigen Kathedralen bevölkert.
Diese Oberfläche trennte eine Welt, in der das, was oben herausragte, nichts anderes war als die Fortsetzung dessen, was darunter war: ein riesiger Raum, der aus Böschungen, Tälern, Canyons, Plateaus, Bergketten, Brüchen und Verwerfungen bestand und in dem immer wieder Stöße und beeindruckende Kollisionen stattfanden.
Der Unterschied zwischen den beiden Welten bestand wahrscheinlich nur in der Zeit. Oben maß man in Minuten. Darunter in Zeitaltern. Hephaistos schmiedete auch in Unterwassergrotten. Das war eine absolut richtige Wahrnehmung: Es gab nicht nur sieben Liparische Inseln, sondern darüber hinaus zahlreiche untergegangene Vulkane mit griechischem Namen – Äolus, Alkyon, Sisyphos und die Lametini-Berge.
Überall im südlichen Tyrrhenischen Meer verbergen sich gigantische erloschene Vulkane. Vor dem Cilento liegt der Palinuro, zusammengekauert wie eine Eidechse, und sein Krater liegt so knapp über der Wasseroberfläche, dass ein guter Taucher sehen könnte, wie weit er den Rachen aufreißt, obwohl er erloschen ist.
Im Nordosten schläft der Vavilov, ein Ungeheuer, so hoch wie der Ätna, der von Russen entdeckt worden war. Angeblich hat ihn ein U-Boot gefunden, das in geheimer Mission unterwegs war, sich mitten im Kalten Krieg in den Bosporus einfädelte wie in ein Nadelöhr und unter einer Reihe von Lastschiffen durchtauchte. Eine Geschichte wie aus 20.000 Meilen unter dem Meer, das vielleicht den Film Jagd auf Roter Oktober inspiriert hat.
Doch der größte submarine Vulkan liegt weniger als fünfzig Meilen nördlich von Alicudi. An seinen Flanken finden sich frische Basaltströme und Schwefelkristalle, und niemand kann mit Sicherheit sagen, ob er tatsächlich erloschen ist oder nur in einer Ruhephase. Vor Kurzem wurden verdächtige Bewegungen rund um den Krater festgestellt; vielleicht eine wiedererwachte Aktivität nach siebenhunderttausend Jahren von Eruptionen.
In den Siebzigerjahren hatte seine Entdeckung der noch jungen Disziplin der explorativen Ozeanografie neue Horizonte eröffnet. Sein Name ist legendär: Marsili, nach Luigi Ferdinando Marsili, einem Bologneser, der Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts lebte, dessen romanhafte Geschichte allerdings in keinem Schulbuch vorkommt.
Ein Universalgenie wie Leonardo, der die Strömungen im Bosporus entdeckte, Wien gegen die Türken verteidigte, von den Türken gefangen genommen wurde und dann mit ihnen eine der beständigsten Grenzen Europas festlegte. In Bologna hatte ich die Ketten berührt, in die man ihn gelegt hatte. Sie waren an der Universität ausgestellt, und ich hatte in seiner faszinierenden Histoire physique de la mer geblättert.
Submarine Vulkane: Bereits die Antiken wussten über sie Bescheid, und wie! Ante nos et iuxta Italiam inter Aeolias insulas …, schreibt Plinius der Ältere. „Vor unserem Zeitalter tauchte mitten unter den Äolischen Inseln eine Insel auf, und so auch in der Nähe von Kreta. Eine war 2500 Schritte lang und besaß heiße Quellen; eine andere tauchte im dritten Jahr der 163. Olympiade (126 vor Christus) vor Etrurien auf, hier blies ein glühend heißer Wind, und man erzählt, dass alle, die die Fische aßen, die in großer Zahl um die Insel schwammen, sofort starben.“
Bevor wir in Alicudi an Land gingen, hatten die tüchtigen Liparoten mit uns die Inseln umrundet, vom grünen Salina bis zur rauchenden Kathedrale Vulcano. Sie hatten uns die schlaflose Erde mit ihren höllischen Magensäften, ihrem Schluckauf gezeigt.
Vor dem Fischerboot, mit dem wir auf smaragdgrünem Wasser an den Küsten entlangfuhren, stürzten erkaltete Lavaströme ins Wasser, die aussahen wie die Klauen eines Brontosaurus, messerscharfe Menhire ragten in die Höhe und unter uns erblickten wir in allen Farben schillernde, fischreiche Meerestiefen, wir sahen mit Olivenbäumen bewachsene Terrassen und Abschürfungen von alten Bergwerken.
Das Bild einer reichen und ruhelosen Welt, geprägt von Eruptionen, Erdbeben, Invasionen und Kriegen, die nichtsdestotrotz seit Jahrtausenden Menschen anzog, die fähig waren, sich an etwas zu klammern, was so instabil, gefährlich und veränderlich war, wie die Erde nur sein konnte.
Im Archäologischen Museum der Inselhauptstadt wird ganz einfach und mithilfe einer Fülle von Fundstücken die Geschichte der Phönizier, Römer, Griechen, Araber, Juden und Karthager aufgerollt. Ihre Gesichter spiegeln sich in den Theatermasken aus Terrakotta wider, die in Gräbern gefunden wurden, oder in den Profilen mythologischer Figuren auf Keramikvasen.
Ihre Physiognomien ähneln auf unglaubliche Weise den Gesichtern der zeitgenössischen Einwohner, die man in Bars, auf der Straße, am Anlegeplatz der Fähre oder einer Imbissbude trifft, die Reisbällchen verkauft. Wie Giancarlo, Bartolo oder Liborio, ein Aristophanes’ würdiges Triumvirat, das sich gern zu nächtlicher Stunde traf, Lehrmeister südländischer Gastlichkeit und Heimatverbundenheit. Ihrer epikureischen Haltung folgend, hatte ich Lipari in Latschen erforscht, bequem, als wäre ich dort zu Hause. Ein Luxus, den ich seit Jahrzehnten nicht mehr erfahren hatte. Dort, in engem Kontakt mit der Tiefe, gaben mir die Liparischen Inseln die Zeit zurück.
Ich hatte eine spezielle Italienkarte nach Alicudi mitgenommen. Sie begleitete mich seit dem Erdbeben in L’Aquila 2009, als ich in meiner Eigenschaft als Journalist die seismisch aktiven Zonen des Landes erhoben hatte.
Es war weder eine physische noch eine politische Karte, doch sie erzählte, was unter der Oberfläche liegt. Ein Meisterwerk des CNR, des Centro Nazionale delle Ricerche. Sie hieß: strukturellkinematische Karte, im Maßstab eins zu zwei Millionen. Renato Funiciello, ein leidenschaftlicher Geologe, hatte sie mir geschenkt. Auch in Hinblick auf die Malerei, die Auswahl der Farben der jeweiligen Zeitalter und der Kontraste ein Meisterwerk.
In der Nacht, als die große Klage ertönte, hatte ich eine Taschenlampe angemacht, in deren Licht das Violett des Mesozoikums, das vulkanische Rot des Pleistozäns, das Ockergelb der „plutonischen Felder“ im nördlichen Tyrrhenischen Meer leuchteten. Mehr als sechzig Farben erzeugten einen Farbsturm, der besser als jede politische Karte die Vielschichtigkeit meines Landes darstellte, das inmitten des Mittelmeers zwischen drei Kontinenten lag. Ein Land mit einer unruhigen Topografie, seit Jahrtausenden ein idealer Zufluchtsort für migrantische Völker.
Renatos Karte erzählte eine Millionen Jahre währende Geschichte. Sie zeigte zum Beispiel, dass die Adria stark nach Nordosten drängt und Apulien und den Gargano hinter sich herzieht, und dass Kalabrien sich ein paar Millimeter pro Jahr Richtung Griechenland bewegt, sodass die Halbinsel eine Drehbewegung um Ligurien vollzieht.
Die Karte der Wunder zeigte, dass das Tyrrhenische Meer sich ausdehnt, während das Ionische Meer sich zusammenzieht und Stöße in Richtung Osten schickt, die Griechenland und die Türkei in Unruhe versetzen. Sie erinnerte die fanatischen Nationalisten daran, dass die Po-Ebene in geologischer Hinsicht zu Afrika gehörte und Europa allenfalls bis Süditalien reicht.
Doch der Apennin war das wahre Farbwunder dieser Kreisbewegung. Im Norden, in Richtung der Alpen, nahm die Komplexität rasch ab. Hinter der Schweiz und Tirol wurden die Farben bleich und bedeckten monotone Räume. Die Palette des kontinentalen Europas stellte sich kurz gesagt viel weniger interessant dar. Ruhige, von der Zeit abgehobelte Länder, die oft keine Ahnung vom Brüllen des Minotaurus hatten. Bleiche Länder, in denen die Erde nicht bebt, nicht brodelt, nicht bricht, keine Eruptionen kennt und keine Meeresbeben hervorbringt.
Im Apennin hingegen schuf die Erde großartige Skulpturen: Fossa Bradanica, Messinian Chain, Tyrrhenian rifting, Cobblestone Area of the Ionian Sea. Namen mit mythologischen Anklängen, die – als ich noch ein Kind war – gemeinsam mit den Farben der Geologie die Faszination für die Tiefen der Erde in mir weckten.
In dieser Nacht fiel mir ein, dass ich schon einmal die Stimme aus der Tiefe gehört hatte. Es war im Resia-Tal in den Julischen Voralpen gewesen, nach dem katastrophalen Erdbeben von 1976. Nach einem langen Arbeitstag mit anderen Freiwilligen hatte ich mich eben im Zelt hingelegt. Rund um mich schroffe, menschenleere, abweisende Berge, gezeichnet von riesigen Narben.
In diesem Augenblick hörte man plötzlich ohne Vorankündigung, und einige Sekunden vor dem eigentlichen Erdstoß, ein Donnern. Ein tiefer, höllischer Bass, wie von einem Heer von Trompeten, Fagotten, Oboen und Englischhörnern, übertrug sich von der Erde durch meinen Körper direkt in meine Lungen.
Nach ein paar bangen Minuten, die endlos lang schienen, verzerrten sich die Felsen und stürzten in die Tiefe, während die Reibung zwischen den einzelnen Schichten Schwefelgeruch freisetzte. In so einem Augenblick ist man winzig klein.
Etwas Ähnliches erlebte ich noch einmal vierzig Jahre später, an einem Ort, wo ich es niemals erwartet hätte: im Shoah-Museum im Mailänder Bahnhof. Bei einer Konferenz anlässlich des Internationalen Gedenktags, in Anwesenheit von Liliana Segre, ertönte aus dem hohlen Boden unter dem Gleis 21, von dem die Juden aus der Lombardei heimlich in Konzentrationslager geschickt wurden, ein langgezogenes Donnern.
Es war nur ein abfahrender Zug, der auf der darüberliegenden Ebene, auf dem Fundament des Mailänder Hauptbahnhofs, ratterte, doch in diesem langen Augenblick hatte man das Gefühl, die Bisons, die vor sechzigtausend Jahren auf die Wände der Höhle in Altamira gezeichnet worden waren, seien ausgebrochen und hätten im Galopp das ganze Mailänder Eisenbahnnetz niedergetrampelt und dabei ein Dröhnen, einen warnenden Widerhall erzeugt, der noch stärker, heftiger und dunkler war als unsere Worte.
Ein Donnern, das uns zum Schweigen brachte.
In diesem Augenblick in Mailand dachte ich zum ersten Mal, dass die Unterwelt eine Stimme hatte und dass diese Stimme bei ihrer Verbreitung ein riesiges Fresko schuf, auf dem das Schreckliche der Natur mit der Unterwelt der Menschen eine Verbindung einging.
Seismische Verwerfungen und Brüche, unterirdische Flüsse, Luftschutzkeller, Höhlen mit paläolithischen Malereien, Bradyseismen, unterirdische Gänge, ozeanische Lager, Atombunker, die Höhlen der frühen Eremiten. Eine Welt, bestehend aus Vulkankratern, Bergwerken, Karstquellen, Katakomben, Miasmen, ein Labyrinth von Tunneln, U-Bahnen, Gefängnissen, Krypten mit den Sarkophagen von Heiligen, unerforschten Brunnen, Meeresböden voller Relikte, Waffen aus alten Kriegen, die noch immer Blitze anziehen und im Falle eines Brandes explodieren konnten.
Dieses Buch musste erst noch geschrieben werden, eine monumentale Dark Symphony, die wahrscheinlich nie einen Komponisten finden würde. Das Labyrinth war zu weitläufig. Vielleicht machte es zu viel Angst, in die Keller einer Terra incognita einzudringen, der uns direkt zu unserem Unbewussten führen und Abgründe in uns aufreißen würde.
Schon die Stimme des erloschenen Vulkans lud mich zu einem speläologischen Abstieg in Richtung der wahren, äußersten Grenze ein. Dem Unbewussten. Doch fürs Erste empfahl es sich, das Reich des Minotaurus mit einem guten Ariadnefaden zu betreten: der seismischen Linie, die von Sizilien bis zu den Alpen reicht.
Jahre davor hatte ich das Hauptquartier des INGV, des Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologica, in Rom besucht. Dort war mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die Grundfesten der Erde in der Lage waren, hörbare Signale zu senden und sich die Erschütterungen am einfachsten akustisch darstellen ließen.
Eine Wand des riesigen, halbdunklen Saals des Instituts wurde fast zur Gänze von einem leuchtenden Bildschirm eingenommen, auf dem über ein mit Tausenden Seismografen verbundenes Display die Halbinsel dargestellt war. Dieser Schirm „spürte“ Erschütterungen in einem Abstand nicht von Tagen oder Stunden, sondern Minuten; das Epizentrum wurde durch ein blinkendes rotes Licht auf der Karte angezeigt, während eine Orgel die ersten, unverwechselbaren Töne von Beethovens Fünfter anstimmte – dieses Echo hallt in mir noch immer wider wie ein in einer Kathedrale angestimmtes Confutatis maledictis.
Abruzzen, Magnitude 2,4. Sila-Gebirge, 2,0. Irpinia, 1,5. Ionisches Meer vor Syrakus, 1,8. Die hohe Frequenz, aufgrund der das feine Knistern zu Musik wurde, besagte, dass Erdbeben auf der Halbinsel keine Ausnahme, sondern die Regel waren.
Der Donner in c-Moll war ein fixer Bestandteil des Rückgrats Italiens und stellte es besser dar als die Nationalhymne, doch das wussten die Italiener nicht, sie zogen es sogar vor, es nicht zu wissen. Von Eruptionen oder einer bebenden Erde zu sprechen, bringt Unglück, es bringt Politiker in Verlegenheit, ruiniert den Baulöwen das Geschäft, versetzt Reisebüros in Angst und Schrecken und bringt die Profiteure des Kurzlebigen gegen dich auf.
Lieber verleugnen, dass die Po-Ebene in keiner Weise stabil ist, weil unterhalb des größten Flusses von Italien Europa und Afrika aufeinandertreffen. Niemand wird Ihnen erzählen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts in Rimini Hotels eingestürzt sind und dass vor vierzig Jahren der Torre dell’Orologio abgerissen wurde, nachdem er nach einem Erdstoß einsturzgefährdet war.
Es ist beunruhigend, dass Ischia sich vor den jüngsten Erdbeben in dreißigtausend Jahren um achthundert Meter gehoben hat oder dass Messina und Reggio Calabria sich ständig senken, außer in den Pausen zwischen zwei Erdbeben, in denen sie sich heben.
Bologna, das in Gleichgültigkeit versinkt, ist an der Plünderung des Po-Wassers schuld. Der Montello im Veneto hebt sich doppelt so schnell wie die Alpen, aufgrund eines mörderischen Drucks, dessen Ursprung nicht wirklich bekannt ist. Pozzuoli ist in wenigen Monaten um eineinhalb Meter gewachsen und bebt noch immer, die Menschen sind gezwungen, draußen, im Auto oder sonst wo zu schlafen, um rechtzeitig davonlaufen zu können.
Und dann noch die Vulkane, Krater, Geysire, heißen Quellen, Fumarolen, ganz zu schweigen von den Erdöllagern. Überall Löcher wie in einem Emmentaler-Käse. Doch trotz der Erdbeben in L’Aquila, Ischia und Amatrice ist das Donnern aus der Tiefe nach wie vor das Symbol der chronischen Amnesie der Italiener.
Ohne dass ich es wusste, führte der rote Faden vieler meiner Reisen durch ein bebendes Labyrinth, durch den unruhigen Untergrund der nationalen Identität, wurde ein Seismograf ihrer Ängste, Laster und Verdrängungen und verband sich mit einer Geschichte, die von Piratenüberfällen, glühend heißen Sommern und unzeitgemäßen Schneefällen, Erdrutschen, Zerstörungen, Schiffbrüchen, Kriegen, Invasionen, Stürmen, Prozessionen und apokalyptischen Ängsten gekennzeichnet ist.
Meine Reisen auskultierten die kleinsten Schwingungen eines Italiens voller Votivgaben und Schuldgefühle, Vorahnungen und Beschwörungen, Litaneien und Kinderreime, Dämonen und Schwarzer Madonnen. Sie führten in die Widersprüche eines merkwürdigen Landes, wo man schon aufgrund eines kleinen Bebens stirbt, wo man Razzien gegen Einwanderer veranstaltet, statt es mit korrupten Baulöwen aufzunehmen. Eines Landes, das nicht auf einer Bruchlinie steht, sondern eine Bruchlinie ist.
Unvergessliche Nächte in Alicudi. Die Milchstraße glühte hinter einer sich im Wind biegenden Zypresse wie auf einem Gemälde von Van Gogh. Der abnehmende Mond stieg zum Zenit auf, und ich folgte ihm, ohne allzu viele Fragen zu stellen, in der kühlen Nacht, in der immer neue Düfte aufkamen: Mastix, Feige, Rosmarin.
Ich dachte, Italien sei einzigartig auf der Welt, mit seiner Mischung aus Wissenschaft, Mythos und Geschichte, die so faszinierend und so stark in der Unterwelt verhaftet war. Kalifornien ist nichts dazu im Vergleich. In Italien sind das Schöne und das Schreckliche – wie das Seismische und das Fruchtbare – kein Widerspruch, sondern eine geheimnisvolle, in den Eingeweiden der Erde verborgene Einheit.
Es heißt, Empedokles hätte sich, um das Wesen der Eruption zu erforschen, kopfüber in den Krater des Ätna gestürzt, worauf dieser seine Sandalen ausspuckte. Hannibals Ankunft in Italien wurde angeblich von schweren Erdstößen angekündigt. Und angeblich hauste der Zyklop Polyphem in einer Höhle zu Füßen des Ätna.
Unendlich viele Sibyllen wohnten in den Höhlen der bebenden Berge des Apennins, und bis heute stimmen die Bruderschaften in Sessa Aurunca am Karfreitag einen Gesang an, der sich tremuoto, Erdbeben, nennt.
Wir verbrachten noch weitere Nächte im Freien, immer unter dem Eindruck dieser Stimme. In der letzten Nacht sah ich kurz vor dem Morgengrauen beleuchtete Schiffe auf die Meeresenge von Messina zulaufen. Hinter dem schwarzen Bergrücken Kalabriens erhob sich die Morgenröte.
Etwas später erhellte sich auch im Süden eine Bergkette. Monti Nebrodi, Monti Peloritani, Madonie. Schroffe, unruhige, flüchtige Berge. Bei ihrem Anblick glaubt man, ein stürmisches Meer hätte sich wie durch Zauber in Stein verwandelt.
Ich erinnerte mich an meine erste Begegnung mit Sizilien: der Monte Pellegrino, der wie eine Warze aus dem Meer aufragt, auf der langen Welle des Hochplateaus zwischen Partinico und der Piana degli Albanesi, afrikanischer Geruch nach verbrannten Stoppelfeldern, frischem Brot und schon aus der Ferne sichtbaren Müllhaufen, streunende Hunde auf der Mole der Fähren, die den Eingang zum Hades bewachten.
Und dann der Abstieg von den Tempeln in Segesta unter einer afrikanischen Sonne zu den Dünen, wo duftende Lilien wogten, deren Geruch noch intensiver war als der von Jasmin.
Aber vor allem erinnere ich mich an mein Staunen angesichts dieser gewalttätigen Topografie, die in einem blendend gelben Licht lag.
Dieses Licht und der in den Bergen Siziliens verborgene Donner waren daran schuld, dass ich beschloss, von dort aufzubrechen und meine Reisen entlang der italienischen Berge neu zu lesen, um die Stimme aus der Tiefe zu hören.
Ich war der Sohn einer bebenden Erde. Ich gehörte zu ihr und wollte einen Blick in ihr Inneres werfen. Mit Aladins Lampe hineingehen.
1.Ein Feuer mitten auf dem Meer
Ab insidiis diaboli, ab omni malo libera nos Domine.
Eine Reise in die Unterwelt erfordert ein spezielles Gepäck. Amulette zum Beispiel. Ich hatte ein ganz besonderes: ein Evangelium aus äthiopischem Pergament, geschwärzt vom Kerzenrauch und durchsetzt mit dem Geruch vieler Hände. Auf dem Deckel aus Eukalyptusholz befand sich eine Abbildung des heiligen Georg – gemeinsam mit dem bärtigen Nikolaus, dem wichtigsten Heiligen des Orients –, wie er gerade ein Schwert in den Rücken des Drachen rammt, als wolle er ihn in die Unterwelt verbannen.
Es war im Juni 2009, ich fuhr mit dem Schiff nach Pantelleria. L’Aquila war von einem Erdbeben zerstört worden und Freunde aus Neapel, die wussten, dass ich ins Inferno unterwegs war, hatten mir ein kleines Horn aus roter Koralle, einen Glücksbringer, geschenkt.
Zum ersten Mal hatte ich auch einen kleinen Computer dabei, um mithilfe von Satellitenbildern die verrückt gewordene Topografie des italienischen Südens zu lesen. Exorzismus und Technologie lagen friedlich in meinem Rucksack nebeneinander.
Das Wetter war gut. Ein schwacher Gregale und kaum bewegtes Meer. Eine italienische Fregatte kreuzte auf der Seite von Mazara, am Rande des italienischen Territoriums. Ich brach aus dem tiefen Süden auf, von einem Meer, in dem vereinzelt die ersten illegalen Migranten unterwegs waren, Schlepper und Fischkutter, die sich um den Blaufisch streiten.
Doch unter der Oberfläche war auch die Straße von Messina in Aufruhr. Aufgrund des nicht sehr tiefen Meeres sah man besser als im Tyrrhenischen Meer, wie die Erde unter Wasser schillerte. Der Abgrund unter dem Abgrund, das transparenteste Zeichen der Unterwelt in der Oberwelt.
1831 war für einige Tage ein Vulkan aus dem Meer aufgetaucht, sein Feuerschein war von Dutzenden Schiffen gesehen worden. In einem alten Buch wird die Geschichte der Insel, Ferdinandea genannt, erzählt, „die nach einem kurzen Leben, von der Brandung zerstört, unterging“. Die Engländer, „die immer nach Herrschaft trachteten, fühlten sich veranlasst, sie symbolisch in Besitz zu nehmen, indem sie eine Fahne darauf aufstellten“, was eine diplomatische Verstimmung mit dem Königreich beider Sizilien bewirkte, bis das Verschwinden der Insel „das Problem löste“ und die Sache bereinigt war.
Derselbe Autor, Angelo D’Aietti, erzählt, 1891 habe Pantelleria dasselbe Schicksal erfahren. „Der Ausbruch hatte sich seit dem Vorjahr auf heftige Weise angekündigt, ungefähr vierzig Brunnen waren eingebrochen und die nordöstliche Küste hatte sich gehoben …“
Eines Tages begannen die Glocken spontan zu läuten, „wie bei einem Begräbnis“, dann „begann das Meer auf geheimnisvolle Weise zu schäumen und zu brodeln, und plötzlich erhob sich ein noch nie gesehener Auswuchs, in dem manche ein Meeresungeheuer von ungeahnter Größe zu erkennen glaubten. Dann wurde der Auswuchs flach, verwandelte sich in einen nahezu ein Kilometer langen Streifen, aus dem jede Menge Rauch, unheimliche Flämmchen und erschreckende Geräusche austraten“. Darauf folgte das große Finale, mit „fantastischen Leuchtfeuern“, einem Regen von Projektilen, „Schwefeldioxiddünsten“ und einer „höllischen, aus Donnern und Detonationen bestehenden Sarabande“. Das Ganze endete nachts „mit einem riesigen Feuer, das sogar an den gegenüberliegenden Küsten Tunesiens und Siziliens mit Staunen bewundert wurde“. Ein „wunderbares Bengalfeuer“, das die Inselbewohner, die sich in der Hauptkirche versammelt hatten, nur löschen konnten, indem sie einen Umzug mit den Knochen des heiligen Fortunato veranstalteten.
Merkwürdigerweise war sogar der Meeresboden in der Nähe der sizilianischen Küste wenig erforscht. Es dauerte noch viele Jahre, bis die Unterwasserberge beobachtet wurden. Erst 2023 wurden drei neue Vulkane gegenüber Sciacca und Mazara del Vallo entdeckt, einer davon war sechs Kilometer breit und befand sich in einer Tiefe von hundertfünfzig Metern.
Die Expedition wurde von einem internationalen Team geleitet, zu dem auch eine Gruppe Triestiner vom Osservatorio Geofisico Sperimentale gehörte. Landsmänner, Söhne eines Landstrichs, der mit der Unterwelt vertraut war, und die ich bei meinen Reisen noch oft treffen würde.
Ich musste mich mit dem Sizilien auseinandersetzen, das dem Averno auf dem italienischen Festland, dem Eingang zur Unterwelt, am ähnlichsten war. In Sizilien befand sich der größte aktive Vulkan des Landes, es trug noch immer die Narben des heftigsten Erdbebens, das sich in den letzten zweitausend Jahren ereignet hatte und von dem es zerstört worden war. Einer Katastrophe Ende des 17. Jahrhunderts im Südosten der Insel, die fünfzigtausend Tote gefordert hatte.
Gewiss konnte ich meine Reise nicht auf Sardinien beginnen, einer Insel, die aus altem Granitgestein bestand und von allen Inseln im Mittelmeer die geringste seismische Aktivität aufwies. Eine Stabilität, die sich auch im Charakter der Bewohner widerspiegelte. Seit ich die Sarden kenne, erscheinen sie mir in jeder Hinsicht als ein Volk, das mit beiden Beinen fest auf der Erde steht. Ebenso vertrauenswürdig, treu und vorhersehbar wie misstrauisch, rätselhaft und verschlossen. Im Gegensatz zu den Neapolitanern ohne eine Spur von Nervosität und Extrovertiertheit.
Aber es gab auch noch einen anderen Grund, warum ich von Sizilien aufbrach.
In unserer Welt wird der Tod so gut wie möglich verborgen, doch Sizilien stellte ihn aus, organisierte spektakuläre Begräbnisse, mordete auf offener Straße, und stellte ihn sogar in Metzgereien und Fischhandlungen zur Schau. Der Tod nicht als Ende des Lebens, sondern als ein ständiges Rieseln in Richtung des Nichts.
Auf dem Markt in Syrakus, wo die dargebotene Ware den Lebenskampf in großen Meerestiefen dramatisch darstellte, glänzte das Messer des Fischverkäufers, der es so kundig führte wie ein Stierkämpfer; auf den Theken lagen Steinbrassen mit der Angelschnur zwischen Maul und Schwanzflosse, im Todeskampf erstarrt.





























