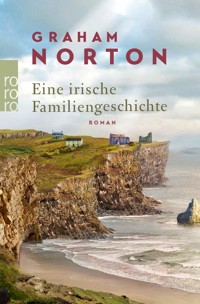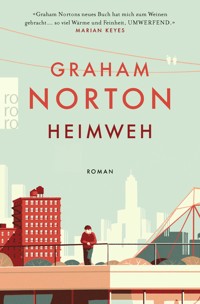19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Frankie ist warmherzig und klug; eine Frau, die Sie unbedingt kennenlernen sollten!» Bonnie Garmus New York, 1965: Völlig mittellos strandet Frances Howe mit Mitte zwanzig in New York City. Für die junge Frau aus der irischen Provinz ist die fremde Großstadt beängstigend, aber auch wild und aufregend. Die Wolkenkratzer sind endlos, die Nächte lang, in den Straßen von Greenwich Village vibriert das Leben. Und Frankie, die bisher immer eine Nebenrolle im eigenen Leben gespielt hat, lässt sich treiben. Dann lernt sie Joe kennen, der als Chauffeur arbeitet, aber eigentlich als Künstler erfolgreich werden will. Joe und Frankie verlieben sich und tauchen gemeinsam ein in die Kunstszene der Stadt. Ein Leben, das vor Intensität nur so lodert. Frankie hilft in einem französischen Restaurant aus und macht es bald zum angesagtesten Lokal des Viertels. Endlich, so scheint es, spielt sie die Hauptrolle in ihrem Leben. Doch dann kommt auch Joe zu Ruhm. Frankie erkennt den Mann, den sie liebt, kaum noch wieder. Und plötzlich droht ihr alles, wofür sie gekämpft hat, zu entgleiten … Eine faszinierende Geschichte über Freundschaft, Liebe und Schmerz, über Kunst und New York, so bewegend, traurig-schön und schillernd wie nur Graham Norton sie schreiben kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Graham Norton
Eine wie Frankie
Roman
Über dieses Buch
«Frankie ist eine Frau, die Sie unbedingt kennenlernen sollten!» Bonnie Garmus
New York, 1965: Völlig mittellos strandet Frances Howe mit Mitte zwanzig in New York City. Auf die junge Frau aus der irischen Provinz wirkt die fremde Großstadt beängstigend, aber auch wild und aufregend. Die Wolkenkratzer sind endlos, die Nächte lang, in den Straßen von Greenwich Village vibriert das Leben. Und Frankie, der es immer so vorkam, als würde sie eine Nebenrolle im eigenen Leben spielen, ist mittendrin. Sie verliebt sich in den Chauffeur Joe, der als Künstler erfolgreich werden will. Joe und Frankie tauchen tief ein in die Kreativenszene der Stadt. Ein Leben, das vor Intensität nur so lodert. Endlich, so scheint es, spielt Frankie die Hauptrolle in ihrem Leben. Bis ihre Vergangenheit sie einholt. Und ihr plötzlich alles zu entgleiten droht, wofür sie gekämpft hat …
Vita
Graham Norton, Schauspieler, Comedian und Talkmaster, ist eine der bekanntesten Fernsehpersönlichkeiten der englischsprachigen Welt. Geboren wurde er in Clondalkin, einem Vorort von Dublin, aufgewachsen ist der Sohn einer protestantischen Familie im County Cork im Süden Irlands. Sein erster Roman «Ein irischer Dorfpolizist» avancierte in Irland und Großbritannien zum Bestseller, wurde mit dem Irish Book Award 2016 ausgezeichnet und zu einer Fernsehserie. Auch der zweite Roman, «Eine irische Familiengeschichte», und der dritte, «Heimweh», gehörten in Irland jeweils zu den bestverkauften Büchern des Jahres. Zuletzt begeisterte Norton mit der Familiengeschichte «Ein Ort für immer».
Silke Jellinghaus, geboren 1975, ist Übersetzerin, Autorin und Lektorin und lebt in Hamburg. Unter anderem hat sie Jojo Moyes und Graham Norton übersetzt.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel «Frankie» bei Coronet, Hodder & Stoughton, an Hachette Company, UK.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Frankie» Copyright © 2024 by Graham Norton
Redaktion Ilona Jaeger
Covergestaltung Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildung Michael Carson
ISBN 978-3-644-02474-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Das Leben … [ist] eine Klage auf dem einen Ohr, möglicherweise, aber auf dem anderen immer ein Lied.»
Seán O’Casey
Jeder Mensch, der jemanden umsorgte und pflegte, gab sich Mühe, das war Damian klar. Man kümmerte sich, oder tat zumindest so, aber bei ihm war es etwas anderes. Er war mit Leib und Seele Pfleger. Es war sein Beruf, und er wusste, dass er gut darin war. Er reagierte immer noch gereizt, wenn er gefragt wurde, was er denn wirklich machen wolle, oder wenn seine Mutter am Telefon nachhakte, ob er nicht wieder aufs College gehen wolle – Maureen Collins hat keinen so guten Schulabschluss wie du, und sie hat einen Jura-Platz bekommen. Es stimmte schon, sein Traumjob war es nie gewesen, aber es machte ihm Spaß, und er konnte damit die Rechnungen bezahlen, also was wollte er mehr? Wie sich herausgestellt hatte, lag es ihm, reiche alte Menschen in ihren geräumigen Domizilen im Westen Londons zu versorgen. Häuser und Wohnungen mit dicken Teppichen und goldgerahmten Gemälden. Die Arbeit selbst war relativ einfach, zumal er sich häufig für die Nachtschicht entschied. Knarrende Dielen, ein paar Tabletten verabreichen und Kissen aufschütteln, danach konnte er einfach lesen oder auf seinem Laptop Filme schauen. Wenn der Morgen kam und er die Zeit dafür hatte – und die hatte er üblicherweise –, fuhr er gern mit dem Bus nach Hause und sah zu, wie die Stadt zum Leben erwachte. So viele Menschen, die Dinge zu erledigen hatten und zu Orten unterwegs waren, an denen sie sein mussten. Er stellte sich die beengten Wohnungen vor, die sie verlassen hatten und in die sie zurückkehren würden, und verglich sie mit den großzügigen Räumen mit hohen Decken, in denen er die letzten zwölf Stunden verbracht hatte. Fair war das nicht, natürlich nicht, aber dennoch bezweifelte er, dass irgendwer, der in der U-Bahn die Treppen hinauflief und dabei zwei Stufen auf einmal nahm, die Menschen beneidete, die er pflegte, die in der Nacht Krämpfe bekamen und vor Schmerz aufschrien, mit krümeligen Ablagerungen im Mundwinkel. Doch wenigstens hatten sie Damian. Sich im Dunkel der Nacht nicht einsam und verlassen zu fühlen, erschien ihm wie ein menschliches Grundbedürfnis, und für dieses Privileg mussten die alten Leute, um die Damian sich kümmerte, Hamilton Homecare ein stattliches Sümmchen bezahlen.
Der Bus ruckelte und zuckelte gemächlich durch London, zurück in Richtung des kleinen Reihenhauses in Shadwell, das er sich mit zwei permanent arbeitslosen Schauspielern teilte. Damian lehnte den Kopf ans Fenster und fragte sich, ob er zu Hause noch genug Milch im Kühlschrank vorfinden würde. Ein großes Plakat in der Tottenham Court Road erinnerte ihn daran, dass er seinen Telefonvertrag upgraden wollte, und als sich der Bus in gemächlichem Tempo Aldgate näherte, dachte er an die Arbeit. An seiner neuen Klientin war irgendetwas seltsam. Auch nach zwei Jahren kam Damian dieses Wort immer noch komisch vor – ein Klient war für ihn jemand, der sich beraten ließ, wie er mit möglichst geringer Steuerlast Fremdwährung verschob, und nicht jemand, der zusammengesackt auf der Toilette hockte und darauf wartete, dass man ihm hochhalf. Nadine, seine Vorgesetzte, hatte wie immer gut gelaunt geklungen, als sie ihn angerufen hatte.
«Du wohnst im Osten, oder?»
«Ja», antwortete Damian argwöhnisch.
«Also, Wapping ist doch auch im Osten, oder?»
«Ja, von hier aus direkt im Süden. Wieso?»
«Eine neue Klientin. Sie wohnt in Wapping. Frances Howe, vierundachtzig. Lebt allein. Gebrochener Knöchel. Ich schicke dir die Adresse.»
«Und wie komme ich rein?»
«Ihre Freundin wird da sein. Heute Abend um sieben. Und nicht zu spät kommen, Damian.»
Das war eine Warnung. Es hatte in der Vergangenheit Beschwerden gegeben.
«Wieso kann die Freundin nicht …»
«Willst du arbeiten, Damian? Außerdem ist sie Irin, das ist doch nett für dich. Sieben Uhr.» Ohne eine Antwort abzuwarten, legte Nadine auf.
Damian war neugierig, aber auch leicht angefressen. Es nervte ihn, wenn man einfach alle Iren in einen Topf warf. Es war so ähnlich, wie von Hetero-Freunden stolz auf die Existenz eines weiteren schwulen Freundes hingewiesen zu werden. «Du musst ihn unbedingt kennenlernen. Du wirst ihn mögen.» Als würden sie durch ihre sexuelle Orientierung zu so etwas wie Hunden, die gemeinsam im Park spielten. Es leuchtete ihm nicht ein, inwiefern er durch eine wie auch immer geartete irische Wesensart mit einer gebrechlichen Vierundachtzigjährigen etwas gemein haben sollte. Was ihn allerdings mehr interessierte, war die Tatsache, dass sie in Wapping lebte. Es kam ihm unwahrscheinlich vor, dass jemand dort lebte, im entsprechenden Alter war und die Mittel besaß, Hamilton Homecare zu beauftragen.
Shadwell, der Stadtteil, in dem Damian und die Schauspieler in einem winzigen Arbeiterhäuschen wohnten, war von Wapping nur durch den Highway getrennt, einer breiten Straße, auf der ständig jede Menge Verkehr in Richtung Canary Wharf rauschte und zu den unbekannten Gefilden, die sich östlich davon befanden. In seinen acht Jahren in London war Damian nicht übermäßig abenteuerlustig gewesen. Seine ersten beiden Jahrzehnte auf Erden hatte er umgeben von Feldern in West Cork verbracht, und er konnte nicht sagen, dass er diese seit seiner Abreise aus Irland besonders vermisst hatte, falls er sie denn überhaupt vermisst hatte. Nun spielte sich sein Leben ausschließlich in den Londoner Zonen eins und zwei ab.
Bisher hatte Damian keine große Lust verspürt, Wapping zu erkunden. Gelegentlich hatte er Streifzüge durch die engen Kopfsteinpflasterstraßen unternommen, um in einem der alten Pubs etwas zu trinken, die sich trotz der Gentrifizierung noch immer am Flussufer befanden. Die alten Lagerhäuser aus Backstein waren alle zu Wohnungen für wohlhabende junge Banker und Anwälte umgewandelt worden. Wenn er sich nach Westen vorwagte und den malerischen Weg zur U-Bahn-Station Tower Hill einschlug, kam er an den St. Katharine Docks mit ihren Yachten und Cafés vorbei, die im Schatten der imposanten Tower Bridge lagen. Damian war davon ausgegangen, dass Frances Howe in diesem Teil von Wapping lebte, wo die Bäume grüner waren und die Autos glänzender, aber Google Maps widersprach. Es führte ihn zum Rand eines schlichten kleinen Parks, etwa in der Mitte zwischen Highway und Themse. Damian blieb stehen und sah auf. «Cleaver Buildings 1864» stand da in eine verwitterte Steintafel eingraviert. Das vierstöckige Gebäude stand verlegen und allein da. Es hatte offensichtlich überdauert, während seine Nachbarn abgerissen oder vielleicht auch im Krieg bombardiert worden waren. Es umwehte ein Hauch von Romantik und Verfall. Große, helle Schiebefenster saßen in den gelben Backsteinmauern, welche die dunkelrot gestrichenen Treppenhäuser und Verbindungsgänge umgaben. Den besonderen Touch verliehen dem Gebäude die verzierten Geländer, die sich an jeder Etage entlangzogen. So stellte sich Damian New Orleans vor. Auf jedem Treppenabsatz schien es zwei Eingangstüren zu geben. Neben einigen lehnten Fahrräder, vor anderen standen Blumenkübel. Das Haus war zu alt, um sozialer Wohnungsbau zu sein, deswegen nahm Damian an, dass es einer Wohnungsbaugesellschaft gehörte. Er rätselte weiterhin, wie sich eine alte Dame, die hier lebte, einen privaten Pflegedienst leisten konnte.
Der Abend war mild, ein vorzeitiger Hauch von Frühling lag in der Luft. Aus dem nahe gelegenen Park drangen die fröhlichen Geräusche von Hunden und Kindern herüber. Damian schob das Metalltor auf und ging auf die Treppe zu. Nummer vier befand sich am hinteren Ende des Treppenabsatzes im zweiten Stock, und es standen weder Fahrrad noch Blumen davor. Die Fenster waren sauber, und die Tür sah so aus, als wäre sie kürzlich gestrichen worden. Keine Klingel. Er klopfte, und die Tür öffnete sich sofort – augenscheinlich wurde er erwartet. Eine ältere Dame mit kurzem, verdächtig dunklem Haar nahm Damian in Empfang. Sie war groß und hatte einen etwas unkonventionellen, aber eleganten Kleidungsstil. Bunte Perlenketten ergossen sich über ihr weißes Herrenhemd, das sie über einer locker sitzenden, bunt gemusterten Hose trug. Ihr Mund war ein Strich aus rotem Lippenstift.
«Damian?» Sie lächelte und reichte ihm die Hand zu einem forschen, festen Händedruck, der ihre Armreifen zum Klimpern brachte.
«Ja. Schön, Sie kennenzulernen.»
«Nor. Nor Forrester. Ich bin Frankies Freundin.» Noch während sie sprach, machte sie kehrt und ging voraus in die düstere Wohnung. Damian schloss die Tür hinter sich und folgte ihr. «Und hier ist sie!» Nor stand in einem ehemals geräumigen Zimmer, das nun allerdings mit übergroßen Möbelstücken vollgestellt war. Damian trat vor. Ein dunkler hölzerner Esstisch stand an der Wand unter dem Fenster gegenüber einem verblichenen Chesterfield-Sofa mit Samtbezug, das so groß war, dass Damian sich fragte, wie man es ins Zimmer bekommen hatte. In einem Ohrensessel mit hoher Rückenlehne saß neben einer Vitrine voller Gläser die Person, auf die Nor gezeigt hatte.
«Das ist Frankie!» Ihre Stimme schien zu laut, ihre Fröhlichkeit aufgesetzt. «Frankie, das ist Damian.»
Die alte Dame im Sessel sah ihn an. Sie schien nicht sonderlich beeindruckt. Sie nickte.
«Schön, Sie kennenzulernen», sagte Damian und nahm seinen leichten Rucksack ab. Dann warteten sie alle drei, dass einer der anderen das Wort ergriff.
Frankie sah älter aus als Nor. Ihr Haar war grau und wurde seitlich von einer schwarzen Spange aus dem Gesicht gehalten. Das Gesicht war eingefallen und ungeschminkt. Frankies eingegipster linker Fuß ruhte auf einem kleinen Hocker.
«Frankie hatte einen schlimmen Sturz.»
Frankies blassgraue Augen huschten zu ihrer Freundin.
«Ich hatte keinen Sturz. Ich bin einfach hingefallen. Ich bin gestolpert. Ende der Geschichte. Hör auf zu sagen, ich hätte ‹einen Sturz gehabt›.» Ihre Stimme klang etwas rau, als bräuchte sie einen Schluck Wasser.
«Wir wollen jedenfalls nicht, dass das noch mal vorkommt, und deshalb ist der junge Damian hier.» Nor drehte sich zu ihm um. «Ich muss gleich los, aber lassen Sie mich Ihnen alles zeigen.» Sie schob sich an ihm vorbei in die enge, quadratische Diele. «Da ist die Küche, das Bad …» Sie zeigte auf die Türen rechter Hand. «Und das ist Ihr Zimmer.» Sie öffnete die Tür zu einem kleinen, schmalen Raum mit einem Einzelbett. Damian spähte hinein und sah, dass an den Wänden Gemälde und Fotografien hingen, die nicht zusammenpassten. Ein Großteil des dunklen Teppichbodens stand voll mit Pappkartons.
«Es ist eigentlich mehr eine Art Abstellraum, aber Sie können hier Ihre Tasche lassen und sich auch hinlegen, vermute ich?» Sie schien unsicher zu sein, wie Damian die Nacht verbringen würde.
«Perfekt.» Er stellte seinen Rucksack auf das Bett.
Nor griff nach seinem Arm und senkte die Stimme zu einem Flüstern. «Ich muss mich gleich im Voraus entschuldigen. Sie ist gerade nicht sie selbst. Seit dem Sturz ist sie sehr gereizt. Das mache ich ihr nicht zum Vorwurf, natürlich, aber sie braucht Hilfe – auch wenn sie sich das nicht eingestehen will. Sie hat zwar Krücken, aber diese Wohnung ist ein einziger Hindernisparcours. Wenn Sie ihr morgen früh Tee und Toast machen könnten, schaue ich vor dem Mittagessen noch mal nach ihr.» Ohne wirklich innezuhalten, sprach sie in normaler Lautstärke weiter. «So, das war’s von meiner Seite. Benimm dich, Frankie. Wir sehen uns dann morgen.» Die Worte rief sie aus der Diele. An der Tür griff sie nach einer großen Tragetasche von Daunt Books, die auf dem Boden lag. Sie steckte die Hand hinein und zog einen Schlüsselbund heraus.
«Für Sie.» Sie übergab ihn Damian. «Viel Glück.» Ihre hochgezogenen Augenbrauen signalisierten ihm, dass er es brauchen würde. Und schon war sie mit einem Perlenrasseln und einem Scheppern des Türklopfers verschwunden.
Das war immer eine etwas heikle Phase. Dieser seltsame Auftakt, bei dem Patientin und Pfleger sich bemühten einzuschätzen, mit wem sie es zu tun hatten, wobei sie gleichzeitig ihre spezifischen Rollen in diesem Arrangement einzunehmen versuchten. Damian holte tief Luft und wagte einen Vorstoß.
«Also, Frankie, möchten Sie eine Tasse Tee?»
Der Vorschlag schien sie noch trauriger zu stimmen, als sie ohnehin schon war.
«Ja, gern.» Ihre Stimme war jetzt leiser, kaum noch ein Flüstern.
«Milch? Zucker?» Damian blieb an der Küchentür stehen.
Frankie blinzelte, als verstünde sie nicht ganz, doch dann kam die leise Antwort. «Schwarz. Einen halben Teelöffel Honig. Steht gleich neben dem Wasserkocher.»
Die Küche war klein, aber sehr gut sortiert und organisiert. Auf den offenen Regalbrettern neben dem Herd waren identische Flaschen mit getrockneten Kräutern und Gewürzen aufgereiht, während in Töpfen auf der Fensterbank frische Kräuter sprossen. Woks und Pfannen hingen von Haken an der Decke, und auf der Arbeitsplatte drängte sich eine große Auswahl an augenscheinlich teuren Ölen und Essigflaschen.
«Kochen Sie gern, Frankie?», rief Damian durch die offene Tür. Zuerst antwortete die alte Frau nicht, doch dann verkündete sie mit überraschend lauter und fester Stimme: «Ja, ich koche.» Ihr Tonfall legte nahe, dass sie nicht weiter darüber reden wollte.
Damian verdrehte die Augen. Das würde eine zähe Nacht werden. Er hoffte, dass sie früh schlafen ging.
Er stellte den Wasserkocher an und sah sich nach zwei sauberen Bechern um. Ihm fiel auf, dass der Honig aus Frankreich und das Etikett von Hand geschrieben war.
«Wo haben Sie die Teebeutel, Frankie?» Er schlug weiterhin einen aufgeräumten und positiven Ton an.
«Ich habe keine. In der grünen Dose ist loser Tee.»
Damian wünschte, er hätte nie Tee angeboten. Wer bitte verwendete keine Teebeutel? Selbst seine Granny benutzte sie inzwischen, und sie backte ihr Sodabrot immer noch selbst.
«Sie steht da drüben.» Frankies Stimme drang so laut an sein Ohr, dass Damian einen kleinen Schrei ausstieß. Die alte Frau stand im Türrahmen und schwankte auf ihren Krücken.
«Ab mit Ihnen, setzen Sie sich, Frankie. Ich bin hier, damit Sie sich ausruhen können.» Er deutete auf ihren Sessel im Wohnzimmer.
Frankie ignorierte ihn und fuhr fort: «Sehen Sie zu, dass Sie die Kanne vorwärmen. Drei Teelöffel werden ausreichen. Einen für jeden von uns und einen für die Kanne. Er ist ziemlich stark, Assam. Mögen Sie Assam?»
Damian starrte sie ausdruckslos an. Er mochte Tee. Zählte das?
«Er schmeckt bestimmt toll.»
«Ich habe ihn immer in diesem kleinen Laden in Covent Garden gekauft, aber der hat inzwischen natürlich zugemacht. Nor besorgt ihn mir bei Harrods.» Sie deutete mit dem Kinn auf die mit einem Markenlogo bedruckte Dose. «Glauben Sie bitte nicht, dass ich mein Geld in diesem Geschäft verpulvere.»
Damian fragte sich, ob Nor Forrester diejenige war, die für seinen Lohn aufkam.
«Na los, setzen Sie sich. Ich kriege das hier hin.»
Ihr Gesichtsausdruck ging ihm auf die Nerven. In ihren blassen Augen las er Zweifel daran, dass er das hier hinkriegte, oder dass er überhaupt irgendetwas hinkriegte. Nichtsdestotrotz tat sie wie geheißen und hoppelte langsam zurück ins Wohnzimmer. «Nehmen Sie das Tablett», raunzte sie.
Als der Tee aufgebrüht war, setzte sich Damian mit seiner Tasse an den Esstisch. Frankie nippte kommentarlos an der ihren, was Damian als Zufriedenheit deutete.
«Hier riecht es so gut.»
«Pfirsichöl.»
«Oh.» Damian war kein Stück klüger.
«Man tupft es auf die Glühbirnen. Haben Sie noch nie davon gehört?»
Er schüttelte den Kopf. «Nein. Nein, das ist mir neu.»
Einen Moment lang herrschte Schweigen, während sie beide genussvoll ihren Tee tranken, dann versuchte Damian es erneut.
«Sie haben noch den Akzent. Leicht, aber trotzdem wahrnehmbar. Woher kommen Sie?»
«Ursprünglich aus der Grafschaft Cork, westlich von Ballytoor.» Sie machte diese Angabe, als würde sie auf das Verhör eines Polizisten antworten.
Damian war Menschen wie ihr schon öfter begegnet, üblicherweise gelang es ihm, sie zu knacken. Er ging in die Offensive.
«Ballytoor? Na klar, das kenne ich gut. Ich komme aus Mallow. Meine Schwester hat einen Kerl aus Stranach geheiratet, das liegt gleich hinter Ballytoor. Kennen Sie das?»
Frankies Kopf fuhr zu Damian herum. Anscheinend kannte sie es.
«Mmm, kenne ich. Ja, das kenne ich.» Ihr Blick schweifte kurz zum Fenster, dann richtete sie sich in ihrem Sessel auf. «Würden Sie für mich den Fernseher einschalten? Den Nachrichtensender. BBC, ich kann diese Leute von Sky nicht ausstehen. Und schauen Sie bitte, dass die Untertitel eingeschaltet sind. Die nuscheln. Alle miteinander.»
Damian tat, wie ihm geheißen, und räumte dann den Tee ab. Nachdem er die Becher gespült und abgetrocknet hatte, kam er zurück ins Wohnzimmer.
«Wenn Sie mich brauchen, Frankie, ich bin in meinem Zimmer.»
«Gut. Danke.» Die alte Frau wedelte ihn fort, dann fuhr sie sich mit der Hand übers Gesicht. Wischte sie sich Tränen ab? Damian war sich nicht sicher.
Ungefähr eine Stunde später, die Storys bei Instagram begannen sich zu wiederholen, hörte er Frankie herumgehen. Er trat an die Tür, um nach ihr zu sehen.
«Brauchen Sie etwas?»
«Nein. Nein, ich mache mich nur bettfertig. Das dauert eine Weile», teilte sie ihm mit und humpelte auf ihren Krücken in Richtung Bad.
«Lassen Sie mich helfen.»
«Nein», sagte sie scharf. «Nein, danke.» Dann, sanfter: «Ich kann alles alleine. Bis auf die Socke. Die müssen Sie mir ausziehen.»
«Okay.» Er wartete, bereit, ihr zu helfen.
«Ich rufe, wenn ich Sie brauche.» Die Badezimmertür schloss sich.
Damian schlenderte ins Wohnzimmer und sah einem Reporter zu, der am Rand einer Straße stand und von Überschwemmungen berichtete. Er blickte sich im Raum um. Auf dem Boden stapelten sich wahllos Taschenbücher, und an den Wänden entdeckte er einen ähnlichen Flickenteppich von Bildern wie in seinem Zimmer. Er wusste nicht viel über Kunst, aber diese Sachen hier sahen anders aus als die Bilder, die er in den Häusern alter Leute normalerweise vorfand. Sie wirkten zu modern. Abstrakt und chaotisch, manche leuchtend und geometrisch, andere mehr wie blasses Gekritzel. Sie schienen weder zu den alten, schweren Möbelstücken zu passen noch zu der kleinen, gepflegten Frau, die gerade im Bad war. Vielleicht hatte ein verstorbener Ehemann sie gesammelt. Damian war sich recht sicher, dass diese Bilder nicht alle von demselben Künstler stammen konnten. Hatte Frankie sie von einem Verwandten geerbt? Er speicherte seine Fragen als Gesprächsthemen für die Unterhaltung, die er unbedingt mit ihr führen wollte. Es war für ihn eine Frage der Berufsehre, diese alte Dame dazu zu bringen, ihm Einlass in ihr Leben zu gewähren.
Frankies Schlafzimmer überraschte ihn. Es war vielleicht sogar noch kleiner als das, das Damian zugeteilt worden war, und dort, wo er das Fenster vermutete, standen gefährlich hohe Büchertürme. Die Nachttischlampe war die einzige Lichtquelle und teilte ihren Sockel mit weiteren Büchern und einer Reihe von Tablettenfläschchen. Frankie saß auf dem Bett und trug ein langärmeliges babyblaues Nachthemd. Das dünne, glänzende Schleifenband am Hals veranlasste Damian zu der Annahme, dass es ein Geschenk gewesen sein könnte. Er bezweifelte stark, dass Frankie in ein Geschäft spaziert war und es sich ausgesucht hatte. Er kniete sich vor seinen Schützling, zog ihr die eine Socke aus und blickte zu ihr auf. Während er die Socke zu einem Knäuel zerknüllte, betrachtete er Frankies Füße und fragte: «Möchten Sie, dass ich Ihnen die Fußnägel schneide?»
«Nein!» Allein die Frage schien sie zu schockieren, und sie zog die Beine hastig unter die Bettdecke.
«Okay. Na gut, falls Sie Ihre Meinung ändern …» Ein Lächeln. Sein immergleicher, ruhiger, ausgeglichener Tonfall.
Frankie griff nach einem Buch und sagte dann, als fiele ihr ein, dass noch jemand im Zimmer war: «Sie können fernsehen, wenn Sie wollen. Hier drin stört mich das nicht.»
«Gut.» Er erhob sich zum Gehen. «Und wann möchten Sie morgen früh Ihren Tee und den Toast haben?»
Sie runzelte die Stirn. «Die kann ich mir wohl selber machen. Keine Sorge.»
«Frankie, kommen Sie schon, ich werde dafür bezahlt. Lassen Sie mich etwas für Sie tun.»
Ein Seufzer. Sie schlug ihr Buch auf, ohne ihn anzusehen. «Gegen halb acht. Und nehmen Sie die ungesalzene Butter. Nur ein kleiner Klecks Orangenmarmelade.»
«Wird gemacht. Gute Nacht. Schlafen Sie gut.» Er begann langsam die Tür zu schließen.
«Bitte.»
Er tat einen Schritt nach vorn. «Entschuldigung?»
«Bitte. Wegen des Toasts. Ich habe vergessen, bitte zu sagen.»
«Sehr gern.» Er schloss sorgfältig die Tür, bevor er sich gestattete, über das ganze Gesicht zu grinsen.
Irland, 1950
Glück war ein Gefühl, dem man nicht trauen durfte. Das war eine Lektion, die Frances Howe schon in jungen Jahren gelernt hatte. Mit elf, um genau zu sein. Nein, sie war zehn gewesen, aber kurz davor, elf zu werden, denn sie war auf Catherine Woodworths Geburtstagsparty eingeladen, und Catherine war die Erste in ihrer Klasse, die die kindische Zahl Zehn hinter sich gelassen hatte. Dies war eine Party, wie Frankie sie noch nie zuvor erlebt hatten. Für den Anlass war der Festsaal im Langton’s Hotel angemietet worden. Es gab kleine Teigtaschen, die mit Hühnchen und Sauce gefüllt waren, und zum Abschied hatte jedes Kind eine Partytüte mit einem Stift und Brausepulver bekommen. Elf schien eine Welt voll ungeahnter Raffinessen zu sein.
Als die Party um sechs Uhr zu Ende war, versammelten sich Frances, ihre Freundin Norah Dean und drei andere Mädchen in der Lobby, sie alle sollten von Norahs Vater nach Hause gefahren werden. Während die anderen Mr Dean aufgeregt von den kohlensäurehaltigen Getränken erzählten, die von echten Kellnern serviert worden waren, saß Frances still auf dem Rücksitz und lehnte den Kopf ans Fenster. So fühlte es sich an, glücklich zu sein. Den ganzen Nachmittag über war es ihr so vorgekommen, als wäre sie endlich im selben Takt mit der Musik. Sie freute sich darauf, ihren Eltern zu erzählen, wie vernünftig sie gewesen war; anscheinend zeitigte das Alter von fast elf Jahren eine Wirkung. Sie hatte sich nicht einfach bloß die süßen kleinen Schmetterlingsbrötchen in den Mund gestopft, sondern zuvor bedächtig auch zwei langweilige Sandwiches gegessen. Sie hatte die Serviette vom Tisch genommen und tatsächlich benutzt. Frances hatte sich an die Worte ihrer Mutter erinnert und die Reise nach Jerusalem ohne übermäßigen Körpereinsatz zu gewinnen versucht, und obwohl ihr beim ‹wandernden Geschenk› klar gewesen war, dass sich unter all den Schichten von Geschenkpapier eine Schneekugel verbarg, hatte sie das Päckchen nicht allzu lange festgehalten, als es herumgereicht wurde. Vor ihrem inneren Auge konnte sie sehen, wie ihre Eltern sie anlächelten und ihr sagten, was für eine feine junge Dame aus ihr werden würde.
Als Mr Dean den Wagen in ihre kurze Auffahrt lenkte, die von der Straße durch dicke Tannen abgeschirmt wurde, lag das Haus der Howes im Dunkeln.
«Sind deine Mammy und dein Daddy zu Hause, Frances?»
Sie zögerte. Es hatte nicht den Anschein. Der Wagen ihres Vaters parkte nicht an seinem üblichen Platz. Gleichzeitig wusste sie, dass es falsch wäre, Mr Dean Unannehmlichkeiten zu bereiten.
«Sie sind bestimmt hinten in der Küche.»
Mr Dean öffnete die hintere Wagentür. «Bist du dir sicher?»
«Ja, danke, Mr Dean.» Sie lächelte, erfreut, dass sie daran gedacht hatte, sich bei dem Erwachsenen zu bedanken, und sprang von ihrem Sitz. «Tschüs!» Sie winkte ihrer Freundin Norah zu und ging zur Hintertür. Die Scheinwerfer des Autos glitten über sie hinweg, und plötzlich kam ihr alles sehr dunkel und still vor.
Die Tür war nicht abgeschlossen, wie Frances angenommen hatte, aber das Haus war leer.
«Hallo!», rief sie in den Flur. Die einzige Antwort kam von der Wanduhr neben dem Herd, die weitertickte. Ihre Schritte erschienen ihr seltsam laut, als sie den Raum durchquerte und das Licht einschaltete. Im Hellen wirkte alles besser, oder wenigstens normaler. Ihre Eltern würden bald nach Hause kommen. Auf dem Tisch stand noch das Abkühlgitter, Frances und ihre Mammy hatten am Morgen gebacken. Sie hatte den Kuchenteig umrühren und den Löffel ablecken dürfen. Es war seltsam, ohne die Hitze des Ofens, die Wärme ihrer Mutter in der Küche zu sein. Frances zog sich einen Stuhl unter dem Küchentisch hervor, setzte sich und wartete.
Später, als andere Leute es übernahmen, die Geschichte für sie zu erzählen, erfuhr sie, dass sie über zwei Stunden gewartet hatte. Hinterher hatte sie keine Ahnung, was sie in dieser Zeit getan hatte. Sie hatte sich weder ein Buch geholt noch mit ihren Buntstiften gemalt. Sie war nicht mal zur Keksdose hochgeklettert, um etwas zu stibitzen. Frances nahm an, dass sie einfach nur still dagesessen hatte wie ein braves kleines Mädchen, weil braven kleinen Mädchen nichts Schlimmes zustieß.
Sie wusste noch, wie sie den Automotor gehört und durch die Glasscheiben der Eingangstür hindurch das Licht der Scheinwerfer im Flur gesehen hatte. Sie hatte versucht, sich darüber zu freuen, dass ihre Eltern nach Hause kamen, aber etwas hatte sich nicht richtig angefühlt. Alle Autos klangen wie Autos, aber dieses klang nicht wie Daddys Auto. Dann hallte der dumpfe Schlag des Türklopfers durchs Haus. Wie sollte dieses Geräusch jemals gute Nachrichten ankündigen?
Frances ging langsam den Flur hinunter, so als wüsste sie, sobald sie die Tür erreicht hätte, würde nichts mehr so sein wie zuvor. Das heftige Schlagen des Türklopfers ertönte erneut. «Hallo?» Der gedämpfte Klang einer Männerstimme.
«Hallo», antwortete Frances.
«Hallo.» Die Stimme des Mannes hatte sich verändert. Sie klang leise und trällernd, so wie viele erwachsene Männer mit kleinen Mädchen sprachen. «Kannst du mir die Tür aufmachen, Schätzchen?»
Frances blickte zum Türschloss und bekam plötzlich Panik.
«Wer sind Sie?»
«Nur die Polizei, Kleines. Wir müssen mit dir sprechen.»
Frances dachte darüber nach. Der Mann klang tatsächlich wie ein Polizist.
Die wohlige Vertrautheit der Küche wurde abrupt durch das Erscheinen von zwei Polizisten gestört. Frankie sah nur noch dunkle Uniformen und Mützen. Sie schienen den gesamten Raum auszufüllen, also blieb sie an der Tür stehen. Der ältere Polizist mit dem breiten roten Gesicht entdeckte sie.
«Hallo, Schätzchen. Kommst du mal her und setzt dich zu mir?» Es war die Stimme von vorhin an der Tür. Er klopfte auf einen Stuhl am Tisch.
«Wo sind meine Mammy und mein Daddy?» Die Antwort auf die Frage musste der Grund dafür sein, dass diese Männer in der Küche standen.
Die Polizisten sahen einander an. Vielleicht hatten sie nicht damit gerechnet, dass Frances so direkt war. Der jüngere Beamte zeigte großes Interesse am Fußboden, der ältere leckte sich über die Lippe.
«Heißt du Frances?», fragte er.
«Ja. Was ist mit Mammy und Daddy passiert?» Ihre Stimme klang gepresst, als würde sie von einem unsichtbaren Klammergriff, in dem ihr kleiner Körper steckte, gewürgt werden.
«Es hat einen Unfall gegeben, Frances, und wir wollen nicht, dass du alleine hierbleibst.» Er hielt inne, um abzuschätzen, wie sie diese Nachricht aufnahm.
«Geht es ihnen gut? Wo sind sie?» Frances konnte spüren, wie ihr alles entglitt. Das überstieg ihre schlimmsten Albträume. Was gab es noch auf der Welt, wenn ihre Eltern nicht da waren?
«Sie sind im Krankenhaus, Schätzchen. Die Ärzte kümmern sich um sie.» Der Polizist ließ sich auf ein Knie herab, seine Hand ruhte auf dem Tisch. «Gibt es jemanden, der sich für eine Weile um dich kümmern kann? Eine Großmutter vielleicht oder eine Nachbarin?» Sein Gesicht war ihrem zu nah. Sie sah die dunklen Haare in seinen Nasenlöchern, das Gelb seiner Zähne. Frances versuchte zu sprechen, aber sie konnte nicht. Ihr ganzer Körper hatte sich verkrampft und begann zu zittern. Alles, was sie wollte, war, dass ihre Eltern wieder bei ihr waren. Sie presste die Augen zu. Sie würden zurückkommen. Sie würde die Augen wieder öffnen, und sie würden auftauchen. Aber sie kamen nicht. Da war nur der Polizist, der sie anstarrte und sich dann zu seinem Kollegen umdrehte.
«Ich will meine Mammy und meinen Daddy», brachte sie zwischen schweren Atemzügen hervor, und dann, als hätte die einzige, tiefe Wahrheit dieser Aussage sie befreit, sank Frances Howe zu Boden und begann zu schluchzen.
Ihre Eltern waren tot. Wenn sie auf dem Weg ins Krankenhaus waren, dann nur, um in die Leichenhalle gebracht zu werden. Ein Gerichtsmediziner würde später bestätigen, was die Polizisten im Haus der Howes bereits wussten: Frances’ Eltern waren ertrunken. Es war ein eigenartiger Unfall gewesen. Ihr Wagen auf einem Kai, am späten Nachmittag. Sie hatten den Ausblick genossen oder vielleicht darauf gewartet, von einem zurückkehrenden Trawler Fisch zu kaufen. Was dann passiert war, blieb unklar. Möglicherweise hatten die Bremsen versagt, oder Frances’ Vater hatte geglaubt, er hätte den Rückwärtsgang eingelegt, als er das Gaspedal durchdrückte? Was auch immer die Ursache dafür war, Zeugen hatten beobachtet, wie das Auto vom Kai schoss und beinahe augenblicklich unter der Wasseroberfläche verschwand. Ein paar Männer waren von der Straße hingerannt und ins Wasser gesprungen, aber es war zwecklos. Das Wasser war zu tief, man konnte kaum etwas sehen. Sie tauchten wieder und wieder hinab, ohne Erfolg. Da kletterten sie die Metallleiter seitlich am Kai hinauf und ließen sich von dem kleinen Menschenauflauf trösten, der sich in solchen Momenten immer wie aus dem Nichts zu bilden scheint.
Es dauerte nicht lange, bis Gerüchte aufkamen. Es war ein schlimmer Tod gewesen. Geldprobleme. Das arme kleine Mädchen. Wie konnten die Eltern sie nur zurücklassen?, fragten die Leute. Wenigstens haben sie das Mädchen nicht mit sich in den Tod gerissen, antworteten andere. Stimmt, das stimmt schon. Ein winziger Silbersplitter im dunkelsten Streifen am Horizont. Später, viel später erst, erfuhr Frances von diesen Gerüchten. Einige Mädchen in der Schule erzählten sie weiter, um sich in dem brutalen Dschungel des Klassenzimmers, den sie alle zu überleben versuchten, Geltung zu verschaffen. Sie weigerte sich, die Gerüchte zu glauben. Ihre Eltern hatten sie zu sehr geliebt, als dass sie sie jemals freiwillig alleingelassen hätten. Das Ganze war das Werk des Herrn gewesen, und dessen Wege sind, wie die Menschen nicht müde wurden, ihr in Erinnerung zu rufen, unergründlich.
Die Polizisten hatten ihren schluchzenden Schützling ins Pfarrhaus gebracht. Frances’ Mutter hatte eine Schwester, die mit einem Priester der Church of Ireland verheiratet war, Reverend Derek Roper. Doch obwohl sie in derselben Stadt lebten, kannte Frances ihre Tante und ihren Onkel kaum. Wenn Mammy und Daddy über sie sprachen, war ihre Tante Mona gewöhnlich als ‹die arme Mona› betitelt worden, und wenn sich alle zusammen im selben Raum befanden, bemerkte Frances, dass sich die Schwestern zwar unterhielten, die Männer einander aber nur wenig zu sagen hatten. Ihre Tante entriss sie den Polizisten, legte ihr eine Decke um die Schultern und hielt sie fest, während sie beide weinten. Mit jemandem zusammen zu weinen, war ein seltsamer Trost, zumal die Tante ihrer verstorbenen Mutter so ähnlich sah – das gleiche braune Haar, das ihre weichen Züge umspielte, der gleiche warme Busen, an dem sie ihr Gesicht vergraben konnte. Frances nahm ihren Onkel nur verschwommen wahr, der neben dem Kamin stand und Gebete sprach. Derek Roper hatte keine Ähnlichkeit mit ihrem Vater. Seine Haut wirkte zu straff gespannt, sodass seine Fingerknöchel, seine Ohren und sein Kinn daraus hervorstachen wie Äste aus einem Baum. Sein Glaube wirkte aufrichtig, aber andere daran teilhaben zu lassen, war nie seine Stärke gewesen. Er erfüllte seine seelsorgerischen Pflichten so, wie man es ihm auf der kirchlichen Hochschule beigebracht hatte, aber er ließ dabei jede Umgänglichkeit oder Menschlichkeit vermissen. Es hätte viel besser zu ihm gepasst, ein geistlicher Hirte zu sein, wenn dabei keine echte Herde im Spiel gewesen wäre.
In den ersten Wochen nach der Beerdigung ihrer Eltern hatte Frances das Gefühl, etwas zu sein, das man im Blick behalten musste wie ein Topf auf dem Herd, der überkochen konnte, oder ein Bad, das man gerade einließ. Ihre Tante Mona schlief bei ihr im Zimmer, und von einer Rückkehr in die Schule war keine Rede. Ihre Tante und ihr Onkel unterrichteten sie am großen Kieferntisch in der Küche des Pfarrhauses abwechselnd in verschiedenen Fächern.
Die Monate vergingen, und nach und nach bemerkte Frances, dass sich ihre Gefühle veränderten. Sie fühlte sich nicht unbedingt besser, das war unmöglich, aber sie weinte nicht mehr so viel. Eine neue Normalität hatte sich eingestellt. Ihre Tante ließ sie allein schlafen, und die Tage waren damit ausgefüllt, dass sie im Haus half oder ihre Schulaufgaben machte. Frances wurde klar zu verstehen gegeben, dass es nicht erwünscht war, wenn sie über ihre Eltern sprach. Als sie fragte, ob sie einen Kuchen backen dürfe, wie ihre Mammy es ihr beigebracht hatte, tätschelte ihre Tante ihr die Hand und ermahnte sie, sich ‹nicht damit zu quälen›. Im Pfarrhaus war Essen nichts, was Trost spenden oder gar Freude bereiten konnte. Tante Mona war der Meinung, dass Kartoffeln nur in gekochter Form genießbar waren; bei den Ropers gab es kein buttriges Püree oder Käsegratin, wie Frances’ Mutter es gemacht hatte. Beim Backen gab es keine schokoladigen Leckereien, sondern lediglich Scones oder trockene Biskuitkuchen für den Kirchenverkauf.
Als sie das erste Mal an ihrem alten Haus vorbeifuhren, schrie Frances vor Schreck und Überraschung auf. Die hohen, dunklen Kiefern waren verschwunden, und das Haus sah kleiner aus. Es gefiel Frances nicht. Das gemütliche Zuhause aus ihrer Erinnerung war nicht mehr da. Dieses Haus wirkte kahl und blutleer, irgendwie verletzlich.
«Nun, Frances, das ist nicht mehr dein Zuhause. Jetzt wohnt dort eine andere Familie, denn du hast ein schönes neues Zuhause bei uns.» Ihr Onkel, der hinter dem Lenkrad saß, schlug seinen pastoralen Tonfall an. «Denn jedes Haus wird von jemand gebaut; der aber alles gebaut hat, ist Gott.»
Frances fragte sich, ob sie jemals wieder zur Schule gehen würde. Bei einer ihrer Schulstunden am Küchentisch sprach sie ihre Tante darauf an, und Mona erläuterte: «Dein Onkel glaubt nicht, dass du schon so weit bist. Vielleicht könnten ja ein paar deiner Freundinnen zu Besuch kommen?»
Frances gefiel die Idee. Sie erinnerte sich, wie ihre Klassenkameradinnen früher zum Spielen zu ihr nach Hause gekommen waren. Ihre Mammy hatte dann etwas Süßes gebacken und sie ihre Kleider anprobieren lassen. Doch bei Tante Mona ging es anders zu.
«Norah und ein paar andere sind hier, um mit dir zu spielen», wurde vom Fuß der Treppe aus verkündet, und man schickte die Mädchen hoch in Frances’ Zimmer, wo sie verlegen voreinander saßen und sich daran zu erinnern versuchten, worüber sie sich sonst unterhalten hatten. Frances bemühte sich vergeblich, sich Fragen über ihre Lehrerin oder andere Mädchen aus der Klasse einfallen zu lassen. Die Zeit schien überhaupt nicht zu vergehen.
«Danke, Mrs Roper», riefen die Mädchen unisono und rannten beinahe von der Haustür auf ihre wartenden Eltern zu, wobei sie nicht einmal versuchten, die Erleichterung über ihr Entkommen zu verbergen.
An einem Freitag wurde Frances vor dem Abendessen ins Arbeitszimmer ihres Onkels gerufen. An Freitagnachmittagen schrieb er seine Predigten, und auf seinem Schreibtisch stapelten sich dicke, wenig ansprechende Bücher. Ihre Tante nahm seitlich auf einem kleinen samtbezogenen Stuhl Platz. Draußen schien noch die Sonne, doch sie saßen alle drei in staubiger Düsternis.
«Frances», begann Reverend Roper und drückte die Handflächen zusammen, als wollte er beten. «Deine Tante und ich haben miteinander gesprochen und gebetet, und der Herr in seiner Weisheit und Barmherzigkeit hat uns dazu auserwählt, deine Vormunde zu sein.» Er hielt inne. Er sprach immer in langsamen und gleichmäßigen Einheiten, als würde er vor etwas minderbemittelten Sündern predigen. «Verstehst du, was das bedeutet?»
Frances schluckte. «Ich glaube schon.»
Reverend Roper blickte seine Frau an. Mona lächelte unsicher. «Du wirst hier bei uns leben», fuhr er fort, «und wir werden uns um dich kümmern, als wärst du unser eigenes Kind. Unser himmlischer Vater hat dich zu uns gesandt, und wir müssen unsere christliche Pflicht erfüllen.» Er nickte, als stimmte er sich selbst zu. Dann räusperte er sich und sah seine Nichte an. «Gibt es etwas, das du uns mitteilen möchtest, Frances?» Er neigte den Kopf zur Seite. Offenbar erwartete er, dass sie etwas sagte.
Sie hatte so viele Fragen, Dinge, die sie unbedingt wissen wollte. Wieso hatte der himmlische Vater sie hierhergesandt? Wieso hatte er ihre Mammy und ihren Daddy zu sich geholt?
«Danke», sagte sie leise.
Ihr Onkel lächelte und schloss langsam die Augen. «Lasset uns beten.»
Frances senkte den Kopf und lauschte ihrem Onkel, der seinen barmherzigen Herrn bat, dieses Haus und seine Bewohner zu segnen. Was sie nicht begriff, war, wieso Onkel Derek diesen Mann immer noch um etwas bat. Barmherzig? Es war Frances sehr deutlich geworden, dass dieser Vater im Himmel alles andere als das war. Warum sollte sie jemals wieder etwas Gutes von ihm erwarten, wo er sich dazu entschieden hatte, etwas so katastrophal Grausames wie den Tod ihrer Eltern geschehen zu lassen? Sie grub ihre Nägel in die Handflächen.
«Amen.»
«Amen», wiederholten Frances und Tante Mona.
In den Augen der Gemeindemitglieder von St. Ann war es ein klarer Beweis für die unergründlichen Wege des Herrn, dass den Ropers durch den Tod der Howes ein eigenes Kind geschenkt worden war. Durch die Kinderlosigkeit ihres Priesters hatten viele das Gefühl gehabt, als läge ein dünner Schleier von Traurigkeit über der ganzen Gemeinde. Es war schwierig zu frohlocken, wenn der Herr seinen Priester nicht mit dem größten Geschenk segnete, das er zu geben vermochte. Von nun an erfreute es die Herzen der Gemeinde, wenn die kleine Frances Howe am Sonntagmorgen an der Hand ihrer Tante zu ihrer Kirchenbank ganz vorne im Gotteshaus ging. Nicht länger kinderlos.
Am Ende ihres ersten gemeinsamen Sommers wurde beschlossen, dass Frances nicht in die Grundschule zurückkehren würde. Stattdessen sollte sie ein Jahr früher auf die weiterführende Schule kommen. In Ballytoor gab es ein Gymnasium für die umliegenden Gemeinden der Church of Ireland, und da Reverend Roper im Direktorium saß und gelegentlich an der Schule unterrichtete, lag es nahe, Frances dorthin zu schicken. Nach einem Gespräch mit dem Rektor wurde alles arrangiert. Für Frances war die Neuigkeit lediglich ein weiterer dunkler Schatten, der auf ihr neues Leben fiel. Zwar war es eine Erleichterung, nicht mehr den ganzen Tag mit ihrer Tante Mona im Haus versteckt zu werden, doch der Gedanke, ein Klassenzimmer zu betreten, in dem sie niemanden kannte, war beängstigend. Wie erfreulich war da die Nachricht, dass ihre Freundin Norah Dean das letzte Grundschuljahr ebenfalls überspringen würde!
In der unbekannten Welt des Gymnasiums klammerten die Freundinnen sich förmlich aneinander. Die beiden Mädchen hielten sich an den Händen, wenn sie versuchten, den Weg von einem Klassenzimmer zum nächsten zu finden. Sie saßen nebeneinander und gingen entweder gemeinsam nach Hause oder saßen nebeneinander auf dem Rücksitz des Autos, wenn Norahs Vater sie einmal abholte. Mr Dean war stets besonders nett zu Frances. Er hatte immer Schuldgefühle gehabt, weil er das kleine Mädchen an jenem Tag vor dem dunklen Haus alleine gelassen hatte. Es kam nur sehr selten vor, dass Reverend Roper sie zur Schule mitnahm, und das war für Frances vollkommen in Ordnung. Sie verabscheute es, neben Norah zu sitzen und von ihrem Onkel mit sinnlosen Fragen zum Alten Testament traktiert oder Bibelverse abgefragt zu werden. Sie wollte nicht, dass ihre Freundin die ganze Tristesse ihres Lebens im Pfarrhaus mitbekam.
Bald stellte sich heraus, dass Norah für die weiterführende Schule besser geeignet war. Der Unterricht fiel ihr leichter als Frances, und Norah erwies sich schnell als versierte Hockeyspielerin, während Frances sich mit ihrem Schläger am Spielfeldrand herumdrückte und hoffte, dass der Ball nicht in ihre Richtung flog. Norah wurde in der Warteschlange beim Mittagessen von älteren Mädchen angesprochen, und nach der Schule gingen diese manchmal zusammen mit Norah und ihr nach Hause. Frances stellte sich widerstrebend darauf ein, ihre einzige Freundin zu verlieren. Im Speisesaal blickte sie hinüber zu dem Tisch, an den sie befürchtete verbannt zu werden. Dort saß eine Gruppe von Mädchen mit fettigen Haaren in handgestrickten Schulpullovern. Sie glaubte sich kurz davor, auf der untersten Sprosse der sozialen Leiter zu landen. Aber so kam es nicht.
Norah und ihre Eltern, die vielleicht spürten, dass das Pfarrhaus nicht die beste Umgebung für ein junges Mädchen war, begannen, Frances in ihr Leben einzubeziehen. Sie wurde oft zu Übernachtungen eingeladen, und an den Wochenenden war Frances häufig mit dabei, wenn die Familie Ausflüge unternahm. Norah hatte zwei Brüder, die jedoch älter waren, und so wurde Frances quasi zu der Schwester, nach der sich Norah immer gesehnt hatte. Die Ropers förderten diese neue Entwicklung bereitwillig. Die Deans waren regelmäßige Kirchgänger, und man nahm an, dass ihre Einladungen aus Mitleid oder christlicher Nächstenliebe erfolgten. Anfangs dachte Frances das auch, aber es fühlte sich nie so an. Bei Familie Dean ging es locker und lustig zu, ganz im Gegensatz zum steifen und unbehaglichen Umgang im Pfarrhaus. Außerdem war es nicht so, dass Norah wegen Frances irgendetwas entging. Norah war in jeder Sportmannschaft und freundete sich mit anderen beliebten Mädchen an. Frances machte das nichts aus, weil sie stets zu ihr zurückkehrte.
Es war Norahs Mutter, die Frances durch die Pubertät half und ihr zeigte, wie man Binden benutzte und mit dem dünnen Gürtel befestigte.
«So, und wenn du nach Hause kommst, erklärst du deiner Tante, dass du angefangen hast … dass du jetzt eine Frau bist. Dann wird sie dafür sorgen, dass du alles hast, was du brauchst.»
Frances musste ziemlich erschrocken ausgesehen haben, denn Mrs Dean lachte nur und strich ihr auf eine Weise übers Haar, die ihr das Gefühl gab, dass sie immer noch ein kleines Mädchen war und keine Frau.
Als Norahs Mutter Frances an diesem Abend wieder im Pfarrhaus absetzte, kam sie mit rein und unterhielt sich in der Küche flüsternd mit Tante Mona. Danach tauchten wie von Zauberhand Packungen mit Binden in Frances’ Zimmer auf.
Norah war früher entwickelt als Frances, und die beiden betrachteten Norahs Brüste und fragten sich, wie groß sie wohl noch werden würden. Norah forderte Frances auf, sie zu drücken, und dann kugelten sich die Mädchen vor Lachen auf dem Boden. Es dauerte nicht lange, bis auch Frances’ Körper sich zu verändern begann, und diesmal war es Tante Mona, die vorschlug, Unterwäsche kaufen zu gehen. Sie stand am Spülbecken, wandte Frances den Rücken zu und verkündete: «Dein Onkel Derek findet, dass du obszön aussiehst, und ich muss ihm zustimmen. Das ist keine schöne Sache, und es wird Zeit, dass wir einen Büstenhalter für dich besorgen.»
Frances hätte nicht geglaubt, dass es noch peinlicher werden könnte, aber dann schob die alte Mrs Lane sie an diesem Nachmittag in eine Umkleidekabine im hinteren Teil des À La Mode in der Weir Street, riss ihr praktisch die Schulbluse vom Leib und umfasste ihre Brüste mit den Händen. «Ich wollte im Boden versinken», erzählte Frances Norah später. «Ich konnte nur noch auf das haarige Muttermal neben ihrer Lippe starren. Ich dachte, gleich wird mir schlecht.»
Frances hatte hoffnungsvoll die kopflosen Schaufensterpuppen betrachtet. Sie alle trugen BHs mit hübschen Spitzenborten, die aussahen wie die von Norah, doch Frances verließ das À La Mode mit einer Papiertüte mit zwei stabilen BHs in der Farbe von Dosenmilchreis. Frances hätte nicht gewusst, wie genau man sexy definierte, aber sie war sich sicher, ihre neue Unterwäsche war es nicht.
Auch die Jungs veränderten sich, oder vielleicht war es nur die Art, wie sie und Norah über sie dachten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Frances sie entweder gefürchtet oder ignoriert, aber nun, da sie anfingen, sie anders anzuschauen, änderte sich auch ihre Perspektive. Sie waren immer noch beängstigend mit ihren lauten Stimmen und plötzlichen Schlägereien, aber einige von ihnen, vor allem die Jungs aus der sechsten Klasse, waren auch … interessant? Anziehend? Frances war sich nicht sicher. Sie wusste nur, dass es sie herrlich erschauern ließ, wenn einer von ihnen sie bemerkte. Sie achtete mehr darauf, wie sie ihr Haar scheitelte, und sorgte dafür, dass ihre Kniestrümpfe nie zu ihren Knöcheln herunterrutschten. Sie betupfte sich mit kleinen Tröpfchen aus Mrs Deans Shalimar-Flasche.
Natürlich erregte Norah bei den Jungen mehr Aufmerksamkeit. Sie trug ihre kurzen Hockeyröcke öfter in die Schule, als es Frances’ Einschätzung nach unbedingt notwendig war. Die Jungs boten Norah an, ihr die schwere Schultasche nach Hause zu tragen, und sie ließ sie gewähren. Frances lief derweil hinter ihnen her, gebückt unter ihrem eigenen Ranzen voller Bücher. Sie fühlte sich wie Sancho Panza auf dem Cover von Don Quichote in der Schulbibliothek. Wieder einmal fand sie sich damit ab, dass sie ihre Freundin verlieren würde, doch Norah erwies sich einmal mehr als extrem loyal. Es war, als würde Norah die Jungs nur bei Laune halten, damit die beiden Mädchen anschließend über sie lachen konnten.
«Er dachte, Heathcliff wäre ein Ort!»
«Ganz schön frech, dass er versucht hat, meine Hand zu halten. Seine Finger haben sich angefühlt wie schwitzige Würste!»
Sie heulten vor Lachen über die Ahnungslosigkeit der Jungen, und doch ertappte sich Frances dabei, wie sie auf die dunklen Härchen über Roger Baileys Oberlippe starrte und sich fragte, wie es sich wohl anfühlen würde, seinen breiten Rücken zu berühren. Sie erzählte Norah nie von diesen Fantasien, es wäre ihr illoyal vorgekommen. Sie hatten einander, und das war alles, was zählte.
Im fünften Schuljahr wurde einigen der Mädchen allmählich erlaubt, an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen, kleinen Tanzabenden, die ausschließlich für die Jugend der irischen Kirche organisiert wurden. Es war nie offen ausgesprochen worden, aber Frances vermutete, die Veranstaltungen waren dafür gedacht, dass Protestanten einander kennenlernten, heirateten und Babys bekamen, die dann wie Sandsäcke gegen die stete Flut an römisch-katholischen Geburten eingesetzt werden sollten. Die Tanzabende wurden unter strenger Aufsicht abgehalten und beinhalteten immer ein Abendessen mit Tee und Sandwiches. Der Veranstaltungsort wechselte von Gemeinde zu Gemeinde in West Cork, aber Ende November sollte ein geselliges Beisammensein im Gemeindehaus von St. Ann in Ballytoor stattfinden.
Dieser Tanzabend wurde nun zum Lebensmittelpunkt der Mädchen. Lachend und schwitzend übten sie zu Norahs einziger Bill-Haley-Platte vor dem Sofa ihre Schritte, obwohl sie sich sicher waren, dass die Band wahrscheinlich eher Songs von Ruby Murray und Dean Martin spielen würde. Sie erörterten ihre Outfits, was sich größtenteils darin erschöpfte, dass Norah Frances mitteilte, was sie ihr zu leihen bereit war. Das ganze Gequatsche machte Spaß, aber tief in ihrem Inneren erschien es Frances fraglich, dass ihre Tante und ihr Onkel ihr jemals erlauben würden, an der Veranstaltung teilzunehmen. Norah zerstreute ihre Befürchtungen: «Natürlich lassen sie dich hingehen. Das ist schließlich von der Kirche organisiert. Frag sie einfach.» Durch Norahs Zuversicht fasste Frances den nötigen Mut. Sie versuchte es bei ihrer Tante, deren Antwort umgehend lautete: «Frag deinen Onkel.» Frances bezweifelte, dass sie die Frage überhaupt gehört hatte. Sie stand im Flur und wusste nicht, was sie tun sollte. «Na los, frag ihn doch!», drängte Tante Mona und deutete ungeduldig auf die Tür zum Arbeitszimmer.
«Herein.»
Die Tür öffnete sich knarrend, und Frances trat in die Dunkelheit. Ihr Onkel saß hinter seinem Schreibtisch und spähte über seine Halbbrille.
«Nun?» Sein Tonfall sorgte dafür, dass Frances ihr Vorhaben sofort bereute.
«Ich habe mich gefragt …» Sie räusperte sich und fing noch einmal an, in der Hoffnung, selbstbewusster zu klingen. «Ich habe mich nur gefragt, ob ich nächsten Freitag wohl zu der Veranstaltung gehen darf. Tante Mona hat gesagt, ich soll dich fragen.»
Die Augenbrauen ihres Onkels hoben sich überrascht. Mit dieser Bitte hatte er offensichtlich nicht gerechnet.
«Zu dem Tanzabend?», fragte er.
«Ja.» Frances hätte sich gerne an einem Stuhl festgehalten oder an einen Tisch gelehnt, aber da war nichts.
«Nun, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, warum deine Tante fand, dass du mir eine solche Frage stellen solltest. Das ist keine gute Idee. Vollkommen unangebracht, würde ich sagen.»
«Aber du bist doch auch da», platzte Frances heraus.
Reverend Roper nahm die Brille ab. «Ich werde», sagte er und legte eine theatralische Pause ein, «vor dem Abendessen das Tischgebet sprechen und dem Komitee danken. Das ist kaum dasselbe, wie an der Tanzveranstaltung teilzunehmen. Einer Tanzveranstaltung, die, wie ich hinzufügen möchte, für Erwachsene bestimmt ist, nicht für siebzehnjährige Schulmädchen.» Er tippte, um dies zu unterstreichen, mit seinem Kugelschreiber auf den Schreibtisch.
«Norah Dean geht auch hin …» Sie verstummte. Sie wusste bereits, dass es hoffnungslos war.
«Aha, aha», seine Stimme wurde lauter, «und wenn Norah Dean ihre Hand ins Feuer halten würde, nehme ich an, du würdest das auch tun?» Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er fort: «Es ist mir gleichgültig, was für ein Verhalten die Deans angemessen finden, aber ich kann dir sagen, dass sich aus diesem Haushalt niemand herausputzen wird wie … wie …» Er rang um einen Vergleich und entschied sich dann für: «… eine widerspenstige Kuh auf dem Viehmarkt! ‹Der Weg allen Fleisches ist offenkundig!›» Reverend Roper schüttelte angewidert den Kopf, und Frances begriff, dass die Unterhaltung damit beendet war.
Am Samstagabend nach dem Tanz stürmten Norah und Frances die Treppe zu Norahs Zimmer hinauf. Norah stemmte sich mit dem Rücken gegen die geschlossene Tür, um zu verhindern, dass jemand hereinplatzen konnte, und verkündete in lautem Flüsterton: «Ich habe einen Jungen geküsst!»
«Nein.» Frances umklammerte eine imaginäre Perlenkette. «Wen? Wen hast du geküsst?»
Norah zog ihre Freundin zum Bett. «Trevor Sweetnam. Den Bruder von Shirley Sweetnam, er studiert in Dublin.»
Frances stieß einen Schrei aus, der zugleich Entsetzen und Anerkennung ausdrückte.
«Wie? Wo ist es passiert?»
«Zum Schluss.» Norah lachte jetzt, als sie daran dachte. «Als wir unsere Mäntel geholt haben. Er hat mich hinter den Kleiderständer geschubst. Und dann noch einmal draußen, als Daddy das Auto geholt hat, da war er immer noch da und hat mich hinter die Statue von Padraic Pearse gezogen, und wir haben uns noch ein bisschen mehr geküsst. Ich meine, ziemlich lange.»
Frances war außer sich vor Neid. «Wie war es?»
Norah dachte einen Moment nach. «Ich weiß nicht genau. Es war komisch.»
Dann sprang sie vom Bett. «Warte hier!» Sie rannte aus dem Zimmer, um einen Moment später mit einem Gegenstand in der Hand zurückzukehren.
«Darf ich es dir zeigen?»
Frances begriff nicht.
«Hier.» Norah schwenkte einen Lippenstift ihrer Mutter. «Ich trage ihn dir auf.»
Frances spitzte gehorsam die Lippen, und Norah zog sie nach. Als ihr Werk vollendet war, lehnte sie sich zurück. «Jetzt bist du ich, und ich bin er.»
Norah beugte sich vor und presste ihre Lippen auf die ihrer Freundin. Sie legte die Hände auf Frances’ Rücken und zog sie näher zu sich heran. Es war weich und warm, und einen Moment lang fand Frances es angenehm, doch dann schob Norah ihre Zunge vor, und die Nässe ließ sie zurückschrecken.
«Das mag ich nicht.»
«So hat er es gemacht», versicherte Norah ihr. «Komm, wir probieren es noch mal.»
Frances streckte die Arme vor sich aus, um sie daran zu hindern, sich wieder zu ihr vorzubeugen. «Nein. Ich mag das nicht. Hör auf.» Wenn es eine Sünde war, einen Jungen zu küssen, und sie war sich ziemlich sicher, dass es eine war, was war dann das hier?
«Na gut.» Norah zuckte mit den Schultern. «Du wolltest doch wissen, wie es war.»
Den restlichen Nachmittag über kam es Frances so vor, als würde ihre Freundin schmollen, und was das Küssen anging, wurde keine der beiden Varianten jemals wieder angesprochen.
Und dann war Norah fort. Es geschah genau das, wovor Frances sich gefürchtet hatte, seitdem sie ihre Eltern verloren hatte. Es hätte sie nicht so treffen sollen, sie hatte ja gewusst, dass sich ihre Schulzeit dem Ende zuneigte, aber ihre Freundin verschwand so unvermittelt aus ihrem Leben und schien nicht den kleinsten Blick zurückzuwerfen, daher hatte Frances unwillkürlich das Gefühl, Norah hätte sie fallen gelassen.
«Meine Tante Christine in London hat für mich einen Platz in einer Sekretärinnenschule in Wimbledon gefunden. Du weißt schon, wo dieses Tennisturnier stattfindet?» Norahs Gesicht leuchtete förmlich vor Aufregung. Frances versuchte, sich für Norah zu freuen, fragte sich aber, wieso es ihre Freundin nicht zu bedauern schien, ihre besondere Verbindung zueinander hinter sich zu lassen. Es war, als hätte Norah schon die ganze Zeit auf gepackten Koffern gesessen und durch die Freundschaft zu Frances lediglich etwas Zeit totgeschlagen.
«Meine Tante hat einen Flug für mich gebucht! Aer Lingus nach London. Ich ziehe meinen Kirchenmantel an, du weißt schon, den blauen? Ich meine, ich weiß ja nicht mal, was man in London so trägt.» Für Frances hörte es sich so an, als versuchte Norah bereits, mit englischem Akzent zu sprechen.
«Kleider, so wie wir alle, nehme ich an», sagte Frances und hoffte, dass es nicht so missgünstig klang, wie es gemeint war.
Norah hielt inne und sah ihre Freundin an. «Du musst mich besuchen kommen.»
«Natürlich!», sagte Frances ohne Überzeugung.
Der Weg zurück zum Pfarrhaus fühlte sich nicht wie ein Heimweg an. Norah, das Haus der Deans und alles, was ihr seit dem Tod ihrer Eltern Trost gespendet hatte, gehörte nun der Vergangenheit an. Nachdem sie durch das Tor zum Pfarrhaus getreten war, versteckte sie sich hinter dem kleinen steinernen Schuppen seitlich vom Haus, wo sie ihren Tränen freien Lauf ließ. Sie hatte keine Ahnung, was die Zukunft für sie bereithielt, aber sie wusste, sie musste ihr allein gegenübertreten. Sie putzte sich mit dem Rocksaum die Nase und ging hinein.