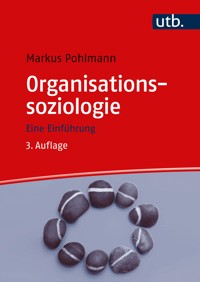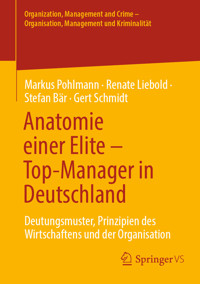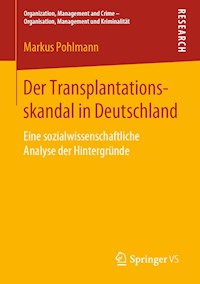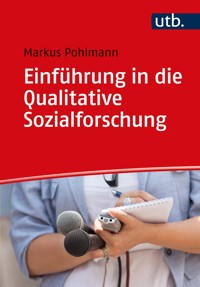
31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Lehrbuch erleichtert und unterstützt den Erstkontakt mit der qualitativen Sozialforschung. Es ist zugleich ein Arbeitsbuch, welches an konkreten Beispielen veranschaulicht, wie man mithilfe der Methoden der qualitativen Sozialforschung unterschiedliche Fragestellungen im Fach Soziologie sowie in den Sozialwissenschaften bearbeiten kann. Die Orientierung an Mixed-Methods-Ansätzen und ihrer Durchführung unterscheidet dieses Lehrbuch von vielen anderen. Das Buch richtet sich an Bachelorstudierende der Soziologie sowie der Sozialwissenschaften. Aber auch für andere Fächer ist das Buch einfach zu rezipieren, da es keine Grundkenntnisse der Soziologie oder der empirischen Sozialforschung voraussetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Markus Pohlmann
Einführung in die Qualitative Sozialforschung
UVK Verlag · München
Umschlagabbildung: iStockphoto, wellphoto
Markus Pohlmann ist Professor für Organisationssoziologie mit den Schwerpunkten Management und Wirtschaftskriminalität am Max-Weber-Institut für Soziologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838555300
© UVK Verlag 2022— ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
utb-Nr. 5530
ISBN 978-3-8252-5530-5 (Print)
ISBN 978-3-8463-5530-5 (ePub)
Inhalt
Für Carola †
Vorwort
Dieses Buch hat eine ungewöhnliche Vorgeschichte. Es kam überhaupt nur zustande, weil zwei Ereignisse zusammentrafen. Zum einen eine hohe Nachfrage von Studierenden, welche aus einem Seminar eine Vorlesung mit mehr als 100 Teilnehmern werden ließ. Zum anderen der erste Lockdown während der Corona-Pandemie 2020, welcher dazu führte, dass diese Vorlesung online gehalten und mit Skripten, Audiofiles, Übungen für Zuhause etc. versorgt werden musste. Dadurch waren wir ins kalte Wasser der Online-Lehre geworfen und mussten sehen, wie wir damit zurechtkamen. Ich hatte die Vorlesung ursprünglich so konzipiert, dass die Studierenden in jeder zweiten Sitzung ins Feld gehen und erste Erfahrungen mit qualitativen Erhebungen sammeln sollten, aber das war nun Geschichte. Als Feld diente uns jetzt das Internet, das wenigstens ersatzweise Erfahrungen bot, wenn auch oft aus zweiter Hand. Das Produkt, das aus dieser Vorlesung entstanden ist, liegt nun vor Ihnen. Meine Absicht war es, das Buch so zu gestalten, dass es hilft, selbständig ins Feld zu gehen. Ich habe dafür kleine Gehhilfen und Wegekarten bereitgestellt. Ziel war es, dass Sie diese ersten Schritte ohne allzu viel Gepäck, ohne allzu viel Vorbereitung absolvieren zu können und dafür ist dieses Buch gedacht.
Aber dieses Buch verdankt sich nicht nur den oben beschriebenen Zufällen, sondern auch einem Team, das mich sehr unterstützt hat und Kolleg*innen, welche den Text kommentiert und mit mir diskutiert haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Zuallererst möchte ich Aleksandra Barjaktarević und Meira Hilbertz danken, die nicht nur die Vorlesung als Tutorinnen mit unterstützt haben, sondern auch in vielfältiger Weise an dem Buch mitgewirkt haben. Auch Jan Hoffmann hat tatkräftig zum Gelingen des Buches beigetragen. Katharina Döllinger hat das Buch Korrektur gelesen und Kathia Serrano Velarde hat es mit ihrem Feedback unterstützt. Viele andere haben ebenfalls ihr Feedback zu dem Buch gegeben. Auch ihnen gebührt mein herzlicher Dank.
Inspiriert ist das Buch auch von meinen drei Kindern, die mir beim Homeschooling während der verschiedenen Lockdowns immer wieder klargemacht haben, wie wichtig es ist, Spaß beim Lernen zu haben. Auch meiner Frau danke ich sehr für ihre fortwährende Unterstützung und die Arbeitsteilung, welche es uns im Zweischichtbetrieb ermöglicht hat, unsere Schriften, wenn auch bisweilen im Schneckentempo, trotz der Lockdowns fertigzustellen.
Gewidmet ist dieses Buch einer sehr guten Freundin und Kollegin, die viele Jahre sehr schwer erkrankt war und in dem Jahr, in dem dieses Buch entstand, 2021, von uns gegangen ist. Ihr Mut und ihr Durchhaltevermögen werden mir immer unbegreiflich bleiben. Das Buch hat ihrem Vorbild viel zu verdanken.
Alle Fragen zur Vertiefung und die Übungen für Zuhause finden Sie unter http://qs-pohlmann.de.
1Einleitung: Einladung zur qualitativen Sozialforschung
Mein erstes InterviewInterview als Student im zweiten Semester des Soziologiestudiums in Freiburg fand im Rahmen einer standardisierten Befragung zum Wertewandel statt. Wir bekamen Interviewpartner in unterschiedlichen Vierteln der Stadt zugeteilt und ich hatte eines in einem Lehrer- und Akademikerviertel und eines in einem Arbeiterviertel zu führen. Ich begann mit dem Arbeiterviertel. Es war später Nachmittag. Ich war aufgeregt, klingelte an der Tür und wurde von der Frau eines Straßenarbeiters – konkret: Pflasterers – eingelassen. Ich wurde ins Wohnzimmer gebeten, bekam einen Kaffee und das Interview begann. Der Interviewte war anfangs ebenfalls nervös und ich merkte, dass er mit einigen der Fragen nichts anfangen konnte. Der Fragebogen war lang. Ab und an kam seine aufmerksame Frau herein, schenkte Kaffee nach oder brachte Kekse und bemerkte dann jedes Mal: Wir sind eine glückliche Familie. Die Nervosität meines Interviewpartners legte sich erst, als er sich einen Schnaps zum Kaffee genehmigte. Immer wieder verließ das Gespräch die Vorgaben meines Fragebogens. Die Antworten des Interviewten wurden zwar immer flüssiger, aber hatten immer weniger mit den Fragen des Fragebogens zu tun. Wir kamen nur langsam voran. Seine Frau erzählte immer wieder von ihren Kindern, wenn sie dazu kam. Nach einer weiteren halben Stunde kam sein Cousin zu Besuch und nach weiteren Schnäpsen begann dieser meine Fragen zu beantworten. Kurzum: Es war interviewtechnisch eine Katastrophe. Das Interview erwies sich nach den Vorgaben der Studie als nicht verwertbar. Ich war enttäuscht. Aber dennoch hatte ich viel gelernt. Ich hatte ein neues Milieu und Milieunette Leute kennengelernt, die mir in ihren Erzählungen viel über ihre Relevanzen, Sichtweisen, aber auch ihre Werte und Bedürfnisse mitgeteilt hatten. Das Erzählte hatte eben nur nicht in den Fragebogen gepasst. Das Interview sollte 45 Minuten dauern, aber ich war erst zweieinhalb Stunden später wieder draußen, mit mehr Erfahrungen, aber auch mit dem Gefühl, versagt zu haben. Erst später habe ich verstanden, dass das InterviewInterview trotz aller Einschränkungen, Erhebungsfehler und des Schnapses in Bezug auf das Erkenntnisinteresse gut funktioniert hat. Ich möchte das im Nachhinein nicht schönreden. Meine Interviewtechnik war nicht gut, ich war aufgeregt, anfangs steif und habe wahrscheinlich auch die Fragen nicht so flüssig und neutral gestellt, wie ich das gesollt hätte. Erst viel später habe ich verstanden, dass ich über die Wertehorizonte und ihren Wandel, also über das Erkenntnisinteresse der Studie, sehr viel erfahren hatte. Es war eben nur nicht geordnet, in den vorgesehenen SkalenSkalen und Kästchen untergebracht, wie wir uns das ursprünglich gewünscht hatten. Viele der standardisierten Fragen waren an dem Befragten einfach vorbeigegangen. Was bei dem zweiten Interview mit einem Studienrat dann ohne Probleme funktioniert hatte, erwies sich bei dem Straßenarbeiter nicht als anschlussfähig. Und das lag nicht daran, dass die Fragen nicht vorher getestet worden wären oder zu kompliziert waren. Sie waren nur nicht anschlussfähig an die Lebenswelt, die Interessen und Orientierungen des Straßenarbeiters und seiner Familie. Damals, im zweiten Semester, wusste ich noch nicht viel über die MethodenMethoden der qualitativen Sozialforschung, aber ohne es zu wissen, hatte ich durch mein erstes Interview viel über diese gelernt und gemerkt, wie erkenntnisreich sie sein können. Natürlich hat man hinterher keine Kreuzchen oder Klicks in Kästchen und muss sich gut überlegen, wie man diese Gespräche auswerten und ihre ErgebnisseErgebnisse generalisieren kann, aber der Informationsgehalt und der Zugang zum Milieu, zur Lebenswelt und zu den Wertorientierungen in den Worten und in der Perspektive der Befragten gingen weit über das hinaus, was die standardisierte Befragung zugelassen hatte. Mir wurde klar, wie erkenntnisreich und einfach der Zugang zu anderen Lebenswelten war, wenn man auf bestimmte Dinge achtete und wie vielversprechend eine Kombination offener, gesprächsorientierter Methoden mit stärker standardisierten Fragen sein kann.
Von diesen Erfahrungen als Student ist dieses Lehrbuch inspiriert. Es soll jenen helfen, die forschend unterwegs sein wollen, den Zugang zu anderen Lebenswelten zu öffnen und zugleich aufzeigen, wie man diesen offenen, qualitativen Zugang mit anderen, stärker standardisierten Herangehensweisen kombinieren kann. Es soll eine Einladung zur qualitativen Sozialforschung sein, aber auch eine Einladung dazu, verschiedene MethodenMethoden einzusetzen und miteinander in Beziehung zu bringen. Denn wer Forschung, insbesondere Primärforschung betreibt und als Student*in oder Forscher*in ins Feld geht, sollte wissen, dass die Methoden je nach Fragestellung ausgewählt, variiert und kombiniert werden – und nicht umgekehrt. Dies zumindest ist die im vorliegenden Lehrbuch vertretene Ansicht.
MethodenMethoden sind Hilfsmittel, um empirische Phänomene zu verstehen und ihr Auftreten erklären zu können. Je nach Fragestellung und Phänomen, je nach den anvisierten Erklärungsfaktoren (Explanans) und dem, was erklärt werden soll (Explandum), müssen daher unterschiedliche Methoden zum Einsatz kommen. Sie sollen sich darauf bezogen als nützlich erweisen. Welche besser geeignet sind, bestimmt sich nicht nach dem Paradigma, also nach den wissenschaftlichen Denk- und Glaubensgrundsätzen, denen die Forscher*innen ggf. anhängen, sondern danach, wie sehr sie helfen, ein empirisches Phänomen verstehen und erklären zu können. Wenn man sie selbst zum Gegenstand weiterer Reflektionen macht, kann man viel diskutieren und streiten, Paradigmen und Positionen verteidigen, kommt aber als Forscher*in dennoch nicht umhin, zu entscheiden, welche Theorien und Methoden am besten geeignet erscheinen, das jeweilige empirische Phänomen zu analysieren. Das vorliegende Lehrbuch orientiert sich nicht an den Paradigmen und Positionen des fortwährenden Methodenstreits in den Sozialwissenschaften, sondern ausschließlich daran, wie man Methoden einsetzen kann, um in einem wissenschaftlichen Verfahren Antworten auf die Fragestellung zu generieren.
Auch wenn wir uns nicht an Paradigmen orientieren, eint eine qualitative Herangehensweise mehr als die Vielfalt ihrer Ansätze vermuten lässt. Für Studierende macht es die überbordende Vielfalt an MethodenMethoden, Ansätzen, Postulaten derzeit schwer, den Wald vor lauter Bäumen noch zu erkennen. Es ist nicht zu übersehen, dass es sich bei der qualitativen Sozialforschung mittlerweile um eine “broad church” handelt, der sich Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Fächern zeitweise angeschlossen haben, mit teils unvereinbaren methodologischen Positionen und Verfahren. Bei genauerem Hinsehen eint sie sicherlich kein geteiltes methodologisches Paradigma (siehe dazu die Diskussion bei Kelle 2017: 59) oder Verfahren. Dennoch gibt es für viele Verfahren und Positionen – wenn auch nicht für alle – Ähnlichkeiten in den Herangehensweisen, die sich gut beschreiben und von einer stärker standardisierten Forschung gut unterscheiden lassen. Dazu gehören u. a. der offene, oft das Vorwissen zurückstellende Zugang, der Ausgangspunkt beim empirischen Material selbst und der Einsatz von vergleichenden Verfahren, um zu Schlussfolgerungen und zu Generalisierungen zu gelangen. Dabei gibt es einen fließenden Übergang zu Verfahren der stärker standardisierten, quantitativ orientierten Forschung und eine Vielzahl von Methodenkombinationen. Auch wenn dies die Unterscheidung zwischen qualitativer und quantitativer Sozialforschung viel gradueller werden lässt, als der stete „Methodenstreit“ suggeriert, bleiben prinzipielle Unterschiede in der Herangehensweise erkennbar. Die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen von Ansätzen und Verfahren sind immer noch größer als die internen Unterschiede in den jeweiligen Gruppen. Gerade dies macht ja ihre Kombination in der Sozialforschung so reizvoll und eröffnet die Möglichkeit, die qualitative Sozialforschungqualitative Sozialforschung in einem vergleichsweise eher schmalen Lehrbuch darzustellen anstatt der dicken Handbücher und Kompendien, die es bereits zum Thema gibt.
Das vorliegende Lehrbuch versteht sich dabei als Arbeitsbuch, um verschiedene Denk- und Herangehensweisen der qualitativen Sozialforschung kennenzulernen, aber auch um Einblicke in verschiedene MethodenMethoden und deren Kombinationen zu geben. Zu den einzelnen Methoden gibt es bereits zahlreiche Bücher, deren Detaillierungsgrad und Ausführlichkeit das vorliegende Lehrbuch weder ersetzen noch wiedergeben kann. Es verweist bei Gelegenheit auf diese und wer sich in eine Methode vertiefen möchte, sollte sich am besten ihrer bedienen. Das vorliegende Lehrbuch versteht sich vielmehr als ein Arbeitsbuch, das man zur Hand nehmen kann, um erste Schritte in diesem Feld selbständig zu gehen. Es soll dazu inspirieren, selbst in die Empirie zu gehen, die Hallen der Universität und die kurzatmige Welt des Internets und der sozialen Medien zu verlassen, um selbst erste Schritte im Feld zu gehen. Erst wenn man mit den realen Problemen im Feld konfrontiert ist – wie im Falle des Interviews mit dem Straßenarbeiter –, wächst für viele von uns auch das reale Interesse an Methoden. Dazu soll das Buch befähigen.
1.1Vorgehensweise und Aufbau des Buches
Mit der Konzeption dieses Lehrbuches als Lern- und Arbeitsbuch ist verbunden, dass es immer wieder Übungen, Werkzeug- und Informationsboxen enthält, welche helfen sollen, das Gelesene anzuwenden und zu vertiefen. Es soll zumindest ein simuliertes “learning by doing” ermöglichen, auch wenn es nicht ersetzen kann, selbst ins Feld zu gehen und erste Erfahrungen zu sammeln. Dabei wurde immer wieder versucht, die Einführung in die MethodenMethoden und Verfahren auf konkrete inhaltliche Fragestellungen zu beziehen und die ersten Schritte zur Beantwortung der inhaltlichen Fragestellungen mit Ihnen gemeinsam zu gehen. Es wurde in der Regel davon abgesehen, bereits durchgeführte Studien nachzuvollziehen und bereits geprüfte, validierte und getestete Instrumente in den Vordergrund zu stellen. Dafür stehen zahlreiche Handbücher zur Verfügung. Ziel war es vielmehr, mit den Leser*innen gemeinsam diese Schritte zu gehen und damit das Verfahren in der konkreten Durchführung zu illustrieren und zu lernen, worauf wir bei der Durchführung achten müssen.
Unsere Vorgehensweisen bei den inhaltlichen Fragestellungen sind dabei nicht in Stein gemeißelt. Sie sind immer auch anders möglich und sicherlich kann man diskutieren, ob man dies so oder anders durchführen sollte. Und genau darauf basiert die qualitative Sozialforschungqualitative Sozialforschung auch: auf InterpretationsgemeinschaftenInterpretationsgemeinschaften, welche im Streit um Deutungs- und Verfahrensweisen zur intersubjektiven Validierung der ErgebnisseErgebnisse beitragen. Wenn wir Hinweise zu den Ergebnissen der Übungen oder zur Beantwortung von Fragen geben, so sind sie genau als solches zu verstehen: als Vorschläge, zu welchen Ergebnissen man kommen kann, aber nicht ohne Wenn und Aber kommen muss. Im Vordergrund steht immer das grundlegende Verständnis, das wir generieren wollen, und eine Vorstellung davon, wie man vorgehen könnte, wenn man erste Schritte in einem solchen Feld unternimmt.
Am Ende jedes Kapitels haben wir Vertiefungsfragen und Übungen für Zuhause bereitgestellt. Sie dienen der Ergebnissicherung sowie der vertiefenden Beschäftigung mit dem Thema des Kapitels. Die Antwortvorschläge unsererseits werden jeweils auf einer Homepage von uns zur Verfügung gestellt. Zugleich finden Sie dort weiterführende Literatur, wenn Sie das Studium der qualitativen MethodenMethoden weiter vertiefen wollen.
Das vorliegende Lehrbuch hat zum Ziel, einen Überblick über die wichtigsten Verfahren der qualitativen Forschung zu geben – inklusive der Möglichkeiten, sie mit anderen MethodenMethoden zu kombinieren. Gemessen an der großen und wachsenden Vielfalt der qualitativen Methoden ist es also sehr selektiv, im Grunde auf die “basics” der qualitativen Forschung konzentriert. Dazu gehören u.E. ExperimenteExperimente, Beobachtungen, Inhaltsanalysen und Interviews. Das hört sich nach wenig an, ist aber tatsächlich in der Darstellung der wichtigsten Grundlagen bereits eine Herausforderung für ein Lehrbuch. Denn hinter jedem dieser qualitativen ErhebungsverfahrenErhebungsverfahren stecken weitere zahlreiche Möglichkeiten und Varianten der Durchführung sowie der Analysemethoden. Wir haben versucht, uns auf die grundlegenden Perspektiven zu konzentrieren, um das Buch halbwegs schlank zu halten und dadurch natürlich viele Verfahrensvarianten, neue Ansätze und Autoren nicht oder nicht hinreichend berücksichtigen können. Aber dazu ist die “broad church” der qualitativen Sozialforschung mittlerweile zu groß und auch zu bedeutend geworden, um all dies in einem Lehrbuch darstellen zu können.
Bevor wir jedoch auf die grundlegenden ErhebungsverfahrenErhebungsverfahren eingehen, ist es für uns wichtig, die erkenntnistheoretischen Grundlagen, auf welchen viele Verfahren basieren, zu klären (Kapitel 2). Ohne diese und eine grundlegende Idee von „Verstehen“ und „InterpretationInterpretation“ können wir u.E. die Erhebungs- und AnalyseverfahrenAnalyseverfahren in ihrem Kern nicht verstehen. Zugleich wollen wir – bei allen Unterschieden – das Gemeinsame und Verbindende in den Prinzipien dieser “broad church” der qualitativen Forschung herausarbeiten (Kapitel 3) und so einen Ausgangspunkt gewinnen, um in die grundlegenden Erhebungsverfahren tiefer hineinzugehen. Bezogen auf die grundlegenden Verfahren haben wir mit Experimenten (Kapitel 4) begonnen, weil insbesondere Krisenexperimente für uns einen guten Zugang eröffnen, um Sinn und Zweck der Sozialforschung nachvollziehen zu können. Deren Vorgehensweise, das Gewebe alltäglicher Normen, Erwartungen und informeller Regeln kennen zu lernen, indem man gegen sie verstößt, macht zugleich deutlich, dass die qualitative Sozialforschungqualitative Sozialforschung auch für die Forschenden nicht äußerlich bleibt. Vielmehr fordert sie heraus, sich auch persönlich einzubringen und eigene Widerstände zu überwinden. Das Gleiche gilt für die BeobachtungBeobachtung (Kapitel 5), insbesondere die teilnehmende Beobachtungteilnehmende Beobachtung. Sie eröffnet nicht nur einen direkten Zugang zum Forschungsfeld, sondern verlangt zugleich auch eine Mitwirkung in diesem Feld. Die Beschäftigung mit der qualitativen InhaltsanalyseInhaltsanalyse (Kapitel 6) eröffnet dann u. a. eine hermeneutische Perspektive auf empirisches Material und Texte und fördert damit das Einüben einer Kernkompetenz in der qualitativen Forschung: das Zwischen-den-Zeilen-Lesen, das Herausarbeiten des Hintergründigen, Nicht-Offensichtlichen. Diese wird in Kapitel 8 mit der DeutungsmusteranalyseDeutungsmusteranalyse weiter vertieft, doch zuvor werden wir in Kapitel 7 noch eine Königsdisziplin der qualitativen Forschung genauer kennenlernen: Das InterviewInterview. Auch wenn die Reihenfolge der Darstellung der grundlegenden Erhebungs- und Analyseverfahren nicht zwingend ist und jedes Kapitel für sich stehen kann, ist sie doch so angelegt, dass sie den sukzessiven Erwerb von Kernkompetenzen befördern kann.
1.2Theoretische Ansätze und Kompetenzerwerb
Entlang der Theorien, welche für die qualitative Sozialforschungqualitative Sozialforschung wegweisend sind, sollen im vorliegenden Lehrbuch verschiedene Kompetenzen eingeübt werden. Sie sollen den Leser*innen helfen, sich im Forschungsfeld zurechtzufinden und nicht nur eigene Erhebungen durchführen, sondern deren ErgebnisseErgebnisse auch einordnen zu können.
Während in diesem Kapitel der Zugang zum Thema im Vordergrund steht, ist es in Kapitel 2 die methodologische, erkenntnistheoretische ReflexionReflexion der uns entgegenscheinenden WirklichkeitWirklichkeit. Es soll mithilfe einer Bezugnahme auf den erkenntnistheoretischen KonstruktivismusKonstruktivismus eine Reflexion unserer „natürlichen Einstellung“ (wie uns die Welt ganz selbstverständlich erscheint) ermöglichen und die Voraussetzungen schaffen, um die Kernkompetenzen des Interpretierens und Konstruierens einzuüben. In Kapitel 3 werden unter Bezugnahme auf die PhänomenologiePhänomenologie Husserls sowie auf die Grounded TheoryGrounded Theory Kompetenzen der phänomenologischen ReduktionReduktion, des Codierens sowie des Theorieaufbaus aus dem Material heraus eingeübt. In Kapitel 4 entwickeln wir erste ethnomethodologische Kompetenzen und lernen, wie wir Alltagssituationen gezielt in die KriseKrise bringen und ExperimenteExperimente durchführen können, um mehr über den Aufbau der sozialen Welt zu erfahren. Zugleich trainieren wir, wie wir unter Bezugnahme auf GoffmanGoffman die Rahmungen identifizieren können, welche vielen sozialen Situationen zu Grunde liegen (siehe Tabelle 1).
Theoretische Ansätze
Kernkompetenzen
Kapitel 1
Einleitung
Zugang zum Thema abseits des Methodenstreites kennenlernen
Kapitel 2
Konstruktivismus
(Kant, Piaget, von Förster, Berger & Luckmann etc.)
Reflexion der „natürlichen Einstellung“
Interpretieren und Konstruieren verstehen lernen
Kapitel 3
Phänomenologie
(Husserl)
Grounded Theory
(Glaser & Strauss)
phänomenologisch reduzieren
Theorien aus dem Material heraus bauen
Kapitel 4
Ethnomethodologie
(Garfinkel)
Rahmenanalyse
(Goffman)
Alltagssituationen kontrolliert in die Krise bringen
Experimente durchführen
Rahmungen von Situationen identifizieren
Kapitel 5
Symbolischer Interaktionismus (Blumer, Mead)
Bedeutungszuweisungen in Interaktionen verstehen
unstrukturiert und strukturiert beobachten
Kapitel 6
Hermeneutik
(Dilthey)
hermeneutisch interpretieren
verschiedene Arten der Inhaltsanalyse durchführen und kombinieren
Kapitel 7
Wissenssoziologie
(Schütz, Berger, Luckmann)
Interviews vorbereiten
Interviewer*innen schulen
Textsorten identifizieren
Interviewfragen gestalten
Interviewarten kennenlernen
Kapitel 8
Deutungsmusteransatz
(Oevermann)
Schwierigkeiten bei der Interpretation von Interviews kennenlernen
hermeneutisch interpretierend Deutungsmuster herausarbeiten
Theoretische Ansätze und Kompetenzerwerb in den einzelnen Kapiteln
In Kapitel 5 lernen wir, auf Bedeutungszuweisungen in Interaktionen zu achten und wie man unstrukturiert sowie strukturiert beobachtet. Kapital 6 dient dem Erwerb von Kompetenzen des hermeneutischen Interpretierens, welche später in Kapitel 8 weiter vertieft werden. Zugleich lernen wir, verschiedene Arten der InhaltsanalyseInhaltsanalyse durchzuführen und zu kombinieren. Kapitel 7 dient dann dem Kompetenzerwerb rund um das InterviewInterview. Wir lernen, Interviews vorzubereiten, Interviewer*innen zu schulen, verschiedene Textsorten einordnen zu können, InterviewfragenInterviewfragen zu gestalten und verschiedene Arten des Interviews durchzuführen. Auch Kapitel 8 dreht sich noch ganz um Interviews, aber in diesem lernen wir zum Abschluss, wie wir Interviews interpretieren und welche Fehler wir dabei machen können. Der hermeneutische Kompetenzerwerb wird weiter vertieft und wir lernen die Durchführung eines genuin soziologischen Interpretationsverfahrens, die Durchführung der DeutungsmusteranalyseDeutungsmusteranalyse kennen.
Wenn wir das alles durchlaufen haben, ist ein erster Kompetenzerwerb in der qualitativen Sozialforschung möglich geworden und wir sollten dann in der Lage sein, selbständig ins Feld zu gehen. In der PraxisPraxis der qualitativen Sozialforschung können wir dann die frisch erworbenen Kompetenzen anwenden und weiter vertiefen.
Quellen:
Kelle, Udo (2017): „Die Integration qualitativer und quantitativer Forschung – theoretische Grundlagentheoretische Grundlagen von ‚Mixed MethodsMixed Methods‘“, in: KZfSS – Kölner Zeitschrift für SoziologieSoziologie und SozialpsychologieSozialpsychologie 69 (2), S. 39–61.
2Erkenntnistheoretische Grundlagen der qualitativen Sozialforschung
In der ersten Lerneinheit wollen wir die wissenschaftstheoretischen Grundlagen für die qualitative Sozialforschungqualitative Sozialforschung (QS) legen. Dies ist wichtig, weil große Teile der qualitativen Sozialforschung nur auf der Grundlage einer ausgeführten ErkenntnisErkenntnis- und Wissenschaftstheorie zu verstehen sind. Wir werden deshalb nach einer kurzen Einleitung verschiedene Disziplinen dazu befragen, welche erkenntnistheoretischen Stellenwert sie dem Vorgang des Interpretierens und Konstruierens von WirklichkeitenWirklichkeiten – der im Mittelpunkt der qualitativen Sozialforschung steht – zuweisen. Wir wandern dabei von den kognitiven Grundlagen der WirklichkeitswahrnehmungWirklichkeitswahrnehmung unserer Gattung (WahrnehmungspsychologieWahrnehmungspsychologie (2.2), philosophische ErkenntnistheorieErkenntnistheorie (2.3), KognitionspsychologieKognitionspsychologie (2.4) und NeurophysiologieNeurophysiologie (2.5)) zu den sozialen und gesellschaftlichen Faktoren in ihrem Einfluss auf unsere Wirklichkeitswahrnehmung (SozialpsychologieSozialpsychologie (2.6) und SoziologieSoziologie (2.7)). Wir tun dies, um uns Schritt für Schritt von der alltäglichen Vorstellung zu lösen, dass wir das, was uns umgibt, einfach nur abbilden und uns der Vorstellung näher zu bringen, dass wir Wirklichkeiten durch unsere InterpretationenInterpretationen schaffen – also nicht nur abbilden, sondern konstruieren. Wenn wir dies erkannt haben, dann können wir auch besser verstehen, warum es der MethodenMethoden bedarf, um zu rekonstruieren, wie andere dies tun.
2.1Einleitung: Interpretieren und Konstruieren
Erst durch unsere InterpretationenInterpretationen schaffen wir WirklichkeitenWirklichkeiten und nur insoweit dies unser Erkenntnisapparat ermöglicht. Das hört sich zunächst einfach an, jedoch sind die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen, weitreichend. Wir wollen uns daher genauer ansehen, was dies für Schlussfolgerungen sind und wie diese den Zugang der qualitativen Sozialforschung zur „WirklichkeitWirklichkeit“ bestimmen. Insbesondere der erkenntnistheoretische KonstruktivismusKonstruktivismus, d. h. die Lehre davon, wie wir Wirklichkeiten konstruieren, ist daher in seinen unterschiedlichen Spielarten und fachspezifischen Ansätzen Gegenstand dieser ersten Lerneinheit (vgl. nur BergerBerger & LuckmannBerger & Luckmann 1966; Burr 1995; Knoblauch 1995, 2005; Knorr-Cetina 1989; Luhmann 1990, 1996, 1997; von Glasersfeld 1984; Watzlawick 1984 u. v. a.). Unter Konstruktivismus verstehen wir in einem ersten Zugang hier nur die Überzeugung, dass ein Gegenstand vom BeobachterBeobachter selbst durch den Vorgang des Erkennens konstruiert wird.
Wenn wir morgens die Augen öffnen, sehen wir die WirklichkeitWirklichkeit: klar, eindeutig und für alle, die gesund sind, in unterstellt gleicher Erscheinungsform. Ohne nachzudenken, nehmen wir sie als Abbild unserer Innen- und Außenwelt und finden uns – je nach Müdigkeit – mehr oder weniger gut darin zurecht. Wir wollen dies unsere „natürliche Einstellungnatürliche Einstellung“ nennen. Sie lässt uns selbstverständlich denken, dass die Wirklichkeit genau so ist, wie wir sie wahrnehmen. Auch die Vorstellung, dass wir wissen können, was die RealitätRealität an sich – und nicht bloß für uns – ist, gehört zu unserer „natürlichen Einstellung“. Wenn wir nicht wollen, müssen wir darüber nicht weiter nachdenken und kommen dennoch gut zurecht.
Für die Wissenschaft ist aber die Bezugnahme auf unsere natürliche Einstellungnatürliche Einstellung nicht hinreichend. Sie kann es nicht dabei bewenden lassen, sondern stellt vielmehr infrage, ob unsere RealitätRealität die „Realität an sich“ ist und wie wir dies denn wissen können. Für die Sozialwissenschaften rückt mit dieser Hinterfragung durch die ErkenntnistheorieErkenntnistheorie das große Thema der „InterpretationInterpretation“ in den Vordergrund. Diese sind in der Regel der Überzeugung: Das, was uns umgibt, kann nicht einfach von uns gespiegelt werden, sondern die ErkenntnisErkenntnis unserer Umgebung ist ein produktiver Prozess des Interpretierens, der nicht nur von den Merkmalen der Umgebung, sondern auch von uns beeinflusst wird. Erst durch die selbsttätige Interpretation dessen, was uns umgibt, halten wir den Schlüssel zu unserer Erkenntnis der Welt in Händen (vgl. BergerBerger & LuckmannBerger & Luckmann 1966). Und genau diesen sozialen und gesellschaftlichen Regeln und Logiken der Interpretation wollen wir nachgehen, um die gesellschaftliche Konstruktion der WirklichkeitWirklichkeit zu verstehen.
Lernziel:
Das erste Lernziel für diese Lerneinheit ist es also zu verstehen, wie wir interpretierend WirklichkeitenWirklichkeiten schaffen. Im Durchgang durch verschiedene Disziplinen geben wir Antworten auf die Frage, wie wir Dinge interpretieren und was diese InterpretationenInterpretationen beeinflusst. Indem wir dies tun, hinterfragen wir zugleich unseren „natürlichen“ Zugang zur WirklichkeitWirklichkeit.
Um dieses Lernziel zu erreichen, machen wir wie gesagt einen Spaziergang durch verschiedene Disziplinen, immer mit dem Blick darauf, was sie zum „Erschaffungsprozess“ von WirklichkeitenWirklichkeiten zu sagen haben. Dabei beginnen wir mit einigen bekannten Wahrnehmungsexperimenten, um zu verstehen, was unsere Wahrnehmung beeinflusst und wie sie sich „täuschen“ lässt.
2.2WahrnehmungspsychologieWahrnehmungspsychologie
Wir beginnen unsere Überlegungen mit ein paar Übungen zur WahrnehmungspsychologieWahrnehmungspsychologie. Mithilfe dieser Übungen können wir sehen, wie unser Gehirn sich vergleichsweise einfach „täuschen“ lässt. Wenn aber unser Gehirn sich so einfach täuschen lässt, so lautet unsere weiterführende Frage, wie können wir dann sicher sein, dass es nicht sonst auch eine „Täuschung“ produziert anstatt die „RealitätRealität an sich“ abzubilden?
Für diese erste Verunsicherung unseres Alltagsdenkens ziehen wir ein paar gut bekannte Wahrnehmungsexperimente heran. Wir sehen etwas anders als in der Abbildung oder springen von einer Wahrnehmung auf die andere, wie dies zum Beispiel bei Vexierbildern der Fall ist. Oder wir sehen Dinge, welche in der Abbildung gar nicht dargestellt sind. Das Feld der optischen Täuschungen ist ein weites und wir beginnen mit einer Abbildung, welche im Internet viel geteilt wurde: die schwebende Mülltonne.
Optische Täuschung I – Die schwebende Mülltonne. Bildquelle: tz.de
Wenn wir die Abbildung der Mülltonne betrachten (siehe Abbildung 1), dann sehen manche von uns diese wahrscheinlich schwebend, andere auf dem Boden stehend und wieder andere werden sich zwischen beiden Wahrnehmungen hin und her bewegen. Natürlich steht die Mülltonne in der Abbildung auf dem Fußgängerweg, aber wenn wir sie einmal schwebend gesehen haben, müssen wir uns schon sehr konzentrieren, um sie dauerhaft auf dem Boden zu halten. Unser Gehirn hält auch wider besseres Wissen an bestimmten Voreinstellungen fest.
Die nächste optische Täuschung gehört zu den klassisch gewordenen Beispielen. Wenn wir zwischen zwei gleich langen Strichen eine Perspektive von nah und fern einbauen, sehen wir den hinteren Strich viel größer, weil unser Gehirn weiter Entferntes kleiner wahrnimmt und deswegen im Umkehrschluss gleich Großes in der Ferne als größer erscheint.
Optische Täuschung II – Müller-Lyer-Illusion. Bildquelle: Perspectiva Nociones
Optische Täuschung III. Bildquelle: pixy.org
Optische Täuschung IV – Müller-Lyer-Illusion. Bildquelle: Wikimedia Commons
In der perspektivischen Verzerrung (siehe Abbildung 2) erscheint uns der hintere fett gedruckte Kantenstrich länger als der vordere. Tatsächlich aber sind sie in der Abbildung genau gleich lang.
Auf Abbildung 3 sehen wir schräge Linien, tatsächlich aber verlaufen die Linien parallel zueinander. Und auf Abbildung 4 haben wir das Vergnügen mit einer weiteren berühmten Müller-Lyer-Illusion. Beide Linien sind gleich lang. Aber ein Kontexteffekt ist dafür verantwortlich, dass für die meisten von uns die untere Linie als länger erscheint.
Eine wahrnehmungspsychologische Erklärung beruht auch hier wieder auf der DeutungDeutung als perspektivische Darstellung: „Die stumpfen Winkelspitzen könnten wie der Blick auf die entfernte Ecke eines Raumes wahrgenommen werden, diese Kontur wäre weiter entfernt und würde damit als ‚größer‘ interpretiert; die Kontur mit spitzen Winkeln könnte wie die vorspringende Kante (z. B. die Hausecke eines quadratischen Gebäudes) wahrgenommen werden, diese Kontur wäre dann näher und würde bei gleicher Länge als ‚kleiner‘ interpretiert“ (Spektrum 2000: Lexikon der Neurowissenschaft: Apolare Nervenzelle).
Wir können mittels der optischen Täuschungen also sehen, wie unser Gehirn sich täuschen lässt. Dies ist ein erstes Indiz dafür, dass unser Wahrnehmungsapparat „WirklichkeitWirklichkeit“ für uns schafft und nicht einfach die Wirklichkeit außerhalb von uns abbildet oder spiegelt. Also nochmal: Wenn unser Gehirn sich also täuschen lässt, wie können wir sicher sein, dass unsere Wahrnehmung der Welt nicht selbst das Produkt einer Täuschung ist?
Die Antwort darauf lautet im erkenntnistheoretischen KonstruktivismusKonstruktivismus: gar nicht. Wir wissen nur, dass wir uns in der Welt, so wie sie uns erscheint, zurechtfinden, aber nicht, wie sie für sich selbst beschaffen ist. Schon bei wissenschaftlichen Überlegungen zu Zeit und Raum, bei Einsteins Relativitätstheorie oder bei der Quantenphysik hat das Gehirn von vielen von uns große Verständnisprobleme, weil die Welt, wie sie die Wissenschaft darstellt, für uns kaum mehr begreifbar ist. Wir können die Welt an sich nicht erkennen, sondern nur das, was wir mittels unseres Beobachtungsapparats sehen. Inwiefern dies mit der Welt an sich übereinstimmt, könnten wir nur erkennen, wenn wir eine dritte Position einnehmen könnten, welche sowohl die Welt an sich als auch unsere BeobachtungBeobachtung untersuchen könnte, um mögliche Übereinstimmungen oder Abweichungen festzustellen. Aber eine solche Position gibt es für uns nicht. Insofern ist die Beobachterabhängigkeit unserer ErkenntnisErkenntnis für uns eine grundlegende Tatsache, die es zu berücksichtigen gilt. Auch die moderne Physik baut heute auf der Beobachterabhängigkeit der Erkenntnis auf. „Nach der InterpretationInterpretation von Werner Heisenberg, einem der Pioniere der Quantenmechanik, sind Dinge erst dann real, wenn sie beobachtet werden. Er hielt es für nicht mehr möglich, ‚zur Vorstellung einer objektiven realen Welt zurückzukehren, deren kleinste Teile in der gleichen Weise objektiv existieren wie Steine oder Bäume, gleichgültig, ob wir sie beobachten oder nicht‘“ (Ananthaswamy 2018).
Das heißt zum einen, was uns als Gattungswesen Mensch als WirklichkeitWirklichkeit erscheint, muss für andere beobachtende Lebewesen – seien das Bienen, Hunde oder Spinnen – keine gleiche oder ähnliche Wirklichkeit sein. Zum anderen bedeutet dies aber auch, dass unsere BeobachtungBeobachtung das Phänomen für uns erst schafft bzw. konstituiert. Dies ist auch in der Physik bekannt: So lässt sich ein Photon als Teilchen oder als Welle beobachten und verhält sich, je nachdem, wie man es beobachtet, als Teilchen oder als Welle (vgl. Ananthaswamy 2018).
2.3Ein kurzer Blick in die Philosophie
In der Philosophie gehört dies bereits seit der antiken Philosophie zum Wissensbestand (vgl. z. B. Mansfeld & Primavesi 2011: 231, 239; Honerkamp 2019) und wurde dann von Immanuel KantKant in der „Critik der reinen VernunftCritik der reinen Vernunft“ (1787) sehr klar aufbereitet.
Critik der Vernunft, Titelblatt der Erstausgabe 1781. Bildquelle: Wikipedia.org
Immanuel Kants „Critik der reinen VernunftCritik der reinen Vernunft“ war die kopernikanische Wende in der ErkenntnistheorieErkenntnistheorie (vgl. KantKant 1787: XVI, XVII). Sie machte deutlich, dass wir nur das erkennen können, was unsere Verstandeskategorien uns selbst vorgeben (vgl. Kant 1787: VVIII). Wenn diese Gefäße wären, mit denen wir WirklichkeitWirklichkeit schöpfen würden, um ein viel zu statisches Bild der Erkenntnisproduktion zu verwenden, dann würden wir eben nur verfügbar haben, was in diese Gefäße passt. Das große Meer des Anderen bliebe uns verborgen. Zwar klammerte Kant noch die Apriori von Zeit und Raum (vgl. Kant 1787: 73ff.) aus, aber es wurde klar, dass wir nur eine RealitätRealität für uns haben, aber keinen Zugang zu den „Dingen an sich selbst“, zur Realität an sich haben können (vgl. Kant 1787: XX, XXI; Hervorhebung M.P.).
Alle derzeitigen Erkenntnistheorien, so unterschiedlich sie sein mögen, gehen nicht hinter Kants Diktum zurück: „daß die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt“ (KantKant 1787: XIII). „Allein die Verbindung (conjunctio) […] kann niemals durch die Sinne in uns kommen […] denn sie ist ein Aktus der Spontanität der Vorstellungskraft […] eine Verstandeshandlung“ (Kant 1787: 129f.). Das heißt, selbst wenn unsere Sinneseindrücke die WirklichkeitWirklichkeit angemessen wiedergeben würden, wäre die Verbindung der verschiedenen Sinneseindrücke ein Akt des selbsttätigen Schaffens einer Vorstellung von der Wirklichkeit.
Um dies selbst zu erfahren, wenden wir eine kleine Übung an:
Wir lassen uns von einer anderen Person die Augen verbinden und diese einen für uns unbekannten oder ungewohnten, außeralltäglichen Gegenstand heraussuchen. Die Person legt diesen Gegenstand in unsere Hände und wir müssen erraten, um was es sich handelt. Wir lassen uns dabei beobachten und überlegen, welche Sinne wie ins Spiel kamen und ggf. die ErkenntnisErkenntnis brachten.
Wir werden voraussichtlich feststellen, dass wir Zeit brauchen, um den Gegenstand zu identifizieren und dass wir ganz verschiedene Sinne anwenden – hören, riechen, schmecken, fühlen –, um der Identität des Gegenstandes auf die Spur zu kommen. Erst die Verbindung unserer Sinne wird die ErkenntnisErkenntnis bringen und wir können erkennen, dass diese durch unsere Verstandestätigkeit hervorgebracht wird – und nicht durch den Gegenstand selbst. Wenn das geklappt hat, haben wir einen ersten Zugang zu Immanuel KantKant gewonnen.
Wir müssen uns hier mit diesem kurzen Blick in die ErkenntnistheorieErkenntnistheorie Kants begnügen, aber vertiefen unser Thema weiter mit Blick auf die Entwicklungspsychologie, welche uns lehrt, dass unser Gehirn nicht per se die äußere Welt abbildet und spiegelt, sondern sich erst nach und nach in bestimmten Entwicklungsstufen bestimmte Formen der Wahrnehmung und Konstruktion von WirklichkeitenWirklichkeiten herausbilden.
2.4Die KognitionspsychologieKognitionspsychologie von Jean PiagetPiaget
Wandern wir daher weiter zu Jean PiagetPiaget (1896–1980), einem bekannten Schweizer Entwicklungspsychologen und Biologen, und seiner ErkenntnistheorieErkenntnistheorie. Auch für Piaget (1937) war unter Rückbezug auf KantKant klar, dass es „dem erlebenden Subjekt unmöglich ist, eine objektive Welt zu erkennen, wie sie wäre, bevor sie erlebt wird“ (von Glasersfeld 2011: 99f.). Es baut sich vielmehr eine mehr oder weniger stabile Erlebenswelt als WirklichkeitWirklichkeit auf und geht dabei auf die begrifflichen Konstruktionen zurück, welche ihm im jeweiligen Entwicklungsstadium möglich sind (vgl. von Glasersfeld 2011: 100).1 Piaget führte zahlreiche, oft replizierte Wahrnehmungsexperimente unter anderem mit seinen eigenen Kindern durch, um zu verdeutlichen, dass ErkenntnisErkenntnis nicht nur auf Anpassung an eine äußere Umwelt beruht, sondern auch auf begrifflichen Operationen, welche sich mit dem jeweiligen Entwicklungsstadium verändern.
Nehmen wir an, wir spielen mit einem wenige Monate alten Baby. Wir nehmen eine Rassel, spielen mit ihm und lassen diese Rassel dann lautlos hinter einem anderen Gegenstand, einem Sichtschutz verschwinden. Das Baby wird in der Regel nicht hinter dem Gegenstand nach ihm suchen, weil es das Konzept der Objektpermanenz noch nicht entwickelt hat.
Springen wir etwas in der Entwicklung und lassen ein Kind unter fünf Jahren eine Orangensaftflasche malen. Wenn die Flasche steht, wird der Flüssigkeitsspiegel richtig wiedergegeben. Aber wenn die Flasche liegt, zeichnen die Kinder die Flasche oft so – selbst wenn Sie diese vor Augen haben – als wäre der Orangensaft gefroren. Der Wasserspiegel wird vertikal dargestellt.
Bildquelle: Pixabay.com
Oder machen wir Folgendes: Wir nehmen den Orangensaft vor den Augen vierjähriger Kinder und füllen exakt die gleiche Menge in ein breites, wenig hohes Glas und in ein hohes, schmaleres Glas (vgl. Mietzel 1998). Welches Glas werden die Kinder bevorzugen, wenn sie Orangensaft mögen? Das höhere. Es sieht für Sie einfach nach mehr aus. Auch wenn die Flüssigkeitssäule in dem einen Glas höher, im zweiten Glas niedriger aussieht, berücksichtigt erst das sieben- oder achtjährige Kind sowohl Höhe als auch Breite.
PiagetPiaget hat eine Vielzahl solcher Versuche durchgeführt. Sie zielen darauf, dass unsere WirklichkeitswahrnehmungWirklichkeitswahrnehmung von unserer kognitiven Entwicklung abhängt (vgl. Piaget & Inhelder 1968: 66; Piaget 1974: 27). Diese verläuft nach Piaget in Stufen und Phasen, macht aber deutlich, dass ErkenntnisErkenntnis und WirklichkeitWirklichkeit ihrem Wesen nach (Selbst-)Konstruktion sind. Diese besteht im autogenen Aufbau von in der Interaktion mit der Umwelt angeregten Strukturen bzw. im Knüpfen von Beziehungen zwischen Handlungs-, Operations- und Begriffsschemata (vgl. Reusser 1996).
Dies zeigt sich auch in Zurechnungen, wie sie manche Erwachsene auch noch kennen. So sagt ein vierjähriges Kind zum Beispiel, wenn es sich an der Treppe weh getan hat, dass diese böse sei und sie geschlagen habe. Und auch Erwachsene treten bisweilen noch nach Gegenständen, an denen sie sich weh getan haben. Aber nicht nur der Animismus, also die Vorstellung einer Beseeltheit der Dinge, sondern auch der Egozentrismus verliert sich oftmals nicht in der Erwachsenenwelt. So kann ein 4½-jähriges Kind sagen, ich stampfe mit dem Fuß, damit die Suppe gut ist oder ein Erwachsener denkt, dass die von ihm priorisierte Mannschaft verlieren wird, wenn er seinen Fanschal nicht umlegt. Solche Rationalitäten gehören zu den Voreinstellungen von Wirklichkeitskonstruktionen und zeigen einmal mehr, wie abhängig diese von unserer kognitiven Entwicklung ist. Unsere RealitätRealität ist also nicht einfach Abbild der äußeren Welt, in der wir uns befinden, sondern eine selbsttätige Konstruktion nach Maßgabe der Anpassungsvorteile, die wir realisieren können und der uns zur Verfügung stehenden begrifflichen Operationen.
2.5Ein Ausflug in die NeurophysiologieNeurophysiologie
Kommen wir zur NeurophysiologieNeurophysiologie. Hier werden im Anschluss an Immanuel KantKant einige zentrale Grundlagen der neueren ErkenntnistheorieErkenntnistheorie gelegt. Zu den zentralen Autoren, die sich auf neurophysiologische Befunde beziehen, gehört u. a. Heinz von Förstervon Förster (1985, 2006).1 „Die übliche Annahme ist“, so Heinz von Förster in einem InterviewInterview „daß unsere Sinne uns sagen, was draußen in der Welt vor sich geht. Man sagt, sie würden die Welt abbilden, uns über ihre Gestalt und Natur informieren. Ich habe versucht, meine Leser daran zu erinnern, dass schon vor über 150 Jahren der große Physiologe Johannes Müller das Prinzip der ‚spezifischen Nervenenergie‘ ausgesprochen hat. Es besagt, daß die Nerven der verschiedenen Sinne, wie Sehen, Hören, Tasten immer nur die ihnen entsprechenden Empfindungen – Licht, Schall und Druck – hervorbringen, und zwar unabhängig von der physikalischen Natur des Reizes, der diese Empfindung verursacht“ (Pörksen & von Förster 1996).
Wie von Heinz von Förstervon Förster ausgeführt, liegt dem erkenntnistheoretischen KonstruktivismusKonstruktivismus die neurophysiologische These der „undifferenzierten Codierung“ (von Förster 1993: 30ff.) zugrunde. Nach dieser These erfassen wir mit unseren Neuronen über die Sinnesorgane einzig die Intensität eines Reizes, aber keine qualitative Bestimmung des Reizes. Das Gehirn entwickelt aus den undifferenzierten Nervenimpulsen selbst Repräsentationen der WirklichkeitWirklichkeit oder anders formuliert: Die Umwelt, die wir wahrnehmen, ist unsere Erfindung.
Dies bestätigen auch neuere Befunde der Hirnforschung. Der Hirnforscher Matthias Ekman von der Radboud Universität in Nijmegen beobachtete z. B. die Nervenaktivität in der Sehrinde. Seine Versuchspersonen sahen auf einem Bildschirm, wie sich ein Lichtpunkt in vier Schritten von links nach rechts bewegt, immer und immer wieder. Hunderte Male. Da die Forscher*innen nur diese kleine Hirnregion untersuchten, konnten sie gut messen und einen kurzen Film direkt aus dem Gehirn aufzeichnen. „Dann sieht man eben, wie erwartet diese vier Punkte erscheinen. Spannend wurde es, als Matthias Ekmann dann den Punkt nicht in der gewohnten Vierersequenz erscheinen ließ, sondern nur einmal in der Anfangsposition am linken Rand. Und da könnte man sagen, ok dann sollte das Gehirn auch nur einen Punkt abbilden, weil das ist ja das, was gezeigt wird. Aber was wir gefunden haben, ist, dass der visuelle Kortex alle vier Punkte zeigt. Das heißt, von dem Startpunkt aus komplementiert er die Sequenz so, dass dort vier Punkte auch zu sehen sind“ (Wildermuth 2017). Auch wenn die Signale etwas schwächer sind und eher als eine Art Geisteraktivität erscheinen: RealitätRealität und Nervenaktivität klaffen auseinander.
Wahrnehmung hat also nicht nur etwas mit der Welt zu tun, sondern auch mit den Erwartungen des Gehirns.
Bildquelle: Rowohlt.de
Auch hier ist die Lehre eindeutig: Wir sehen nicht nur mit den Augen, sondern vor allem mit dem Gehirn. So werden beispielsweise in den Büchern von Oliver Sacks reale neuropathologische Fälle geschildert, in denen Störungen oder Erkrankungen des Gehirns weitreichende Folgen für die Wahrnehmung hatten. Die Titel, wie z. B. „Der Tag, an dem mein Bein fortging“ (1989) oder „Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte“ (2010), sprechen dabei für sich. Sie können uns helfen zu verstehen, wie sehr „unsere WirklichkeitWirklichkeit“ von unserem Wahrnehmungsapparat bestimmt wird.
Bildquelle: Wikimedia.org
Schon lange ist bekannt, dass ein Großteil der KommunikationKommunikation zwischen Nervenzellen über „Aktionspotenziale“ oder auch „Spikes“ genannte elektrische Impulse vermittelt wird (vgl. Quiroga et al. 2005). Bei menschlichen Versuchspersonen hat man zum Beispiel über Nervenzellen berichtet, die ihre Synapsen so eingestellt hatten, dass sie immer dann aktiv wurden, wenn bestimmte berühmte Personen des öffentlichen Lebens in ihrem „Sichtfeld“ erschienen. Die sog. „Bill-Clinton-Zelle“ begann immer dann – und anscheinend auch nur dann – Spikes zu generieren, wenn den Proband*innen eine Abbildung des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton vorgelegt wurde (Quiroga et al. 2005).2
Unser Gehirn fertigt ein Bild auch entlang seiner Erwartungen an und hat dazu keine qualitativen Informationen von den Dingen aus seiner Umwelt, nur Frequenzen und Intensitäten.
Bildquelle: Pixabay.com
Bevor wir uns jedoch auf unserem Spaziergang mit einer weiteren Disziplin beschäftigen, möchten wir mit einem beliebten Missverständnis aufräumen: Der erkenntnistheoretische KonstruktivismusKonstruktivismus hat in unserer Lesart nichts mit der Beliebigkeit oder einer individuellen Wählbarkeit der Wirklichkeitskonstruktionen zu tun. Pörsken (2011: 26, Fn. 15) schreibt dazu: „Die Einwände, die gegen den Konstruktivismus vorgebracht wurden und werden, sind massiv; […] der Konstruktivismus begünstige eine ethisch-moralische Beliebigkeit, so heißt es; man propagiere ein modisches ‚anything goes‘ und einen haltlosen Relativismus“ (Pörsken 2011: 26, Fn. 15). Unseres Erachtens wird aber gerade im kognitionsorientierten Konstruktivismus klar, dass wir uns leider – frei nach Pippi Langstrumpf – die Welt nicht einfach machen können, wie sie uns gefällt (vgl. Efraimstochter 2020). Für uns als Gattungswesen Mensch ist die WirklichkeitWirklichkeit, wie sie unseren Sinnen erscheint, nicht einfach dekonstruierbar. Sie kann nicht einfach von jetzt auf gleich grundlegend verändert werden. Wenn wir die Augen schließen – machen Sie es ruhig für ein paar Sekunden – und uns vornehmen, sie zu dekonstruieren und sie dann wieder öffnen, dann werden wir feststellen, dass unsere WirklichkeitswahrnehmungWirklichkeitswahrnehmung durch unseren Wahrnehmungsapparat weitgehend determiniert ist. Wir müssten schon bewusstseinsverändernde Drogen nehmen oder uns einer Gehirnoperation unterziehen, um diese Determination aufzuheben.
Der springende Punkt ist vielmehr, dass wir wissen können, dass für andere Gattungen die Welt qualitativ ganz anders beschaffen ist und ganz anders erscheint. So können Bienen und Adler beispielsweise im ultravioletten Bereich sehen (vgl. Satorius 2009). Auch für Katzen und Hunde sieht die Welt ganz anders aus. Sie hören, riechen, sehen und spüren ganz andere Dinge. Und dies sind nicht einfach Unterschiede in den Ausschnitten der Wahrnehmung, sondern es bedeutet eine qualitativ ganz andere RealitätRealität.
Da wir wissen, dass diese anderen Welten existieren, wissen wir auch, dass wir als Gattungswesen Mensch mit den Mitteln unseres Wahrnehmungsapparates unsere eigenen WirklichkeitenWirklichkeiten schaffen. Genau auf dieses Wissen von der Relativität bzw. Beobachterabhängigkeit unserer ErkenntnisErkenntnis zielt der erkenntnistheoretische KonstruktivismusKonstruktivismus ab.
Nach diesen kognitionsorientierten Zugängen wenden wir uns nun den kulturalistischen, konkreter: auf gesellschaftliche und soziale Faktoren zielenden Spielarten des erkenntnistheoretischen KonstruktivismusKonstruktivismus zu. Hier sind vor allem Studien und ExperimenteExperimente zum Thema sozialer Druck in Gruppen, Effekte von Hierarchien und von Konformismus auf die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, bekannt geworden. Sie haben ihr Zuhause in der SozialpsychologieSozialpsychologie, aber teilweise auch in der SoziologieSoziologie.
Bevor wir daher zum Ende dieses Kapitels in die SoziologieSoziologie einmünden, statten wir der SozialpsychologieSozialpsychologie noch einen kurzen Besuch in dieser Angelegenheit ab. Damit nähern wir uns bereits den sozialen Kontextfaktoren, welche die WirklichkeitswahrnehmungWirklichkeitswahrnehmung beeinflussen und stoßen damit auch die Tür zum SozialkonstruktivismusSozialkonstruktivismus auf.
2.6SozialpsychologieSozialpsychologie
Bildquelle: Amazon.de
Wir wollen mit einem historischen Beispiel beginnen, welches uns die Rolle von Gruppendruck und Konformismus für die Art und Weise, wie Menschen die Welt sehen und in ihr handeln, auf tragische Weise näherbringen kann. Manche von Ihnen haben vielleicht die bekannt gewordene Studie von Christopher Browning (1993) mit dem Titel „Ganz normale Männer“ zur Kenntnis genommen. Sie handelt von Erschießungen von sog. Partisanen und Juden im polnischen Hinterland durch das Reserve-Polizei-Bataillon 101, das zwischen 1941 und 1943 im Rahmen des Unternehmens Barbarossa in Osteuropa mindestens 38.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder erschossen hatte. Ihr Vorgesetzter, ein Major stellte es ihnen frei sich nicht an den Erschießungen zu beteiligen.
Es zeigte sich aber in erschreckender Weise, dass nur wenige von dieser Möglichkeit Gebrauch machten. Zunächst meldeten sich nur ein Dutzend von ca. 500 Männern, um nicht bei den Exekutionen mitmachen zu müssen (vgl. Browning 2002 [1993]: 105). Obwohl es sich um Erschießungen aus großer Nähe handelte und die Täter keine bekennenden Nazis waren – sondern Familienväter, die bei der Polizei Dienst taten –, war der Konformitätsdruck und Gruppenzwang so groß – so erklärt es zumindest Browning –, dass die weitaus meisten sich an den Erschießungen von älteren Männern, Frauen und Kindern beteiligten. Zwischen 10 % und 20 % der eingeteilten Schützen baten zu einem späteren Zeitpunkt um Ablösung von den Exekutionskommandos (vgl. Browning 2002 [1993]: 108). Die Wahrnehmung der Taten, der polizeilich-militärischen Verpflichtung sowie der Opfer war durch die kulturellen Umstände und die sozialen Kontextfaktoren offensichtlich so geprägt, dass diese menschenverachtenden Erschießungen durch „ganz normale Männer“ auch ohne sog. „Befehlsnotstand“ möglich wurden (siehe dazu auch Welzer 2009; Kühl 2014). Dies kann als ein erster Hinweis dafür dienen, wie soziale Kontexte unsere Art zu denken und zu handeln prägen können.
Dazu gibt es auch eine Vielzahl bekannt gewordener sozialpsychologischer ExperimenteExperimente, welche die Faktoren, die dabei ins Spiel kommen, genauer bestimmen und messen. Wir gehen hier nicht auf die Diskussionen und die Kritik ein, die diese Experimente ausgelöst und erfahren haben. Wir führen sie hier nur an, um die Effekte zu illustrieren, welche soziale Kontexte für die Art und Weise haben, wie wir Dinge sehen und als WirklichkeitenWirklichkeiten wahrnehmen, die dann auch unser Handeln beeinflussen.
So brachte z. B. Solomon Asch in einem bekannten ExperimentExperiment (1951) nach einer Reihe von Einzelsitzungen die Teilnehmer*innen in Gruppen zusammen und ließ sie gemeinsam über die Länge von Strichen urteilen. Jede Gruppe bestand aus einer Versuchsperson und sieben Helfer*innen, die Asch ohne Wissen der Proband*innen instruiert hatte. „Die Helfer begannen nun einstimmig falsche Antworten zu geben. Kurze Striche nannten sie lang, lange kurz. Und die nichts ahnenden Versuchspersonen? Sie schlossen sich an. Dieselben Probanden, die vorher ohne zu zögern die Linien vor ihren Augen richtig zuordnen konnten, erklärten jetzt Striche, die nach ein paar Fingerbreiten endeten, für länger als solche, die sich fast über die ganze Seite erstreckten. Nicht einmal jede vierte Versuchsperson schaffte es, dem Zureden der Helfer zu widerstehen“ (Klein 2018).
Auch das berühmt gewordene, erstmals 1961 durchgeführte MilgramMilgram-ExperimentExperiment gehört in diese Reihe (vgl. Milgram 1963, 1997 [1974]). Es wurde 2017 von Forscher*innen von der SWPS University of Social Sciences and Humanities in Polen repliziert (vgl. Hauschild 2017). Sie haben das Milgram-Experiment mit 80 Landsleuten wiederholt. Die Gruppe der Teilnehmer*innen war gemischt, Männer und Frauen von 18 bis 89 Jahren alt, Schüler*innen, Studierende, Berufstätige, Rentner*innen. Die Proband*innen erhielten wie im Original die Rolle der Lehrperson. Ihr Schüler sollte Silbenpaare lernen und korrekt wiedergeben. Wann immer er einen Fehler machte, sollte die Lehrperson ihm über einen Knopf einen Stromstoß geben – beim ersten Fehler nur 15 Volt, bei jedem weiteren 15 Volt mehr, in zehn Stufen. In Wahrheit war der Schüler, wie schon bei Milgram, ein eingeweihter Schauspieler, der mitunter aufstöhnte, wenn er einen vermeintlichen Schock erhielt. Wie sich die Proband*innen verhielten, erschreckte die Forscher*innen: Nur ein Viertel äußerte während des Experiments Zweifel oder Unbehagen, nur acht brachen es ab. 72 der 80 Teilnehmer*innen gingen bis zur höchsten Stromstufe (vgl. Hauschild 2017; Drinkard 2017).
Die ExperimenteExperimente zeigen in dem wichtigen Aspekt der Konformität auf, wie sehr der soziale Kontext die Art und Weise beeinflusst, wie wir Dinge sehen und als WirklichkeitenWirklichkeiten wahrnehmen, welche dann auch unser Handeln beeinflussen.
Die Illustration dieser Effekte durch sozialpsychologische ExperimenteExperimente soll uns helfen, nun einen Schritt weiter in die Richtung der sozialen Bedingtheit von ErkenntnisErkenntnis, der gesellschaftlichen Konstruktion von WirklichkeitWirklichkeit zu gehen. Damit sind wir bei der SoziologieSoziologie angelangt.
2.7SoziologieSoziologie
In der SoziologieSoziologie ist die Auswahl der Ansätze groß, welche sich auf den erkenntnistheoretischen KonstruktivismusKonstruktivismus beziehen. Wir wählen hier für unsere Zwecke einen Ansatz aus, welcher in der Soziologie klassisch geworden ist und häufig qualitativen MethodenMethoden zugrunde liegt: den SozialkonstruktivismusSozialkonstruktivismus von BergerBerger und LuckmannLuckmann mit ihrem Vorläufer bei Alfred SchützSchütz. Da man mit der Literatur zu diesen Klassikern ganze Bibliotheken füllen kann, konzentrieren wir uns hier nur auf deren Bezüge zum erkenntnistheoretischen Konstruktivismus. Als wissenssoziologische Herangehensweise wird der Ansatz ausführlicher im Kapitel 7.2 Wissensoziologie vorgestellt.
Die wissenssoziologische Herangehensweise von Alfred SchützSchütz sowie Peter L. BergerBerger und Thomas Luckmann hat zum Ausgangspunkt, dass die selbstproduzierte Sozialordnung von deren Teilnehmern als „objektive“, „äußerliche“ und quasi „naturgegebene“ erfahren wird (vgl. Berger & LuckmannBerger & Luckmann 2018; Weiß 2014). Dabei spielt das Lebensweltkonzept von Alfred Schütz eine tragende Rolle. Bestimmte Deutungsweisen und TypisierungenTypisierungen werden von uns im Prozess des Aufwachsens angeeignet.
Der SozialkonstruktivismusSozialkonstruktivismus hebt dabei die sozialen Kontexte in ihrem Einfluss auf unsere WirklichkeitswahrnehmungWirklichkeitswahrnehmung und die kommunikative Verfasstheit unserer WirklichkeitWirklichkeit besonders hervor. Nicht nur die Individuen, sondern auch die Gesellschaften selbst erzeugen WirklichkeitenWirklichkeiten (vgl. Siebert 2020). Wir konstruieren unsere Wirklichkeit gemeinsam mit anderen in unseren sozialen Milieus und entlang des zur Verfügung stehenden kollektiven Deutungswissens in der Gesellschaft.
Wir müssen uns als Erwachsene im Alltag keine Gedanken darübermachen, was z. B. ein Stuhl ist, sondern für uns ist es selbstverständlich, wie wir ihn verwenden. Wenn wir also Präsenzlehre haben, dann setzen sich die meisten von uns – ohne nachzudenken – auf einen Stuhl und harren der Dinge, die da kommen. Wir könnten aber auch auf dem Stuhl stehen, Handstand machen oder auf ihm tanzen. Oder wir könnten uns auf den Boden setzen. Aber das würden wir, ohne groß nachzudenken, nicht tun. Selbst das Kunststück, während der 90 Minuten, die ein Seminar oder eine Vorlesung dauert, halbwegs ruhig auf dem Stuhl zu sitzen, ist für uns selbstverständlich geworden. Während Unterricht auch im Gehen möglich wäre, ist es für uns klar, dass wir sitzen, zuhören, mitschreiben und erst danach unsere weitergehenden Bewegungsimpulse oder Bedürfnisse befriedigen.
Wichtig ist, dass diese lebensweltliche Selbstverständlichkeit zu unserem kollektiven Wissensvorrat gehört. Es sind nicht nur einzelne von uns, die sich so verhalten, sondern selbst in einer sehr großen Vorlesung lässt sich der wundersame Vorgang dieser selbstverständlich disziplinierten Nutzung der Stühle oder Sitzreihen – wenn genügend vorhanden sind – mit großer Zuverlässigkeit beobachten. Diese Schematisierung oder Rahmung ist intersubjektiv so fest verankert, dass andere Formen der Nutzung Befremden, Kopfschütteln oder bei anhaltender Abweichung Sanktionen auslösen würden. Dabei wissen wir heute, dass nicht dauerhaftes Sitzen, sondern ganz im Gegenteil Bewegung das Lernen und die Konzentrationsfähigkeit fördert (vgl. Ameri 2001; Walk 2011).
Es sind also kognitive und normative MusterMuster, welche unser Alltagswissen konstituieren und institutionelle Ordnungen (wie die Sitzordnung) für uns schaffen. Dadurch etablieren sich feste Formen der WirklichkeitswahrnehmungWirklichkeitswahrnehmung, welche auch unser Handeln orientieren.
Diese von uns selbst gemachte Beschaffenheit einer Ordnung, welche uns dann als Sitzordnung objektiviert entgegentritt, war ein wichtiger Ausgangspunkt der Arbeiten von Alfred SchützSchütz sowie Peter L. BergerBerger und Thomas LuckmannLuckmann (vgl. Schütz & Luckmann 2017; siehe auch Kapitel 3).
Die Lebenswelt wird also für Alfred SchützSchütz zum einen durch unsere alltägliche Lebenspraxis geschaffen. Zum anderen stellt sie eine Struktur unseres Bewusstseins dar, nämlich den Vorrat an praktischem Wissen, der uns die aktive Teilnahme am Alltag ermöglicht. Diesen „Wissensvorrat“ erwerben wir im Laufe unseres Heranwachsens, unserer Sozialisation. Er besteht zum überwiegenden Teil aus „Selbstverständlichkeiten“, über die wir gewöhnlich nicht nachdenken bzw. nicht nachdenken müssen (vgl. Legewie 1998/99).
2.8Schlussbemerkung
Das Ziel dieses Kapitels war es, in einem Spaziergang durch verschiedene Disziplinen die für uns „natürliche Einstellungnatürliche Einstellung“ der Abbildtheorie der WirklichkeitWirklichkeit zu hinterfragen und den Boden für das Thema der „InterpretationInterpretation“ zu bereiten. Denn hier, in der Interpretationsabhängigkeit von ErkenntnisErkenntnis und WirklichkeitswahrnehmungWirklichkeitswahrnehmung, liegt eine wichtige Wurzel vieler Ansätze der qualitativen Sozialforschung, mit denen wir uns im Weiteren beschäftigen. Diese zielen darauf, an Regeln und Verfahren geknüpfte Interpretationsweisen anzubieten, welche sich von der „natürlichen Einstellung“ und der alltagsweltlichen Interpretation lösen. Diese Loslösung soll zugleich in einer für andere nachvollziehbaren, offenen und transparenten Weise erfolgen, sodass der Vollzug der Interpretation für andere überprüf‑ und kritisierbar wird. Ob dies in den Interpretationsverfahren der qualitativen Sozialforschung immer gelingt, ist umstritten, aber eine Zielgröße bleibt es dennoch. Wie sich die qualitative Sozialforschungqualitative Sozialforschung darin von der standardisierten, auf große Fallzahlen zielenden Sozialforschung unterscheidet, ist Gegenstand des folgenden Kapitels.
Fragen zur Vertiefung 1
Wenn in Sibirien der sprichwörtliche Baum umfällt und niemand sieht zu, ist dieses Geschehen dann Teil unserer WirklichkeitWirklichkeit?
Wenn es unwiderlegbare Beweise dafür gibt, dass sich die Erde um die Sonne dreht, wieso ist diese Tatsache dann gebunden an unsere InterpretationInterpretation? Denn für jedes Lebewesen ist diese Tatsache doch gleich, ob es davon weiß oder nicht.
Welchen Aspekt ergänzt die SoziologieSoziologie in Bezug auf die anderen hier vorgestellten Ansätze der ErkenntnistheorieErkenntnistheorie?
Übung für Zuhause 1: Das Abilene-Paradox
Stellen Sie sich vor, Sie treffen sich mit Ihren Freunden. Sie wissen nicht so recht, was sie tun sollen. Mia schlägt vor, zum Skatepark unter der Brücke zu gehen, weil sie weiß, dass Linus dort gerne ist. Sie selbst hat darauf keine Lust. Lina geht es ebenso, aber sie hält zurzeit immer zu ihrer Freundin Mia, weil es dieser in der Beziehung zu Linus nicht so gut geht. Lina mag es nicht, mit dem Skateboard zu fahren und kann mit den Leuten im Skatepark nichts anfangen, die sich dort immer zur Schau stellen. Linus selbst hatte Ärger mit einem seiner Skater-Freunde und will dort zurzeit nicht hingehen. Aber Mia zuliebe nickt er, gerade weil ihre Beziehung seit einiger Zeit nicht mehr so gut ist. Auch Jakob, Linus‘ Freund hat auf einen solchen Ausflug zum Skatepark keine Lust und würde lieber zu dem Beach-Volleyball-Feld gehen, wo er letzten Sonntag mit einer der Spielerinnen einen Flirt begonnen hat. Aber wenn drei aus der Gruppe das wollen, fügt er sich der Mehrheit, wie er es immer tut. Seine Zugehörigkeit zur Clique ist ihm wichtig. Auch Sie selbst finden den Vorschlag wenig inspirierend, aber machen mit, weil Sie gerade mit einem Lehrbuch beschäftigt sind und sich nicht selbst Gedanken über eine Alternative machen wollen. Mia sagt: „Also, das scheint eine gute Idee zu sein, oder?“ Alle nicken und machen sich auf den Weg zum Skatepark.
Sie machen also als Gruppe etwas, was kein Einzelner in der Gruppe tun wollte. Sie gehen zum Skatepark unter der Brücke und langweilen sich zunächst. Doch dann kommt wider Erwarten Stimmung auf und Sie verbringen gerne Ihre Zeit am Skatepark. Hinterher sagen alle, dass es eine gute Idee war und schön, dass alle dahin wollten. Sie finden, dass es ein gelungener Nachmittag war. Die eigenen Vorbehalte sind schnell vergessen.
Bitte arbeiten Sie an diesem Beispiel heraus, welche Bedeutung der Ausgang eines Ereignisses auf dessen retrospektive DeutungDeutung haben kann (1). Zeigen Sie bitte auf, wie das Geflecht sozialer Beziehungen zu einer Kollektiventscheidung führt, welche nicht durch die Interessen der Einzelnen an einem Skateparkbesuch getragen sind (2). Arbeiten Sie bitte heraus, wie es zur Konformität mit dieser Kollektiventscheidung kommt und diese Konformität in der Lage sein kann, die kollektiven Deutungsweisen des Ereignisses zu beeinflussen (3).
Quellen:
Ameri, Andrew (2001): „Neue Nervenzellen in alten Gehirnen: Eine mögliche Rolle bei reparatur- und Lernprozessen“, in: Extracta Psychiatrica/Neurologica 1 (2), S. 12–16.
Ananthaswamy, Anil (2018): „Was verrät die Quantentheorie über die Realität?Realität“, in: Spektrum der Wissenschaft, am 26.09.2018 (letzter Aufruf am 28.11.2020).
Asch, Solomon E. (1951): “Effects of Group Pressure Upon the Modification and Distortion of Judgment,” in: Harold Guetzkow (Hrsg.): Groups, Leadership and Men, Pittsburgh: Carnegie Press, S. 177–190.
Bateson, Gregory (1983): Ökologie des Geistes: Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
BergerBerger, Peter L. & Thomas LuckmannLuckmann (1966): The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, New York: Doubleday.
BergerBerger, Peter L. & Thomas LuckmannLuckmann (2018): Die gesellschaftliche Konstruktion von WirklichkeitWirklichkeit, Frankfurt am Main: Fischer.
Browning, Christopher R. (2002 [1993]): Ganz normale Männer: Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die „Endlösung“ in Polen, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Burr, Vivien (1995): An Introduction to Social Constructionism, London/New York: Routledge.
Dettmann, Ulf (1999): Der Radikale KonstruktivismusKonstruktivismus: Anspruch und WirklichkeitWirklichkeit einer Theorie, Tübingen: Mohr Siebeck.