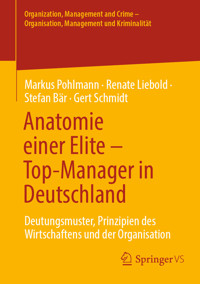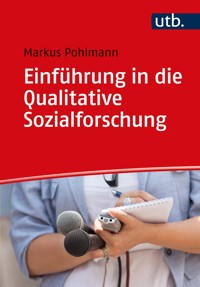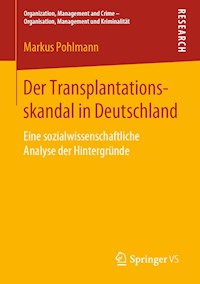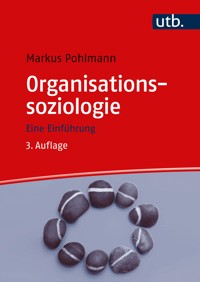
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Band lädt zum organisationssoziologischen Denken ein. Anhand empirischer Beispiele und Fallstudien wird in zentrale Begriffe, Konzepte und Perspektiven der Organisationssoziologie eingeführt und den Leser:innen ein ebenso fundierter wie praktischer Einstieg in deren Fragestellungen, Themen und Erklärungsformen ermöglicht. Dabei spannt sich der inhaltliche Bogen von der Darlegung eines sozialwissenschaftlichen Verständnisses der Organisation und der Klassifizierung von Typen der Organisation über die Beschreibung zentraler Ansätze der Organisationssoziologie bis zu den Themenbereichen Motivation, Macht, Führung und Strategie. Nicht zuletzt analysiert der Autor auch Fragen der Organisationskultur und der organisationalen Kriminalität. Das Buch bietet Studierenden sozialwissenschaftlicher und auch betriebswirtschaftlicher Studiengänge einen idealen Einstieg in dieses Thema.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
utb 3573
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Markus Pohlmann
Organisationssoziologie
Eine Einführung
3., vollständig überarbeitete Auflage
Umschlagmotiv: © Friedberg · Fotolia.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
3., vollständig überarbeitete Auflage 2024
2., überarbeitete Auflage 2016
1. Auflage 2011
DOI: https://doi.org/10.36198/978383855089
© UVK Verlag 2024
– ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 3573
ISBN 978-3-8252-5508-4 (Print)
ISBN 978-3-8463-5508-4 (ePUB)
Für Sonja †
Vorwort zur dritten Auflage
Das Schicksal, das Lehrbüchern in der Soziologie in Deutschland beschieden ist, lässt sich im Vorhinein schwer kalkulieren. Ich bin daher sehr dankbar, dass die Leser*innen mir die Möglichkeit gegeben haben, das vorliegende Lehrbuch nochmals zu aktualisieren und zu ergänzen. Allerdings erwies sich die Aufgabe, die sich mir damit gestellt hat, als keine einfache. Insbesondere das Vorhaben, das Lehrbuch um ein Kapitel zu den verschiedenen Typen von Organisationen zu ergänzen, erwies sich als ein anspruchsvolles Unterfangen. Die Typik verschiedener Organisationsformen auf den Punkt zu bringen und eine Vergleichssystematik zu entwickeln, war herausfordernd. Der Problematik, dass wir in der Realität eine überbordende empirische Vielfalt an Formen und zahlreiche Mischformen vorfinden, bin ich mit der Entwicklung einer Heuristik begegnet. Sie soll helfen, Ordnung in das Chaos der Empirie zu bringen und den Studierenden ermöglichen, selbst Einordnungen von Organisationen vorzunehmen.
Dadurch, dass seit der zweiten Auflage einige Zeit vergangen ist, habe ich auch viele Aktualisierungen vorgenommen. Allerdings habe ich mich auf solche aktuellen Entwicklungen beschränkt, die bereits einzuordnen sind. Andere, wie z.B. das Thema der generativen künstlichen Intelligenz, habe ich ausgespart, weil die daraus resultierenden Entwicklungen für die Organisationen und ihre Operationsweisen noch nicht hinreichend absehbar sind. Die Grundform und -ausrichtung des Lehrbuches habe ich beibehalten. Sie hat sich in vielen Seminaren und Vorlesungen bewährt.
Wie immer habe ich zahlreichen Kolleg*innen zu danken, welche mich durch ihre Kommentare und ihre erneute Durchsicht des Buches unterstützt haben. Allen voran gebührt mein besonderer Dank Kim Kettner, welche mit großem Einsatz die formale Aufbereitung, Korrektur und Durchsicht der Neuauflage besorgt hat. Aber auch Kristina Höly, Monika Bancsina, Savka Dekic, Subrata Mitra und Stefan Bär standen der Überarbeitung des neu hinzugefügten Kapitels mit kritischen Kommentaren zur Seite. Nina Baumann, Leoni Kotwan und Nicolas Mechnig haben sich das neu hinzugefügte Kapitel ebenfalls angesehen und auf seine Lesefreundlichkeit geprüft. Wie üblich zeichne ich natürlich für alle verbleibenden Fehler und Irrtümer selbst verantwortlich.
Mein Dank gebührt auch meiner Frau und meinen drei Jungs, die sich damit arrangiert haben, dass ich „altmodische“ Bücher schreibe anstatt mich als Influencer oder Youtuber zu betätigen.
Vorwort zur zweiten Auflage
Auch ein Lehrbuch ist in der Regel nicht ein abgeschlossenes Projekt, sondern es entwickelt sich durch jede Neuauflage weiter. Dem Verlag, den Lesern und Leserinnen sei gedankt, dass sie dem Lehrbuch diese Entwicklungsmöglichkeit eröffnet haben. Ich habe sie genutzt, um den Text weiter zu vereinfachen und zu präzisieren. Neue Beispiele wurden eingefügt und aktuelle Entwicklungen eingeblendet. Eine Vielzahl von Fallstudien, Übungen, Informationsmaterial und Links sind darüber hinaus zu den einzelnen Themen über das Internet verfügbar. Das Buch soll zum einen in die soziologische Denkweise von Organisationen einführen, zum anderen aber auch in der Handhabung für Lehrende, Studierende und andere Interessierte Spaß machen. Wenn mir das gelungen sein sollte, dann ist dies nicht nur das Verdienst eines engagierten Forschungsteams, das mich in der Aufbereitung der Neuauflage unterstützt hat, sondern auch einer Vielzahl von Studierenden, die mit dem Buch gearbeitet und mir Feedback gegeben haben. Besonders bedanken möchte ich mich bei Friederike Elias, Alexander Fürstenberg, Sonja Linder, Kristina Höly, Julian Klinkhammer und Elizangela Valarini, die mir wie immer mit Rat und Tat zur Seite standen. Ein großer Dank gebührt auch Frau Renninghoff, die die sprachliche und formale Korrektur der Neuauflage vorgenommen hat. Für etwaige noch verbliebene Fehler zeichnet natürlich nichtsdestotrotz der Autor verantwortlich. Frau Rothländer hat dieses Buch wohlwollend und mit viel Geduld von Verlagsseite aus begleitet. Dafür sei ihr ebenfalls gedankt. Last but not least waren mir meine Frau und meine beiden Jungs eine stete Inspirationsquelle und haben dafür gesorgt, dass das Abenteuerliche und Spielerische seinen Platz in diesem Buch findet. Auch diesmal hoffe ich wieder, dass die Neuauflage das Engagement von allen Beteiligten rechtfertigen und vielen Leserinnen und Lesern die Tür zu einer soziologischen Denkweise von Organisationen öffnen möge.
Vorwort zur 1. Auflage
Universitäten sind Organisationen, die, wie andere auch, eine Tendenz zur Vereinnahmung haben. Was ihnen an formaler Betriebsförmigkeit fehlt, machen sie gerne durch Betriebsamkeit wett. Dennoch eröffnen sie ihrem wissenschaftlichen Personal immer wieder die Möglichkeit, einen Moment innezuhalten und ihre Gedanken in einem Buch zu sammeln. Dafür sind wir dankbar. Die Universität Heidelberg hat dieses Buch durch die Gewährung eines Forschungssemesters unterstützt und dadurch seinen Abschluss möglich gemacht. Wir sind aber nicht nur der Universität, sondern insbesondere auch dem Max-Weber-Institut für Soziologie zu Dank verpflichtet. Ohne die Heidelberger Soziologie mit ihrer sehr lebendigen Weber-Tradition wäre dieses Buch ein anderes geworden.
Dass es uns überhaupt möglich war, dieses Lehrbuch zu schreiben, verdanken wir auch der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Kolleginnen und Kollegen. Allen voran möchten wir Gert Schmidt für seine hilfreichen Anregungen danken, die uns in der Konzeption des Lehrbuches weitergebracht haben. Philipp Hessinger hat uns mit wichtigen Kommentaren und Hinweisen unterstützt und uns ermutigt, unsere Linie beizubehalten. Kathia Serrano-Velarde, Ulrich Bachmann und Mateusz Stachura konnten uns mit gezielten Kommentaren und Kritik hinsichtlich der von uns ausgewählten Theorieansätze, ihrer Darstellung und Interpretation ebenfalls sehr helfen. Das wissenschaftliche Team im Bereich der Organisationssoziologie in Heidelberg, allen voran Julian Klinkhammer, Volker Helbig, Stefan Bär, Rafael Bauschke, Sonja Gwinner und Thorsten Zillmann, haben das Buch mit Rat und Tat sowie mit sehr viel Engagement vorangebracht. Dasselbe gilt auch für unser Sekretariat, insbesondere Frau Chaluppa und Frau Ponier, die uns vor allem bei der formalen Aufbereitung des Buches zur Seite standen. Den Studierenden Kristina Bitsch, Viviane Bressem, Mareike Daiber, Franziska Gässler, Mathias Köhler, Stefanie Krieg, Christian Menn und Michael Trampota, welche die Vorfassungen der einzelnen Kapitel gelesen haben, sind wir ebenfalls sehr zu Dank verpflichtet. Dem Verlag und seinen Lektorinnen Frau Artz und Frau Rothländer sind wir vor allem für die Geduld und das Verständnis dankbar, die sie im Rahmen des Entstehungsprozesses aufgebracht haben. Wir hoffen, dass unser Buch das Engagement von allen Beteiligten rechtfertigen und vielen Leserinnen und Lesern die Tür zu einer so verstandenen Soziologie der Organisation öffnen möge.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1Einleitung — Eine Einladung zum organisationssoziologischen Denken
1.1Die Vorgehensweise
Quellen
2Das sozialwissenschaftliche Verständnis der Organisation
2.1Die italienische Mafia als Organisation?
2.2Die Bekämpfung der Mafia
2.3Auf dem Weg zu einem komparativen Organisationsverständnis
2.4Zusammenfassung
Quellen / weiterführende Literatur
3Zentrale Ansätze der Organisationssoziologie
3.1Das Konzentrationslager: Auf den Spuren irrationaler/rationaler Organisation
3.2Organisationssoziologische Ansätze im Vergleich
3.3Organisation als korporativer Akteur
3.4Organisation und die Institutionen der Gesellschaft
3.5Organisation als System
3.6Zusammenfassung
Quellen / weiterführende Literatur
4Personal und Motivation
4.1Der Mensch als Person – Zum Personenverständnis in der Soziologie
4.2Personal — eine soziologische Bestimmung
4.3Motive
4.4Die Entgrenzung von Arbeit und das »unternehmerische Selbst«
4.5Zusammenfassung
Quellen / weiterführende Literatur
5Macht und Geld
5.1Macht
5.1.1Machtentstehung und Ordnungsbildung bei Popitz
5.1.2Macht und Interessen im Handlungssystem der Organisation: Colemans Theorie
5.1.3Probleme kollektiven Handelns in der Organisation: Crozier/Friedbergs Theorie
5.1.4Macht als Medium der Organisation: Luhmanns Theorie
5.2Geld
5.3Zusammenfassung
Quellen / weiterführende Literatur
6Management, Führung und Strategie
6.1Die Funktion des Managements – Grundlegende Perspektiven
6.2Führung und Strategie
6.2.1Führung
6.2.2Strategien
6.3Manager*innen – Person und Personal
6.4Zusammenfassung
Quellen / weiterführende Literatur
7Organisationskultur
7.1Kultur als veränderbare Variable oder als ungeschriebene Regeln, die sich der gezielten Veränderung entziehen?
7.2Organisationskultur als Regeln, wie Dinge gesehen werden
7.3Organisationskulturen und die Veränderung der Organisation
7.4Organisationskulturen im Theorienvergleich
7.5Zusammenfassung
Quellen / weiterführende Literatur
8Organisationale Devianz, Moral und Korruption
8.1Organisation und Moral — einige Vorbemerkungen
8.2Organisationale Devianz und organisationale Kriminalität
8.3Aktive Korruption bei Siemens
8.3.1Korruption als Risikokalkulation
8.3.2Korruption als Anpassung und Nachahmung
8.3.3Korruption als »brauchbare Illegalität«
8.4Individuelle, organisationale und professionsgeleitete Devianz: Die Manipulationen der Wartelisten in der deutschen Transplantationsmedizin
8.5Compliance, Moral und die Bekämpfung von Korruption und Manipulationen
8.6Zusammenfassung
Quellen / weiterführende Literatur
9Organisationstypen im Vergleich
9.1Die feldspezifische Ausrichtung der Organisation
9.2Ein Besuch in der Kirche
9.3Interessen- oder Arbeitsorganisation als Vergleichskriterium
9.4Die PPU oder: Welche Organisationsformen haben politische Parteien?
9.5Aufgabenautonomie, Hierarchie und Professionsgebundenheit als Vergleichskriterien
9.6Das öffentliche Krankenhaus
9.7Die Eigentums- und Ressourcenautonomie als Vergleichskriterium
9.8Unternehmen oder: Der Ikea-Effekt
9.9Zusammenfassung
Quellen / weiterführende Literatur
10Schlagwortverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Tab. 2.1Idealtypischer Vergleich der Merkmale von totalen Institutionen und Organisationen
Tab. 2.2Idealtypischer Vergleich der Merkmale von Gruppen und Organisationen
Tab. 2.3Idealtypischer Vergleich der Merkmale von Netzwerken und Organisationen
Tab. 2.4Idealtypischer Vergleich der Merkmale von Märkten und Organisationen
Tab. 3.1Drei organisationssoziologische Ansätze im Vergleich
Tab. 3.2Idealtypischer Vergleich der Merkmale von Interessen- und Arbeitsorganisationen
Tab. 4.1Das Verständnis von Person und Akteur im Theorienvergleich
Tab. 4.2Das Verständnis von Personal und Personalpolitik im Theorienvergleich
Tab. 4.3Das Verständnis von Motiven und Motivation im Theorienvergleich
Tab. 5.1Das Verständnis von Macht im Theorienvergleich
Tab. 5.2Zur Bedeutung von Geld in Organisationen: Coleman und Luhmann
Tab. 6.1Das Managementverständnis in der Soziologie der Organisation im Theorienvergleich
Tab. 6.2Das Strategieverständnis in der Soziologie der Organisation im Theorienvergleich
Tab. 7.1Das Verständnis von Organisationskultur im Theorienvergleich
Tab. 8.1Das Verständnis von Moral und Ethik im Theorienvergleich
Tab. 8.2Abweichung von formalen Normen und Probleme der Kontrolle nach verschiedenen Theorieansätzen
Tab. 9.1Die Schlüsselorganisation im Vergleich der verschiedenen Felder
Tab. 9.2Interessen- und Arbeitsorganisationen im Vergleich der verschiedenen Felder
Tab. 9.3Idealtypischer Vergleich der Merkmale von Interessen- und Arbeitsorganisationen
Tab. 9.4Eigentumsformen, Trägerschaften und Finanzierungsformen im Vergleich der verschiedenen Felder
Abbildungsverzeichnis
Abb. 2.1Koordinationsform der Cosa Nostra nach Catino
Abb. 2.2Koordinationsform der ‘Ndrangeta nach Catino
Abb. 5.1Ordnungszustand I der fluktuierenden Nutzung nach Coleman
Abb. 5.2Übergang zu Ordnungszustand II der dauerhaften Besitzansprüche nach Coleman
Abb. 5.3Übergang zu Ordnungszustand II der dauerhaften Besitzansprüche nach Crozier/Friedberg
Abb. 5.4Mögliche Strategien der Rückgewinnung von Macht durch C, D, E
Abb. 9.1Der Organisationsaufbau der Evangelischen Kirche in Deutschland
Abb. 9.2Gliederung und Organe der PPU (nach dem deutschen Parteienmodell)
1Einleitung — Eine Einladung zum organisationssoziologischen - Denken
In diesem Kapitel erfahren Sie
warum wir uns mit Organisationen beschäftigen,
welches die Ziele des Buches sind,
wie wir vorgehen, um diese Ziele zu erreichen.
Es kann viele Gründe geben, sich mit Organisationen zu beschäftigen. Für die Soziologie ist vor allem die Tatsache interessant, dass Organisationen zu einem erheblichen Maße unser Leben und unseren Alltag bestimmen. Nicht nur, weil sie unseren Lebenslauf prägen, sondern auch, weil moderne Gesellschaften sie als ein wichtiges Instrument nutzen, um ihre Probleme zu lösen.
Wir erfahren Organisationen zum einen als fremde Macht, wenn über unsere Leistung oder Karriere entschieden und bestimmt wird, ob es in unserem Lebenslauf bergauf oder bergab geht. Zum anderen signalisieren die Personalabteilungen, dass wir für diesen Lauf des Lebens selbst verantwortlich und also gehalten sind, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sie legen uns, wenn die Leistung stimmt, Karrieren unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Alter oder Ethnie nahe. Die Träume von Glück, Reichtum und Macht werden in modernen Gesellschaften nach Maßgabe der Organisationen geträumt, die den Zugang dazu eröffnen. Allerdings können sie diese Zugänge auch verschließen. Denn Organisationen sind insofern exklusiv, als sie selbst entscheiden, wer Mitglied wird und wer nicht. Dadurch geben sie in modernen Gesellschaften den Takt für den Lebenslauf jedes Einzelnen vor: Wann man zu jung ist, wann zu alt, welchen Einstieg man hätte wählen und wann man hätte aussteigen sollen. Da Organisationen Karrieren ermöglichen und außerhalb von Organisationen kaum mehr Karrieren stattfinden, sind sie die Taktgeber gesellschaftlicher »Normalbiografien« sowie der (positiven und negativen) Diskriminierung dessen, was davon abweicht. Ohne den Selektionsmodus der Organisation kämen keine Karrieren mehr zustande, schreibt Luhmann (2000: 101f.). Auch dann, wenn man nicht die Karriereleiter hinauf möchte oder ganz andere Wege sucht, wird man in der Fremdzurechnung anderer – der Eltern, der Schulfreund*innen, der Vereinskolleg*innen oder Facebook-Freund*innen– oft dem Karrieretakt der Organisation ausgesetzt. Er orientiert berufliche Erfolgs- und Misserfolgszuschreibungen. Er sagt uns, welche Züge bereits abgefahren oder welche Chancen nicht genutzt worden sind. Jede Abweichung von ihm erhöht die Begründungslasten für den eigenen Weg. Denn ob wir dies wollen oder nicht: Organisationen sorgen in modernen Gesellschaften für unsere gesellschaftliche Positionierung, indem sie zu einem erheblichen Maße die gesellschaftliche Rang- und Statusordnung orientieren.
Zugleich sind sie für moderne Gesellschaften zum Erreichen kollektiver Ziele nahezu unersetzbar und eine ihrer bedeutendsten Kulturtechniken geworden. Wann immer moderne Gesellschaften Probleme bewältigen, Problemlösungen auf Dauer stellen oder Ziele erreichen wollen, kommen Organisationen ins Spiel. Sie sorgen für die kollektive oder korporative Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit. Genau in diesem Sinne lässt sich die Organisation als eine gesellschaftliche Institution verstehen: Sie formuliert ein Rationalitätsversprechen instrumenteller Art und erfährt in diesem gesellschaftliche Anerkennung. Selbst wenn es darum geht, die Verbreitung oder Einhaltung bestimmter Werte, Normen oder Moralstandards zu verfolgen, bilden sich in aller Regel Organisationen aus, deren Aufgabe es ist, dies zu bewerkstelligen. Sehr oft also, wenn kollektive Handlungsfähigkeit sichergestellt, wenn etwas kollektiv erreicht oder entschieden werden soll, bedienen sich moderne Gesellschaften der Organisationsform.
Natürlich gibt es noch eine Vielzahl anderer sozialer Gebilde, wie etwa Familien, Gruppen, Netzwerke, soziale Bewegungen, welche dauerhaft eine Rolle spielen. Aber überall dort, wo es um den Leistungsbezug der Teilsysteme1 oder um die Wirkmächtigkeit der institutionellen Ordnungen verschiedener Wertsphären, wie z.B. der Wissenschaft, der Politik, der Kunst, der Wirtschaft oder der Religion geht, haben sich Organisationen ausgebreitet. Sie spezialisieren sich auf die institutionellen Logiken der Teilsysteme oder Wertsphären und wählen diese als »Lebensmittelpunkt« (vgl. dazu Schimank 2002). Das bedeutet nicht, dass sie nicht auch andere Logiken zu bedienen haben, also als z.B. Universität auch wirtschaften, Politik machen, auf Ästhetik achten oder Rechtsnormen befolgen zu müssen. Aber dennoch wären ihr Charakter und ihre Legitimation als Universität gefährdet, wenn etwas anderes als wissenschaftliche Erkenntnisproduktion und –vermittlung im Mittelpunkt stünde: Ein Professor, der Doktorarbeiten meistbietend vergibt oder sich am Verkauf von Doktortiteln beteiligt, der für Leistungspunkte Geld verlangt oder in der Prüfung anstelle eines Arguments 50 Euro akzeptiert, wirtschaftet zwar, bewegt sich damit aber außerhalb der normativen Zwecksetzungen einer Universität. Ein solches Handeln würde und wird skandalisiert und macht auf die Legitimitäts- und Legalitätsgrenzen des Wirtschaftens der Organisation »Universität« aufmerksam. Damit wird festgelegt, in welchem Rahmen sich die Aktivitäten einer Universität bewegen sollen, aber zugleich innerhalb dieses Rahmens eine vergleichsweise hohe Autonomie in der Bestimmung der Art der Zweckverfolgung gewährt. Dies erlaubt eine Spezialisierung und Fokussierung, die gesellschaftliche Leistungserbringung auf der Ebene der Organisation möglich werden lässt, auf welche sich andere gesellschaftliche Teilbereiche oder Wertsphären beziehen können, also z.B. das Rechtssystem und die Politik auf wissenschaftliche Gutachten, die Wirtschaft auf wissenschaftliche Qualifikationen oder gar die Kirche auf theologische Abschlüsse2
Es ist diese enorme Bedeutung (im Weberschen Duktus: Schicksalshaftigkeit) der Organisation für das Personal und für die Institutionenordnungen moderner Gesellschaften, gepaart mit einer Faszination dafür, wie weit es moderne Gesellschaften mit dieser Kulturtechnik gebracht haben, die uns zu einer eingehenden Beschäftigung mit Organisationen inspiriert hat. Ähnlich wie bei Max Weber, einem der Begründer der modernen Organisationssoziologie, ist unsere Faszination für deren instrumentelle Funktionsweise zugleich mit der Sorge verbunden, wie viel an wertbezogener (materialer) Unvernunft mit dieser Rationalisierung durch formale Organisation einhergeht. Wir übernehmen von ihm daher die Perspektive, Organisation in einem größeren Zusammenhang mit der Entwicklung (bei Weber: »Rationalisierung«) moderner Gesellschaften zu sehen und diese Entwicklung nicht als etwas zu fassen, das weitgehend außerhalb der Organisation stattfindet. Die nachstehende Infobox zu Max Weber soll diese für das Buch wichtige Perspektive verdeutlichen helfen.
Infobox 1.1: Max Weber und die Gefährten
Als Max Weber mit seinen Gefährten 1904 zur Weltausstellung nach St. Louis fuhr und dabei auch durch Chicago kam, stach ihm einmal mehr die rationelle Betriebsform des Kapitalismus in der neuen Welt ins Auge. In den Schlachthöfen Chicagos wurde das Fließband erfunden, lange bevor es mit Henry Ford Einzug in die Automobilindustrie hielt. Der Überlieferung Marianne Webers zufolge war Weber von dem rationellen Verarbeitungsprozess beeindruckt. Wie das getötete Rind an eisernen Klammern unaufhaltsam an immer neuen Arbeitern vorbeiwanderte, welche in ihrem Arbeitstempo an den Rhythmus des Fließbands, an den Rhythmus der Maschine gebunden waren, bewegte ihn. Aber auch in Chicago zeigte sich für ihn am Beispiel der Kostenkalkulation eines Transportunternehmens von jährlich 400 Toten und Verletzten, wie schnell sich die formale Vernunft der Kostenrechnung gegen die auf Lebenserhaltung zielenden Werthorizonte des Wirtschaftens selbst richten kann.
Quelle: WikimediaCommons, File: Max Weber 1917.jpg; Max Weber bei der Lauensteiner Tagung
»Überall fällt die gewaltige Intensität der Arbeit auf: Am meisten in den Stockyards mit ihrem ›Ozean von Blut‹, wo täglich mehrere tausend Rinder und Schweine geschlachtet werden. Von dem Moment an, wo das Rind ahnungslos den Schlachtraum betritt, vom Hammer getroffen zusammenstürzt, dann alsbald von einer eisernen Klammer gepackt, in die Höhe gerissen wird und seine Wanderung antritt, geht es unaufhaltsam weiter, an immer neuen Arbeitern vorüber, die es ausweiden, abziehen usw., immer aber, im Tempo der Arbeit, an die Maschine gebunden sind, die es an ihnen vorbeizieht. Man sieht ganz unglaubliche Arbeitsleistungen in dieser Atmosphäre von Qualm, Kot, Blut und Fellen, in der ich mit einem Boy, der mich gegen 1/2 Dollar führte, herumbalancierte, um nicht im Dreck zu ersaufen — und wo man das Schwein von der Kofe bis zur Wurst und Konservenbüchse verfolgt. Stundenweit haben die Leute vielfach, wenn um 5 Uhr die Arbeit aus ist, nach Hause zu fahren, — die Tram-Gesellschaft ist bankerott, seit Jahren — wie üblich — verwaltet sie ein ›Receiver‹, der kein Interesse an der Abkürzung der Liquidation hat und daher keine neuen Wagen anschafft — die alten versagen alle Augenblicke. Jährlich gegen 400 Leute werden tot oder zu Krüppeln gefahren, ersteres kostet laut Gesetz die Gesellschaft 5000 Dollar (an die Witwe oder Erben), letzteres 10000 Dollar (an die Verletzten solange sie nicht bestimmte Vorsichtsmaßregeln trifft). Sie hat nun kalkuliert, daß sie die 400 Entschädigungen weniger kosten, als die verlangten Vorsichtsmaßregeln und bringt diese nicht an. (…) Es war den Gefährten so, als würden sie erst hier aus träumerischem Halbschlaf wachgerüttelt: ›Sieh, so ist die moderne Wirklichkeit.‹«
Im Hintergrund einer für Weber durchdringenden Rationalisierung der Welt steht für ihn nicht nur die kapitalistische Maschinerie, sondern auch die alle Lebenssphären durchdringende »Apparatur« der Bürokratie, welche eine bestimmte Form zweckrationaler Organisation als universelles Mittel der formalen Vernunft verbreitet. Sie ist für ihn nicht nur eigentümlichster Ausdruck des Prozesses der okzidentalen Rationalisierung, sondern vor diesem Hintergrund auch die Herrschaftsapparatur, derer sich der individuell Handelnde zugleich bedient und zu erwehren hat: »Und so fürchterlich der Gedanke erscheint, daß die Welt etwa einmal von nichts als Professoren voll wäre — man müßte ja in die Wüste entlaufen, wenn derartiges einträte — noch fürchterlicher ist der Gedanke, daß die Welt mit nichts als jenen Rädchen, also mit lauter Menschen angefüllt wäre, die an einem kleinen Pöstchen kleben und nach einem größeren streben. (…) Es fragt sich, was wir dieser Maschinerie entgegenzusetzen haben, um einen Rest des Menschentums frei zu halten von dieser Parzellierung der Seele, von dieser Alleinherrschaft bürokratischer Lebensideale…« (Weber 1926/84: 421).
Für Weber war klar: Rationale Organisation ist mehr als ein instrumenteller Entscheidungszusammenhang zur Verfolgung beliebiger Zwecke. Gerade weil sie dies ist, wird sie damit zu einer kulturbedeutsamen Rationalisierungsform moderner Gesellschaften, welche die kollektiven Lebensschicksale ebenso prägt wie deren Wert- und Sinnhorizonte. Auf die Wahrnehmung, dass Organisationen kulturbedeutsame Techniken und institutionelle Formen moderner Gesellschaften sind, kommt es uns an. Jede Organisationssoziologie muss darauf in der einen oder anderen theoretischen Form Bezug nehmen.
Organisationen sind für uns Teil der Gesellschaft. Sie geben dieser eine bestimmte Form und konkretisieren sie (siehe dazu Kap. 3). Daher lässt sich Gesellschaft für die Organisationssoziologie nicht auf eine wie immer geartete »Umwelt« der Organisation reduzieren. Organisationen erscheinen vielmehr als typische Formen der Gesellschaft, die sich durch ihre Art der Sinngebung von anderen gesellschaftlichen Formen wie Gruppen, Netzwerken oder Märkten unterscheiden lassen (siehe dazu Kap. 2). Diese Auffassung markiert den Ausgangspunkt des vorliegenden Buches.
Es möchte auf dieser Basis an eine soziologische Beschäftigung mit dem Phänomen »Organisation« heranführen und zum organisationssoziologischen Denken einladen. Es ist daher in Aufbereitung und Form kein klassisches Einführungsbuch und kann ein solches auch nicht ersetzen. Sein Ziel ist es nicht, alle zentralen organisationssoziologischen Ansätze oder Debatten umfassend darzustellen. Dazu gibt es bereits hinreichend Einführungsliteratur (u.a. Tacke 2001; Preisendörfer 2016 Bonazzi 2014; Abraham/Büschges 2009; Müller-Jentsch 2003). Vielmehr möchten die Autoren zentrale Begriffe und Perspektiven organisationssoziologischen Denkens vorstellen, um den Blick für die soziologische Perspektive zu schärfen, so dass diese von betriebswirtschaftlichen, psychologischen oder pädagogischen Herangehensweisen hinreichend unterscheidbar wird. Zugleich ist die vorliegende Einladung zum organisationssoziologischen Denken ein Versuch, das Denken über Organisationen von einem alltagstheoretischen Zugang zu lösen und darzulegen, welche anderen oder zusätzlichen Einsichten eine soziologisch präzisierte Herangehensweise bringt. Dasselbe gilt für den sehr eingängigen, in der Praxis der Organisationen und bei ihren Experten*Expertinnen gepflegten Diskurs, der uns unter der Hand schnell zu (vermeintlich kundigen) Gestalter*innen, Berater*innen oder Praxeolog*innen der Organisation werden lässt. Wir wollen mit diesem Buch hinter die Selbstbeschreibungen der Praxis zurückgehen und diese selbst zum Gegenstand unserer Reflexionen werden lassen. Die von uns gewählten Beispiele dienen dazu, den gesellschaftlichen Horizont der angesprochenen Praxis des Organisierens sichtbar werden zu lassen; sie eröffnen uns einen Zugang zu den Mythen und Fiktionen der Praxis, deren Analyse eine soziologische Aufklärung erst möglich macht. Wir sind dabei notwendigerweise sehr selektiv in unserem Zugang, haben aber unsere Themen so ausgewählt, dass sie jeweils zentral für die Reflexionen der Organisationssoziologie sind. Wir wollen erreichen, dass Studierende und Praktiker*innen eine Art »Grammatik« organisationssoziologischen Denkens zur Verfügung haben, mit der sie beginnen können, selbst organisationssoziologisch zu denken und zu arbeiten. Dies wird bisweilen bei unseren Leserinnen und Lesern ein Umdenken erforderlich machen. Und genau darauf zielt unser Buch: dieses Umdenken zu ermöglichen und Brücken zu bauen, um sich in dem fremden Terrain der Organisationssoziologie zurechtzufinden.
Der Argumentationspfad des Buches ist — gemessen an der Vielfalt der Organisationssoziologie — sehr schmal angelegt und im Wesentlichen auf drei Theorieansätze beschränkt: die Theorie rationaler Wahl, die neue Institutionentheorie und die Systemtheorie. Wir haben gerade diese Ansätze ausgewählt, weil sie für grundlegende Perspektiven einer Soziologie der Organisation stehen, an denen niemand, der sich ernsthaft mit dem Fach beschäftigt, vorbeikommt.
1.1Die Vorgehensweise
Um klar zu machen, worüber in diesem Buch gesprochen wird, beschäftigen wir uns zunächst mit dem soziologischen Verständnis von Organisation (Kapitel 2). Dieses wird am Beispiel der Mafia erläutert und im Vergleich mit anderen sozialen Gebilden wie Gruppen, totalen Institutionen, sozialen Netzwerken und Märkten vertieft. Wenn man weiß, was unter Organisation sozialwissenschaftlich verstanden wird, versteht man auch, woher ihre Schlagkraft, aber auch ihr Unvermögen in bestimmten Kontexten rührt. Natürlich wird dieses Verständnis durch die verschiedenen Denk- und Theoriemodelle der Organisationssoziologie moderiert, die oft eng mit den »großen« soziologischen Theorien verbunden sind, weil eine Gesellschafts- ohne eine Organisationsanalyse (und umgekehrt) mittlerweile nicht mehr vorstellbar ist. Wir wählen für unsere Beschäftigung mit Organisationen drei zentrale Denktraditionen aus, ohne damit zu beanspruchen, die vielfältige Landschaft der Organisationstheorien abzubilden oder auch nur alle wichtigen Ansätze damit abzuhandeln. Dafür gibt es andere Bücher (siehe z.B. Kieser/Ebers 2006; Walter-Busch 1996; Ortmann/Sydow/Türk 2000). Vielmehr haben wir zwei Ansätze ausgesucht, die in ihren Grundannahmen diametral entgegengesetzte Positionen vertreten: die Rational-Choice-Theorie und die Systemtheorie. Hinzu tritt ein dritter Ansatz, der mit seiner moderierenden Position zwischen den Genannten liegt und beansprucht, die gesellschaftliche Seite der Organisationstheorie wieder stärker zu betonen: der neue Institutionalismus.3 Unser Ziel ist jedoch nicht, diese Ansätze vollständig abzubilden oder die wissenschaftliche Kritik, die sie erfahren haben, zu diskutieren. Vielmehr sollen sie uns in diesem Kapitel und in den folgenden helfen, einen Zugang zu relevanten organisationssoziologischen Themen zu eröffnen. Mit diesen drei Ansätzen ist ein Feld der organisationssoziologischen Theorien abgesteckt, das nicht nur helfen soll, einige grundlegende Herangehensweisen der Organisationssoziologie zu verstehen, sondern auch einen Sortiermechanismus bietet, mit dem sich die Vielfalt der anderen Ansätze und Perspektiven einfacher ordnen und bewältigen lässt (Kap. 3).
Dass in einer Organisation Menschen zusammenarbeiten und sie als eine ihrer Kooperationsformen verstanden werden kann, vermittelt bereits der erste Eindruck, wenn man die Gebäude einer Organisation betritt. Es fällt oft schwer, hinter diesen ersten Eindruck zurückzugehen. In den Sozialwissenschaften, und zumal in der Organisationssoziologie, ist dies jedoch wichtig. Denn »Menschsein« ist in der Regel sehr viel mehr als Organisationen verstehen, einbeziehen oder verkraften können. Viele menschliche Komponenten, wie z.B. unbewusste chemische oder molekulare Prozesse des biophysischen Organismus werden in der Regel sowohl gesellschaftlich als auch organisational ausgeblendet. Auch die sogenannten privaten Probleme sind normalerweise kein Thema für eine Arbeitsorganisation. Natürlich kann man sich mit seinen Kolleg*innen darüber unterhalten, aber die organisationalen Verarbeitungsprozesse in einer Universität, bei einem Motorenproduzenten oder in einer Pflegeeinrichtung werden sich daran nicht orientieren können und wollen. Die innere Gefühlswelt hält in der Regel viel mehr bereit als gesellschaftlich oder organisational zum Ausdruck kommen kann. Das bedeutet, jede Organisation kann nur selektiv auf Menschen bzw. Personen zugreifen. Sie kann diese nicht als Ganzes einbeziehen. Für diesen selektiven Einbezug steht auch der Begriff des Personals, der sich nicht auf die Menschen in einer Organisation bezieht, sondern darauf, wie diese Personen und deren Arbeitskraft nutzt. Personal sein bedeutet nicht nur, den Nützlichkeitserwartungen der Organisation ausgesetzt zu sein, sondern auch als Ressource auf Märkten gehandelt zu werden. Dabei überträgt man durch die Mitgliedschaft – zumeist im Tausch gegen ein Entgelt – der Körperschaft bestimmte Rechte, die wiederum sicherstellen möchte, dass die Interessen der Agent*innen mit den Zielen der Körperschaft übereinstimmen. Die Motive, die dabei im Spiel sind, werden in den hier herangezogenen soziologischen Ansätzen nicht so sehr als innere Beweggründe thematisiert (denn als solche sind sie nicht beobachtbar oder direkt zugänglich), sondern als Ausdrucksformen der Person im Kontext von Gesellschaft und Organisation. So erscheint es im Kontext der Organisation legitim, bestimmte Motive zu artikulieren, während andere (gleichwohl relevante) Ausdrucksformen als illegitim diskreditiert werden. Sowohl der neue Institutionalismus als auch die Systemtheorie interessieren sich daher in unterschiedlicher Weise für diesen Prozess der gesellschaftlichen oder organisationalen Motivproduktion, wenn sie von Motivation sprechen. Auch daran kann man erkennen, dass eine solche Umstellung auf einen soziologischen Personen- und Personalbegriff weitreichende Konsequenzen dafür hat, wie der Zusammenhang von Organisation, Person und Motivation gefasst wird (Kap. 4). Auch Macht und Geld sorgen für den Zusammenhalt in der Organisation und werden in der Soziologie als »Beziehungsmittel« oder Medien in Organisationen thematisiert (Kap. 5). Wir zeigen, welche Rolle Macht in Organisationen spielt, und vergleichen anhand der Argumentationen von Coleman, Crozier/Friedberg und Luhmann die Erklärungsweise der verschiedenen Machttheorien. Der Bedeutung von Geld als »Beziehungsmittel« in Organisationen widmen wir uns sehr selektiv, indem wir am viel diskutierten Beispiel der Managergehälter fragen, wie sich deren Höhe soziologisch erklären lässt. Das Beispiel der Managergehälter dient uns zugleich als Überleitung zu einem soziologischen Begreifen des Managements der Organisation (Kap. 6). »Management« wird in diesem Kapitel thematisiert als Steuerung und Koordination in der Organisation; als eine Position im Unternehmen, die z.B. mit einem bestimmten Tätigkeits- und Entscheidungshorizont verknüpft ist; oder als Personal, z.B. in Gestalt des Managers Herr Müller, der durch seine Visionen und Überzeugungen organisationale Prozesse wesentlich beeinflussen kann. Bezogen auf die Funktion des Managements vertiefen wir in demselben Kapitel zwei weitere für die Praxis wichtige Begrifflichkeiten: »Mitarbeiterführung« und »Unternehmensstrategie«. Dabei beschäftigen wir uns weniger mit den Eigenschaften eines Managers, die er benötigt, um eine gute Führungskraft zu sein, sondern im Mittelpunkt steht die soziale Beziehung, die Führung erst ermöglicht. So kann Herr Müller nur dann führen, wenn ihm Führungsqualitäten und Autorität zugeschrieben werden. Ist dies nicht der Fall, droht ein Positions- und Führungsverlust. Auch bezüglich des Verständnisses von Unternehmensstrategien bieten wir in diesem Kapitel von der Theorie rationaler Wahl über den neuen Institutionalismus bis zur Systemtheorie verschiedene soziologische Perspektiven an, mit jeweils unterschiedlich gearteter Skepsis gegenüber den Möglichkeiten des Managements, eine Organisation strategisch zu steuern.
Damit leiten wir dann über zu den Gründen für diese Skepsis, die u.a. in der schwer beweglichen Kultur einer Organisation zu finden sind. In Kapitel 7 befassen wir uns daher mit dem Phänomen der Organisationskultur aus soziologischer Sicht. Zweifelsohne handelt es sich um eine für den organisationalen Alltag wichtige Kategorie, der in letzter Zeit sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Durch die Gestaltung einer »intakten« Organisationskultur sollen Konflikte und Störungen in Organisationen vermieden werden. Im genannten Kapitel zeigen wir exemplarisch anhand von drei soziologischen Theorierichtungen auf, wie der Begriff »Organisationskultur« definiert werden kann, und fragen, inwiefern eine gezielte Veränderung von Organisationskulturen realistisch ist. Dabei werden wir sowohl die kognitiven Deutungsschemata der Organisationsmitglieder berücksichtigen als auch die Frage, welche Auswirkungen die institutionelle Abhängigkeit der Organisation auf ihre Kulturproduktion hat: Gesellschaftlich etablierte Erwartungsstrukturen spielen eine wesentliche Rolle, wenn man sich dem Kulturphänomen nähern möchte. Nicht zuletzt erläutern wir die systemtheoretische Fassung von Organisationskultur, die darin einen Komplex unentscheidbarer Entscheidungsprämissen sieht, die, ohne eigens thematisiert zu werden, den Horizont organisationaler Entscheidungen abstecken.
Mit dem soziologischen Begreifen von »Organisationskulturen« sowie der »institutionellen Einbettung von Organisationen« ist auch das nächste von uns ausgewählte organisationssoziologische Thema des Buches eng verknüpft: jenes der Moral und Korruption in Organisationen. In Kapitel 8 klären wir, inwiefern nach den verschiedenen soziologischen Ansätzen Organisieren überhaupt etwas mit Moral zu tun hat und wie man dieses Thema wissenschaftlich, und damit jenseits der eigenen Moral, behandeln kann. Wir schildern am Beispiel eines aktuellen Falls, warum es Organisationen den unterschiedlichen Ansätzen zufolge nicht verhindern können, dass es zu Abweichungen von formalen Normen kommt, und welche Möglichkeiten die verschiedenen Ansätze sehen, in der Organisation unerwünschte und/oder illegale Abweichungen von organisationalen Normen, also ggf. Korruption und Bestechung, zu bekämpfen.
Im letzten Kapitel des Buches (Kap.9) beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Organisationstypen, um die verschiedenen Organisationsformen sichtbar werden zu lassen, welche Organisationen auf verschiedenen gesellschaftlichen Feldern annehmen. Wir rücken dabei „Schlüsselorganisationen“ in den Vordergrund, die prototypisch für die verschiedenen Felder stehen, also z.B. Krankenhäuser für das Gesundheitsystem, Kirchen für das Religionssystem oder Parteien für das politische System. Auf Basis einer Heuristik soll dann zum Abschluss sichtbar- und analysierbar gemacht werden, was verschiedene Organisationstypen verbindet und worin sie sich unterscheiden.
Quellen
Abraham, Martin/Büschges, Günter (2009), Einführung in die Organisationssoziologie, Bd. 4., Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Bonazzi, Giuseppe (2014), Geschichte des organisatorischen Denkens, Wiesbaden: Springer VS.
Drepper, Thomas (2003), Organisationen der Gesellschaft. Gesellschaft und Organisation in der Systemtheorie Niklas Luhmanns, Wiesbaden: WDV.
Kieser, Alfred/Ebers, Mark (Hrsg.) (2006), Organisationstheorien, 6. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer.
Kneer, Georg (2001), Organisation und Gesellschaft: Zum ungeklärten Verhältnis von Organisations- und Funktionssystemen in Luhmanns Theorie sozialer Systeme. In: Zeitschrift für Soziologie 30(6), S. 407–428.
Lieckweg, Tania (2001), Strukturelle Kopplung von Funktionssystemen ‹über› Organisation. In: Soziale Systeme 7 (2), S. 267–289.
Luhmann, Niklas (1997), Die Gesellschaft der Gesellschaft, Bd. 2, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Luhmann, Niklas (2000), Organisation und Entscheidung, Opladen/Wiesbaden: WDV.
Luhmann, Niklas (2002), Die Politik der Gesellschaft, Kieserling, André (Hrsg.), 3. Aufl., Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Müller-Jentsch, Walther (2003), Organisationssoziologie. Eine Einführung, Frankfurt a.M.: Campus.
North, Douglass C. (1990), The political economy of institutions and decisions: Institutions, institutional change and economic performance, Repr. Aufl., Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press.
Ortmann, Günther/Syndow, Jörg/Türk, Klaus (Hrsg.) (2000), Organisation und Gesellschaft: Theorien der Organisation. Die Rückkehr der Gesellschaft, 2., durchges. Aufl., Wiesbaden: WDV.
Preisendörfer, Peter (2016), Organisationssoziologie. Grundlagen, Theorien und Problemstellungen, 4., überarb. Aufl., Wiesbaden: Springer VS.
Schimank, Uwe (2002), Organisationen: Akteurskonstellationen. Korporative Akteure -Sozialsysteme. In: Allmendinger, Jutta/Hinz, Thomas (Hrsg.), Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie: Soziologie der Organisation, Bd. 42, Bd. 2002, S. 29–54.
Schluchter, Wolfgang (1996), Unversöhnte Moderne, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Schluchter, Wolfgang (2006), Grundlegungen der Soziologie, Bd. 1, Tübingen: Mohr Siebeck.
Stachura, Mateusz u. a. (Hrsg.) (2009), Der Sinn der Institutionen. Mehr-Ebenen- und Mehr-Seiten-Analyse, Wiesbaden: Springer VS / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
Tacke, Veronika (2001), Organisation und gesellschaftliche Differenzierung. Organisation und Gesellschaft, Wiesbaden: WDV.
Walter-Busch, Emil (1996), Organisationstheorien von Weber bis Weick, Amsterdam: Facultas.
Weber, Marianne (1926/84), Max Weber. Ein Lebensbild, Tübingen: Mohr Siebeck.
Weber, Max (1904/88), Die Protestantische Ethik und der »Geist« des Kapitalismus. In: Weber, M. (Hrsg.), Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, Tübingen: Mohr Siebeck.
Williamson, Oliver E. (1990), Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus. Unternehmen, Märkte, Kooperationen, Tübingen: Mohr Siebeck.
1Mit dem Begriff der »Wertsphäre« beziehen wir uns auf das Wertsphärenmodell von Max Weber, der die Ausdifferenzierung der Wertsphären Politik, Wirtschaft, Religion, Kunst, Wissenschaft, Erotik und Recht konstatiert (Weber 1904/1988: 536-573). Mit »Teilsystem« führen wir die systemtheoretische Perspektive ein (siehe Luhmann 1997; 2002).
2Siehe hierzu auch den Sammelband von Tacke (2001) sowie die Beiträge von Drepper (2003), Kneer (2001) und Lieckweg (2001).
3Vom neuen Institutionalismus der Organisationssoziologie zu unterscheiden sind sowohl die allgemeine soziologische Institutionentheorie, die in verschiedenen Ansätzen ausformuliert wurde (siehe Dazu u.a. Schluchter 1996, 2006; Stachura u.a. 2009), als auch der neue ökonomische Institutionalismus (siehe z.B. North 1990, Williamson 1990).
2Das sozialwissenschaftliche Verständnis der Organisation
In diesem Kapitel erfahren Sie
was die Sozialwissenschaften unter Organisationen verstehen,
ob die Mafia in diesem Sinne eine Organisation ist und
wie sich Organisationen von anderen sozialen Gebilden unterscheiden lassen.
Wir beginnen unsere Überlegungen in diesem Kapitel mit der italienischen Mafia.4 Das mag ungewöhnlich erscheinen, aber immerhin wird die Mafia als eine sehr erfolgreiche und zugleich beständige kriminelle Organisation gesehen. Nicht ohne Grund sprechen Polizei und Justiz in ihrem Falle von »organisierter« Kriminalität. Haben wir es hier also mit einem althergebrachten Prototyp von Organisation zu tun, und woher rührt dessen Beständigkeit? Diese Frage leitet unsere Beschäftigung mit der italienischen Mafia an. Unsere Absicht ist es, im idealtypischen Vergleich mit anderen sozialen Gebilden herauszuarbeiten, welches die besonderen Merkmale moderner Organisationen sind. Dabei rücken wir vor allem die Form und Art der Mitgliedschaft ins Zentrum, um beispielsweise Gruppen oder Familien von Organisationen unterscheiden zu können, und orientieren uns dabei gleichermaßen am Organisationsverständnis von Max Weber und Niklas Luhmann. Obwohl Weber handlungstheoretisch argumentierte und Luhmann systemtheoretisch, ergänzen sich ihre Perspektiven in Bezug auf die Form der Organisation in sinnvoller Weise. Um also herauszufinden, wie wir Organisationen am besten sozialwissenschaftlich einordnen können, sehen wir uns im Vergleich verschiedene soziale Gebilde an und stellen drei einfache Fragen: (1) Wie kommen wir in dieses soziale Gebilde hinein? (2) Welche Mitgliedschaftsregeln – formale und informale – gelten für uns, wenn wir Mitglieder sind? (3) Wie kommen wir aus diesem sozialen Gebilde wieder hinaus. Diese drei einfachen Fragen sollen uns helfen zu verstehen, womit wir es zu tun haben.
Begriffsbox 2.1: Organisierte Kriminalität
»Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- und/oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig (a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, (b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder (c) unter Einflussnahme auf Politik, Massenmedien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusammenwirken.« (RiStBV 1991).
Natürlich könnten wir auch anders vorgehen und von Organisation sprechen, wenn wir es mit dem geplanten, koordinierten Handeln mehrerer Personen zu tun haben (wie es z.B. die Ermittlungsbehörden tun), aber dann fällt zu viel darunter und wir könnten Familien, Gruppen oder totale Institutionen nicht mehr voneinander unterscheiden bzw. müssten sie alle in diesem Aspekt als Organisationen führen.
2.1Die italienische Mafia als Organisation?
Ist die italienische Mafia im sozialwissenschaftlichen Sinne eine Organisation? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, beschäftigen wir uns zunächst mit den oben genannten drei Aspekten: 1. Wie ist der Eintritt bei der italienischen Mafia gestaltet? 2. Wie sind die Mafiosi in die italienische Mafia integriert, welche Regeln der Mitgliedschaft gelten und welche Zwecke werden verfolgt? 3. Auf welche Weise erfolgt der Austritt aus der italienischen Mafia?
Bei der Beantwortung dieser Fragen müssen wir berücksichtigen, dass wir keine Insiderinformationen über die „italienische organisierte Kriminalität“ haben und nur darüber berichten können, was Polizei, Staatsanwält*innen und Richter*innen in aufgedeckten Fällen über die italienische Mafia herausgefunden haben. Dabei gibt es ein großes Dunkelfeld, das sich unserer Erkenntnis entzieht. Insbesondere wenn wir Roberto Scarpinato Glauben schenken, einem der bekanntesten Mafia-Jäger Italiens, operiert die italienische Mafia immer mehr im Stillen („mafia silente“) und immer mehr verdeckt von legalen Organisationen mit weltweiten Geschäftspraktiken auf globalen Märkten („marketist mafia“) (Scarpinato 2020: 44; vgl. dazu auch Le Moglie et al. 2022). Auch liegen länderübergreifend keine einheitlichen Definitionen und (mit wenigen Ausnahmen) belastbare Statistiken zur „italienischen organisierten Kriminalität“ vor, auf die wir unsere Analyse gründen können (Kirkpatrick 2020: 69). Dennoch gibt es durch die aufgedeckten Fälle, die von uns geführten Interviews und die verfügbaren Datenbanken der Justizbehörden hinreichend Indizien, um Antworten auf diese drei Fragen geben zu können und mit ihrer Hilfe zu einem sozialwissenschaftlichen Verständnis von Organisationen zu gelangen.
Ein erstes alltagstheoretisches Verständnis der Mafia legt die Vorstellung einer Organisation nahe. Wir haben Hierarchien — von der obersten Position des sogenannten Paten oder »capo dei capi« über die »consiglieri« (Berater) bis hinunter zu den einfachen Mitgliedern (vgl. Arlacchi 1995; Paoli 1999) — und auch die Polizei spricht von organisierter Kriminalität (siehe Begriffsbox 2.1). Manche Expert*innen, wie z.B. Catino 2019; 2020: 70, sprechen im Falle der italienischen Mafia sogar von formalen Organisationen.
Organisationen implizieren außerdem klare Anweisungsstrukturen, Über- und Unterordnungsverhältnisse und gemeinsame Ziele, die mit ihrer Hilfe verfolgt werden. All dies trifft auch für die italienische Mafia zu. Auf den ersten Blick ließe sich also sagen, bei der Mafia handelt sich um eine Organisation. Trotzdem stellt sich die Frage, inwiefern es – gemessen an der Beantwortung der drei Fragen – tatsächlich sinnvoll ist, die Mafia als eine solche zu bezeichnen. So zeichnen sich formale Organisationen in modernen Gesellschaften z.B. dadurch aus, dass sie Ein- und Austritte vertraglich regeln und die Beschäftigten nur in einem begrenzten Umfang formal beanspruchen, nämlich in ihrer Rolle als Personal.5 Gilt das auch für die Mafia? Dazu kehren wir zur ersten Frage vom Anfang des Kapitels zurück:
(1) Wie ist der Eintritt bei der italienischen Mafia gestaltet?
Darüber kann man einiges sagen (vgl. Paoli 1999: 4 f.; Paoli 2003: 21; Meneghini et al. 2021: 7 ff.): Die italienische Mafia rekrutiert ihre Mitglieder in der Regel durch Zuwahl (Kooptation). Man kann sich nicht bewerben. Sehr häufig werden auch heute noch Familien- und Sippenmitglieder vorgeschlagen (vgl. nur Catino 2020: 73 ff.) und nach Abstimmung mit den anderen Mafia-Familienoberhäuptern aufgenommen. Eine reine Blutsverwandtschaft oder nur die Ehe mit einem Mafioso reichen hingegen nicht aus, um dazuzugehören. Je nachdem, mit welcher italienischen Mafia man es zu tun hat, werden auch weitere Familien und Clans, wie z.B. bei der Cosa Nostra, assoziiert (vgl. Catino 2020: 75). Die Mitgliedschaft ist nicht auf Blutsverwandtschaft beschränkt, aber die Auswahl ist sehr streng (ebd.). Auch sollte keine weitere Verwandtschaft mit Angehörigen der Polizei oder des Justizsystems vorliegen (vgl. ebd. 75). Die 'Ndrangheta ist die einzige Mafia, deren Mitgliedschaft ausschließlich auf Blutsbande und strategische Ehen zwischen Familien beruht (ebd.: 78).
Eine Auswertung der Proton-Datenbasis, welche von 1985-2017 Daten zu 11.138 Straftäter*innen mit späterer Mafia-Zugehörigkeit in Italien enthält, zeigt darüber hinaus, dass gerade junge Rekrutierte (unter 27 Jahren) der italienischen Mafia in nicht wenigen Fällen vor Eintritt bereits schwere Straftaten begingen (Meneghini et al. 2021: 7 ff.).6 Insofern ist auch von einer Art Bewährung im „kriminellen Geschäft“ auszugehen, die als Empfehlung für eine Mafia-Zugehörigkeit dienlich ist (ebd.: 12). Schulbildung ist dabei nicht von Belang. Nur ca. 10% der Mitglieder der italienischen Mafia, welche in diese Polizeidatenbank gelangten, weisen nach den Auswertungen von Meneghini et al. einen High-School-Abschluss auf.
Auch wenn die italienische Mafia bisweilen mit assoziierten Gruppen von nicht clanzugehörigen Kriminellen zusammenarbeitet, bleibt sie in ihrem Kern bis heute durch Familenclans konstituiert (vgl. nur Scarpinato 2020; Catino 2020; Paoli 2020).
Aber auch in der Art der Aufnahme mit den dazugehörigen Ritualen erkennt man eine Besonderheit: Der – nach Meinung von Expert*innen auch heute noch verlangte – Schwur von Gehorsamkeit und Schweigsamkeit bis in den Tod sieht einer Organisation nicht ähnlich und erinnert eher an geheimbündische Traditionen (vgl.dazu auch Paoli 2008a; 2020; de Donno 2009: 895 ff.; Sergi 2019: 14).7 Auch außerhalb Italiens, beispielsweise bei der Ndranghetta in Australien, spielen diese Rituale eine wichtige Rolle (vgl. für Australien z.B. Sergi 2019: 14). Wie bei anderen Formen der organisierten Kriminalität gibt es auch bei der italienischen Mafia Initiationsrituale und rituelle Tötungspraktiken, welche zur Kultur der organisierten Kriminalität gehören (vgl. Paoli 2020; Catino 2020; Nicaso/Danesi 2013; 2021: 6 etc.).8
Wie bei anderen Formen organisierter Kriminalität auch hat die italienische Mafia ihre eigene Kultur mit Todesschwüren, Schweigegeboten, Tötungsritualen und Initiationsriten, die sie von einer Organisation unterscheiden.
Damit nimmt der Eintritt nicht, wie in Organisationen üblich, die Form eines zweckgebundenen Kontrakts an, denn diese Verträge kann man immer auch kündigen. Die Mitgliedschaft in der Mafia hat die Form eines »Verbrüderungsvertrages«.9 Sie setzt die Bereitschaft zu einer grundlegenden Veränderung der gesamten Person voraus und ist nach der vollzogenen Verbrüderung unkündbar, weil man »ein anderer Mensch« geworden ist. Dadurch schafft der Beitritt eine umfassendere Form von Zugehörigkeit, die Leib und Seele mit einschließt und damit weit über das hinausgeht, was eine Organisation üblicherweise von seinem Personal verlangt (vgl. dazu auch Hessinger 2002).
In der Mafia wird man also komplett, mit Leib und Leben vereinnahmt und diese Totalinklusion betrifft oft nicht nur das eigene Leben, sondern auch das von Frau und Kindern, Familie und Sippe. Um einer späteren »Blutrache« (vendetta) zu entgehen, bringt die italienische Mafia im Falle von Konflikten nicht selten auch diese um. Die Totalinklusion bedeutet in diesem Falle aber nicht, dass man sich 24/7, wie in einem Gefängnis oder einer geschlossenen Psychiatrie, an einem Ort aufhalten muss, an dem jede Einzelheit des Verhaltens geregelt ist, sondern dass der potentielle Zugriff der Mafia auf die Person umfassend und ohne Grenzen ist. Die jederzeitige Verfügbarkeit und der unbedingte Gehorsam sind Elemente dieser Totalinklusion. Während jede Organisation formal Grenzen im Zugriff aufrechterhalten muss und durch Gesetze bereits in der Arbeitszeit und im Schutz der Privatheit sanktionsbewehrte Grenzziehungen beachten muss, gilt dies für die kriminelle Gemeinschaft der italienischen Mafia sowie für viele andere Formen organisierter Kriminalität nicht.
Ein wichtiger Aspekt – denn um von Organisationen in einem sozialwissenschaftlichen Sinne sprechen zu können, bedarf es einer bestimmten Form der Mitgliedschaft. Sie ist zumeist kontraktuell geregelt, auch dann, wenn kein schriftlicher Vertrag geschlossen wurde. Der Eintritt erfolgt über eine vertragliche Bindung, welche der Austritt wieder auflöst, oft durch Kündigung oder im wechselseitigen Einvernehmen. Man kann Organisationen in dem von uns präferierten soziologischen Verständnis einfach daran erkennen, dass der Ein- und Austritt zwar an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, aber prinzipiell ohne Schaden für Leib und Leben möglich sein muss.10 Denn nochmals: Jeder Vertrag ist kündbar, auch wenn darin gegebenenfalls Vertragsstrafen und Laufzeiten festgelegt sein sollten. Die Form der Mitgliedschaft gibt also bereits zu erkennen, mit welchem sozialen Gebilde wir es zu tun haben. Andere soziale Gebilde, wie z.B. Märkte oder Institutionen kennen hingegen in der Regel ebenso wenig eine formale Mitgliedschaft wie Familienverbände oder Sippen. Dies führt direkt zu unserer zweiten Frage:
(2) Wie sind die Mafiosi in die Mafia integriert und welche Regeln der Mitgliedschaft gelten?
Die Mitgliedschaft in Organisationen schafft eine Rolle, welche das Mitglied auszufüllen hat. Mit dieser Mitgliedschaftsrolle wird die Person zum Personal (siehe dazu auch Kap. 4). Sie beinhaltet die vertragliche Erlaubnis oder die Anforderung, das Arbeitsvermögen der Person in den Dienst der Organisation zu stellen. Die Person erkennt mit der Mitgliedschaft bestimmte Regeln an und verpflichtet sich zur Regelbefolgung. Mit dieser Mitgliedschaftsrolle sind aber zugleich die Zugriffsmöglichkeiten der Organisation zeitlich, sachlich und sozial begrenzt, denn moderne Gesellschaften versehen diese Rolle mit rechtlichen Normen, geschaffen von staatlichen Institutionen11 und sorgen somit für die gesellschaftliche »Einbettung« von Organisationen. Zeitlich regeln Gesetze und Vereinbarungen zur Arbeitszeit die größtmögliche Beanspruchung des Personals. Sie darf z.B. in Deutschland 48 Stunden (einschließlich Überstunden) nicht überschreiten (§ 3, § 14 Abs. 3 ArbZG, zit. n. ArbG). Dasselbe gilt für die soziale Seite. So sind in Bewerbungsgesprächen z.B. Fragen nach den finanziellen oder familiären Verhältnissen, nach Vorstrafen oder Schwangerschaften rechtlich nicht erlaubt (§ 7 AGG), solange sie nicht einer Ausübung der Tätigkeit im Wege stehen (§ 8 Abs. 1 AGG). Auch sachlich kann die Organisation das Recht auf freie Meinungsäußerung der Person nicht einschränken, solange u.a. die »Treuepflicht« gegenüber dem*der Arbeitgeber*in sowie die Persönlichkeitsrechte anderer Personen durch die Ausübung dieser Meinungsfreiheit unberührt bleiben (Art. 5 Abs. 2 GG).
Begriffsbox 2.2: Mafia als Organisation?
Die Mafia ist im sozialwissenschaftlichen Sinne keine Organisation, weil
•der Eintritt nicht zweckvertraglich geregelt ist;
•die Mitgliedschaft nicht kündbar ist;
•eine Vereinnahmung der Person mit Leib und Leben stattfindet;
•das Personal kaum austauschbar ist
•und unbedingter Gehorsam verlangt wird.
Damit wird deutlich: Die gesellschaftlichen und rechtlichen Regeln sind so formuliert, dass die Mitgliedschaftsrolle in einer Organisation nie total vereinnahmend sein soll. Im Falle einer durchgängig anderen Fassung der Mitgliedschaftsrolle – wie z.B. bei der italienischen Mafia – hat man es im sozialwissenschaftlichen Sinne mit keiner Organisation mehr zu tun, sondern mit einem anderen sozialen Gebilde wie z.B. Familien, andere Gemeinschaften (oder »totalen Institutionen«). Organisationen sind in modernen Gesellschaften gerade daran erkennbar, dass sie es dem Personal ermöglichen, mehrere Rollen anzunehmen und auszufüllen, an mehreren gesellschaftlichen Wertsphären oder Teilsystemen zu partizipieren. Auch wenn es uns manchmal anders vorkommt: Moderne Organisationen beanspruchen uns in unserer Mitgliedschaftsrolle nicht total, sondern immer nur in Teilen, also partial. Um diesen Umstand zu beschreiben, benutzt die Soziologie den Begriff der »Partialinklusion« und unterscheidet diesen von der »Totalinklusion« (siehe Kap. 4, Scherm/Pietsch 2007, Kieser/Walgenbach 2010, Laux/Liermann 2005). Auf diese Weise gewinnt man einen sinnvollen Zugriff zum Phänomen der Organisation, das dadurch vor allem von anderen sozialen Anstaltsformen unterschieden werden kann. So sind Gefängnisse und Psychiatrien, aber auch Familien oft total inkludierend und verlieren spätestens dann für die Insass*innen, Patient*innen oder Familienmitglieder den Charakter einer Organisation, weil der Ein- und Austritt nicht mehr nach Belieben der »Vertragspartner*innen« erfolgen kann.
So wie die Person den Vertrag mit der Organisation kündigen kann, ist dies für die Organisation selbstverständlich auch möglich. Anders als bei Gruppen oder Familien (siehe dazu auch Kapitel 2.4) ist für Organisationen ihr Personal prinzipiell austauschbar. Deswegen sind Arbeitsmärkte für sie relevant. Die Austauschbarkeit des Personals ist konstitutiv für die Organisation (siehe ausführlich auch Kap. 4). Sie begrenzt dadurch ihre Abhängigkeit von einzelnen Personen. Theoretisch und praktisch könnte eine Organisation in kurzer Zeit ein Großteil ihres Personals austauschen, ohne ihre Existenz infrage zu stellen und ihre Legitimität zu verlieren. Wie anders ist dies bei der Mafia?! Sie könnte weder ihr ganzes Personal einfach austauschen noch einzelne Mitglieder oder Führungskräfte, auch wenn sicherlich das Auslöschen einer Mafia-Familie die Mafia als Phänomen nicht gefährdet (Paul und Schwalb 2011: 134). Als verschworene Gemeinschaft ist sie jedoch in Bezug auf die Austauschbarkeit ihrer Mitglieder sensibel und macht sich auch strategisch von Personen und Familien abhängig. Wenn Personal ausgetauscht wird, gelingt dies oft nur durch Intrigen und Morde.
Welche Zwecke werden auf Basis welcher Strukturen verfolgt? Die Mafia ist zwar im sozialwissenschaftlichen Sinne keine Organisation, aber sie hat Strukturen und Koordinationsformen, welche Organisationen ähneln. Zumindest werden diese von ihr simuliert. Sie ist eine Zweckgemeinschaft, die sich eine Hierarchie gibt und Karrieren kennt (Arlacchi 1995; Paoli 1999).
Abbildung 2.1: Koordinationsform der Cosa Nostra nach Catino (2020)
Nach Catino (2020: 75) zeichnen sich die Familien der Cosa Nostra durch eine Hierarchie aus, in der die der Macht klar definiert ist: vom Picciotto (Soldat) am unteren Ende bis zu den Familienoberhäuptern (siehe Abb. 1). Die Soldaten, auch als "Ehrenmänner" bezeichnet, führen operative Befehle aus. Der capodecina ("Zehnerchef") leitet eine Mannschaft von Soldaten, die je nach Größe der Familie zwischen 5 und 30 in der Zahl sind. Der Chef wird von den Soldaten gewählt und trifft die Entscheidungen. Der Chef ernennt einen Unterboss, der in seiner Abwesenheit Entscheidungen trifft. Berater*innen oder Seelsorgende beraten den Chef und dienen als Bindeglied zu den Soldaten (ebd.).
Abbildung 2.2: Koordinationsform der ‘Ndrangeta nach Catino (2020)
Innerhalb jeder Familie der Ndranghetta gibt es eine starke Hierarchie, die auf Doti (Ränge) und Cariche (Ämter) basiert, die alle mit besonderen Zeremonien verliehen werden (siehe Abb. 2). Die Dienstgrade repräsentieren die Verdienste, die sich die Mitglieder im Laufe ihrer Karriere erworben haben. Sie steigen mit der Anzahl und Schwere der Verbrechen an und können nur mit Zustimmung der kalabrischen Zentrale verliehen werden. Der nominelle Rang des giovane d'onore (junger Ehrenmann) wird durch "Blutrecht" bei der Geburt der Söhne der 'ndranghetisti‘ verliehen. Der erste wirkliche Rang ist der picciotto d'onore (Ehrenmann), der lediglich dazu bestimmt ist Befehle auszuführen. Der wichtigste, allgemein anerkannte Rang ist der padrino, der "Pate“.
Auch wenn es verschiedene Koordinationsformen der verschiedenen italienischen Mafias (Camorra, `Ndrangheta, Cosa Nostra) gibt, welche sich zudem im Laufe der Zeit wandeln (siehe nur Catino 2020) steckt hinter allen – trotz aller Modernisierung – doch das dominante Muster der Clan-Kriminalität. Die von Catino erstellten Organigramme sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es nicht mit formalen Über- und Unterordnungsverhältnissen mit Weisungs- und Zeichnungsbefugnissen zu tun haben, sondern mit sanktionsbewehrter, gewaltbasierter krimineller Willkür im Kontext von Clan-Gemeinschaften.
Ihren Aktionen liegt eine paradoxe Umkehrung herkömmlichen Organisationsgeschehens zugrunde: Formale Organisationen bewegen sich nicht im rechtsfreien oder gar im berufskriminellen Raum und versuchen deshalb, im Regelfall kriminelle Aktivitäten ihrer Mitglieder negativ zu sanktionieren (siehe dazu auch ausführlich Kap. 8). Die Mafiosi hingegen sind bei Strafe für Leib und Leben zu kriminellen Handlungen verpflichtet, wenn diese ihnen aufgetragen werden. Ein Auftragsmörder kann sich nicht plötzlich entscheiden, sich an die Gesetze zu halten, wenn er einen Mord verüben soll. Unbedingter Gehorsam ist gefordert, um die kriminellen Machenschaften der Mafia voranzutreiben, während Organisationen in der Regel auf bedingte Gehorsamkeit abonniert sind. Man kann als Personal zu Entscheidungen des*der Vorgesetzten auch »nein« sagen oder in einem Unternehmen die kriminelle Verfolgung wirtschaftlicher Zwecke ablehnen. Organisationen sind im Weber‘schen Sinne immer insofern Herrschaftsformen, als sie auf der freiwilligen Anerkennung von Regeln basieren und diese Anerkennung jederzeit durch die Mitglieder wieder entzogen werden kann: Sehe ich als Mitglied den Zweck wichtiger Mitgliedschaftsregeln nicht mehr ein, dann muss ich gegebenenfalls die Organisation verlassen (Luhmann 1964: 36). Diese Möglichkeit des (oft nicht sanktionierten) Entzugs von Anerkennung eröffnet die Mafia nicht. Sie ist keine reine Herrschaftsform, sondern immer auch eine auf traditionelle Normen gegründete, gemeinschaftliche Ausübung von Macht und Gewalt, in welcher der Wille des Paten gerade auch gegen Widerstand vollstreckt werden muss (siehe hierzu auch ausführlich Kap. 5 und Kap. 6). Damit ist die Hierarchie keine für Organisationen typische Stellenhierarchie, sondern es handelt sich eher um das Resultat der mittelfristigen Über- und Unterordnung nach Maßgabe eines absoluten Machtanspruchs.12
(3) Wie kann man die italienische Mafia wieder verlassen?
Für eine soziologische Betrachtung wichtig ist auch die Frage, wie sich der Austritt aus der italienischen Mafia gestaltet. Auch hieran kann man gut erkennen, ob und inwieweit wir es mit einer Organisation zu tun haben. Können die Mitglieder der Mafia einfach kündigen oder gehen, wenn sie nicht mehr mitwirken wollen? Die Antworten auf die Frage haben wir oben bereits angedeutet. Bis heute ist es so, dass nur der – oftmals mutwillig herbeigeführte – Tod die Mitgliedschaft beendet. Die Auftragsmörder*innen und Verbündeten von Salvatore 'Totò' Riina, dem Boss der Mafia aus Corleone in den frühen 1980er-Jahren, ermordeten nicht nur reihenweise Richter*innen, Polizei- und Justizbeamt*innen, christdemokratische und kommunistische Spitzenpolitiker*innen, Journalist*innen, Ärzt*innen oder Priester*innen. Nein, sie massakrierten auch ganze Familien von zu Feinden erklärten Mafiosi. Insgesamt kam der Blutzoll auf schätzungsweise 2000 Tote, die von 1981 bis 1983 Opfer des Mafia-Krieges in Italien wurden (vgl. Pfletschinger und Spadi 2004: 8 f.). Dabei ist ihre Anzahl sicher noch unterschätzt. Nicht nur der reale Mafia-Krieg, sondern auch viele andere Tötungsdelikte sprechen eine deutliche Sprache: Die Mafia ist keine »Organisation«, aus der man lebend austreten kann. Zumeist erfolgt der Austritt durch den Tod oder die Tötung des Austrittswilligen sowie nicht selten auch von deren Familien. Selbst wenn man ins Gefängnis kommt, ist man vor dem Zugriff der Mafia nicht gefeit. Allein ein Zeugenschutzprogramm des Staates vermag vielleicht noch vor dieser häufigen Austrittsform zu schützen, sicher sind sich die Zeug*innen diesbezüglich jedoch nicht.13 Selbst hier, in den vorgenommenen Tötungsdelikten der italienischen Mafia kommen wieder Tötungsrituale, wie z.B. “Lupara Bianca” (“White Lupara”), ins Spiel, bei denen die Opfer mit einer speziellen Waffe (Lupara) getötet und ihr Leichnam danach verbrannt wird (vgl. z.B. Mondello et al. 2019: 31; De Donno et al. 2009; Pomara et al. 2015).
Begriffsbox 2.3: Die italienische Mafia als traditionale kriminelle Gemeinschaft
Die italienische Mafia erscheint gemessen an ihren Mitgliedschaftsregeln als eine „traditionale Vergemeinschaftungsform“, mit
1.rituellem „geheimbündnerischen“ Eintritt;
2.Zugehörigkeit bis zum Tod;
3.Vereinnahmung der Person mit Leib und Leben;
4.Haftung von Familie und Sippe;
5.Schweigensgebot und Blutrache;
6.unbedingtem Gehorsam und unbedingter Hierarchie.
Wir haben damit gesehen, dass die italienische Mafia im sozialwissenschaftlichen Verständnis ihrer Mitgliedschaftsregeln keine Organisation ist. Unsere Einblicke legen eher ein Verständnis als »traditionelle Vergemeinschaftungsform«14 nahe, die mit geheimbündlerischer krimineller Ausrichtung auf die von Gewinn- und/oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten zielt.15 Sie setzt dabei strategisch am höchsten Gut der Menschen an, an deren körperlicher Unversehrtheit. Mord und Totschlag, die Gefährdung von Leib und Leben sind konstitutiv für die Geschäftspolitik der Mafia, Blutrache an Familie und Sippe Bestandteil ihrer Tradition.
Für die organisierte Kriminalität typisch gelingt es ihr, sich in Verbindungen mit der Bevölkerung sowie dem Machtapparat langlebig zu institutionalisieren und ihre vormodernen, archaischen Wurzeln zu bewahren. Sie folgt dabei männerbündischen Traditionen, da ihre Mitgliedschaft fast ausschließlich männlich ist. Sie weist komplexe, hierarchische Koordinationsformen auf und starke kulturelle sowie rituelle Elemente. Für ihre Mitglieder erzeugt sie eine starke Identität und – wenn keine Realien vorliegen – fiktive verwandtschaftliche Bindungen mit einer Zugehörigkeit bis zum Tod (vgl.Paoli 2020: Zusammenfassung).
2.2Die Bekämpfung der Mafia
Es ist der 23. Mai 1992. Drei Autos nähern sich dem Ort Capaci in Richtung Palermo, als in einem Abflussrohr unter der Fahrbahn 500 Kilo Sprengstoff ferngezündet werden. Die drei Autos werden von der Wucht der Explosion hochgeschleudert. Die Leibwächter sterben im Trümmerfeld. Auch Giovanni Falcone ist sofort tot, seine Frau, Francesca Morvillo, stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Nur 55 Tage später, am 19. Juli 1992, werden der Richter Paolo Borsellino und seine Leibwächter in Palermo durch eine ferngezündete Autobombe hingerichtet. Es geschieht vor dem Haus der Mutter Borsellinos (vgl. Pfletschinger und Spadi 2004: 14 f.).
Infobox 2.1: Die Mafia-Bekämpfung der italienischen Justiz — Falcone und Borsellino
»Giovanni Falcone wird am 18. Mai 1939 in Palermo geboren. Sein Vater ist Chemiker, seine Mutter Hausfrau. Giovanni wächst in der Kalsa, dem sogenannten arabischen Viertel Palermos auf, einer Hochburg der aggressivsten Mafia-Familien. Er hat Schulkameraden, die er rund dreißig Jahre später als Mafiabosse verhaften wird. 1961 promoviert er an der Juristischen Fakultät der Universität Palermo. 1979 holt der leitende Oberstaatsanwalt Rocco Chinnici, der die im Rauschgifthandel involvierten Mafia-Clans verfolgt, den 40-jährigen Falcone in den Justizpalast von Palermo. Im gleichen Jahr ermordet die Mafia den Untersuchungsrichter Cesare Terranova, der erfolgreich in diesem Ambiente ermittelt hatte. Oberstaatsanwalt Chinnici übergibt Falcone 1980 die Ermittlungen gegen italoamerikanische Mafia-Familien, die mittlerweile tonnenweise Heroin und Kokain in die USA schmuggeln und nicht mehr wissen, wohin mit den Abermillionen Dollars aus diesem Geschäft. Falcone knüpft in den USA die ersten Kontakte mit amerikanischen Staatsanwälten und Ermittlern, fängt an, die Spur des schmutzigen Geldes zu verfolgen. Paolo Borsellino wird am 19. Januar 1940 geboren, ebenfalls in Palermo. Seine Eltern waren Apotheker und Anhänger des faschistischen Diktators Benito Mussolini, der eine ganze Armee nach Sizilien geschickt hatte, um die Mafia zu entmachten.« (Pfletschinger und Spadi 2004: 7).
Quelle: Wikimedia Commons, File: Falcone e borsellino murales.JPG, Mural painting inspired by the most famous image of Italian magistrates Giovanni Falcone and Paolo Borsellino. Painting found on a wall of University of Calabria campus
»Borsellino, ehemaliger Funktionär der neofaschistischen Studentenorganisation FUAN, wird nach seinem Jura-Studium an der Universität Palermo 1975 von Rocco Chinnici in den Justizpalast von Palermo geholt. 1980 verhaftet Borsellino sechs Mafiabosse, sein engster Mitarbeiter, der Capitano der Caribinieri Emmanuele Basile, wird von der Mafia ermordet. Als Falcone und Borsellino sich 1979 im Büro ihres Chefs Oberstaatsanwalt Rocco Chinnici begegnen – der eine Wähler einer kommunistischen Partei, der andere Anhänger des untergegangen faschistischen Regimes — hätte es eigentlich zu einer explosiven Auseinandersetzung kommen müssen. Es kam anders. Das gemeinsame Ziel, die Bekämpfung der Mafia, vereinte zwei Männer mit diametral entgegengesetzten politischen Überzeugungen, ließ sie zu unzertrennlichen Freunden werden.« (Pfletschinger und Spadi 2004: 7).
Quelle: Wikimedia Commons, File: Giovanni Falcone tree.jpg, Giovanni Falcone memorial tree, in Palermo
Giovanni Falcone stand kurz vor seiner Ernennung zum Leiter einer neuen, nationalen Anti-Mafia-Behörde, einer Art Generalstaatsanwaltschaft für Mafia-Delikte, als er ermordet wurde. Das italienische Parlament hatte das Strafgesetz für Mafia-Delikte verschärft. Gerichte konnten nun bei Verurteilungen Isolationshaft in Hochsicherheitsgefängnissen verhängen. Damit findet eine Episode im Kampf der italienischen Justiz gegen die Mafia ihren traurigen Abschluss. Sie begann auch im richtigen Leben — wie im Film – im sizilianischen Corleone, endete für viele Mafiosi im Gefängnis und für Falcone und Borsellino mit dem Tod. Beide hatten zusammen mit Giuseppe Di Lello sowie verbündeten Richter*innen und Staatsanwält*innen im November 1985 an die 500 Mafiosi vor Gericht gestellt und im Maxi-Prozess in Palermo im Dezember 1987 die Verurteilung von etwa 350 angeklagten Mafiosi zu fast 2600 Jahren Haft erreicht. Ihre »Strafe« folgte auf dem Fuße (vgl. Pfletschinger und Spadi 2004: 12-15).
Trotz dieser Erfolge von Falcone, Borsellino und anderer seit Ende der 1990er-Jahre, aufgrund effektiverer Anti-Mafia-Gesetze und deren Vollstreckung durch italienische Strafverfolgungsbehörden, konnte die Mafia aber nicht endgültig besiegt werden. Sie stellt nach wie vor eine ernstzunehmende Gefahr für die staatliche Ordnung in Süditalien dar. Sie wurde schon oft für tot erklärt und ging doch immer wieder gestärkt aus Phasen der existenziellen Krise hervor (vgl. Paoli 2008b: 21-27). Auf Basis des von uns erarbeiteten sozialwissenschaftlichen Verständnisses von Organisationen lässt sich nun auch in einem Aspekt begründen, woran dies liegt.
Während die Mafia mit den archaischen Mitgliedschaftsregeln einer traditionalen Gemeinschaft operiert, totalinklusiv und entgrenzt, oft abzielend auf die (heute nicht mehr immer nur gewaltvolle, sondern bisweilen auch digitale) Bedrohung der sozialen oder körperlichen Existenz, stehen ihr bei den Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden Organisationen mit kontraktuell gebundenem, oft schlecht bezahltem Personal gegenüber. Für diese ist der Einsatz von Leib und Leben eher die Ausnahme als die Regel. Zwar kann sich »[f]ür Beamte der Polizei, des Strafvollzugs und der Feuerwehr (…) in bestimmen Situationen sogar die Pflicht ergeben, Leben und Gesundheit einzusetzen. Einem Polizeibeamten darf der Einsatz des Lebens jedoch nur dann zugemutet werden, wenn dies zur Abwehr von Gefahren für vorrangige Rechtsgüter des Staates oder der Bürger erforderlich und das einzugehende Risiko kalkulierbar ist.« (Jäger o.J.). Damit wird klar, woraus in diesem Aspekt die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung der Mafia resultieren: Ihr steht im Regelfall das Personal moderner