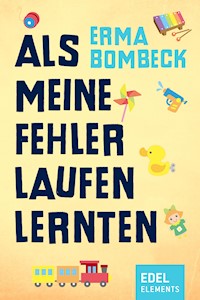Erma Bombeck
Einmal und doch wieder
Ins Deutsche übertragen von Erna Tom
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel A MARRIAGE MADE IN HEAVEN OR TOO TIRED FOR AN AFFAIR
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel Germany GmbH
Neumühlen 17, 22763 Hamburg
Copyright der Originalausgabe © 1993 by Erma Bombeck
Copyright First German Edition © 1993 by Bastei Lübbe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Inhaltsverzeichnis
Titel - Untertitel (/Genre)Impressum1949 - Die HochzeitVon der Liebe lebenWir unterbrechen diese Ehe ...In Krankheit und Gesundheit1953 - „Du wirst auch nicht jünger!“1954-1958 - Die Kinder„Wieviel Glück können wir finanzieren?“In Reichtum und Armut1959 - KlassentreffenWofür hat man Freunde?1964 - Das leere NestRevolutionswehen„... und vergib uns unsere Schuld“1967 - Die große SchuldRenovierungsbedürftigKreatives Streiten1971 - TeenagerDie sexuelle Revolution1974 - Die DinosaurierWo ist die Leidenschaft geblieben?In guten wie in schlechten TagenHallo, Mami! Hallo, Papi! Ich bin wieder da!Des langen Haders müde1979 - Er läuft und läuft und läuft und ...Rollentausch oder Tanze, so schnell du kannstWenn die Technik nicht wär, wär das Leben, ach, schwer!1981 - Die TrennungDie wilden Fünfziger„Für immer und ewig“MetamorphoseIch will Großmutter werdenMit 60 fangen die Probleme erst an1992 - Die Hochzeit
1949
Die Hochzeit
Es hätte eine wunderbare Hochzeit sein können – wäre es nicht die meine gewesen.
Die Sonne lachte. Die Verwandtschaft unterhielt sich. Der Bräutigam erschien. Am Altar wartete ein Mann auf mich, den ich auf der Highschool kennengelernt, der im Zweiten Weltkrieg in Korea gekämpft hatte und der in Uniform fabelhaft aussah. In Uniform machte sogar noch der letzte Hinterwäldler richtig was her.
Bill war praktisch ein Fremder; ich kannte ihn nämlich erst seit sieben Jahren.
Was hatten sich meine Eltern nur dabei gedacht? Sie mit ihrem Geschwätz von „Du wirst auch nicht jünger“? Wir hatten kein Auto, keine Wohnung, keine Möbel, kein Tafelsilber. Konnte man ohne Tafelsilber überhaupt rechtmäßig heiraten? Bill hatte nicht mal einen Job. Vor einem Jahr war er vom College abgegangen. Es gab überhaupt keinen Zweifel: Meine Eltern waren dabei, einen großen Fehler zu machen.
Nichts lief, wie es sollte. Als Kind hatte ich mir immer eine Hochzeit ausgemalt, die unsere Verhältnisse weit überstiegen hätte. Und nun stand ich da in einem zu großen Brautkleid aus dem Schlussverkauf, mein Cousin machte mit der Kleinbildkamera Schnappschüsse fürs Hochzeitsalbum, und meine Mutter
roch nach dem Schinken, den sie schon den ganzen Morgen für den Empfang gebraten hatte.
Und was sollte aus meinen Träumen werden? Ich hatte doch schon so große Pläne für mich gehabt. Mit meinem erstklassigen Collegeabschluss hätte ich nach New York gehen können, als Korrespondentin für die New York Times. Na ja, und für den Fall, dass das nicht klappte, hatte ich ein ernst zu nehmendes Angebot aus Ohio, für den „Dayton Herald“ Nachrufe zu schreiben. Das war doch schon mal was!
Ja, und da schritt ich nun, zwei Wochen nach meinem Abschluss, durch das Mittelschiff der Auferstehungskirche, um diesem Mann mein Jawort zu geben – ohne irgendeine Stelle zu haben.
Doch dann begegnete ich dem Blick meines Bräutigams, der vor dem Altar auf mich wartete, und mit einem Mal waren gefühlte Armut und unerfüllte Träume unwichtig. Ich liebte diesen Mann. Wir waren das vollkommene Paar, hatten so vieles gemeinsam. Also, in wirklich wichtigen Dingen.
Beide kauten wir nur eine Hälfte des Kaugummis und hoben die andere auf (wer macht schon so was!). Beide konnten wir uns über die Witze von Robert Benchley totlachen, hassten den Kommunismus, und ... war da nicht noch etwas? Ach ja: Wir gingen beide furchtbar ungern zum Zahnarzt.
Viele Ehepaare, die wir kannten, hatten weit weniger Gemeinsamkeiten.
Als ich neben Bill niederkniete, entdeckte ich durch meinen Schleier, dass er einen weißen Farbklecks am Ohr hatte. Ein schwacher Terpentingeruch haftete ebenfalls an ihm. Im Sommer strich er in Wohnungen die Decken und Wände, um sich etwas Geld zu verdienen. Das musste anders werden. Er konnte bestimmt eine gehobenere Arbeit finden. Außerdem hatte ich nicht die Absicht, mich mit jemandem abzugeben, in dessen Gegenwart man sicherheitshalber kein Streichholz anzünden durfte.
Der Mann brauchte ganz entschieden einen gescheiten Job. Aber ich hatte ja noch jahrelang Zeit, aus ihm den Ehemann zu machen, der in ihm steckte. Als Erstes, so notierte ich mir in Gedanken, musste er sich die Haare wachsen lassen. Gott im Himmel, wie ich diesen Bürstenschnitt hasste! Er sah damit aus wie ein abgewetzter Teppich, der frisch gesaugt war.
Und im Hinblick auf seine Essgewohnheiten mussten wir etwas unternehmen. Ich kam aus einer Familie, die von Soße lebte, er aß lieber Gemüse. Gemüse war für mich Dekoration am Tellerrand. Ich konnte mir kaum vorstellen, den Rest des Lebens mit einem Mann zu verbringen, der nie kalte Klöße zum Frühstück gegessen hatte!
Sein bester Kumpel und Pokerfreund, Ed Phillips, reichte ihm den Ring. Ich lächelte, als Bill ihn mir an den Finger steckte. Ed und die ganze Meute lustiger Burschen würden bald Teil seiner Vergangenheit sein. Aus mit dem Singleleben, mit den Pokerspielen bis in den frühen Morgen hinein. Von jetzt an würden es nur noch wir zwei sein, die den Sonnenaufgang betrachteten und einander dabei in die Augen schauten.
Als sich unsere Schultern berührten, kam mir die Idee, ihm für jeden Tag einen Plan zu machen. All die Jahre, seit wir uns kannten, war dieser Mensch immer und zu allem zu spät gekommen. Ich gelobte einem Mann ewige Treue, der noch nie die Nationalhymne oder einen Spielanpfiff gehört hatte, nie einen Vorhang hatte aufgehen sehen oder eine Ouverture gehört hatte. Er sah so zufrieden aus. Er konnte ja nicht wissen, dass ich ihm bald solche Tugenden beibringen würde wie einen Filzstift nach Gebrauch stets mit der Kappe zu verschließen, damit er nicht austrocknete, und
den Telefonhörer so aufzulegen, wie es ein Linkshänder tun sollte, um einen Rechtshänder nicht rasend zu machen.
Der Priester war Pole, und ich bemühte mich, aus seinem Akzent und dem Latein der Liturgie den Sinn der Worte herauszufiltern. Dann hörte ich laut und deutlich seine mahnenden Worte: „Du, Bill, sollst der Kopf der Familie sein, und du, Erma, ihr Herz.“
Das hatte er sich so gedacht! Mit wem meinte er es eigentlich zu tun zu haben? Mit einem Kind, dem man ein X für ein U vormachen konnte, weil es nicht lesen konnte? Ich hatte mich nicht jahrelang mit der Konjugation von unregelmäßigen Verben abgekämpft, um vor den Bowlingtreffen meines Mannes in Ehrfurcht zu erstarren.
Vielleicht wüurde ich Bill überreden können, das Herz zu sein ... oder wenigstens manchmal mit mir zu tauschen.
„Und hiermit erkläre ich euch für Mann und Frau.“
Es gibt wenige Sätze, die einen so rasch auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, wie dieser. Höchstens noch: „Wir setzen in wenigen Minuten zur Landung an“ oder „Das Land befindet sich im Kriegszustand.“
Die Hochzeitsfeier fand in einem Gemeindesaal am Stadtrand statt, wo für gewöhnlich die Veteranentreffen abgehalten wurde. Die an die Wand gelehnten Klappstühle vermittelten die Gemütlichkeit eines Busbahnhofs. Ein langer Tisch, mit weißem Papier gedeckt, stand mitten im Raum, darauf der Kuchen und Berge von Schinkensandwiches.
Ein Wagen hielt am Eingang, heraus kletterte ein Paar mit sechs Kindern. Der Mann rief: „Charlie ist hier! Wo bleibt das Bier?“
Bill sah mich an und fragte: „Deiner?“
Ich nickte. „Ein angeheirateter Onkel von mir.“
Den Rest des Tages habe ich nur noch als verschwommenes Bild in Erinnerung ... Die ganzen Verwandten standen einander gegenüber, aufgereiht wie kriegführende Stämme ... Hunderte von Kindern, die man nie zuvor gesehen hatte, mit kuchenverschmierten Gesichtern. Brautjungfern mit diesem „Gottlob bist es du und nicht ich“-Blick. Und eine Mutter, die sich nicht beruhigen konnte, weil der Schinken zur Neige ging.
Eine Gratulantin fragte mich, wo wir unsere Flitterwochen verbringen wollten. Ich erklärte ihr, ich wolle nach New York, um eine Broadway-Show anzuschauen, in einem Traumhotel zu wohnen und nachts in einer Kutsche durch den Central Park zu fahren.
„Also wohin fahrt ihr?“, fragte sie nachdrücklich.
„Zum Fischen an den Larvae-See in Michigan.“
„Du hast einen Romantiker geheiratet“, sagte sie lächelnd.
Was hätte ich auch von einem Mann erwarten können, dessen Heiratsantrag darin bestand, dass er meinen Verlobungsring über seine Zigarre steckte und sie anzündete?
Von der Liebe leben
Die Sache, die wir alle fürchteten und über die wir nie sprachen, hatte etwas mit Sex zu tun. In den Vierzigerjahren hatten nur wenige meiner Freundinnen Erfrahrungen in dieser Hinsicht. Außerdem hatten wir die Befürchtung, dass die „Erfüllung der ehelichen Pflichten“, also etwas, was die katholische Kirche guthieß, nicht viel Spaß machen konnte.
Das größte Problem mit dem Sex aber war, ihn in unsere Terminkalender reinzukriegen. Samstags zwischen zwei und drei kam Sex nicht in Frage, weil da der Altpapiersammler kam. Vor dem Frühstück ging auch nicht, weil wir regelmäßig verschliefen. Nach dem Abendessen konnten wir's ohnehin vergessen – um diese Zeit rief immer jemand von unseren Eltern an, und wenn wir nicht ans Telefon gingen, benachrichtigten sie die Polizei. Dienstagabend war Bowling, da kam Bill spät nach Hause, und freitags wusch ich mir immer die Haare und schlief mit Lockenwicklern, um eine formvollendete Frisur zu kriegen. Also war der Freitag auch gestrichen.
Eines Abends erzählte mir eine meiner Freundinnen im Kartenklub von einem Artikel, den sie gelesen hatte. Darin stand, dass der sexuelle Reiz sich nach zwei Jahren Ehe bereits abgenutzt hätte.
Bei den Versuchen, uns auszumalen, was ihn ersetzen könnte, reichten die Antworten von Fruchteis mit heißer Schokolade bis zu Zahnregulierung.
Die Sache mit dem Sex zählte nicht mal zu den ersten zehn dringlichen Fällen auf unserer Hitliste.
Die echten Probleme waren die, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Frischvermählte sollten den ganzen Quatsch von Zärtlichkeit und Liebe in guten wie in bösen Tagen, in Reichtum und Armut, Krankheit und Gesundheit vergessen und sich lieber der großen Frage befassen: „Können wir uns ernähren und erhalten?“ Meinen Sie, irgendjemand würde zu den in die See der Ehe stechenden Paare sagen: Nehmt belegte Brote mit!?
Ich erinnere mich schwach, dass meine Mutter mich eines Abends, als ich noch alleinstehend und unbedarft war, bat: „Wenn du gerade schon stehst - könntest du mir ein Glas Wasser aus der Küche bringen?“
Ich fragte: „Wo?“
Sie fragte zurück: „Wo was? Das Wasser oder die Küche?“
„Die Küche“, gab ich zur Antwort.
„Ist das Zimmer mit der großen Uhr an der Wand.“
„Aha.“
Solange ich zu Hause lebte, hat sie immer mal wieder versucht, mich dazu zu kriegen, ihr bei der Küchenarbeit zuzuschauen, aber ich war nicht neugierig darauf, wie man ein Ei richtig aufschlägt oder ein Huhn zubereitet. Im Alter von zweiundzwanzig Jahren hielt ich Aspik immer noch für einen Wintersportort.
Ich hatte auf der Highschool einige wenige Male Hauswirtschaft belegt, aber es war jeweils nur eine Frage der Zeit, bis uns der immer wiederkehrende Speiseplan samt der Götterspeise mit Vanillesoße zum Hals heraushing.
Eines Abends legte Bill seine Gabel auf die undefinierbare (und unangerührte) Speise auf seinem Teller
und überlegte: „Vielleicht sollten wir einige Hochzeitsgeschenke zurückgeben und gegen was Nützliches eintauschen.“
„Und das wäre?“
„Eine automatische Würstchenbude, zum Beispiel.“
Tatsächlich ging uns jetzt die Bedeutung des alten Spruches auf: „Der Mensch ist, was er isst.“ Solange wir verliebt und dann auch verlobt waren, hatten wir von der Liebe gelebt, die weder Kalorien noch Nährwert hat und nur geringen Vorbereitungsaufwand erfordert.
Jetzt entdeckten wir, dass die nächste Mahlzeit nicht nur der Grund unseres Daseins war, sondern darüber hinaus die Basis aller unserer Gespräche, ein immer wiederkehrendes Thema.
„Was gibt es zum Abendessen?“
“Soll ich das Essen machen?“
„Bist du zum Einkaufen gekommen?“
„Hast du es aufgetaut?“
„Macht das deine Mutter so?“
„Ist es zu hart?“
„Ist es zu sehr durch?“
„Sind Koteletts zu teuer?“
„Soll ich es aufheben?“
„Du isst ja gar nichts.“
Wenn wir nicht über unsere Essgewohnheiten sprachen, dann rief meine Mutter an, um sich zu erkundigen, was ich kochte, oder meine Schwiegereltern kamen vorbei, um nachzusehen, ob ihr Sohn auch etwas Anständiges zu essen bekam.
Keiner von uns beiden wollte es zugeben, aber das Essen, das wir jede Woche bei unseren Eltern abstaubten, war unsere Rettung. Sozusagen eine verlängerte Nabelschnur.
Wir waren mit gänzlich überflüssigen Dingen in
die Ehe gegangen. Warum nur hatte ich mir eingebildet, ich brauchte silberne Platzkartenständer in meiner Vitrine? Ich werde das nie verstehen. Jeder wusste, dass man an meinem Tisch keine Platzkarten brauchen würde: Man blieb nicht lange genug, um neue Bekanntschaften zu machen.
Unsere Hochzeitsgeschenke waren in keiner Hinsicht hilfreich. Wohlmeinende Freunde hatten uns kleine Pfännchen in Igelform geschenkt. Wir brauchten einen Badezimmerboiler. Wir besaßen zwar gravierte Teelöffel, aber keine Matratze für unser Bett. Wir waren Besitzer zweier Wohnzimmertischlampen. Aber die Tische, auf die man sie hätte stellen können, die fehlten uns noch immer.
Unsere Wohnung sah aus, als hätte sie jemand eingehäkelt ... dank Tante Mae. Als sie hörte, dass ich heiratete, häkelte sie sich bewusstlos. Es gab einen gehäkelten Überzug für den Klodeckel und den Wasserboiler, eine gehäkelte Fußmatte vor dem Waschbecken, einen gehäkelten Überzug für die Toilettenpapier-Reserverolle und eine gehäkelte Schnur zum Auf- und Zuziehen des Duschvorhangs.
Des Weiteren waren da noch: gehäkelte Überzüge für Seifenschachteln, Taschentuchpäckchen, die Reinigungsmilch, Schminktücher und ein dekoratives Hütchen als Wandschmuck.
Sie hatte nichts unbekleidet gelassen, soweit das Auge reichte. Selbst über die Tabascosoße war ein mexikanischer Riesenhut mit Poncho gestülpt, und die Weinflasche war als Pudel verkleidet. Jeden Türknauf in unserem Haus hatte sie kostümiert, dazu gab es feine Spitzendeckchen für Rückenlehnen und Armstützen jedes Sessels; die Fußbank war mit einem Afghanteppich bekleidet, auf den Tabletts lagen Sets, und sinnigerweise gab es
sogar Deckchen für Tische, die wir noch gar nicht besaßen.
Konnte ich in der Küche keinen Preis gewinnen, so glänzte Bill seinerseits gewiss nicht als Handwerker.
„Vielleicht könnten wir ein paar unserer Hochzeitsgeschenke gegen einen Hammer eintauschen“, schlug ich eines Tages vor.
„Wozu?“, fragte er scharf.
„Nun, beispielsweise, um einen Briefkasten aufzuhängen und eine Handtuchstange im Bad.“
„Ich habe nie behauptet, handwerklich begabt zu sein“, verteidigte er sich.
„Ich spreche nicht von komplizierten Maschinen, für deren Bedienung man Schutzanzüge braucht. Ich spreche von einem Hammer.“
„Mein Vater hat so was im Keller“, murmelte er.
„Es wäre auch toll, wenn du einen kleinen Bohrer hättest und vielleicht einen Schraubenzieher. Wer weiß, vielleicht könntest du eines Tages ...“
„Moment mal“, unterbrach er mich. „Jetzt sind wir bei Toms und Jeannes Pingpongballuhr, oder? Darauf läuft diese ganze Unterhaltung doch hinaus.“
Tom und Jeanne sind gute Freunde, die drei Wochen vor uns geheiratet hatten. Ihre Wohnung war sozusagen „handmade“. Die Wände waren tiefgrün gestrichen. Sie hatten alte Möbel gekauft und sie weiß und gelb lackiert. Sie rahmten Plakate und hängten sie auf, und Jeanne hatte aus getrockneten Blumen Collagen gemacht, die in der Küche hingen. Tom hatte aus aufeinander gesteckten Blumentöpfen eine Lampe angefertigt, und beide zusammen hatten Bücherborde aus Ziegelsteinen und Brettern entworfen. Aber der Blickfang schlechthin war Toms Uhr. Er hatte
die Innereien einer alten Uhr genommen und um sie herum ein Ziffernblatt aus bemalten Pingpongbällen angelegt, die an Holzdübeln befestigt waren.
„An unserer Wohnung gibt es nichts auszusetzen“, verteidigte sich Bill.
„Sie ist so gemütlich wie eine öffentliche Bedürfnisanstalt.“
„Ich habe einiges daran gemacht“, sagte er.
„Die Regalborde mit Klebefolie bezogen und einen Nagel über der Spüle für die unbezahlten Rechnungen eingeschlagen, ja. Große Dekorationsleistungen sind das nicht gerade.“
Ich glaube, unser größtes Problem war, dass wir ziemlich knapp bei Kasse waren und gänzlich unvorbereitet für die Ehe. Um ehrlich zu sein, ich hatte es mir schöner vorgestellt – und romantischer. Unsere Eltern hatten von den mageren Jahren, „arm, aber glücklich“, mit so viel Begeisterung und Gelächter erzählt, dass wir grün vor Neid darüber waren, dass wir die Wirtschaftsdepression nicht erlebt hatten.
Gelegentlich gestattete ich mir, an die Vorsätze zu denken, die ich vor dem Altar gefasst hatte – einen Bilderbuchehemann zu kreieren.
In dieser Richtung hatte es überhaupt keinen Fortschritt gegeben. Das war ziemlich entmutigend. Immer noch trug Bill seinen Bürstenhaarschnitt. Immer noch zog er mit Ed und den anderen um die Häuser. Und immer noch kam er ständig und zu allem zu spät. Ein 44-Minuten-Ei zum Frühstück war bei uns gang und gäbe.
Noch entmutigender war allerdings, dass meine Liste der Dinge, die an ihm verändert werden mussten, jeden Tag länger wurde.
Er war eine Nachteule und ich eine Frühaufsteherin. Bis
mittags schlafwandelte er. Wenn ich bettreif war, kriegte er gerade den zweiten Auftrieb.
Er wurde nicht braun. Ist es vorstellbar, dass er in den ganzen sieben Jahren, die wir miteinander gegangen waren, nie gesagt hatte, dass er das Strandleben hasst und seine irische Haut keine Sonne verträgt?
Er bewahrte seine gesamte Garderobe im Schrank auf, Sommer- und Wintersachen. Wie kann man nur die Wollklamotten neben die leichten Sommersachen stopfen? Vielleicht ist das eine Kleinigkeit, aber es geht noch weiter. Wenn zwei halb volle Müslipackungen da waren, schüttete er sie zusammen. Genauso machte er’s mit Eispackungen und Säften, so dass man nie genau wusste, was man eigentlich aß.
Zudem bemerkte ich, dass dieser Mann unfähig war, den Klodeckel runterzuklappen.
Aber der wahrscheinlich schwierigste Teil der Anpassung war der Dienstagabend.
Wir hatten uns hoch und heilig versprochen, jeden Alltagstrott in unserer Ehe zu vermeiden. Aber jetzt beteiligten wir uns jeden Dienstagabend an einem Ritual, das in seiner unerschütterlichen Vorhersagbarkeit nur noch mit dem historischen Schauspiel der Wachablösung vor dem Buckingham-Palast zu vergleichen war: Abendessen bei seinen Eltern. Sie waren nett, aber ich fühlte mich bei ihnen vollkommen eingeschüchtert. Seine Mutter war Nur-Hausfrau und trug immer Kleider oder Röcke; meine arbeitete in der Fabrik und trug Hosen. In seinem Elternhaus gab es ein Esszimmer und einen Vitrinenschrank. Meine Familie aß in der Küche, wo man vom Esstisch aus den Herd ausschalten und den Kühlschrank öffnen konnte, ohne aufzustehen. Seine Eltern waren gut zwanzig Jahre älter als meine Eltern.
Als Zugeständnis an mich legten wir unsere Besuche zeitgleich mit der Milton-Berle-Show, die ich gerne sah (Bills Eltern besaßen nämlich einen Fernseher!). Beim Betreten des Hauses hörten wir schon: „Oh, wir sind die Männer von Texaco ... wir kommen von Maine bis Mexiko ...“ Und in den nächsten Minuten passieerte dann Folgendes: Milton Berle stolzierte auf den Schuhkanten vor seinen Zuschauern hin und her, und Mutter Bombeck legte ihrem Sohn das einzige Gemüse auf den Teller, das der seit dem vorigen Dienstag gesehen hatte.
Ich fühlte mich wie Eliza Doolittle beim ersten Essen am Tisch von Professor Higgins ... und sehnte den Tag herbei, an dem alle einander zunicken und sagen würden: „Jetzt hat sie’s. Ich glaube, jetzt hat sie’s!“
Bei mir zu Hause war es so: Mein Vater hatte keine Tochter verloren, sondern mehr Schrankraum bekommen und einen Schwiegersohn, der mit Begeisterung meine Reinigungsrechnungen bezahlte. Meine Mutter, die bei meiner Hochzeit geklagt hatte, ich würde einen Mann heiraten, der „nicht gut genug für dich ist“, wandte sich jetzt gegen mich und sagte: „Er verdient zwei von deiner Sorte."
Sie überhäufte ihren neuen „Sohn“ geradezu mit Lob. Er brachte ihr einen armseligen Blumenstrauß mit, und sie sagte: „Erma hat mir nie Blumen geschenkt, von denen man nicht die Hälfte gleich hätte wegwerfen müssen.“ Sie bemitleidete den „armen Bill“, weil er „so dünn aussieht“, nichts Richtiges zu essen kriegte, und weil er einen Monat lang rosa Unterwäsche tragen musste, nachdem ein rotes Handtuch in die Kochwäsche geraten war. Kurzum, sie liebte ihn.
Psychologen und Eheberater sagen, das erste Ehejahr sei das schwierigste, wegen der gegenseitigen
Anpassung. Ich glaube, junge Ehepaare denken in dieser Zeit viel nach.
Ich, zum Beispiel, dachte manchmal an Mord. Dann überlegte ich, ob ich nicht Schwester Erma Louise im Marienkloster werden sollte. Ich erwog sogar, zu meiner Mutter zurückzugehen. (Aber wozu? Bill hätte in der Küche gesessen und mit meinen Eltern Kaffee getrunken.) Aber Scheidung? Niemals.
Wir unterbrechen diese Ehe ...
Sie war nicht mal sonderlich attraktiv. Sie war klein, farblos und hatte wenig zu sagen – aber sie konnte mit männlichem Publikum umgehen. Die Männer starrten gebannt zu ihr hinüber, wo immer sie auftauchte.
Von dem Augenblick an, als Bill sie nach Hause brachte, auf einen Schemel stellte und sich zwei Meter davor auf einen bequemen Stuhl hockte, wusste ich, dass unsere Ehe nie mehr das sein würde, was sie einmal gewesen war.
Eine Fernsehtruhe in unserem Haus! Das war wie zu dritt in einem Bett schlafen. Ich persönlich fand das dumme Ding jämmerlich, anstrengend, vereinnahmend und seicht, aber für Bill war sie die vollkommene Geliebte. Wenn er schnarchte, machte es ihr nichts aus. Wenn er mitten in ihrem Unterhaltungsprogramm einschlief, verzieh sie ihm. Wenn er es verlangte, stand sie ihm in der Nacht zur Verfügung und unterhielt ihn. Er konnte sie anmachen, indem er auf einen Knopf drückte, und abschalten, wenn ihm danach war.
Der Einfluss des Fernsehens auf die Ehen war erschreckend. Es gab keine Frau, die ihn nicht fürchtete. Die Mahlzeiten richteten sich nach dem Programm ebenso wie das gesellschaftliche Leben. Sex wurde in die Werbepausen eingeschoben. Aber unser Leben wurde am meisten durch die vermittelten Inhalte verändert.
Meine Zeitgenossinnen und ich bekamen wöchentlich
Frauen vorgesetzt, die tagaus, tagein Röcke und Perlen trugen, nie ein Klo putzten, und Männer, die nach Hause kamen, den Hund hinterm Ohr kraulten, ihren Frauen die Wange tätschelten (oder war es umgekehrt?) und in eine Jacke mit Lederflicken an den Ellenbogen schlüpften.
Unsere Rolle als Frauen wurde aber vor allem durch die Werbung definiert und bestärkt.
Die Botschaft lautete, dass wir allein die ganze Verantwortung für den Erfolg oder Misserfolg unserer Männer trugen. Wenn wir ihm kein herzhaftes warmes Frühstück vorsetzten, konnte er Verdauungsstörungen bekommen, wodurch er vielleicht seine Klienten verlor. Wenn sein Badetuch kratzte, konnte das zu Nervosität und damit zu Schwierigkeiten am Arbeitsplatz führen. Und käme, Gott bewahre!, sein Chef zum Essen, und die Gläser wären fleckig oder hätten Streifen! Er würde nie die fällige Beförderung bekommen, und auch das wäre nur unsere Schuld.
Sogar die Männer fingen an, diesen Unsinn zu glauben. Eines Tages kam Bill mit einem Hemd auf mich zu und sang vorwurfsvoll: „Liebling, der Kragen braucht eine Sonderbehandlung.“
„Warum wäschst du dir dann deinen schmutzigen Hals nicht besser?“, fuhr ich ihn an.
Ich hätte so gerne an den Alltag der Serienpaare geglaubt, an Männer, die den ganzen Tag in der Küche herumsaßen und zu ihren Frauen sagten: „Möchtest du nicht darüber reden, Joanna?“ Im wirklichen Leben hatte sich unsere Unterhaltung auf etwa sechs Wörter in der Woche reduziert. Wir stritten nicht einmal mehr. Als endlich die letzte Werbung über den Bildschirm flimmerte, hatten wir längst vergessen, worüber wir gestritten hatten. Ich
ertappte mich dabei, Fernsehfiguren wie Fran zu beneiden ... Sie hatte wenigstens zwei Puppen, Kukla und Ollie, mit denen sie reden konnte.
Die meiste Zeit jedoch verbrachte Bill vor seiner elektronischen „Geliebten“. Er saß vor oder unter dem Basketballkorb, verfolgte jede Hockeyscheibe, stand im Tor, war hinter jedem Ball her und brüllte von den Rängen herunter.
Ich hätte in einem aus Sternen gewobenen Nachthemd erscheinen können, und er hätte dagesessen, die Augen auf den Bildschirm geheftet, und nur gefragt: „Haben wir nichts mehr zum Knabbern?“
Es war idiotisch von mir, seine Aufmerksamkeit erregen zu wollen, und es blieb vergeblich. Ich erinnere mich, Jahre danach Suzanne Pleshette in einer Johnny-Carson-Show gesehen zu haben. Sie saß da, ihre Kurven sprengten fast das lange schwarze Seidenkleid, ihre Alabasterhaut verschlug einem den Atem, und sie lächelte verführerisch mit ihren perlweißen Zähnen. Und dennoch beklagte sie sich, dass sie ihren Mann nicht fünf Minuten von der Mattscheibe und dem Fußballspiel wegbrachte. Und wenn Suzanne Pleshette es nicht schaffte, sich die Aufmerksamkeit ihres Ehemannes zu erhalten, was hatte ich da für eine Chance?
Bill war nicht nur ein leidenschaftlicher Fernsehgucker, er war ein Tiefschlafglotzer.
Normale Menschen vor dem Fernseher zeigen noch irgendeine Regung. Sie freuen sich. Sie springen manchmal vor Begeisterung vom Stuhl auf. Sie nehmen Nahrung zu sich (manchmal intravenös). Ihre Augen blitzen. Aber der Tiefschlafglotzer sitzt mit geschlossenen Augen vor dem Gerät. Er befindet sich irgendwo zwischen Tiefschlaf und Tod.
Die Ehefrau betritt das Zimmer in dem sicheren Glauben,
ihr Mann schlafe. Sie beugt sich vor, um das monotone Gelaber des Ansagers abzuschalten, da schallt es aus dem leblosen Klumpen: „Lass die Programmtaste in Ruhe, sonst bring’ ich dich um.“
Was mich wirklich in Erstaunen versetzte, waren die Vorbereitungen, die Bill vor jeder Sendung traf. Er redete nur noch davon. Eine Stunde vorher rückte er seinen Stuhl vor dem Apparat zurecht, stellte sich die Brote oder das Knabberzeug hin sowie den Getränkekühler und legte den Hörer neben das Telefon. Eine Minute vor Programmbeginn suchte er die Toilette auf. Gleich nach dem Anstoß versank er ins Koma.
Für eine frischverheiratete Frau ist es schwer, damit zurechtzukommen, dass sie durch einen Apparat zu ersetzen ist. Aber so war es. Sollten wir je eine Familie werden wollen, dann würde die Empfängnis während einer Rasierklingenwerbung auf dem Fernsehsessel stattfinden müssen.
In der Weihnachtszeit schmückte ich den Fernseher mit Glitzerzeug, um ihm ein festliches Aussehen zu verschaffen. Wenn wir Besuch hatten, ließ ich vorher drei Fragen aufschreiben, damit mein Mann sie schriftlich beantworten konnte, bevor die Gäste kamen.
Worauf wir alle inbrünstig hofften, war nur eine harmlose kleine Abwechslung in unseren langweiligen Ehen. Selbst Samstagabends, wenn wir uns gegenseitig in unseren kleinen Wohnungen besuchten, hockten die Männer vor der Röhre im Wohnzimmer, und die Frauen saßen draußen in der Küche und stellten sich die große Frage: „Was ist bloß mit unseren Ehen los?“
An einem dieser Abende saßen wir beisammen und suchten eine Lösung für das Problem unserer Einsamkeit. Meine Freundin Joan erzählte von einer
hinreißenden Werbung, in der eine Frau sich eine billige Heimdauerwelle gemacht hatte, nach der ihr Haar so glanzlos und grässlich aussah, dass ihr Mann es vorzog, fortan Überstunden im Büro zu machen – da schaute ein Mann zu uns in die Küche.
Wir kannten ihn alle nicht. Wir dachten, dass er sich auf dem Weg von der Toilette zurück ins Wohnzimmer verlaufen hätte, und sagten: „Die Männer sitzen im Wohnzimmer und sehen Howard Cosell.“
„Howard wen?“ fragte er.
Wir guckten ihn ungläubig an. „Sie machen Witze. Wollen Sie wirklich behaupten, Sie hätten noch nie von Howard Cosell gehört?“
Er schüttelte den Kopf.
„Und was ist mit Bonanza?“, fragte Helen, die Augen misstrauisch zusammengekniffen.
„Wer ist das?“
Wir schnappten nach Luft.
„Wie heißen Sie?“ fragte ich schließlich und rückte ihm näher.
„Bob.“
„Sagen Sie, Bob“, fragte ich ihn, „was machen Sie an Silvester?“
„Das Wasser in meinem Wasserbett wechseln. Und danach gönne ich mir ein Essen um Mitternacht.“
„Und sonntags?“
Keine von uns machte mehr einen Atemzug.
„Fahr’ ich aufs Land und seh’ mir abends irgendwo einen Film im Kino an.“
„Und wie steht es mit dem Montag?“, fragte Charmaine.
„Da bin ich zu Hause, höre Platten, oder aber ich besuche jemanden.“
Wir konnten es nicht glauben. Da stand doch tatsächlich ein Mann, der sich nichts aus
Sport und Fernsehen machte, leibhaftig mit uns in einem Raum!
Ich war immer noch misstrauisch.
„Wir nennen Ihnen ein Wort“, sagte ich, „und Sie sagen ganz spontan, was Ihnen zuerst dabei einfällt. – Tor!“
„Garten.“
„Ecke.“
„Zimmer.“
Bob erschien zwar nie wieder zu einer Nachbarschaftsparty, aber es verging kein Tag, an dem nicht sein Name fiel.
1953 brachte uns das Fernsehen zwei große Ereignisse ins Wohnzimmer. Die New York Yankees gewannen wieder die Weltmeisterschaften, und Lucille Ball wurde wirklich schwanger und schenkte vor Millionen von Zuschauern einem kleinen Rick das Leben.
Ich hatte schon öfter Schwangerschaften in Serien erlebt, aber die künftigen Mütter traten da immer mit niedlichen Bäuchen auf, die nicht größer waren als die von jemandem, der eben ein üppiges Mittagessen verspeist hat. Für gewöhnlich hatten sie dann eine Fehlgeburt, damit sie keine langweilige Mutterrolle spielen mussten (oder damit die Produzenten kein Extrabudget für die zusätzliche Rolle eines Babys brauchten).
Aber Lucille war Wirklichkeit, auf dem Bildschirm und im richtigen Leben.
In Krankheit und Gesundheit
Es gibt Menschen, die sind dazu geboren, Kissen aufzuschütteln und kräftigende Suppen einzuflößen. Schon eine Berührung ihrer Hände lässt das Fieber sinken. Sie können es mit der Treue eines Cockerspaniels aufnehmen. Für den Kranken ist es, als befände er sich in der Hand des Allmächtigen.
Für andere Menschen ist Krankheit wie eine unangenehme Nachricht während eines Meisterschaftsspiels, oder sie erstarren – so, als kämen die Eltern zu früh nach Hause, während man gerade eine Party feiert.
Mischehen zwischen einem Mitfühlenden und einem Unduldsamen kommen nicht selten vor. Mitgefühl ist übrigens nicht notwendigerweise geschlechtsspezifisch. Gewöhnlich ist der eine Partner der Nehmer und der andere der Geber.
In unserer Ehe schaute keiner gern dem anderen zu, wenn er sich übergeben musste. Wir konnten schon mit unseren eigenen Krankheiten nicht umgehen, geschweige denn mit denen des anderen. Das hatten uns unsere Mütter immer abgenommen.
Wenn ich verkündete, meine Augen fühlten sich wie runde Rasierklingen an, im Hals hätte ich ein Brennen, meine Lippen seien spröde, wenn ich vor Fieber glühte und meinem Mann ans Herz legte, nach meinem Tod wieder zu heiraten, schaute er mich an und sagte: „Also Klartext: Du willst damit sagen, dass ich das Putzen übernehmen soll.“
Ich war nicht besser. Wenn er mir auf meinen Rat hin, einen Arzt aufzusuchen, mit der Macho-Märtyrer-Rolle kam, sagte ich: „Also gut, du wirst sterben, aber dann sag mir vorher wenigstens noch, welches Motoröl unser Wagen braucht.“
Statt uns gegenseitig mit Liebe und Fürsorge zu überschütten, neigten wir beide dazu, jede Verantwortung für die Krankheit des anderen abzulehnen. Er sagte beispielsweise: „Na, jetzt hast du also endlich deine Erkältung!“ (Als hätte ich sie käuflich erworben.)
Ich weiß nicht, ob es am Ehestress lag oder ob meine Garantiefrist schon abgelaufen war, jedenfalls entdeckten wir während der ersten Jahre unseres Eheglücks, dass ich mit der Zuverlässigkeit einer Billiguhr versagte.
Erst waren es meine Mandeln.
„Heißst das, du hast sie noch drin?“, fragte mein Mann.