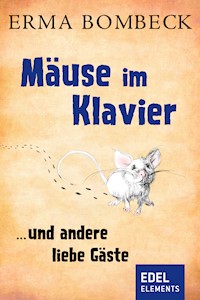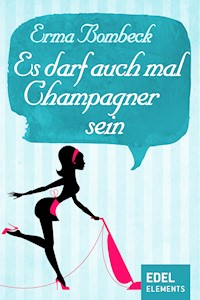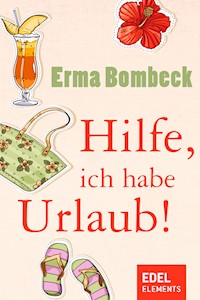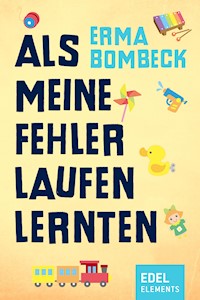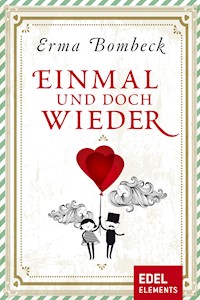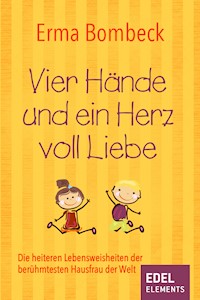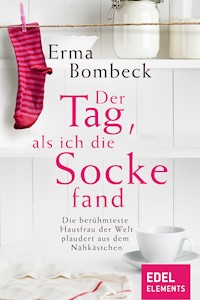
2,99 €
2,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Noch einmal bereitet Erma Bombeck ihren Leserinnen ein garantiert sonniges Vergnügen mit erprobten Patentrezepten gegen alle möglichen und unmöglichen Probleme im Familienalltag. Und für Sommernächte hält sie Sternstunden der Elternschaft bereit, von denen sie augenzwinkernd und mit unvergleichlichem Humor erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2014
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Erma Bombeck
Der Tag als ich die Socke fand.
Die berühmteste Hausfrau der Welt plaudert aus dem Nähkästchen
Ins Deutsche übertragen von Erna Tom
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel FOREVER ERMA (#1)
Edel eBooks
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel Germany GmbH
Neumühlen 17, 22763 Hamburg
Copyright © 1996 by the Estate of Erma Bombeck
Ins Deutsche übertragen von Erna Tom
Copyright First German Edition © 1998 by Bastei Lübbe
The publication of this work has been arranged by Michael Meller Literary Agency GmbH, Munich.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Jouve
Inhaltsverzeichnis
TiteleiImpressumHallo, ihr MütterKinder, KinderHausfrauenlamentoLiebe und EheEtwas zum Nachdenken
Hallo, ihr Mütter
Die Geschichte mit der Farbtube
Einmal ... nur ein einziges Mal ... wäre ich bei einem Notfall gern ordentlich angezogen.
Ich meine es nicht so, wie meine Großmutter uns immer ermahnte: »Das ist nun wirklich nicht die Unterwäsche, in der man einen Unfall haben möchte.« Ich meine nur: irgendwie bekleidet sein, damit man nicht in einem Sweatshirt mit dem Aufdruck »Eigentum der Turnerriege von Notre Dame« und in Pantoffeln in einem Krankenhausflur herumsteht.
Damit man nicht aussieht, als hätte ein grausames Schicksal den Krieg erklärt und man selbst befände sich mitten auf dem Schlachtfeld. Als ob es nicht ausreichte, dass man a) dabei ist zu verbluten, b) sich vor Schmerzen krümmt und c) vor Angst krank ist, nein, man muss auch noch befürchten, dass die Schwestern im Ostflügel Geld sammeln, um die ganze Familie an Thanksgiving zum Dinner einladen zu können.
Nehmen wir zum Beispiel diese Geschichte mit der Farbtube. Unser jüngster Sohn kletterte eines Morgens zu uns ins Bett und strahlte von einem Ohr zum anderen. Ich spürte, dass etwas nicht stimmte. Und auf meine Intuition kann ich mich verlassen, schließlich bin ich Mutter. Seine Zähne waren blau. Er hatte
in eine Tube mit Farbe gebissen. Falls Sie jetzt das Bild von einem süßen, zerzausten Lockenkopf in gestreiftem Schlafanzug vor Augen haben sollten, sind Sie auf dem Holzweg. Der Knabe sah aus, als stamme er von Werwölfen ab!
Zu seinen blauen Zähnen trug er eine Trainingshose und ein altes T-Shirt seines Vaters, das ihm bis zu den Knöcheln ging. Das war ganz gewiss nicht der richtige Zeitpunkt für eine stolz geschwellte Mutterbrust oder für die Ausrede, dass ich mit der Wäsche ein paar Jahre im Verzug bin. Wir rasten wie die Feuerwehr in die Notaufnahme des Krankenhauses, wo der diensthabende Arzt die blauen Zähne so ruhig in Augenschein nahm, dass ich schon fürchtete, dass mit meinen etwas nicht in Ordnung wäre, weil sie weiß waren.
»Was für eine Farbe?« fragte er sachlich.
»Himmelblau«, antwortete ich zitternd und deutete auf die Farbe auf seinem T-Shirt.
»Das sehe ich«, gab er etwas gereizt zurück. »Ich fragte nach der chemischen Zusammensetzung.«
Mein Mann und ich sahen einander wortlos an. Eigentlich kennen wir die chemische Zusammensetzung aller in unserem Haus befindlichen Farben in ihrem prozentualen Verhältnis auswendig, ist doch klar. Aber ausgerechnet diese eine Tube muss uns doch glatt durch die Finger geschlüpft sein.
Während man unserem Sohn den Magen auspumpte, musterten wir uns gegenseitig. Mein Mann stand in einer uralten Jeans und seinem Pyjamaoberteil neben mir. Ich trug das gestrige Hauskleid ohne Gürtel und ohne Strumpfhose und ein Tuch um mein ungekämmtes Haar. In der Hand hielt ich ein Geschirrtuch, mein einziges Accessoire. Wir sahen aus wie zwei Landstreicher,
die gerade vorbeigekommen waren, um sich eine mitgebrachte Blechdose mit Wasser zu füllen.
Es gibt noch andere Geschichten, andere Malheurs, aber die Personen sind immer die gleichen: Jedes Mal stehen wir da, ungewaschen, ungekämmt, ohne auch nur einen Cent in der Tasche, ohne Lippenstift, ohne Strumpfhose, mit verschiedenen Schuhen und dem schmutzigsten Lappen aus unserem Haushalt als provisorischem Verband.
Wer möchte da seinen nächsten Notfall nicht besser organisieren?
Bienen, Fische und Vögel
Die sexuelle Aufklärung eines Kindes ist ziemlich wichtig. Da möchte niemand etwas versäumen.
Eine schreckliche Vorstellung, es könnte mir ergehen wie der Frau in dem alten Witz, die von ihrem Kind gefragt wird, woher es komme. Nachdem sie den Vorgang in wohlgewählten Worten erklärt hat, schaut ihr kleiner Sohn sie eindringlich an und sagt: »Ich meinte ja nur. Mike kommt aus Hartford in Connecticut.«
Ich glaubte, das Problem in den Griff zu kriegen, als mein Sohn großes Interesse für Fische entwickelte. Gibt es einen besseren Weg, das Wunder der Entstehung des Lebens zu erklären als mit Beispielen aus dem Tierreich? Wir kauften also zwei Paar Guppys und ein kleines Aquarium. Das war unser erster Fehler. Wir hätten entweder vier männliche Fische und ein kleines Aquarium kaufen sollen oder vier weibliche Fische und ein kleines Aquarium oder aber zwei Paare und
einen Teich. Ich hatte schon mal etwas von Bevölkerungsexplosion gehört, aber das hier war unglaublich! Das Gespräch am Frühstückstisch verlief etwa so:
»Was gibt’s Neues in Peyton Place by the Sea?«, erkundigte sich mein Mann.
»Mrs. Guppy ist wieder g-r-a-v-i-d«, buchstabierte ich.
»Streu ein bisschen Salz ins Wasser. Das hilft garantiert«, murmelte er.
»Daddy«, warf mein Sohn ein, »das heißt, sie ist schwanger.«
»Schon wieder!«, stammelte Daddy. »Können wir nicht ein Wasservolleyballspiel in dem Aquarium organisieren oder irgendwas Ähnliches?«
Das erste Aquarium gebar sozusagen ein zweites, ohne dass Abhilfe in Aussicht gestanden hätte. »Hast du aus den Erfahrungen mit deinen Guppys etwas gelernt?«, fragte ich eines Nachmittags vorsichtig.
»Ach, sie sind so süß!«, rief mein Sohn begeistert.
»Ich meine, jetzt wo du Männchen und Weibchen beobachtet hast, weißt du jetzt, wie es zu Nachkömmlingen kommt? Hast du beobachtet, welche Rolle die Mutter dabei spielt?«
»Klar doch«, sagte er mit glänzenden Augen. »Du solltest sehen, wie sie ihre Babys auffrisst.«
Wir erstanden ein drittes Aquarium, das unverzüglich mit Salzwasser und drei Seepferdchenpaaren gefüllt wurde.
»Ich möchte, dass du das Weibchen ganz genau beobachtest«, wies ich meinen Sohn an. »Wahrscheinlich wird sie nicht mehr lange schwanger sein, und wenn du Glück hast, kannst du sogar die Geburt miterleben.«
»Aber es sind doch nicht die Weibchen, die die Kinder kriegen«, erklärte er, »sondern die Seepferdmännchen.«
Meine Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln. Vielleicht konnte ich da einer Neigung vorbeugen ... »Das ist doch lächerlich«, widersprach ich. »Es sind immer die Weibchen, die die Kinder kriegen.«
Das Männchen wurde immer dicker. Ich glaubte sogar zu bemerken, dass seine Knöchel anschwollen. Am dreiundzwanzigsten des Monats wurde es dann Mutter.
»Wirklich interessant«, meinte mein Sohn. »Hoffentlich werde ich nicht auch Mutter, wenn ich erwachsen bin. Aber wenn doch, dann kommen meine Kinder wenigstens an Land zur Welt.«
Ich hatte alles vermasselt. Ich wusste ja gleich, dass ich es vermasseln würde.
Nachbarschaftskontakte
Immer wieder höre ich Frauen sagen: »Ich pflege keine Nachbarschaftskontakte. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Dieses ewige Hin und Her und der tägliche Kaffeeklatsch mit einem Haufen tratschender Weiber!«
Tja, wer würde nicht lieber mit ein paar netten Männern plaudern! Aber man muss Kompromisse schließen, und so nehme ich mit meinen Nachbarinnen vorlieb. Und ohne die hätte ich beim Rorschachtest vor ein paar Jahren sehr schlecht abgeschnitten.
Als die Kinder noch klein waren, zogen wir in ein ziemlich abgelegenes Haus. (Ziemlich abgelegen bedeutet: Die hatten in dieser Gegend noch nie ein Rad gesehen, bevor wir die Dreiräder der Kinder auspackten!) Nachdem ich drei Tage damit zugebracht hatte, einem Fünfjährigen zu erklären, warum Vögel keinen elektrischen Schlag erhalten, wenn sie auf den Stromleitungen sitzen, einem Dreijährigen dabei zuzusehen, wie er sein weich gekochtes Ei mit den Fingern isst, und mir rund um die Uhr das Geschrei eines drei Monate alten Babys anzuhören, war ich kurz davor, alles hinzuschmeißen und mit dem Eisverkäufer durchzubrennen.
Genau da tauchte meine nächste Nachbarin auf: eine Frau, die in vollständigen Sätzen sprach, mit Messer und Gabel aß und nur bei Hochzeiten heulte. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Mit einer verzweifelten Geste schloss ich die Tür und warf mich davor, um sie am Gehen zu hindern. Sie verstand mich.
Seither habe ich solche und solche Nachbarinnen erlebt. Eine hatte ich, die hätte sich noch meine Augäpfel geborgt, wenn sie in eine Tasse gepasst und den Transport zum Grundstück auf der anderen Seite des Rasens überlebt hätten. Wenn ich die perfekte Nachbarin beschreiben müsste, würde ich es folgendermaßen tun:
1. Sie ruft nicht an, um zu fragen, warum sich Ihr Sohn dreißig Pfund Zement von ihr borgen will. Sie sagt einfach »Nein!« und verständigt die Polizei.
2. Sie kommt nicht wie Doris Day in Ihre Waschküche gerannt, um Ihnen zu erklären, dass Ihr Bleichmittel nichts tauge und Ihre Wäsche vergilbt sei.
3. Sie zieht nicht die Brauen hoch, wenn Sie sich
Kaffee, Butter und Kartoffeln fürs Abendessen bei ihr leihen, nachdem Sie eben acht Riesentüten aus dem Supermarkt ins Haus getragen haben.
4. Sie schmollt nicht hinter Ihrer Ligusterhecke, wenn Sie Kartentische und Besteck für eine Party bei ihr ausleihen, zu der Sie sie nicht eingeladen haben.
5. Sie hält es nicht für ihr gutes Recht, Ihre Verwandtschaft zu kritisieren, nur weil Sie ihr täglich stundenlang von ihr vorjammern.
6. Sie bestreitet nicht, dass sie Sie gut genug kennt, um einen Bestseller über Sie zu schreiben, aber nicht gut genug, um ohne anzuklopfen bei Ihnen einzutreten.
Zeigen Sie mir eine Frau, die nichts von nachbarschaftlichen Kontakten hält – dann zeige ich Ihnen eine, über die sich alle in der Nachbarschaft das Maul zerreißen.
Wie man Mama aufweckt
Wie ich aufwache, entscheidet normalerweise für den Rest des Tages über mein Wohlbefinden.
Wenn man mich auf natürlichem Wege aufwachen lässt, stelle ich mich den Anforderungen des Tages relativ munter und ausgeglichen. Wenn die Kinder das Aufwecken übernehmen, stehe ich missmutig und einsilbig auf und ermüde sehr schnell. (Einmal schlief ich doch tatsächlich ein, während mir der Zahnarzt eine Plombe verpasste.)
»Ich glaube, sie hört uns. Ihre Augenlider haben geflattert.«
»Wartet bis sie sich umdreht, dann alle loshusten.«
»Sie zieht sich die Decke übers Gesicht. Fang an zu husten.«
Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis eines meiner Kinder herauskriegt, dass man nur den Puls zu messen braucht, um festzustellen, ob ich nur so tue oder ob ich wirklich schlafe. Aber es wird nicht mehr lange dauern.
Als sie kleiner waren, waren sie weniger feinfühlig. Sie haben ihre nassen Finger in meine Nase, Augen und Ohren gesteckt und geflüstert: »Bist du wach?« Oder der liebe Daddy hat ein Windelpaket auf mich gelegt und gesagt: »Da ist Mamis kleiner Junge.« (Jede Mutter, die ihre Sinne halbwegs beisammen hat, weiß: Sobald aus Daddys kleinem Jungen Mamis kleiner Junge wird, ist Daddys kleiner Junge triefend nass.)
Die kindliche Phantasie versetzt mich immer wieder in Erstaunen. Einmal legten sie mir einen Hamster auf die Brust, und als ich mich im Bruchteil einer Sekunde kerzengerade aufrichtete (meine Sprechmuskeln waren vor Schreck gelähmt), fragten sie mich: »Hast du vielleicht ein bisschen Alkohol für unseren Chemiebaukasten?«
Das wahrscheinlich nervigste Wecksignal ertönte vor ein paar Wochen, als ich meine Augen ohne jede Nachhilfe aufschlug. »Die Kinder haben es doch wieder geschafft«, brummte ich. »Wie soll ich bei dieser höllischen Stille schlafen? Als es das letzte Mal so ruhig war, saßen sie in ihren ausgefransten Pyjamas draußen vorm Haus und stopften Frühstücksflocken in sich rein.« Ich machte mich auf die Suche.
Ich fand sie in der Küche über ihren Frühstücksflocken.
Kein Lärm. Kein Streit. »Geh wieder ins Bett«, riefen sie. »Wir wollen frühestens um halb zehn Mittagessen.«
Zweifellos brach da wieder einer dieser Tage an.
Wenn das Jüngste in die Schule kommt
Eine der übelsten Formen, Frauen von heute zu terrorisieren, ist die Frage: »Was werden Sie anfangen, wenn erst mal alle Ihre Kinder in der Schule sind?«
Dann entsteht das trostlose Bild einer einsamen Mutter, die ein Paar schmutzige Socken vom Boden aufliest und herzzerreißend hineinschluchzt: »Mein Baby! Mein Baby!« Einer Frau, die durch das Haus geistert, innerlich leer, die tapfer gegen die Erkenntnis ankämpft, dass sie fortan von einem Pausenbrot und einer anderen Frau ersetzt wird, die sie am liebsten verklagen möchte, weil die ihr ihr Kind entfremdet. Das Bild einer desillusionierten Frau ohne Aufgabe, die irgendwie die Zeit totschlagen muss, bis der Schulbus ihre Brut wieder am Straßenrand ausspuckt, damit sie sie in die Arme schließen kann.
Für manche Frau mag das eine realistische Vision sein, vor allem, wenn sie ohnehin nie viele Interessen hatte. Die Geburt der Kinder war die Antwort auf ihr Problem. Die Kinder waren ihre Krücke, ihr Trumpf im Ärmel, ihre Entschuldigung, um nicht vor die Tür gehen zu müssen, nach Abwechslung zu suchen, neue Freunde kennenzulernen, sich um ihre Frisur zu kümmern, mal ein Buch zu lesen oder einfach eine Frau zu sein. Sie trug ihre Kinder wie ein
Haarnetz und erzählte allen, wie sehr die Kinder sie brauchten – und im Grunde war es genau umgekehrt.
In den Ohren der meisten Frauen aber ist die Schulglocke die Glocke der Freiheit. Vorbei! Sie hat es geschafft! Zum ersten Mal seit Jahren hat sie wieder Zeit für sich selbst, Zeit, über die sie allein verfügen kann. Auch diese Frau wollte Kinder, aber aus einem anderen Grund. Sie erfüllten ihr das starke Bedürfnis zu lieben, sie zu umsorgen und sie der Welt als Vermächtnis zu hinterlassen. Nicht erfüllen konnten sie allerdings ihre Ambitionen, ihr Streben nach Individualität und ihren Wunsch, ihr Scherflein zu diesem Dasein beizutragen, auch wenn es noch so klein ist.
Ich habe Frauen gesehen, die aus dem Kokon aus Mittagsschläfchen und Erdnussbutter wie wunderschöne Schmetterlinge geschlüpft sind, die sich wieder öffentlich engagierten und sich zu aktiven Mitgliedern der Gesellschaft entwickelten, die Talente und Begabungen zeigten, mit denen sie nicht nur die anderen überraschten, die Fähigkeiten wiederentdeckten, die sie vor der Geburt ihrer Kinder besessen hatten, und die sich schließlich auch wieder um ein attraktives Äußeres kümmerten.
Allerdings habe ich auch gesehen, wie manche der Mutlosigkeit anheimfielen, vor lauter Verzweiflung zweimal die Woche den Küchenboden schrubbten und dabei immer die gleichen Sätze vor sich hin murmelten: »Ich kann nicht ... (was auch immer). Ich habe doch Kinder.«
Als Frau, die das Drama mit dem Titel »Wenn das Jüngste in die Schule kommt« überlebt hat, möchte ich Ihnen einen kleinen Rat geben. Sehen Sie ganz genau hin,
wenn Ihnen Ihr Sprössling aus dem Bus zuwinkt. Gießen Sie sich eine schöne Tasse Kaffee ein und weinen Sie mindestens fünf Minuten lang wirklich herzzerreißend. Haben Sie dann noch nicht genug gelitten, gehen Sie langsam durchs Haus und lauschen Sie der Stille. Wenn Sie wollen, können Sie dann auch noch eine Runde Schuldgefühle einlegen. (»Warum war ich den ganzen Sommer über so ekelhaft zu ihm?«)
Aber dann drücken Sie die Schultern durch, holen Sie tief Luft und sehenSie aus dem Fenster. Da draußen liegt die große weite Welt. Sie haben sie verdient! Und jetzt genießen Sie sie!
Wie man die Mutterschaft überlebt
Ich habe herausgefunden, dass eine der schönsten Entschädigungen für eine Mutter die Verwünschungen sind, die man seinen Kindern androht für die Zeit, in der sie selbst einmal Kinder haben werden. So nach dem Motto: »Warte nur, mein Kind ... du kriegst es auch noch zu spüren.«
Zu meinen frühesten Erinnerungen an dieses Menschheitsritual gehört der Tag in meiner Kindheit, als ich dabei erwischt wurde, wie ich das an der Wäscheleine flatternde Korsett meiner Mutter mit Dreck bewarf.
Zornig schüttelte meine Mutter die Faust und rief: »Deine Kinder sollen einmal eingewachsene Fußnägel haben!« Als sie merkte, dass mich das kalt ließ, steigerte sich die Verwünschung noch: »Und deine Tränen sollen so salzig sein, dass du eine Woche lang nur Lauge spuckst!«
Ich kann nicht behaupten, dass ich das alles damals verstanden hätte, aber ihrem Ton nach zu urteilen gratulierte sie mir bestimmt nicht gerade zum Geburtstag. Meine Großmutter ging ähnlich mit mir um. Manchmal, wenn meine Mutter einen schlechten Tag gehabt hatte, lächelte Großmutter still vor sich hin und sagte: »Ich hab’ es dir ja gesagt, meine Liebe: Wenn du dein Bett auf Dornen machst, musst du barfuß drübergehen.«
Oder wenn sie Mutter wirklich fertigmachen wollte, sagte sie: »Hab’ ich dir nicht prophezeit, dass deine Unterlippe eines Tages so weit runterhängen würde, dass du sie hochklammern musst?«
Während meiner Kindheit sprudelten die Weisheiten dieser Art nur so, und ich hatte oft das Gefühl, mit zwei glutäugigen Zigeunerinnen zu leben. Ermutigende Sätze wie »Ich wünsch’ dir an deinem Hochzeitstag eine Warze auf der Nase und in den Flitterwochen Sodbrennen.« Oder »Pass auf, mein Fräulein, kleinen Mädchen, die ihrer Mutter widersprechen, fällt irgendwann die böse Zunge ab!«
Nichts von alledem schien mir viel Sinn zu ergeben, bis ich selbst Kinder hatte. Verwünschungen gegen meine eigenen Kinder auszustoßen, ist mir bereits in Fleisch und Blut übergegangen. Auf keine andere Art und Weise lassen sich meine Ängste, mein Zorn und mein Frust besser bewältigen.
Und das Beste daran ist, dass die Kinder keine Silbe davon verstehen.
Ein Trick funktioniert bei ihnen einfach immer: Ich lasse die Schultern sinken, die Arme locker an der Seite hängen und nicke müde. Ich schweige so lange, bis ich mir ihrer Aufmerksamkeit sicher sein kann.
Dann lege ich los: »Wartet ... wartet nur ... bis ihr selbst einmal Mutter seid!« (Hin und wieder erinnert mich mein Sohn, der für sein Alter sehr aufgeweckt ist, daran, dass er ein Junge ist, und dass nur die weibliche Hälfte der Bevölkerung Mutter werden kann. Trotzdem versteht er. Das weiß ich.)
Verwünschungen auszustoßen ist gar nicht so einfach. Man braucht eben den richtigen Anlass, der einen auf die Palme bringt. So ging es mir vor ein paar Tagen, als ich einen Haufen dreckiger Socken in der Spielzeugkiste fand.
Ich schrie aus Leibeskräften: »Ich hoffe, ihr kriegt eineiige Zwillinge ... im Abstand von zwei Wochen! Ich hoffe, ihr kriegt eine Terrasse, die nach Norden raus geht! Euer Vater soll bei der Taufe eures Sohnes laut rülpsen.«
Und wenn sie von der Schule nach Hause kommen, fallen mir bestimmt noch weitere Flüche ein.
Ein Kostüm für die Schulaufführung
Es gibt nichts, was mich am Morgen mehr in Stimmung bringt, als ein Kind, das hysterisch schreit: »Mama! Ich brauche ein Kostüm! Wir spielen heute Theater.«
Manche Mütter haben Glück. Sie haben Kinder, die nur schöne Rollen bekommen. Ihre kleinen Mädchen spielen Märchenprinzessinnen mit Zauberstäben und Sonntagskleidchen, und ihre kleinen Buben treten als Spielzeugsoldaten auf, die aus der Spielzeugkiste eingekleidet werden können.
Aber meine Kinder nicht. Sie übernehmen die
Rolle des bösen Zahns, des sechzehnten Zusatzartikels zur US-Verfassung oder die von Mister Höflichkeit.
Der böse Zahn ging ja noch. Ich habe das Kind in ein weißes Laken gehüllt und ihm eine Rosine in den Bauchnabel gesteckt, die das Loch darstellen sollte.
Der sechzehnte Zusatzartikel war etwas komplizierter. Er regelt die Befugnis des Kongresses, eine Einkommensteuer zu erheben und einzutreiben. Wir steckten sie also in einen riesigen Anzug, drehten die Taschen nach außen und malten ihr einen Scheck auf den Mund, auf dem stand: Nicht gedeckt!.
Mister Höflichkeit war eine echte Herausforderung! Wir steckten ihn schließlich in ein Supermankostüm und empfahlen ihm zu lächeln, was das Zeug hielt.
Letzte Woche kam wieder eins der Kinder an: »Du, Mama, ich hab’ vergessen, es dir zu sagen, aber ich spiele heute in einem Theaterstück mit.«
»Nur keine Aufregung«, sagte ich gelassen. »Ich sorge für ein Kostüm. Was für eine Rolle spielst du?«
»Ich bin ein Partizip«, sagte er.
Ich stützte mich am Herd ab. »Partizip Präsens oder Partizip Perfekt?«
»Nicht doch!«, sagte er. »Ich bin nur das Partizip Präsens, Dan Freeby ist das Partizip Perfekt.«
»Wunderbar. Und was hast du dir vorgestellt?«
»Eigentlich noch nichts. Der Lehrer meinte bloß, ich müsste mich von Mike Ferrett unterscheiden.«
»Was zieht der an?«
»Keine Ahnung. Was halt Substantive so tragen.«
»Du hast recht«, sagte ich. »Wenn man ein Substantiv kennt, kennt man alle. Sieh mal, warum ziehst
du nicht einfach ein sauberes Hemd und einen ärmellosen Pullover und deine Sonntagshosen an?«
»Das ist doch blöd«, widersprach er. »Wer soll mich denn so als Partizip erkennen?«
»Und wer sollte wissen, dass du keins bist?«, gab ich zurück.
»Vielleicht hilft es dir«, sagte er, »dass ich eigentlich genauso aussehe wie ein Gerundium.«
Für den Fall, dass ich diesen Vormittag überleben würde, wollte ich mir einen starken Kaffee mit Cognac genehmigen, so viel stand fest.
Zu alt für das Mittagsschläfchen
Eine Gruppe junger Mütter stand vor Kurzem am Planschbecken und unterhielt sich über das Mittagsschläfchen ihrer Kleinen.
»Ich glaube, Lisa ist aus dem Alter raus«, meinte eine hübsche Blonde. »Sie ist jetzt zweiundzwanzig Monate und hat mir kürzlich erklärt, dass sie sich nachmittags nicht mehr hinlegen will.«
Ich wäre vor Staunen beinahe ins Becken gefallen. Wo kommen wir denn hin, wenn ein nicht einmal zweijähriges Kind seinen eigenen Zeitplan festlegt?
Bei mir ging es nie darum, ob die Kinder Mittagsschlaf halten oder nicht, sondern vielmehr darum, wann man als Mutter zu alt ist für das Mittagsschläfchen. Es kommt mir vor wie gestern, dass mich mein Sohn zu einer Entscheidung gedrängt hat.
»Muss ich heute Nachmittag wieder schlafen?«
»Ja.«
»Warum?«
»Weil ich heute morgen beim Zahnarzt eingeschlafen bin.«
»Warst du müde?«
»Langweilig war mir bestimmt nicht.«
»Kann ich spielen, solange du schläfst?«
»Nein!«
»Warum nicht?«
»Weil du immer was anstellst.«
»Was denn zum Beispiel?«
»Zum Beispiel hast du die Öffnung vom Gartenschlauch mit Kaugummi verklebt und das Wasser aufgedreht, bis der Schlauch platzte und es im Wohnzimmer eine Überschwemmung gab.«
»Nenn mir noch ein Beispiel!«
»Leg dich schlafen.«
»Kann ich was zu trinken haben?«
»Nein.«
»Schau mal, mein Fuß! Meine Nägel werden schon ganz schwarz.«
»Wie wär’s, wenn du dir die Füße waschen würdest?«
»Was passiert, wenn ich mich jetzt nicht hinlege?«
»Dann gehst du um halb sechs ins Bett.«
»Warum muss ich mich hinlegen, wenn du müde bist?«
»Aus dem gleichen Grund, aus dem ich dir einen Pullover überziehe, wenn mir kalt ist.«
»Ich bin der Einzige in der fünften Klasse, der mit verschlafenem Gesicht zur Turnstunde kommt.«
»Das ist also der Dank für eine Mutter, die jeden
Nachmittag zwei Stunden opfert, damit ihr Kind genügend Schlaf bekommt.«
Er seufzte und sagte: »Soll ich dich auf die Seite rollen, wenn du zu schnarchen anfängst?«
Er musste immer das letzte Wort haben.
Mutterblicke
Keines der bekannten Kommunikationsmittel ist so effektiv wie der Mutterblick. Oder anders ausgedrückt: Der Blick einer Mutter ist so gut wie tausend Ohrfeigen. Hier eine Auswahl, die, jeweils an die Situation angepasst, zur Standardausrüstung gehört.
Der Todesblick: Kommt bei einem Kind zum Einsatz, das man mit dem Finger in der Nase ertappt. (Er ähnelt dem starren Blick, der in der Regel angewendet wird, wenn man die Aufmerksamkeit eines Kellners erzwingen will, ist aber ein bisschen anders.) Es handelt sich um einen unerschütterlichen, unnachgiebigen Blick. Die Stirn ist gerunzelt, die Lippen sind nur noch ein Strich, nicht die Spur eines Lächelns. Die Miene verharrt in einem hypnotischen Ausdruck, bis der Finger aus der Nase genommen wird.
Der ausdruckslose Blick: Wird hauptsächlich am Abendbrottisch bei Kindern zur Geltung kommen, die ihr Glas randvoll gießen, Soße von den Fingern schlecken und sich die Backen vollstopfen. In besonderen Fällen wird dieser Blick von einem gezielten, schnellen Tritt ans Schienbein begleitet.
Der Märtyrerblick: Dieser unverkennbar schmerzerfüllte Blick wird dann angewandt, wenn ein Kind im
Mittelgang der Kirche im Trainingsanzug nach vorne schreitet oder Sie während einer Cocktailparty an die zwei Dollar erinnert, die Sie sich von ihm geborgt haben. Manchmal wird der Märtyrerblick mit dem ausdruckslosen Blick verwechselt. Sollten Sie im Zweifel sein, denken Sie daran, dass der Märtyrerblick von Tränen begleitet wird, von Beißen auf die Unterlippe, bis sie blutet, oder von Ohnmachtsanfällen.
Der verzweifelte Blick ist die Pantomime in Reinkultur. Der Kiefer ist unbeweglich, die Lippen kräuseln sich, die Augen sind zusammengekniffen und blicken drohend in alle Richtungen. Dieser Blick kommt dann zum Einsatz, wenn ein Kind ein loses Mundwerk hat und beispielsweise laut fragt, ob es wahr sei, dass Tante Helen mit einem Mann, sofern sie einen fände, nichts anzufangen wüsste. Befindet sich Tante Helen gerade im Zimmer, wenn diese Worte geäußert werden, greift eine Mutter nicht selten zu ihrem flehentlichen Blick um himmlischen Beistand.
Der flehentliche Blick um himmlischen Beistand ist ein verzweifelter Blick, bei dem sich der Kopf gen Himmel richtet, die Augen nach hinten rollen, bis nur noch das Weiße zu sehen ist, und die Lippen sich endlos in vermeintlicher Wiederholung eines Mantras bewegen.
Der vielleicht gefürchtetste aller mütterlichen Blicke ist der Nicht-Blick. Dabei handelt es sich um einen vollkommen leeren Gesichtsausdruck in Richtung eines Kindes, das mit Lehmschuhen auf dem Sofa turnt oder um zwei Uhr nachts auf einer Erwachsenenparty herumtollt. Der Blick ist leer, aber er hat es in sich. Die wohl wörtlichste Auslegung des
Nicht-Blicks stammt von einem Jungen: »Wenn die Gäste dann gehen, verdrückt man sich am besten ins Bett und tut klein und hilflos, bis sie sich wieder abgeregt hat.«
Chronischer Schreihals
Seit Präsident Nixon in seiner Antrittsrede dafür plädierte, »leise genug zu sprechen, damit wir neben unseren Stimmen auch unsere Worte hören«, habe ich Zweifel an der Angemessenheit meiner lauten Stimme.