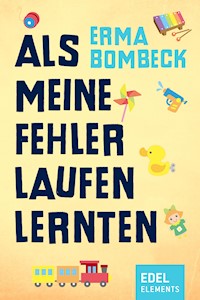
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der ganz normale Alltagswahnsinn einer viel beschäftigten Hausfrau und Mutter... Genau den beschreibt Erma Bombeck so treffend, warmherzig und witzig in ihren Büchern – zum größten Vergnügen ihrer Millionen Leserinnen auf der ganzen Welt. Jahrelang hat sich die Amerikanerin über ihren süßen, aber unentwegt streitenden Nachwuchs und über ihren liebevollen, aber grauenhaft unordentlichen Ehemann geärgert. Bis sie beschloss, sich diesen Ärger einfach von der Seele zu schreiben. Das Ergebnis ist bekannt: Von Erma Bombecks Büchern wurden weltweit viele Millionen Exemplare verkauft! Die Kinder sind aus dem Haus. Was nun? Eine Mutter zieht Bilanz und stellt fest: Wie man es auch macht, man macht es falsch – besonders bei der Erziehung derer, die uns das Liebste auf der Welt sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Erma Bombeck
Als meine Fehler laufen lernten
ins Deutsche übertragen von Isabella Nadolny
Edel eBooks
Die Familie: 1936
Das waren glückliche Jahre!
Ich hatte meine eigene Uhr, ein Dreirad und eine Haarschleife à la Shirley Temple, die fast meine ganze rechte Kopfhälfte bedeckte. Meine Mutter trug eine Schürze und Seidenstrümpfe und backte jeden Tag frisch. Sie sah aus wie Betty Crocker, ehe sie sich das Gesicht liften ließ, die Ohren durchbohrte und sich Zeug in die Haare schmierte, um sie fülliger zu machen.
Die Familie – wir alle vier – saßen im Sommer auf der Veranda und redeten über die quietschende Schaukel. Mein Vater ermahnte mich täglich, ich solle abends das Dreirad vom Gehsteig räumen, sonst würde noch jemand drüber fallen. Ich tat es nie. Meine Mutter machte tagtäglich das Wohnzimmer sauber. Wir saßen aber nie darin. Einmal knipste ich eine der Lampen an, da kokelte das zum Schutz drübergehängte Zellophan und ich bekam was auf die Finger.
Meine Mutter schnitt den Rasen und hängte jeden Tag die Leine voll Wäsche. Jeden Freitag spritzte sie die Mülltonnen mit dem Gartenschlauch aus. Im Frühling drehte sie wirklich durch – schleppte Matratzen in den Hof und montierte Stangen, um die Spitzenstores daran zu trocknen. Manchmal zog sie sich fein an, nahm Hut und Handschuhe und fuhr mit der Straßenbahn in die Stadt, ging von Geschäft zu Geschäft, bezahlte Rechnungen und 50-Cent-Raten für meine Uhr und das Dreirad.
Meine Schwester führte das große Wort und besuchte die Highschool. Sonst tat sie nichts. Ich dagegen war irrsinnig beschäftigt, ging zur Schule und bediente alle, rannte zehntausendmal pro Tag für Mutter zum Kaufmann, und wenn das Gefäß unter dem Kühlschrank sich mit Schmelzwasser füllte, dann gab es nur einen, du weißt schon wer, der es leeren mußte, ohne einen einzigen Tropfen zu verschütten.
Eines Morgens stand mein Vater nicht auf, um zur Arbeit zu fahren. Er kam ins Krankenhaus und starb am Tage darauf. Noch nie hatte ich so viel an ihn gedacht. Er war einfach jemand gewesen, der wegfuhr und heimkam und sich zu freuen schien, wenn abends alle da waren. Er konnte das Glas mit den Mixed Pickles aufschrauben, wenn kein anderer es konnte. Er war der einzige im Hause, der sich nicht fürchtete, allein in den Keller zu gehen.
Er schnitt sich beim Rasieren, aber niemand machte Heile-Heile-Segen darüber oder regte sich auf. Es war ausgemachte Sache, daß er bei Regen den Wagen vorfuhr. Wenn jemand krank war, fuhr er mit dem Rezept zur Apotheke. Er fotografierte, war aber nie mit auf dem Bild.
Wenn ich mit meinen Puppen spielte, hatte die Mutterpuppe immer viel zu tun. Was ich mit der Vaterpuppe anfangen sollte, wußte ich nie so recht, daher ließ ich ihn immer nur sagen: »So, und jetzt muß ich zur Arbeit!« und warf ihn unters Bett.
Die Trauerfeier war bei uns im Wohnzimmer, es kamen viele Leute und brachten alles mögliche Gute zum Essen, auch Kuchen. Noch nie hatten wir soviel Besuch gehabt.
Ich ging in mein Zimmer und tastete unter dem Bett nach der Vaterpuppe. Als ich sie gefunden hatte, staubte ich sie ab und legte sie auf mein Bett.
Er hatte doch nie etwas getan. Ich hatte nicht gewußt, daß es so weh tun würde, wenn er verschwand.
Am Tag nach der Beerdigung kamen die Gläubiger und fuhren den Kühlschrank, den Wagen und die Möbel des Wohnzimmers ab, in dem nie jemand gesessen hatte.
Großmama kam und sagte, sie nähme uns alle zu sich nach Hause, damit wir wieder »eine Familie« wären. Die Familie wurde dadurch größer und sehr viel merkwürdiger. Da waren Mutters Schwester und ihr Mann und ihre beiden Kinder, ein Bruder, der den ganzen Tag Poolbillard spielte, und dann noch eine Schwester, die Rollschuh fuhr und demnächst heiraten sollte. Außerdem gab es meinen Großvater, der nie eine Linkskurve nahm und den Wagen mit Speck polierte.
Großmama trug eine Schürze und machte tagtäglich im Wohnzimmer sauber, in dem nie jemand saß. Die Küche war der einzige Raum des Hauses, der Heizung hatte und auch das nur, wenn der Backofen brannte. Ich pflegte auf dem Stuhl zu stehen, um warm zu werden und blickte auf alle herab, die sich wegen Geld stritten.
Meine Mutter fand eine Stellung. Niemand in meiner ganzen Klasse hatte eine Mutter, die jeden Morgen zur Arbeit fuhr. Ich erzählte es keinem, nur meiner besten Freundin. Sie verzankte sich dann mit mir und verbreitete es in der ganzen Schule.
Im Jahre 1938 sagte meine Mutter: »Jetzt werden wir wieder eine Familie« (»wieder«, sagte sie!) und stellte uns einem Stiefvater vor. Ich war das einzige Mädchen in Nordamerika mit einem Stiefvater. Ich riskierte nicht, es jemand zu erzählen, nicht einmal meiner besten Freundin.
Mein Stiefvater und ich sprachen längere Zeit nicht miteinander. Ich glaube, er war ein Mensch, der nicht wußte, wie man Liebe zeigt. Ich erinnere mich, wie er mir beibrachte, ein zweirädriges Fahrrad zu fahren. Ich bat ihn, mich nicht loszulassen, aber er sagte, es würde Zeit. Ich stürzte und Mom kam gelaufen und wollte mich aufheben, aber er winkte ihr, zurückzubleiben. Ich war so wütend, daß ich es ihm zeigen wollte. Ich stieg sofort wieder auf und radelte allein weg. Er genierte sich nicht einmal. Er lächelte nur.
Wenn ich wieder ins College mußte, blieb er beim Abschied nicht stehen, um sich noch ein bißchen zu unterhalten wie Mom, er wuchtete nur fünfzehn Gepäckstücke in den dritten Stock hinauf und schien irgendwie beklommen.
Wenn ich zu Hause anrief, tat er immer so, als wolle er mit mir reden, sagte aber nur: »Ich hol deine Mutter.« Mein Leben lang hackte er auf mir herum: ›Wo willst du denn hin? Wann kommst du heim? Hast du auch Benzin im Tank? Wer kommt denn sonst noch? Nein, du kannst nicht hingehen.‹
Es dauerte lange, ehe ich merkte, daß das Liebe war.
Meine egoistische Mutter machte Karriere an einem Fabrikfließband und stellte Gummidichtungen für die Autotüren bei General Motors her. Die Lebensaufgabe meines Stiefvaters bestand darin, mich zu zwingen, im Bad die Handtücher aufzuheben und das Licht auszuknipsen.
Ich konnte es kaum erwarten zu heiraten, von zu Hause wegzuziehen und meine eigene Familie zu haben: Mit einem Wohnzimmer, in dem nie jemand saß.
Die Familie: 1987
Freitag, 17 Uhr
Ganz ohne Grund benahm ich mich wie eine lampenfiebrige Gastgeberin: ordnete Falten in den Vorhängen, schob Stühle unter den Tisch und rutschte auf dem Hosenboden über den Couchtisch, um den Staub auf eine Stelle zu übertragen, auf die fast nie mehr jemand blickte.
In wenigen Minuten würde die Ruhe von drei erwachsenen Kindern unterbrochen werden, die übers Wochenende heimkamen: es sollte das traditionelle Familienfoto für die Weihnachtskarte aufgenommen werden.
»Sind sie schon da?« rief mein Mann und balancierte sein Stativ und seine Kamera.
Ich schüttelte den Kopf und ging rasch ins Wohnzimmer, wo ich das Licht anknipste. Es war so, wie ich es in Erinnerung hatte: die weißen Sofas einander gegenüber, der unbenutzte hochflorige Teppich, die prallen Kissen, deren Ecken zipfelten wie frische Meringen.
»Was riecht denn da so?« fragte mein Mann und zog beim Betreten des Zimmers die Schuhe aus.
»Das Zellophan auf den Lampenschirmen. Wo sie nur bleiben?«
»Sie«, das sind zwei Söhne und eine Tochter, empfangen in Leidenschaft, erwartet mit Sodbrennen und aufgezogen mit Liebe. Gene, Chromosome und der Nachname sind uns gemeinsam. Wir haben nie die gleichen Frühstücksflocken gegessen, die gleichen Fernsehsendungen gesehen, die gleichen Menschen gern gehabt oder die gleiche Sprache gesprochen. Warum sollten sie nicht zu spät kommen – in dreißig Jahren hatten wir nie die gleiche innere Uhr.
War bei mir alles auf Waschen, Bügeln, Einkaufen, Kochen und Dauertrab eingestellt, waren sie auf Dauerschlaf programmiert und danach weg. Stand bei mir der Schlaf der Erschöpfung auf dem Programm, dann bei ihnen Drehwurm-in-der-Wiege, Disco-Musik und Moto-Cross-Rennen im eigenen Garten.
Selbst als sie größer wurden: ging ich ins Bett, gingen sie aus. Stand ich zum Frühstück auf, kamen sie eben heim. »Wie hast du überhaupt fertiggekriegt, daß sie herkommen? Du weißt doch, wie sehr sie das Fotografiertwerden hassen.«
»Ich hab ihnen gesagt, wir wollten unser Testament verlesen.« Mich wunderte nur, warum wir uns die ganze Mühe überhaupt machten.
Das vorjährige Weihnachtsfoto zeigte eines unserer Kinder auf dem Sofa mit Schlips und Sportjackett, aber ohne Schuhe. Unsere Tochter blickte genau in die Kamera, aber mit geschlossenen Augen, und der andere Sohn hing mir über die Schulter und hatte eine Temperatur von mindestens 39,2. Der Hund leckte sich an einer unappetitlichen Stelle, und wir alle – mit Ausnahme des Hundes und unserer Tochter – richteten unsere Blicke auf ein Knie meines Mannes, das mit aufs Bild geraten war.
Es war kein Bild, wie man es an einem hohen kirchlichen Feiertag gern anschaut.
Warum nur waren wir nicht wie unsere ehemaligen Nachbarn, die Nelsons? Jedes Jahr bekamen wir eine Weihnachtskarte von ihnen, darauf war die ganze Familie vor dem Kamin versammelt, in Skipullovern und mit Jacketkronen-Lächeln.
»Hast du mit unserem Sohn in Los Angeles gesprochen?«
»Ich habe ihm was aufs Band gesprochen«, sagte ich.
Um genau zu sein, hatte ich seit über drei Jahren nicht mehr mit meinem Sohn persönlich gesprochen. Ich hatte auf seinen Anrufbeantworter gesprochen und er auf meinen Anrufbeantworter, und manchmal unterhielten sich auch unsere Anrufbeantworter miteinander. Ich würde es nicht jedem anvertrauen, aber sein Anrufbeantworter und ich haben eine weit innigere Beziehung zueinander als wir. Sein Automat hat so gute Manieren. Wenn ich anrufe, sagt er leise: »Tach. Ich bin gerade nicht da, aber wenn Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer hinterlassen, rufe ich Sie an, sobald ich kann. Beim Piepston haben Sie noch zehn Sekunden. Einen schönen guten Tag noch.« Mein Sohn würde das nie sagen.
Der Automat war so nett, daß ich es nicht übers Herz brachte, zu sagen was ich hatte sagen wollen: »Du Miststück, ich liege schon dauernd angstvoll auf den Knien, und du findest nicht einmal die fünf Minuten Zeit, um deine Mutter anzurufen.« Ich sagte daher schließlich nur: »Ich weiß, mein Lieber, du hast viel zu tun. Ich wollte bloß mal kontrollieren, ob du noch lebst. Ich hatte heute fast keine Schmerzen. Dir auch einen schönen guten Tag.«
Es würde nett sein, die Familie mal wieder versammelt zu sehen, zusammenzusitzen und alte Erinnerungen aufzufrischen, Wissenswertes über ihr Leben in Erfahrung zu bringen, vor Augen zu haben, was wir ihnen als Vermächtnis hinterließen ... gewissermaßen das Denkmal unserer eigenen Unsterblichkeit.
Meine Träumereien wurden vom Geräusch zuknallender Autotüren unterbrochen. Unser älterer Sohn stieß die Tür auf. »Jemand zu Hause?« (Ich konnte es nicht ausstehen, wenn er mir genau in die Augen sah und diese Frage stellte.) Er trug ein zerknautschtes Jackett mit bis zum Ellbogen hinaufgeschobenen Ärmeln, ein Hawaii-Hemd und Ballonhosen, die weiße Knöchel und nackte Füße freiließen.
Sein Vater wandte sich an mich und sagte: »Um Himmelswillen, Erma, hast du denn deinem Sohn nicht gesagt, daß wir ein Familienporträt für die Weihnachtskarte machen wollen?«
»Aber dazu bin ich doch gekommen«, sagte er.
»Und warum hast du dich dann nicht rasiert?«
»Hab ich ja, erst vor paar Stunden.«
»Hast du auch eine Klinge eingelegt?«
»Aber ja, es sind frische Stoppeln. Ich will aussehen wie aus ›Miami Vice‹. Sag bloß nicht, daß du die nicht schon früher bemerkt hast.«
»Klar habe ich sie schon früher bemerkt, bei Erntearbeitern und Reisenden, deren Gepäck drei Wochen lang verlorenging.«
»Dad, so was ist sexy. Es gibt einem den gewissen ›Eben-aus-dem-Schlafsack‹-Look. Das wirst du doch noch wissen. Hallo, Mom. Ich fahr rüber zum Strand und leg mich noch ein bißchen in die Sonne. Kannst du derweil mein Haustier übernehmen?«
»Ich brauche keinen weiteren Hund. Ist er stubenrein?«
»Mom, ich würde dir doch nichts dalassen, was nicht stubenrein ist. Er ist schon da, samt Futter und allem. Überhaupt kein Stress, Liebes.«
»Du weißt doch, was unsere Nachbarn von bellenden Hunden halten.«
»Ich versprech dir, dieses Tier wird nicht bellen. Ich tu es in den Wirtschaftsraum. Sein Futter steht neben dem Toaster.«
In diesem Augenblick stieß sein Bruder die Haustür auf.
»Na, hoffentlich bist du nun zufrieden«, verkündete er matt. »Ich bin erkältet.«
Meine Augen trübten sich und ich nahm ihn in den Arm. »Es ist wundervoll, daß du da bist. Wie lange kannst du bleiben?«
»Das kommt drauf an, wie lange es dauert, so viel Wäsche zu waschen«, sagte er und schob mir seinen Koffer hin. »Alles, was ich besitze, ist schmutzig.«
Dann begrüßten wir unsere Tochter.
Sie erwiderte unsere Begrüßung mit: »Mein Getriebe klingt irgendwie komisch.«
Und dann kam der große Augenblick. Mein Mann fing an, ihre Gestalten über das Sofa zu drapieren, und blickte dann in den Sucher.
»Na, wie sieht es aus?« fragte ich.
»Wie eine Gruppe illegaler Einwanderer vor dem Verhör. Wieso bist du im Tennisdreß?« fragte er unsere Tochter.
»Weil ich Tennis spiele«, sagte sie trocken. »Ich wußte ja nicht, daß Abendkleidung verlangt wird.«
»Es wird eine Weihnachtskarte, Himmel noch mal. Geh und zieh dir was Passendes an. Los, Jungens, haltet euch gerade!«
»Tu ich ja«, sagte unser Sohn. »Ich hab bloß keine Schuhe an.«
»Dann stell dich hinter deine Mutter. Nein, das geht auch nicht. Der Atompilz auf deinem T-Shirt quillt genau aus dem Kopf deiner Mutter. Mein Gott, was soll überhaupt dieses Anti-Atomkraft-Ding?«
»Es war das einzige T-Shirt, das noch sauber war.«
»Geh und hol dir eins von meinen Hemden. Wo ist wieder deine Schwester hin?«
»Sie wäscht sich die Haare.«
»Dauert das lange?«
»Du, der da hat Schweißfüße.«
»Wo ist der Hund? Wir können kein Bild ohne Harry drauf brauchen.«
»Drängel doch nicht andauernd!«
»Widerling!«
Die Familie. Wir waren ein Häufchen komischer Käuze, die durchs Leben stolperten, Krankheiten und Zahnpasten teilten, dem anderen den Nachtisch neideten, Shampoo versteckten, Geld borgten, sich gegenseitig aus unseren Zimmern aussperrten, einander Schmerzen zufügten und sie im gleichen Moment durch ein Küßchen stillten, lachend, sich rechtfertigend und bemüht, den gemeinsamen Nenner zu finden, der uns verband.
Als ich so dasaß, dachte ich darüber nach, wie doch die Jahre zu Zerreißproben für die Familien geworden waren, von denen man meinte, sie würden sie nie bestehen.
Alles haben sie ausgehalten, Kombinationen von Stief-, Pflege-, Ersatz- und Einzelerziehern, eingefrorene Embryonen, Samenbanken, alles. Sie haben sich erweitert, geteilt, verteilt und zu Kommunen zusammengeschlossen. Die Technologie hat sie angefressen, die sexuelle Revolution ihnen zugesetzt, der Rollentausch sie verwirrt. Und doch gibt es noch immer Familien – im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses.
Die Meinen fanden sich nach und nach wieder zusammen, mit nassen Haaren, in geborgtem Hemd und in nicht passenden Schuhen. Als ich mich gerade bemühte, dem Augenblick eine gewisse Würde zu verleihen, fragte meine Tochter: »Mom, wieso hast du eine Schlange im Wirtschaftsraum?«
Die Kamera klickte. Das traditionelle Weihnachtsporträt der Familie war für ein weiteres Jahr im Kasten. Der eine Sohn saß im gleichen Sportjackett wie voriges Jahr da, und mit den gleichen nackten Füßen. Der andere verzog gerade das Gesicht, weil er mir aus dem Mundwinkel zuraunte, er müsse jetzt gleich brechen, das Flugzeug habe Verspätung gehabt und er heute noch nichts im Magen.
Der Hund leckte sich an der gleichen unpassenden Stelle wie voriges Jahr. Die Augen unserer Tochter suchten die verwischte Gestalt ihres Vaters, der versuchte, sich noch schnell dazuzustellen, ehe der Auslöser klickte. Meine Lippen formten gerade ein Wort, das mit Seh... beginnt, und dabei wollte ich nur »schrecklich« sagen, aber auf dem Foto kann man das nicht unterscheiden.
Gleich nach der Aufnahme fing das Gedrängel an und endete erst, als eines der Kinder am Boden lag. Dafür fühlte sich ein anderes verpflichtet, mir mitzuteilen, sein Bruder sei bestimmt über die Sauce gekommen, der täte immer Käse an alles, das röche man. Uralte Echos erklangen erneut, etwa »Du, das sag ich Mom aber ...« Und die Geschichten wurden wieder wach und flossen erneut. Geschichten von damals, als sie den Babysitter aussperrten in den Schnee. Und von damals, als das Aquarium im Schlafzimmer Feuer fing. Und von der Schüleraufführung, bei der einer von ihnen hilflos steckengeblieben war und davon, daß derjenige, der zum Geschirrspülen dran war, auf die Teller spuckte.
Alle waren sie aus ihren höchstpersönlichen Leben zurückgekehrt, aber in dem Augenblick, in dem wir wieder zusammen waren, öffneten sich die Schleusen der Vergangenheit und wir glitten in die bequemen Rollen als Familienmitglieder.
Eine nach der anderen erstanden die Geschichten der schönen Zeit wieder, die uns gemeinsam war. Wir müssen glatt fünf oder sogar zehn Minuten zusammengesessen haben.
Hab Vertrauen zu mir, ich bin doch deine Mutter
Freitag, 18 Uhr 30
Mutter kam aus der Garage rückwärts in die Küche und jonglierte mit ihrer Handtasche, einer Einkaufstasche und einer großen Hutschachtel.
»Hier riecht es aber gut«, sagte sie und stieß mit dem Fuß die Tür hinter sich zu.
»Zwiebel im Müllzerkleinerer«, sagte ich. »Du hättest keinen Nachtisch mitzubringen brauchen.«
»Weiß ich. Leg das auf einen Teller, dann kann ich die Schachtel wieder mitnehmen, danke.«
Sie hob den Deckel. »Na, riecht das nicht köstlich?«
»Riecht nach Fruitcake. Ich hasse Fruitcake.«
»Ich begreife dich nicht«, sagte sie. »Dein Großvater war ganz wild auf Fruitcake.«
»Was hat das mit mir zu tun?«
»Er hat dich so lieb gehabt. Du warst sein Liebling. Allein die kandierte Ananas hat 6 Dollar gekostet.«
»Ich hasse Ananas, Mutter.«
»Das Rezept stammt von deiner Tante Elly. Die mochtest du doch immer so gern.«
Die Unterhaltung war idiotisch, und ihr Verlauf lag fest. Warum gab ich nicht einfach zu, daß Menschen, die gern Fruitcake essen, »anders« sind. Ich wäre nicht überrascht, wenn Fruitcake-Anhänger die nächste größere Religionsgemeinschaft des zwanzigsten Jahrhunderts gründen würden.
Ich habe noch nie im Leben einen Fruitcakebackenden kennengelernt, der mich nicht zum Glauben aller Fruitcake-Fans hätte bekehren wollen. Ich konnte in Mutters Küche stehen und ohne eine Spur von Humor verkünden: »Ich mag keinen Fruitcake. Ich habe Fruitcake nie gemocht. Ich habe über 10 000 verschiedene Arten durchprobiert und es ist mein Wunschtraum, nie wieder eine probieren zu müssen.« Nur um zu erleben, wie Mutter eine Scheibe vor mich hinstellte und sagte: »Versuch mal den, der ist ganz anders.«
Fruitcake ist nie »anders«. Er ist sich mehr oder weniger immer gleich, birgt unweigerlich ein Sortiment unverträglicher kandierter Früchte im Inneren und zeichnet sich dadurch aus, daß er gewichtiger ist, als der Herd, in dem er gebacken wurde. Außerdem widerspricht er allen Regeln kulinarischer Kriterien. Nie heißt es: »Dieser Fruitcake ist so leicht, daß man ihn beim Essen gar nicht wahrnimmt.«
Weil nämlich Fruitcake gar nicht schwer genug sein kann. Und noch etwas, was ich an Fruitcake-Fans hasse, wenn man ihren Kuchen ablehnt, lächeln sie. Leute, die so etwas tun, mag ich nicht. Es ist unnatürlich. Es wäre mir angenehmer, wenn sie rundheraus sagten: »Na, denn nicht, liebe Tante. Es hat mich 45 Dollar gekostet, ihn herzustellen und könnte ich, wie ich wollte, ich würde ihn dir, du undankbares Geschöpf, auf den Fuß fallen lassen.«
Vor einem solchen Menschen empfände man Respekt. Doch nein, Fruitcake-Fans stellen sich neben einen, sehen zu, wie man sich das Probierstück in die Hand spuckt und sagen: »Aber saftig ist es, was?«
»Du bist eigensinnig«, sagte Mutter und verlagerte den Beton-Kuchen auf eine Platte. »Meinem Schwiegersohn wird er schon schmecken.«
Das war übrigens eine der größten Überraschungen meines Ehelebens gewesen. Der Mann, der bei der Hochzeit noch »nicht gut genug für mich« gewesen war, hatte sich inzwischen zu etwas gewandelt, was »doppelt soviel wert« war wie ich. Das hätte ich mir nie träumen lassen, daß sie einmal gegen mich Partei ergreifen würde. Schließlich sollten Mütter doch treu zu ihren Kindern halten, im Recht oder im Unrecht.
Es war anders gelaufen. Mein Mann brachte ihr bei irgendeiner Gelegenheit einen Blumenstrauß und sie sagte: »Erma hat mir nie Blumen mitgebracht, die man nicht abzustauben braucht.«
Und wenn wir gemeinsam ins Auto stiegen, sagte sie: »Ich bin noch nie auf dem Beifahrersitz gesessen. Erma hat immer gesagt, wenn ich das Fenster runterkurbele, wird mir hinten auch nicht schlecht.«
Als dann die Kinder kamen, stellte sie ihr Verbleiben im Familienverbund auf eine Zerreißprobe. Ich kratzte eines Abends eben Essensreste von den Kindertellern in den Mülleimer, da fragte mein Mann: »Willst du denn nichts davon aufheben?«
Ich erwartete Hilfestellung von Mutter. Sie aber sah mich an, als sei ich etwas, was leider nicht in die Falle unterm Spültisch gegangen war, und sagte: »Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Ich habe sie weiß Gott dazu erzogen. Aber wir konnten ihr ja nie beibringen, den Pfennig zu ehren. Wenn sie hinausmüßte und Geld verdienen, so wie du, wäre sie vielleicht sparsamer.«
Seit Jahren hat sich mein Mann immer wieder anhören müssen, wie eigensinnig ich bin, wie ich dazu neige, mehr Geld auszugeben als ich habe, wie launisch ich bin, wie wenig geduldig, wie unfähig, etwas fertig zu machen, wie rasch mein Interesse verfliegt und wie wenig Ziele ich im Leben habe. Ich habe oft daran gedacht, »heim zu Muttern« zu ziehen, aber wozu? Mein Mann wäre ja schon dort gewesen – beim Fruitcake-Essen.
»Du bist also fest entschlossen, daß Thanksgiving* bei dir gefeiert wird?« fragte ich. »Wir haben es den Kindern schon gesagt, sie freuen sich darauf.«
»Aber ja, es sei denn, ihr wolltet es gern bei euch machen?«
»Mutter«, sagte ich, »ich weiß doch, daß du es herrlich findest, dich inmitten deiner Familie abzustrapazieren ... mit deinem besten Geschirr und all den Aufregungen im letzten Moment. Außerdem kann kein Mensch außer dir einen Puter so braten, daß er aussieht wie aus dem Bilderbuch. Ich weiß nicht, wie du das Jahr für Jahr fertigbringst.«
Mutter lächelte, in eigene Gedanken versunken.
Erma zieht mal wieder die Nummer »Oma genießt das« ab, wie jedes Jahr! Was ist da schon zu genießen? Warum glauben die eigentlich, eine fünfundsechzigjährige Frau stünde gern um 4 Uhr auf, ränge mit einem nackten Puter, stünde gern über einem Toaster und versuchte, altbackenes Brot in frische Fülle zu verwandeln, und verbrächte zehn Stunden damit, eine Mahlzeit zu kochen, die in zwölf Minuten verschlungen ist. Sie hat es leicht, sie braucht nur eine Tüte Paprika-Chips und vier Klappstühle mitzubringen.
Und was den Puter »wie aus dem Bilderbuch« betrifft: Alle glauben, ein Puter sei ein kollernder Spaßvogel. Wenn sie einen brieten, würden sie ihn als das erkennen, was er ist, ein boshafter, leicht beleidigter, rachsüchtiger alter Kerl, der es »einem schon noch heimzahlen wird«. Kein Mensch begreift, daß ein Puter erst dann gar ist, wenn es ihm paßt. Ich habe schon Fünfundzwanzigpfünder gehabt, die in zwei Stunden durch waren, noch ehe die Pasteten ausgekühlt, die Kartoffeln und Gemüse gar, die Preiselbeeren kaltgestellt, ja noch ehe die Gäste von daheim losgefahren waren.
Und ich habe Zehnpfünder gehabt, die acht Stunden im Rohr waren und immer noch aussahen, als tranchiere man rohen Schinken. Manchmal fragt man sich, ob sich das erste Thanksgiving in Massachusetts wirklich als so religiöses Fest abgespielt hat, wie die Kinderbücher es schildern. Die Abbildungen sehen immer so idyllisch aus: Indianer umarmen die Weißen, alles ist Frieden und Harmonie. Ich kann nicht glauben, daß nicht irgendwo eine Hausfrau verärgert geäußert hat: »Wenn der Fliehende Hirsch seine stinkende Pfeife rauchen will, soll er dazu gefälligst hinausgehen.«
So machte Erma es ja auch immer an Weihnachten mit den Spielsachen, bis ich sie durchschaute. »Warum läßt du die Bongo-Trommeln nicht bei Großmama«, pflegte sie zu sagen, »dann hast du was zum Spielen, wenn du zu Besuch kommst.«
Diese Trommeln klangen nämlich wie tausend Kamele, die einem über die Augenlider trampeln.
»Ich habe deine Cousine Marie und ihren Mann zu Thanksgiving eingeladen«, sagte Mutter. »Deine Geschirrtücher könnten übrigens einen Schuß Chlorbleiche vertragen.«
»Ich dachte, mit der sprichst du nicht mehr, weil ihre Tochter dir nie für das Etui mit Füller und Bleistift gedankt hat, das du ihr zum Abitur geschickt hast.«
»Sie hat dann schließlich doch eine Briefkarte geschrieben«, sagte sie. »Außerdem kann ich niemand lange böse sein.«
Richtig. Und wenn man daran glaubt, dann glaubt man auch, daß Nancy Reagan jeden Freitagabend »Falcon Crest« sieht. Meine Mutter hat die Rache zu einer Kunstform erhoben. Jedes Jahr beim Familientreffen erfragen wir bei ihr, wer gerade in Ungnade gefallen ist und mit wem wir sprechen dürfen.
Die Länge ihrer Verurteilung hängt von der Schwere des Vergehens ab.
»Du bist nicht ans Telefon gegangen, als ich anrief, weil du genau wußtest, daß ich es bin.« (Vier Jahre!)
»Du hast mir nie die drei Dollar wiedergegeben, die ich dir bei Margarets Beerdigung für Blumen vorgestreckt habe.« (Achtzehn Jahre!)
»Ich war die letzte, die erfuhr, daß du in der Hoffnung bist.« (Zwei Jahre!)
»Als du dir meine Fotoalben anschautest, war das Bild von Vater noch drin. Als du weggingst, war es verschwunden!« (Fünfundzwanzig Jahre!)
»Du weißt ja, was ich meine!« (Der gefürchtete Groll auf Lebenszeit!)
Ich weiß noch, daß ich zu einem Familientag kam, zu dem man ein Programm gebraucht hätte, um zu wissen, auf welcher Seite des Picknicktisches man sitzen sollte. Ich trat zu meiner Cousine Doris und fragte: »Sprechen wir dieses Jahr miteinander?«
»Ich glaube nicht«, sagte sie.
»Und warum nicht?«
»Ich habe deiner Mutter seinerzeit keine Einladung zu Robbies Taufe geschickt.«
»Und wie alt ist Robbie jetzt?«
»Sechsunddreißig.«
Ich nahm meinen Teller und wollte weiterrücken.
»Und was ist mit Estelle? Spreche ich mit der?«
»Nicht, solange sie die Backform nicht wiederbringt, die deine Mutter ihr vor zwanzig Jahren mitgegeben hat.«
»Ich freue mich auf Marie«, sagte ich zu Mutter. »Ich habe sie nicht mehr gesehen seit dem Familientag, an dem sie sich den letzten Picknicktisch im Schatten aneignete.«
Mutter hob ruckartig den Kopf. »Ach, das war Marie?«
»Vergiß es. Wahrscheinlich hab ich es verwechselt«, sagte ich hastig. »Na, und wie genießt ihr beiden Liebesleute Papas Pensionierung?«
»Ach, es ist wundervoll«, sagte sie. »Gestern hat dein Vater den Dunstabzug in der Küche saubergemacht und morgen entkalkt er mir den Teekessel.«
»Und was hat er heute getan?«
»Er hat mir beigebracht, mit gespreizten Beinen zu gehen, damit auf dem Dielenläufer nicht immer nur die Mitte abgetreten wird.«
»Und wir glaubten uns schon Sorgen machen zu müssen, ihr beide könntet euch auf die Nerven gehen!«
Wenn meine Tochter einen Funken Vernunft hätte, würde sie sich Sorgen machen. Ich könnte Bücher schreiben über Nerven. Möglicherweise eine Art Fibel zum Ausmalen, für die Frauen aller in Pension gegangenen Ehemänner der Welt.
Siehe Jim.
Jim ist früher herumgelaufen und gesprungen und hinter Kunden hergejagt. Jetzt bleibt Jim zu Hause. Er hat eine neue Uhr und sagt einem die Zeit, auch wenn man sie gar nicht wissen will. Es ist Zeit aufzustehen.
Es ist Zeit, den Ölfleck von der Einfahrt wegzuputzen, ehe man ihn im ganzen Haus herumtritt.
Es ist Zeit, die Gewürze alphabetisch zu ordnen.
Es ist Zeit zum Essen (Lunch, Dinner, Frühstück, Brotzeit, Imbiß, Party).
Manchmal benimmt sich Jim wie ein Logierbesuch.
»Wo hast du die Gläser für Eistee?«
»In der Toilette in der Diele ist kein Papier mehr.«
»An der Tür ist jemand, der etwas verkaufen will.«
»Ich würde das Geschirr ja wegräumen, aber ich weiß nicht, wo alles hingehört.«
Manchmal benimmt Jim sich, als habe er einen für einen Sommerjob engagiert.
»Wer war denn am Telefon und was wollte er?«
»Wo gehst du hin und wann kommst du wieder?«
»Ich glaube, der Rasen kann keinen Tag länger warten.«
Männer, die in Pension sind, wie Jim, rationalisieren den Haushalt, nach dem Motto: es ist billiger, sich die Teebeutel selber zu machen als sie fertig zu kaufen.
Heiz doch nicht das Rohr für eine einzige gebackene Kartoffel. Mach ein ganzes Dutzend und frier sie ein.
Siehe da! Jim schlägt neben der Haustür einen Nagel ein, damit man die Wagenschlüssel hinhängen kann.
Siehe da! Jim schlägt einen Nagel neben dem Telefon ein, damit man den Bleistift anhängen kann.
Siehe da! Jim schlägt einen Nagel in die Schreibtischplatte, um die unbezahlten Rechnungen draufzuspießen. Siehe da: Jim macht einen wahnsinnig.
Alles kam ganz überraschend. Ich wußte fünfundvierzig Jahre lang nicht, daß ich einen Mann geheiratet habe, der so viel von allem versteht: von Spülmaschinen, Bohnerwachs, Feinwäsche und ihrer Behandlung, Fleckenentfernen, Kindern und wie man verhindert, daß Bananen braun werden.
Auch Jim ist überrascht. Er wußte gar nicht, wie ich in meiner Ungeschicklichkeit fünfundvierzig Jahre lang ohne ihn den Haushalt habe führen können.
Alle wundern sich, daß er mehr zu tun hat denn je.
Ich nicht.
* Erntedank
Du bist nicht krank, du brauchst nur ein Abführmittel
Als ich am Spülbecken ein Glas Wasser füllte und mir ein Aspirin in den Mund warf, sagte Mutter: »Ist dir nicht gut?«
»Nur ein bißchen Kopfweh«, sagte ich.
»Unsinn«, sagte sie. »Du brauchst vermutlich nur ein Abführmittel.«
Bahnbrechende medizinische Erkenntnisse sind in unserem Lande aufgekommen und wieder verschwunden, und meine Mutter hat sie alle vollkommen ignoriert. Keiner wird sie je überzeugen, daß die stabile Gesundheit nicht von der inneren Einstellung jedes Einzelnen abhängt.
Seit meiner Geburt ist Mutters Allheilmittel für jedwede Krankheit, die mich befällt, »nimm ein Abführmittel«. In den unteren Volksschulklassen fragte ich mich manchmal erstaunt, wieso eigentlich Kinder mit Beinen oder Armen in Gips herumgingen, wo sie doch, um gesund zu werden, nur vor dem Schlafengehen ein wohlschmeckendes Darmpflegemittel einzunehmen brauchten.
Es war unheimlich, wie Mutter einen nur ansah und entschied, man brauche einen inneren Durchputz. Ein Laxativ kurierte bei ihr: verdorbenen Magen, Kopfschmerzen, Fieber, Hautausschlag, Schwindel und allgemeine Zerschlagenheit.
Hatte sie einen verarztet, kam einem nichts mehr wichtig genug vor, um den Mund aufzutun und sich zu beklagen. Als ich etwa zwölf war, erweiterte sie ihre Diagnose noch um »du langweilst dich bloß«.
Meine sämtlichen Freundinnen hatten zu eng stehende Zähne, ein schlechtes Blutbild, Virusbefall, Blinddarmentzündung, Hundebiß und Lungenentzündung. Das hatte ich auch alles, aber ich »langweilte mich bloß« und ihre Therapie lautete: »Such dir was zu tun, sonst finde ich dir was!« Als ich verheiratet war, variierte sie ihr Gutachten etwas. »Das sind nur die Nerven.«
»Mutter, ich bin heute zweimal ohnmächtig geworden.« (Das sind nur die Nerven.)
»Ich glaube, ich bin schwanger.« (Unsinn, das sind nur die Nerven.)
Sie blieb eisern bei ihrer Meinung, sogar noch als ich schon ein fast achtpfündiges Nervenbündel zur Welt gebracht hatte. In meiner Familie hat nie jemand meine Leiden ernstgenommen. Ein einziges Mal nur möchte ich einen Virus erwischen, den nicht schon jeder in der ganzen Stadt hat. Ich scheine immer die letzte weibliche Erwachsene Nordamerikas zu sein, die ihn bekommt. Ich verlange ja nicht gleich das Erbarmen einer Mutter Theresa, aber ein bißchen Mitgefühl, insbesondere bei meinem Mann hätte ich schon verdient.
»Ich fühle mich nicht gut«, sagte ich eines Morgens zu ihm. »Um meine Brust liegt es wie ein zu enger Reifen und in meinen Augen klopft es, als tanze jemand Stepptanz auf meinen Lidern. Und ich unterdrücke den Hustenreiz, bis ich mich dem Husten besser gewachsen fühle.«
»Unsinn«, sagte mein Mann, »du langweilst dich nur. Was du hast, hat das ganze Büro. Das geht jetzt um. Die Diagnose lautet: Du solltest vermutlich einen anderen Beruf ergreifen.«
»Da magst du recht haben«, sagte ich. »Ich möchte nicht länger Ehefrau sein.«
»Manchmal«, fuhr er fort, »redet man sich auch nur ein, man sei krank, während man in Wirklichkeit ganz allgemein unzufrieden mit sich ist. Dieses Verhalten habe ich millionenfach an meinem Arbeitsplatz gesehen.«
»Gesagt hast du das aber nicht, als du dich damals nach dem Zahnsteinentfernen drei Tage ins Bett gelegt hast.«
»Das war etwas anderes«, sagte er. »Dabei kam es zu Komplikationen.«
»Eine im Backenzahn festgebissene Popcornhülse, was?«
Mein Problem ist wahrscheinlich, daß ich meinem Arzt meine Gefühle nicht so richtig verdeutlichen kann. Und von dem, was er sagt, versteh ich kein einziges Wort. Er spricht Latein, ich spreche fließend.
So geht es den meisten. Seit ich damals den im Wartezimmer eines Arztes Versammelten vortrug, ich hätte eine Bavarianische Zyste, hatten zwei andere das gleiche. Ich glaube, wir sprechen gar nicht mehr die gleiche Sprache, mein Arzt und ich. Und natürlich bin ich bange vor einem Menschen, der den ganzen Winter Weiß trägt und sich 137mal pro Tag die Hände wäscht.
»Sie sagen, ich litte an einem verkrümmten Homerus?«
»Nein, das ist ein klassischer Dichter. Was ich meinte, ist die semipermeable Membrane.«
»Wären Sie vielleicht so freundlich, mir das für meinen Mann aufzuschreiben.«
»Natürlich«, sagte er. »Haben Sie einen Zettel da, ich mache Ihnen ein Diagramm.«
»Reißen Sie einfach ein Stück von dem Untersuchungskittel ab, den Sie mir gegeben haben.«
Es gibt nichts Demütigenderes, als seinem Ehemann zu erklären, was ein Arzt gesagt hat. »An meiner Nase ist etwas verkehrt«, sagte ich.
»An welchem Teil der Nase?«
»Du weißt schon, an der Schei... dung.«
»Du meinst die Scheidewand«, sagte er. »Was ist damit?«
»Sie ist pervertiert.«
»Du meinst anomal?«
»Na, ist doch dasselbe.«
Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die mir erzählten, sie hätten eine amniotische Dyspepsie, es könne aber auch eine dyspeptische Amniotie sein.
Ein Bekannter konnte sich nie die Zahlen seines Blutdrucks merken und sagte, wenn sie unter seinen erzielten Punktzahlen beim Golf lägen, wäre er ganz zufrieden.
Meine Großmutter verkündete mir einmal, sie habe eine Prostata-Unterfunktion, und als ich ihr sagte, das sei nun wirklich nicht möglich, meinte sie patzig: »Alles ist möglich, wenn man ißt wie ich.«
Als eines der Kinder sich zu Mutter und mir an den Tisch setzte, nieste ich und putzte mir die Nase. »Du hast dir doch nicht was geholt?« fragte der Junge.
»Sie langweilt sich nur«, sagte meine Mutter. »Hier, nimm mal einen Schluck Hustensirup.«
»Um den zu nehmen bin ich nicht gesund genug«, sagte ich.
»Wie meinst du das, du bist nicht gesund genug?« fragte sie.
»Ja, lies mal.«
In übergroßen Buchstaben warnte der Beipackzettel, die vorgeschriebene Dosis nicht zu überschreiten, da sonst Unruhe, Schwindel und Schlaflosigkeit eintraten. Man durfte das Präparat überhaupt nicht nehmen, wenn man an erhöhtem Blutdruck litt, an Herzinsuffizienz, Diabetes, Schilddrüsenstörungen oder gleichzeitig ein antihypertensives oder antidepressives Mittel verschrieben bekommen hatte, das einen Mono-amin-oxidase-Hemmer enthielt. Auf keinen Fall durfte man es nehmen im Fall von Glaukom, Asthma oder Schwierigkeiten beim Wasserlassen, die auf eine Vergrößerung der Prostata zurückzuführen waren.
»Du könntest es ja riskieren«, sagte mein Sohn, »und im Falle einer Reaktion so bald wie möglich den Vergiftungsnotruf anrufen.«
»Hier habe ich eine, die du möglicherweise nehmen kannst«, sagte Mutter und griff nach einer weiteren Medizinflasche. »Laß mal sehen. Bist du werdende oder stillende Mutter?« (Ich stöhnte.) »Ich frag ja bloß. Hast du ein Magengeschwür? Bist du allergisch gegen Aspirin oder hast du irgendwelche Blutungen?«
»Was für Blutungen?«





























