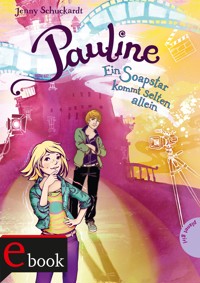Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Förg
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gerhard Thybens Leidenschaft für das Fliegen wurde schon im Kindesalter geweckt, als ihm sein Vater eines Tages einen Bauplan für ein Modellsegelflugzeug schenkte. Die ersten Erfahrungen in der Luft machte er in der Flieger–HJ, bevor er für die Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg eingezogen wurde. Es folgten eine Jagdfliegerausbildung in Paris und eine Versetzung in den Osten. Durch viel Glück und großes Talent schaffte er es, zu den besten Jagdfliegern zu gehören und diese gefährliche Zeit zu überleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ganz besonderer Dank geht an Rob van den Niewendijik (Holland) und Andrew Arthy (Australien), zwei Historiker, die sich mit dem Leben und Wirken von Gerhard Thyben intensiv beschäftigt und mit ihren Informationen zur sorgfältigen Aufstellung der Fakten beigetragen haben.
Vollständige E-Book-Ausgabe der in der Edition Förg erschienenen Originalausgabe 2021
© 2021 Edition Förg GmbH, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Bildnachweis: Alle Bilder innen und auf dem Umschlag stammen aus dem Privatarchiv von Gerhard Thyben.
Lektorat und Satz: Dr. Helmut Neuberger, Ostermünchen
eISBN 978-3-96600-020-8 (epub)
Worum geht es im Buch?
Jenny Schuckardt
Einsatz über den Wolken
Gerhard Thybens Leidenschaft für das Fliegen wurde schon im Kindesalter geweckt, als ihm sein Vater eines Tages einen Bauplan für ein Modellsegelflugzeug schenkte. Die ersten Erfahrungen in der Luft machte er in der Flieger-HJ, bevor er für die Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg eingezogen wurde. Es folgten eine Jagdfliegerausbildung in Paris und eine Versetzung in den Osten. Durch viel Glück und großes Talent schaffte er es, zu den besten Jagdfliegern zu gehören und diese gefährliche Zeit zu überleben.
Inhalt
»Schneller, Pappel, schneller!«
Endlich Herr der Lüfte!
Dank Zahnschmerzen überlebt
Warten auf den ersten Einsatz
Erster Luftsieg gegen einen feindlichen Jäger
Verlegungen immer weiter nach Westen
Gefährlicher Crash auf der Hallig
Permanente Alarmbereitschaft
Auszeichung und Strafpredigt von Göring
Gerade noch mal davongekommen
Ein Hoch auf meine Blähungen
Liebe auf den ersten Blick
Die hellen Nächte von Finnland
Das Missgeschick mit dem rostigen Fernrohr
Verlegung nach Kurland
Verleihung des Ritterkreuzes
Von Erfolg zu Erfolg
Urlaub auf Ehrenwort
Flug zur Kapitulation
In britischer Kriegsgefangenschaft
Zurück an Vaters Tisch
Ein tollkühner Plan
Aufbruch in eine ungewisse Zukunft
Zu Fuß über die Pyrenäen
Beklemmende Erfahrungen in Barcelona
Reise über den Ozean
Eine Arbeit und suchen, seufzen, leiden
»Darf ich bitten?«
Magdas traurige Lebensgeschichte
Die Vergangenheit holt mich ein
Auf dem Weg in das unbekannte Kolumbien
Die ersten Rückschläge
Schädlingsbekämpfung im Tiefflug
Der Verlust des Ritterkreuzes
Mein Abschied von der Fliegerei
»Schneller, Pappel, schneller!«
Mein Vater Fritz Thyben stammte aus der Danziger Niederung aus dem Hof eines Domänen-Pächters der Stadt Danzig und war Prokurist bei der Firma Johansen & Schmielau in Kiel. Meine Mutter Lisbeth, geb. Ebelmann, stammte aus Bingen am Rhein und war Hausfrau – eine hübsche junge Frau mit dunklen Haaren und ebenmäßigen Gesichtszügen, die für das Theater schwärmte und nach gesellschaftlichem Aufstieg strebte. Zu gerne hätte sie aus mir, ihrem einzigen Sohn, einen Künstler gemacht. Ich erinnere mich mit Schaudern daran, dass sie mich eines Tages in einen Matrosenanzug steckte und ins Theater schleifte, da man dort auf der Suche nach einem dunkelhaarigen Jungen war, der einen Italiener spielen sollte.
»Gerdchen«, beschwor sie mich vor meinem Auftritt, »zeig ihnen, was du kannst, geh aus dir heraus!«
Genau das tat ich nicht. Es war mir einfach nur peinlich. Möglicherweise standen aber auch meine abstehenden Ohren einer künftigen Bühnenkarriere im Weg. Jedenfalls wurde ich zu meiner großen Erleichterung und ihrer maßlosen Enttäuschung nicht für die Rolle ausgewählt. Bis heute hält sich meine Begeisterung für das Theater in Grenzen.
Meine Kindheit in Kiel in unserem schmucken ockerfarbenen Reihenhäuschen mit etwas Garten und einem kleinen Kräuterbeet in der Graf-Spee-Straße 14 war unbeschwert und glücklich. Unsere Urlaube verbrachten wir abwechselnd auf dem wunderschönen weitläufigen Gut meines Onkels Karl Thyben in Ostpreußen oder in Bingen. Während meine Mutter zum Glück irgendwann ihre Träume von einer Schauspielerlaufbahn ihres Sohn begrub, schwebte meinem Vater, meinem »Pappel«, wie ich ihn nannte, vor, dass ich einen anständigen handwerklichen Beruf erlernen sollte, denn von meiner Mutter hatte ich eine ausgeprägte handwerkliche Begabung geerbt. Sie bastelte selbst noch im hohen Alter mit wenig Mitteln wunderschönen Weihnachtsschmuck.
Im elterlichen Wohnzimmer 1932 mit Mutter Elisabeth, Großmutter Maria geb. Rahn und dem Vater Fritz Thyben
Um dies zu fördern, brachte mir mein Vater eines Tages einen Bauplan für ein Segelflugmodell mit. Er erinnerte an ein Schnittmuster für Bekleidung. »Sieh mal, mein Junge, du musst jedes Teil einzeln mit einer Laubsäge ausschneiden und dann mit etwas Leim verkleben«, erklärte mein Vater und demonstrierte mir dann auch noch, wie man diesen Kleister aus Wasser, Zucker und Mehl anrührte. Unsere gemeinsamen Bastelstunden fanden in der Küche statt, was meiner Mutter ganz und gar nicht gefiel.
Der Bastler mit seinen Segelflugmodellen im Garten des Elternhauses in Kiel
»Kann der Junge nicht einfach Fußball spielen wie alle anderen auch«, seufzte sie so manches Mal, halb im Scherz, halb im Ernst.
Fußball fand ich langweilig. Während die anderen Jungs auf dem Sportplatz miteinander wetteiferten, gefiel es mir, stundenlang bei meiner Mutter in der Küche zu sitzen und an den Segelfliegern zu basteln, während sie die Pellkartoffeln zu den Matjesheringen kochte, meinem Lieblingsessen. Wenn dann mein Vater von der Arbeit heimkam, zogen wir zusammen los, um die selbstgebastelten Modelle fliegen zu lassen. Mit dem Fahrrad, er vorne, ich hinten drauf, manchmal begleitet von einer drolligen Dohle, die beschlossen hatte, bei uns als Haustier zu leben, radelten wir zu einer Wiese in der Nähe und starteten die Segelflieger, die eine Spannweite bis zu 2,5 Meter aufwiesen, mit einem langen Gummiband.
»Schneller Pappel, schneller!« Glucksend vor Glück rannte ich los, um die nach dem Flug sanft in der Wiese landenden Segler wieder zu holen, mein Vater hinterher. »Gemach, mein Junge, ein alter Mann ist kein D-Zug«, kokettierte er, war aber beinahe so schnell wie ich.
Die Zeit mit meinem Vater zu verbringen und meine Flugmodelle majestätisch durch die Luft gleiten zu sehen, war für mich das Schönste, was ich mir vorstellen konnte. Doch diese unbeschwerte Zeit zu zweit wurde bald schon knapp bemessen.
Seit Hitlers Machtübernahme als Reichskanzler am 30. Januar 1933 lief eine gewaltige Werbekampagne, um die Jugendlichen zum Eintritt in die »Hitlerjugend« zu bewegen, eine Jugendorganisation der NSDAP, die ideologische Indoktrinierung mit attraktiven Freizeitangeboten verband. Für jeden Geschmack wurde eine HJ angeboten: Es gab eine Reiter-, Motor-, Flieger-, Marine- oder Nachrichten-HJ für technisch begabte und sportliche Jugendliche, für künstlerisch Begabte gab es Fanfarenzüge und Spielscharen. Feiern, Ausflüge oder Zeltlager sollten für ein Zusammengehörigkeitsgefühl sorgen. Im Grunde aber wurden die Jugendlichen zu Parteisoldaten erzogen, denen beigebracht wurde, Befehlen zu gehorchen, ohne lange nachzudenken. Einmal in der Woche waren Treffen angesetzt, dafür gab es sogar schulfrei. Weigerte man sich, der Hitlerjugend beizutreten, wurde man automatisch zum Außenseiter und konnte sogar Probleme in der Schule mit linientreuen Lehrern bekommen.
Bei den HJ-Treffen hatte man Uniform zu tragen. Diese Verkleidung mochte ich so wenig wie meinen Matrosenanzug. Meistens schmuggelte ich einen weißen Rollkragenpullover unter die Uniformjacke. Der musste später auch unter meine Luftwaffenuniform und blieb bis zum Ende des Krieges und darüber hinaus mein Lieblingskleidungsstück.
So wenig wie die darstellenden Künste begeisterten mich paramilitärische Übungen in der Natur. Geländespiele waren nicht mein Ding. Aber da gab es eben auch diese Flieger-HJ, und irgendwie sagte mir mein Gefühl, dass ich da hingehörte. Dort durften wir Jungs unter der Anleitung eines Flugzeugbau-Schreiners, eines freundlichen Mannes mittleren Alters, richtige Segelflugzeuge bauen. Das Geld dafür kam von irgendwelchen Sponsoren. In Kiel war das damals die Reichsbahn. Je nach Baustunden und Leistung durfte man dafür am Wochenende fliegen. Maßlos aufgeregt fieberte ich daher jedem Wochenende entgegen.
Alle zusammen schleppten wir dann das Segelflugzeug auf eine Anhöhe und stellten es hangabwärts gegen den Wind. Ein Gummiseil in V-Form wurde unter der Nase eingehakt, und an jedem Ende mühten sich bis zu sieben Kameraden, das Seil zu spannen. Eine Haltemannschaft von etwa fünf Leuten hielt den Segler fest. Ein Vorgesetzter übernahm das Kommando: »Ausziehen! … Laufen!« Sobald das Gummiseil genug gespannt war, erfolgte endlich das ersehnte Kommando »Los!«, und jeder von uns wurde einmal, begleitet von den strahlenden Augen aller anderen, in die Luft befördert.
Als Segelflieger bei der Flieger-HJ im Segelflugzeug SG 38 Zögling kurz vor dem Start
Ich erinnere mich noch ganz genau an das überwältigende Gefühl, zum ersten Mal auf den offenen Pilotensitz einer »Grunau 9« klettern zu dürfen. Dabei handelte es sich um einen einfachen Schulgleiter, dem eine vor dem Piloten angebrachte Strebe den Spitznamen »Schädelspalter« eingebracht hatte. Mein Herz klopfte bis zum Hals, meine Hände waren schweißnass. Fliegen! Wie ein Vogel! Großartig! Am liebsten wäre ich nie wieder heruntergekommen! Jede freie Minute verbrachte ich fortan eifrig beim Flugzeugbasteln, um möglichst viele Baustunden zu sammeln.
Bedauerlicherweise gab es da aber nebenbei auch noch die Schule – und Hein Bolle, meinen Mathelehrer, zu dem ich ein äußerst gespanntes Verhältnis hatte, da mein mathematisches Verständnis nicht allzu ausgeprägt war. es mir wieder einmal nicht gelang, eine Aufgabe zu lösen, zitierte mich Hein Bolle höchst erzürnt an die Tafel, erklärte mir den Lösungsweg und fragte nach, ob mir dieser jetzt endlich verständlich wäre.
»Muschja wohl«, nuschelte ich genervt und dachte dabei ans Fliegen. Dies war nicht die Antwort, die Hein Bolle hören wollte, denn er verpasste mir sogleich einen Satz heiße Ohren.
Aber noch etwas anderes blieb mir von diesem Lehrer im Gedächtnis: Er hatte als Soldat den Ersten Weltkrieg miterlebt. Aber anders als viele andere Kriegsteilnehmer erzählte er höchst ungern davon. Wenn die Sprache darauf kam, war er äußerst verschlossen. Nur einen einzigen Satz wiederholte er immer wieder: »Jungs, eines kann ich euch sagen: Wünscht euch keinen Krieg!«
Gegen Ende meiner Schulzeit kam es in meiner Familie zu einer dramatischen Entwicklung. Meine Eltern vermieteten die obere Wohnung unseres Reihenhauses an ein junges Ehepaar. Sie schlossen rasch Freundschaft mit den neuen Mietern, spielten miteinander Karten und lernten sich immer besser kennen. Er war ein mäßig begabter Musiker, doch meine Mutter bewunderte seine Kunst, lauschte hingebungsvoll seinem Spiel und verbrachte immer mehr Zeit mit ihm. Irgendwann kamen sie sich nahe. Zu nahe! Meine Mutter wurde schließlich schwanger. Mein Vater weigerte sich, dieses »Kuckuckskind«, wie er es nannte, als das seine anzunehmen. Meine Mutter tat alles, um die Beziehung zu retten, und gab das Kind, meinen Halbbruder, zur Adoption frei. Doch die Kluft zwischen meinen Eltern war zu tief. Die Ehe wurde geschieden.
Das Unglück meiner Eltern berührte mich nicht sonderlich, denn schicksalhafte Ereignisse warfen ihren Schatten voraus: Der Krieg brach aus, und es folgten Tage voller Unsicherheit, Gerüchten und Tuscheleien. Aus Angst, mit der Masse zur Infanterie eingezogen zu werden und womöglich in einem Schützengraben zu landen, meldete ich mich freiwillig zur Luftwaffe. Die Schule hatte ich mit einem Notabitur beendet, einer Art abgespeckten Reifeprüfung, bei der lediglich der bis dato unterrichtete Stoff abgefragt wurde. Ab September 1939 konnte man mit dem Segen des Regimes diesen Weg wählen, um möglichst rasch an die Front zu kommen. Für mich war das höchst erfreulich, da ich mit der Schule ohnehin nicht so viel am Hut hatte.
So schnell durfte ich dann aber doch nicht die Uniform tragen. Denn nach dem raschen Sieg über Polen dümpelte der Krieg ereignislos vor sich hin. »Drôle de guerre«, komischer Krieg, nannten die Franzosen diese acht Monate Stillstand bis zum Frankreichfeldzug. Also entschied mein Vater, dass ich ein Maschinenbau-Praktikum bei Blohm & Voss beginnen sollte. Es gab dort für mich wenig zu tun. Die meiste Zeit bastelte ich mit großem Vergnügen an einem kleinen Motor für ein Modellflugzeug.
Doch irgendwann ging der Krieg weiter, und ich wurde als »kriegsverwendungsfähig« (KV) eingezogen – zwar, wie es mein Wunsch gewesen war, zur Luftwaffe, aber leider nicht zum fliegenden Personal, sondern zu den Fallschirmjägern. Das sei eine außergewöhnliche Ehre, hieß es in dem Einberufungsschreiben, denn: »Die Fallschirmjägertruppe muss an ihre Männer besondere Anforderungen an Charakter, Willen und Körperbeherrschung stellen. Dies bedeutet, dass lediglich eine kleine Auslese wehrfähiger Deutscher den Mut besitzt, mit dem Fallschirm abzuspringen.«
Mein Traum war es, zu fliegen. Das Abspringen aus einem Flugzeug war nicht mein Ding, ebensowenig die Vorstellung, in einem Schützengraben zu liegen, denn das folgte wohl logischerweise danach, und davor graute mir. Alles, nur das nicht! Ich war ziemlich verzweifelt, lief tagelang kopflos durch die Gegend, bis meinem Pappel eine List einfiel. Er holte eine seiner besten Flaschen Cognac aus seinem geheimen Spirituosenversteck. »Die Buddel gibst du dem Feldwebel, der für die Rekrutierung zuständig ist, und machst ihm klar, dass du mit deinen Hohlfüßen keine gute Verstärkung für die Fallschirmjäger wärst.«
Mehrmals übte er mit mir die Szene vor dem Unteroffizier. Sicherlich war es nicht die Form meiner Füße, sondern mein doch sehr schüchternes Auftreten, das diesen schließlich zu seiner Entscheidung bewog. Er erhob sich von seinem Schreibtisch, lehnte sich gegen das Fenster und blickte hinaus, die Hände auf dem Rücken verschränkt.
»Nun, bedauerlich, Thyben, wirklich äußerst bedauerlich. Sie hätten das Zeug gehabt. Jedoch nur, wer über sich hinauswachsen will durch selbstlosen Einsatz, wer die Erfüllung des Mannestums erstrebt, der kann Fallschirmjäger werden. Und offensichtlich sind Sie dazu nicht bereit.«
Mir fiel ein Stein vom Herzen, dass dieser Kelch an mir vorbeiging.
Endlich Herr der Lüfte!
Mehr und mehr beherrschte der Krieg das Leben der Menschen. Sondermeldung folgte auf Sondermeldung, und die verkündeten Siege rissen die Bevölkerung in einen wahnwitzigen Freudentaumel. Irgendwann lag dann mein Einberufungsbefehl im Briefkasten, und ich hatte mich umgehend beim Flieger-Ausbildungs-Regiment 71 in Wien-Stammersdorf zu melden. Dort verbrachte ich die Zeit von Juli bis Oktober 1940 mit Exerzieren, ausgiebigem Geländedienst, wurde vereidigt und durfte beim Ausgehen das schöne Wien genießen. Aber eigentlich wollte ich nichts anderes als fliegen. Wie groß war meine Freude, als dann endlich mit 18 Jahren meine Versetzung ins Fluganwärter-Bataillon 32 nach Senftenberg angeordnet wurde. Endlich am Ziel meiner Träume! Doch von wegen! Es wurde alles andere als ein Spaziergang. Man meinte dort, uns richtig trietzen zu müssen, und schikanierte uns nach allen Regeln der Kunst: Liegestütze, Putzdienst, Liegestütze, Putzdienst. Bei Wind und Wetter wurde draußen exerziert, der Dienst war hart, die Schulung eher militärisch als fliegerisch. In der Schwimmhalle wurden Mut und Draufgängertum erprobt: Wer stellt sich wie an beim Sprung rückwärts vom Dreimeterbrett oder bei einem Salto vom Sprungbrett. Dazu kamen Geländedienst und der Drill an der Waffe. Wir saßen nach einer Liste geordnet, auf der Name und Bild eines jeden Rekruten vermerkt war, sodass sich die Vorgesetzten jeden einzelnen einprägen konnten. Keiner entging der Dauerbeobachtung. Das ebenso markige wie menschenverachtende Motto lautete: »Versagt dieses Menschenmaterial bei einer Belastungsprobe am Steuerknüppel vorm Feinde, dann hätte die Kriegsschule ihre Aufgabe schlecht erfüllt. Der deutsche Flieger kämpft bis in den Tod für Führer und Volk, für Deutschlands Sein und Zukunft.»
Nach dem Drill der Grundausbildung wurde ich endlich auf die »AB Schule 113« in Otrokovice bei Brünn, das heute Bruno heißt, geschickt, und hier drehte sich endlich alles um die Fliegerei. Man unterrichtete uns in Zellenkunde, Motortechnik und Navigation – und im Fliegen.
Der Winter in Otrokovice war eiskalt, trocken und windig. Geschult wurde ich auf der Heinkel 72, einem offenen Doppeldecker. Der Wind pfiff uns nur so um die Ohren, und wir flogen dick bekleidet wie Teddybären, der Lehrer vorn, der Schüler hinten. Denn aus dem hinteren Cockpit hatte man die bessere Sicht. Es war ein unvergleichlicher Genuss, die Welt von oben zu bestaunen, die Landschaft in der Tschechei war zauberhaft.
Nach endlosem Büffeln der grauen Theorie, Hallendienst, etlichen Flügen mit Feldwebel Kähne und einem Überprüfungsflug mit Oberfeldwebel Reimer kam endlich die ersehnte Erlaubnis zum ersten Alleinflug.
Auf dem Flugplatz türmten sich noch Mengen an Schnee und Eis, obwohl die Schmelze bereits eingesetzt hatte und die Temperatur gute drei Grad Plus betrug. Die Maschine war mit Kufen ausgerüstet, die Landungen auf Schnee erlaubten, und die Einweisung war ausgiebiger als bei einer Atlantiküberquerung – so schien es mir jedenfalls in meiner Aufregung.
Ungeduldig wartete ich im Flugzeug auf die Starterlaubnis. Der Motor blubberte im Leerlauf, während Feldwebel Kähne weiter heftig auf mich einredete. Immer wieder nickte ich bestätigend und hoffte dabei, dass der so lange ersehnte Moment doch endlich kommen möge. Nach einer gefühlten Ewigkeit trat der Feldwebel schließlich zur Seite und gab das Zeichen zum Start.
Ein Doppeldecker-Schulflugzeug Heinkel He 72 in der fliegerischen Grundausbildung im April 1941
Gas rein und los! Die Maschine nahm auf ihren Kufen rasch Fahrt auf, war ohne Fluglehrer leichter und hob deshalb ungewohnt schnell ab. Die kahlen Bäume am Ende des Platzes näherten sich bedenklich, aber die Maschine war schon hoch genug. Ich flog eine 90-Grad-Kurve nach links und stieg weiter. Noch eine Kurve, und unten war mein Feldwebel Kähne zu erkennen, klein und unscheinbar. Oh mein Gott! So gern hätte ich aus diesem Alleinflug einen richtigen Ausflug gemacht. Aber dieser erste Eindruck musste ein guter werden. Dennoch, diese wenigen Sekunden gehörten mir allein. Ich schickte einen Jauchzer aus der Kabine, atmete tief durch und genoss das überwältigende Gefühl der Freiheit und des Glücks, die Welt von oben sehen zu dürfen. Der erste Alleinflug war immer nur eine Platzrunde. Also ging es nach kurzem Schnuppern an der Freiheit über den Wolken gleich wieder hinunter. Den frischen Wind im Gesicht, das schon vertraut gewordene Vibrieren der Struktur meiner Maschine, nochmal einen Blick nach links und den Motor drosseln. Noch eine 90-Grad-Kurve, und dann ging es in den Landeanflug. Dieser gestaltete sich ungleich schwieriger als der Start. Ich hoffte, beim Landen nicht auf schneefreie Stellen zu treffen, denn das hätte mit den Kufen unweigerlich zum Überschlag geführt.
Rollschaden bei einer Heinkel 72 nach Einsacken im Schneematsch
Der Boden kam immer näher, ich nahm das Gas raus, die Maschine schwebte und schwebte, dann setzte sie sanft auf. Gelandet! Allein!
Ein unbeschreibliches Gefühl erfasste mich. Ich hätte schreien mögen vor Glück, riss mich aber zusammen und schlitterte auf den Feldwebel zu. Und welch eine Freude! Der schickte mich sogleich wieder zurück in die Luft. Noch eine Platzrunde und danach noch eine dritte. Start und Landung sollten ja möglichst schnell zur Routine werden. Mit jeder Runde stieg meine Selbstsicherheit. Doch die dritte Runde lehrte mich, vorsichtig zu bleiben. Der Landeanflug war zu tief. Ich gab Gas, setzte aber an einer Stelle auf, die nicht zur Landung präpariert war. Die Maschine zuckte, der Schwanz stieg unvermittelt hoch, und nur mit größter Mühe gelang es mir, die Kontrolle zu behalten. Mein Herz raste, meine Handflächen waren schweißnass wie immer, wenn ich in Panik geriet, doch ich gab mir große Mühe, meinen Schrecken vor Feldwebel Kähne zu verbergen. Aber der Flug war erfolgreich! Was für ein Glück, denn nun gehörte ich zu den Fortgeschrittenen, die allein fliegen durften!
Vor dem Flugbetrieb: Wir ziehen unsere He 72 aus der Halle im Januar 1941
Es folgte die übliche Aufnahmezeremonie in den Klub der Erlauchten: Mit einer eigens dafür bereitgehaltenen Peitsche wurde mir kräftig der Hintern versohlt. Es schmerzte tagelang, Sitzen war mir kaum möglich. So sollte es auch sein, denn es hieß, das fliegerische Gefühl habe man im Hintern.
Mein Traum hatte sich jedenfalls endlich erfüllt. Ich durfte fliegen. Dass mich die Ausbildung auf den Krieg vorbereiten sollte, wusste ich zwar, es beeindruckte mich aber nicht. Krieg war damals nur ein Wort, nicht mehr. Dass wir angesichts der vielen Siege tatsächlich noch zum Einsatz kommen würden, konnten wir uns zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen. Wir Flugschüler machten sogenannte Ausmärsche durch Mähren und verbrachten viele gesellige Abende. Wir waren Freunde geworden und genossen unsere gemeinsame Zeit. Es war ein bisschen wie Ferien.
Nach der fliegerischen Grundausbildung war die Typenschulung vorgesehen. Jeder von uns musste in der Lage sein, jedes Flugzeug zu fliegen, egal welchen Typs, einstweilen aber nur Schulflugzeuge: Bücker Jungmann, Bücker Jungmeister, Klemm KL-35, Gotha Go 145, Focke-Wulf 56 Stösser, aber auch die tschechische Letow S 328. Ich hatte viel Spaß daran, jedes dieser Schulflugzeuge zu bewegen – und auch ein gewisses Talent.
Weniger Talent und sehr viel weniger Spaß hatte ich bei dem Teil der Ausbildung, bei dem es darum ging, Verkehrsflugzeuge wie Junkers W33 oder Focke-Wulf Weihe zu fliegen. Denn dazu gehörte der Instrumentenflug. »Wer die ganze Skala der Flugausbildung durchmacht, hat eine Flugmaschine zu meistern gelernt. Vom Kunstflug bis zum Langstreckenflug. Meine Herren, Sie müssen in der Lage sein, bei jedem Dreckswetter zu navigieren.«
Und das bedeutete Kopfrechnen: Kurs –Gegenkurs, Höhe halten, Peilung – alles Dinge, die mir als mathematisch Desinteressierten so gar nicht lagen. Es kostete mich große Anstrengung, das alles durchzuhalten, aber ich biss die Zähne zusammen und quälte mich durch den Stoff, denn mein Traum war es, nach dem Krieg, der ja für uns vielleicht niemals stattfinden würde, Lufthansa-Flugkapitän zu werden und in fremde Länder zu fliegen.
Dank Zahnschmerzen überlebt
Mitte September 1941 wurde ich in das besetzte Frankreich an die Jagdfliegervorschule 2 zur weiteren Ausbildung zum Jagdflieger versetzt. Zunächst ging es in die Hauptstadt Paris, die die Deutschen am 14. Juni besetzt hatten. Mein Jagdflieger-Ausbilder Friedrich Sonnenfeld war ein hochgewachsener, stattlicher Herr mit einem aristokratischen Gesicht und einer imposanten Narbe über der Wange. Ich hing an seinen Lippen. Hein Bolle hätte seine Freude gehabt.
»Meine Herren, das Ziel eines jeden Jagdfliegers besteht darin zu überleben. Dies ist Ihr Ziel und das Ziel Ihres Feindes. Und in der Regel wird nur einer von Ihnen dieses Ziel erreichen«, bläute er uns ein. »Sie müssen sich mit allen Sinnen auf Ihr Ziel konzentrieren, egal welche Gefahr hinter Ihrem Rücken lauert. Es gilt, den Überblick zu behalten. Der Pilot, der den anderen zuerst sieht, hat schon halb gewonnen. Und Sie dürfen nie vergessen, dass auch die Gegenseite über ausgezeichnete Piloten verfügt. Ihre Taktik besteht in der richtigen Entscheidung im richtigen Moment: Sie sehen den Feind, entschließen sich dazu, sofort anzugreifen, oder Sie warten auf eine günstigere Gelegenheit oder Sie greifen überhaupt nicht an. Diese Entscheidung müssen Sie mitunter im Bruchteil einer Sekunde treffen.«
Bei so manchem Luftkampf habe ich später an seine Worte gedacht. Einstweilen aber realisierten wir immer noch nicht, dass auch für uns jetzt tatsächlich Krieg war. Denn wir hatten in der wunderschönen französischen Hauptstadt das Gefühl, uns gehöre die Welt. Wir waren blutjung – ich war 18 – und voller Tatendrang. Die Nächte in Paris waren lang, die Mademoiselles sehr hübsch und elegant, der französische Rotwein schmeckte herrlich, und nur allzu gerne prahlten wir mit unserer Ausbildung zum Flugzeugführer.
Im Großen und Ganzen schienen uns die Franzosen durchaus wohlgesinnt zu sein – so empfand ich das jedenfalls. Dass wir in ihr Land eingefallen und Besetzer waren, das war uns damals nicht bewusst. Außerdem ging es mir einfach nur ums Fliegen, egal, wo und was.
Meine weitere Jagdfliegerausbildung absolvierte ich im Dezember 1941 an der Jagdfliegerschule 5 bei Toussus-le-Noble, einer französischen Gemeinde in der Nähe von Versailles gegenüber von Guyancourt. Und hier entschied ein gnädiges Schicksal über meinen weiteren Werdegang.
Von Natur aus sind meine Zähne nicht besonders gut, und eines Tages plagten mich höllische Zahnschmerzen. Aber ich wollte wegen so einer Banalität nicht den fliegerischen Dienst versäumen und wartete also einen Tag ab, an dem das Wetter keinen Flugbetrieb zuließ. Es war schon Herbst, und daher musste ich nicht allzu lange auf einen Tag warten, an dem selbst die Vögel zu Fuß gingen, wie man bei uns sagte.
Die Praxis des Luftwaffenzahnarztes befand sich in Guyancourt, genau gegenüber von den Barackenlagern unseres Fliegerhorstes. Es war nicht gestattet, über das Flugfeld zu laufen, man musste es umrunden: sieben Kilometer statt drei. Auf dem Hinweg hielt ich mich an die Vorschrift. Mein kranker Zahn wurde behandelt, und erleichtert machte ich mich auf den Weg zurück zu unseren Baracken.
Tägliches Antreten vor der Betriebsaufnahme in der Jagdfliegerschule Frankreich
Der Nebel lag wie festgeklebt auf dem Boden, sodass keinerlei Flugbetrieb möglich war. Ich hatte keine Lust, wieder den langen Umweg zu machen, und lief also diesmal quer über das Flugfeld. Die Unterkünfte kamen auch bald durch den Nebel in Sicht. Doch genau in diesem Moment stand der Staffelkapitän am anderen Ende vor den Unterkünften, um nachzusehen, ob sich das Wetter bessern würde.
Mist! Prompt entdeckte er mich, als ich aus dem Nebel kam. Sofort schickte er den Gefreiten vom Dienst auf einem Fahrrad los, um mich abzufangen. »Sie sollen sich unverzüglich beim Staffelkapitän melden«, teilte mir mein Kamerad mit, der mich plötzlich siezte, obwohl er den gleichen Dienstgrad hatte wie ich.
Ich meldete mich also beim Staffelkapitän und erklärte meinen Zahnarztbesuch. Doch der kannte keine Gnade. Er befahl mir, zur Strafe einen Aufsatz zu schreiben mit dem Titel: »Wie bewege ich mich ohne Flugzeug über das Rollfeld.« Mindestens zehn Seiten lang. Zwar bestätigte ich diszipliniert mit einem förmlichen »Zu Befehl«, aber innerlich haderte ich mit dem Schicksal und verzog mich sauer in die Unterkunft.
Jagdfliegerausbildung auf Arado 96 über Frankreich. Dieses Baumuster war Standard bei der Fortgeschrittenenschulung.
Am Nachmittag des gleichen Tages begrüßten wir einen Jagdschülerkameraden, der nach zehn Tagen Arrest zurückkam. Er war vom Staffelkapitän wegen einer Banalität verknackt worden, er hatte wohl die Knöpfe an der Uniformjacke falsch geknöpft. Wir feierten seine Freilassung, der Kamerad ließ eine Runde süffigen französischen Rotweins springen, es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Leicht angetrunken und respektlos machten wir uns über unseren gestrengen Staffelkapitän und seine lächerlichen Strafmaßnahmen lustig – bis mir gegen Mitternacht die Strafarbeit wieder einfiel, die noch am gleichen Abend abzugeben war.
Schwer angeheitert und völlig lustlos beschrieb ich drei Blatt im sogenannten »Gefreiter-vom-Dienst-Zimmer« im Stehen und lieferte den ganzen Senf auch gleich ab. Was genau ich zusammengeschrieben hatte, wusste ich gar nicht mehr.
Am nächsten Tag war ich wie so oft zur Wache eingeteilt, eine öde Beschäftigung, und vertrödelte meine Zeit mit geschultertem Gewehr vor dem Schilderhäuschen, als mir befohlen wurde, mich unverzüglich beim Staffelkapitän zu melden.
Nach einiger Wartezeit im Vorzimmer schallte der Befehl: »Thyben, reinkommen!«
Der Staffelkapitän, der mit großem Stolz das goldene Parteiabzeichen auf der Uniform trug, empfing mich mit finsterer Miene. Es versprach also ziemlich unangenehm zu werden.
»Haben Sie das geschrieben?« Er hielt mir mit gerunzelter Stirn mein Werk vor die Nase, und ich sah nur noch rote Striche.
»Eigentlich sollte ein Tatbericht gegen Sie eingereicht werden wegen Vorgesetztenbeleidigung. Da jedoch bisher nie etwas Derartiges gegen Sie vorlag, werde ich noch einmal davon absehen«, herrschte er mich an. Er verdonnerte mich zu sechs Tagen verschärften Arrests, da ich mich in einer schriftlichen Übungsarbeit über das Thema: »Wie bewege ich mich ohne Flugzeug über das Rollfeld« in unerhörter Weise über meinen Vorgesetzten lustig gemacht hatte.
Von 11. bis 17. April 1942 steckte man mich in den Arrest. Mitnehmen durfte ich nur meine Zahnbürste. Alles andere, auch Hosenträger und Gürtel, wurden mir abgenommen. An geistig literarischer Nahrung lagen in der Zelle Hitlers »Mein Kampf«, aber immerhin auch die Bibel bereit.
Auch diese sechs Tage gingen vorüber. Nach meiner Entlassung durfte ich nicht, wie erhofft, fliegen, sondern war erneut zum Wacheschieben eingeteilt. Nach zwei Tagen ging mir das derart auf den Geist, dass ich eine Mandelentzündung vortäuschte. Elf Tage immerhin wurde ich krankgeschrieben.
Der Tag meiner Entlassung aus dem Krankenstand war ein Samstag, und ich wollte mit meinen Kameraden ausgehen und feiern. Von Toussus-le-Noble nach Versailles war man bei bei normaler Gangart etwa eine Stunde unterwegs. Also fesch gemacht, Stiefel gewichst, Uniformrock sauber gebürstet und ab in die Freiheit. Auf halber Strecke tauchte plötzlich ein Auto vor mir auf und hielt genau auf mich. Zu spät also, um mich ins Gebüsch zu schlagen. Es war eines von unseren Oberen in Frankreich beschlagnahmten französischen Autos. Als es näher kam, war kein Zweifel mehr möglich. Ein Blick auf die Unifom genügte. Zu penetrant leuchtete mir das goldene Parteiabzeichen entgegen. Die Bremsen quietschten.
»Mensch, das ist doch dieser kiebige Thyben«, schnauzte mich mein Staffelkapitän an und musterte mich mit säuerlichem Grinsen. »Wo wollen Sie hin, wo kommen Sie überhaupt her? Wissen Sie nicht, dass für 14 Uhr ein Sonderappell angesetzt ist?«
Ich wusste tatsächlich nichts davon, wollte nach meiner Entlassung aus dem Bau einfach nur nach Versailles und feiern. Daraus aber wurde nichts.
Am nächsten Tag wurde ich wieder zum Staffelkapitän zitiert und musste mir Einiges anhören: »Ich bestrafe den Gefreiten Thyben mit fünf Tagen verschärftem Arrest, weil er sich nach seiner Haftentlassung nicht bei der Einheit zurückgemeldet hat und anstatt bei einem Sonderappell zu erscheinen, auf dem Weg nach Versailles angetroffen wurde.«
Vom 12. bis 17. Mai 1942 wanderte ich mit meiner Zahnbürste erneut in den Bau. Die fünf Tage fühlten sich an wie eine Ewigkeit. Mir war sterbenslangweilig, und die Geräusche der Flugzeuge draußen auf dem Platz bereiteten mir Seelenpein. Aber das war nichts gegen die Strafe, die er außerdem verhängte. Es war das Schlimmste, was er mir antun konnte, denn er befahl meine Ablösung vom fliegerischen Dienst. Ich wurde vor die Wahl gestellt, Propellerputzer oder zur Bodenverteidigung eingesetzt zu werden. Meine Entscheidung fiel auf das Erstere. Also wurde ich ausquartiert zu den Mechanikern. Ich saß dann mit ihnen auf der Bude und durfte die Flugzeuge zumindest anfassen.
Mein gesamter Ausbildungsjahrgang wurde weiter ausgebildet und dann an die Westfront geschickt, wo zum ersten Mal die US-Airforce auftauchte. Die Amerikaner hatten hervorragende Maschinen in großer Zahl wie die P-47 Thunderbolt, die dank ihres mächtigen Abgasturboladers in großen Höhen deutlich bessere Leistungen aufwiesen als unsere Jagdmaschinen – ganz zu schweigen von den britischen Spitfire und ihrer überlegenen Wendigkeit im Luftkampf. Wir hatten gegen die alliierte Übermacht keine Chance. Die Mehrzahl meiner Kameraden, all die Jungs, mit denen ich meine Ausbildung angefangen hatte, wurden nach und nach abgeschossen und haben den Krieg nicht überlebt. Mir hatte mein kaputter Zahn wohl das Leben gerettet.
Schließlich kam es zu einem Wechsel in der Führung unserer Jagdschulstaffel, und damit wehte auch ein neuer Wind. Mein verhasster 150-prozentiger Nazi-Staffelpeiniger, der in seiner Offiziersuniform mehrmals Beispiele dafür gegeben hatte, wie man sich im besetzten Feindesland nicht verhalten sollte, wurde versetzt. Wie ich später erfuhr, sollte es seine letzte Versetzung gewesen sein. Er hielt sich für einen Super-Germanen und flog in 12 000 Meter Höhe ohne Sauerstoff. Dabei wurde er, wie nicht anders zu erwarten, ohnmächtig und stürzte ab. Seine sterblichen Überreste mussten aus dem Boden gebuddelt werden. Ich muss gestehen: Als mir dies zu Ohren kam, ging ich zum Proviantlager, ließ mir die beste Flasche Wein geben und trank sie ganz allein aus.
Verbandsflug während der Ausbildung in der Jagdfliegerschule auf Arado 96
Ein Hauptmann Ehrenberg übernahm das Kommando, groß und schlank, sehr blass mit auffällig dunklen Augenringen. Ich war immer noch bei den Mechanikern untergebracht, doch mein Ablösungsantrag lag bereits beim Ausbildungsleiter. Schließlich wurde ich zum Rapport zu Hauptmann Ehrenberg gerufen. Hoffnungsfroh trat ich an.
Mit ernstem Gesicht, die Hände auf dem Rücken, musterte er mich lange. »Thyben, Ihr Fall ist mir bereits bekannt, und ich fürchte, dass da wohl kaum mehr was rückgängig zu machen ist. Auf jeden Fall werden Sie sich erst einmal bei mir im Schloss Le Loges als Ordonnanz bewähren müssen.«
In den folgenden zwei Monaten durfte ich im Schloss Le Loges nächtigen, doch wie gerne hätte ich diesen Komfort wieder gegen die Schülerbaracke eingetauscht.
Überflüssig zu sagen, dass ich als Ordonnanz nicht besonders erfolgreich war. Gerade hatte ich wieder einmal zwei zu hart gebratene Spiegeleier zurückbekommen und war gerade dabei, es besser zu machen, als Hauptmann Ehrenberg im Ordonnanzbereich erschien. »Thyben, ab nächsten Ersten werden Sie wieder in die Schulung genommen! Zufrieden?«
Zufrieden? Ich war überglücklich und fühlte mich dem Offizier zu größtem Dank verpflichtet. Denn praktisch war ich ihm mein weiteres Fliegerleben zu verdanken. Hauptmann Ehrenberg fiel am 10. Mai 1943, nachdem er zehn Luftsiege errungen hatte, über Tamara am Schwarzen Meer im Süden der Ostfront. Er wurde von einer Flakkanone vom Boden abgeschossen.
Während meine Kameraden in den Westen versetzt worden waren, schickte man mich aufgrund dieser Verzögerung an die Ostfront, wo der Hasardeur Hitler die Wehrmacht in ein Abenteuer getrieben hatte, das ihre Kräfte zwangsläufig überfordern musste – auch wenn sie in der Anfangsphase wieder von Sieg zu Sieg eilte. Dieses Verbrechen hat zahllose deutsche und sowjetische Soldaten das Leben gekostet und auch der Zivilbevölkerung unendliches Leid zugefügt.
Ich wurde auf die Krim versetzt. Die Ukraine war für die Sowjetunion vor Kriegsbeginn von zentraler wirtschaftlicher Bedeutung. Sie lieferte Stahl, Eisenerz und Kohle und trug als »Kornkammer« der Sowjetunion entscheidend zur Versorgung der Menschen bei. Die Luftwaffe hatte sich dort dank der technischen Überlegenheit ihrer Maschinen eine gewisse Luftüberlegenheit erkämpft und traf auf Gegner, die noch wenig Kampferfahrung hatten und meist stur nach Dienstordnung flogen. So hatte ich die Möglichkeit, als Jagdflieger schnell Erfahrungen zu sammeln. Diese Wochen waren für mich und meine weitere Laufbahn ungemein wichtig, denn in diesem Umfeld war mir möglich, Sicherheit zu gewinnen und mein Selbstbewusstsein als Jagdflieger zu stärken.
Warten auf den ersten Einsatz
November 1942. Nun sollte es für mich ernst werden. Denn es ging an die Front über Kiel und Berlin weiter nach Krakau. In Kiel besuchte ich meine Eltern, die allen Differenzen zum Trotz immer noch zusammenwohnten. In meiner schmucken Uniform und mit dem Flugzeugführerabzeichen stellte ich mich als ausgebildeter Jagdflieger vor. Die Begeisterung war unbeschreiblich. Was waren sie stolz auf ihren Jungen! Meine Mutter weinte Tränen der Freude.
Ich sah dem ersten Fronteinsatz mit gemischten Gefühlen entgegen. Von nun an wurde scharf geschossen, und so mancher kam nie wieder zurück. Aber ich war auch voller Erwartung. Was würde jetzt kommen? Wie würde alles sein? Wir bekamen ja nur pathetische Berichte über ruhmreiche Siege zu hören, die unsere tapferen Soldaten errungen hatten. Die Wochenschau zeigte beeindruckende Bilder und verhieß den alsbaldigen vollständigen Sieg über Russland. Vor allem die deutschen Fliegerasse wurden gefeiert. »Jagdkampf in der Luft, das ist Fechten mit Ausfall und Parade in allen Raumdimensionen, es ist einfach Kampfkunst. Nur ein ganzer Mann kann in die scharfe Schneide eines herausragenden Schwertes blicken, ohne zu zucken«, tönte die Propaganda.
Um die erfolgreichsten Jagdflieger entwickelte sich ein wahrer Starkult. Man konnte Postkarten kaufen mit den Porträts von Hans-Joachim Marseille, Theo Osterkamp, Werner Mölders oder Adolf Galland. Jeder wollte so heldenhaft sein wie sie. Ich auch. Die passende Uniform und das Flugzeugführerabzeichen besaß ich ja schon.
Der Abschied von meinen Eltern fiel mir schwer. Es ging auf Weihnachten zu, und so gerne hätte ich dieses wunderschöne Fest zu Hause gefeiert. Meine Mutter hatte schon ihre Weihnachtsbäckerei gestartet, ein feiner Plätzchenduft hing in der Küche. Mein Vater hatte die Schachteln mit der Weihachtsbaumdekoration aus dem Keller geholt und auch schon einen Baum im Wald geschlagen. Diese stolze Tanne wartete nun im Garten darauf, geschmückt zu werden. Aber leider nicht von mir, ich musste weiter. Von Berlin nahm ich die Reichsbahn nach Krakau, wo wir auf Flugzeuge von der Flugzeugschleuse in Wien warten mussten, mit denen wir dann auch im Geschwader eingesetzt werden sollten.
Am 13. Dezember 1942 erfolgte meine Versetzung zum 6. Jagdgeschwader 3 »Udet«, benannt nach Generaloberst Ernst Udet, der im Ersten Weltkrieg nach Manfred von Richthofen der zweiterfolgreichste deutsche Jagdflieger gewesen war. Als ich in Krakau eintraf, war das Wetter extrem schlecht. Die Luft lag scharf und kalt über dem Land, sogar die Zweige der froststarren Bäume schienen unter der grimmigen Kälte zu erzittern.
Die Frage: »Wie wird das Wetter da und dort sein?«, bildete die Grundlage eines jeden Einsatzbefehles, da vom Wetter nicht nur wir, sondern auch die feindlichen Luftwaffen abhängig waren. Das Wolkengelände, die »Landschaft des Himmels«, war immer wechselhaft, oft voller Tücken, und bei bestimmten Wetterlagen war der Einsatz nicht möglich. Wir konnten also nicht viel mehr unternehmen als auf die Flugzeuge zu warten.
Ich als Jagdflieger mit meiner Mutter
In voller Uniform
Wir schrieben inzwischen den 24. Dezember, und es war mir ein großes Bedürfnis, den Heiligen Abend auch hier, weit weg von meinem Zuhause, festlich zu begehen. Nur wie? Mittags machte ich mich mit zwei meiner ebenfalls weihnachtsgierigen Kameraden auf den Weg nach Krakau, um uns nach einer deutschen Weihnachtsfeier zu erkundigen. Ohne Erfolg. Wir landeten schließlich im Soldatenheim, wo eine kleine Feier im Kameradenkreis abgehalten wurde. Ein paar Kerzen, etwas Lametta, Tannengrün, Lebkuchen, Weihnachtsdudelei vom Grammophon, Weihnachtsgebäck. Jeder erhielt ein kleines Päckchen und ein paar warme Worte. Das Heimweh plagte mich fürchterlich. Die Sehnsucht nach Zuhause war übermächtig.
Nach dem Abschluss der Jagdfliegerausbildung mit einer Me 109 F, dem Standardjäger der Luftwaffe
Der nächste Tag dämmerte so kalt und düster herauf wie meine Stimmung, das Wetter blieb hundsmiserabel, dazu kam strenger Frost. Nach dem Mittagessen marschierten wir in die Stadt ins Kino und schauten den Film »Dr. Crippen an Bord«. Warten und Nichtstun hieß es auch in den folgenden Tagen, bis wir endlich am 28. Dezember Me 109-Flugzeuge zugewiesen bekamen und diese nach Taganrog fliegen sollten.
Was für eine Freude! Es war bitterkalt, aber ich verbrachte Stunden damit, um meine Maschine herumzustreichen und jedes Teil ganz genau zu begutachten. Sie hatte eine Spannweite von 9,91 Metern, eine Steigfähigkeit von 1310 m/min und eine Höchstgeschwindigkeit von 630 km/h. Bewaffnet war die Me 109 mit einer 20-mm-Kanone MG 151/20, die durch die Propellernabe schoss und zwei MG 17 im Kaliber 7,92 mm auf der Motorhaube, die durch den Propellerkreis zielten.
Trotz des immer noch schlechten Wetters flogen meine Kameraden Harald Frenzel und Meinter zusammen mit mir nach Lemberg. Unser Gepäck blieb in Krakau, es sollte mit der nächsten Transportflugzeugüberführung mitgeschickt werden. Harald Frenzel erreichte vier Luftsiege mit dem Jagdgeschwader 3. Am 22. Juli 1943 wurde er abgeschossen und kam dabei ums Leben.
Es wurde Silvester. Nach dem Mittagessen besuchten wir in Lemberg eine Neujahrsfeier im Soldatenheim – ein Abend mit wenig Alkohol, weil es kaum mehr welchen gab, viel wildem Gegröle und noch mehr Heimweh.