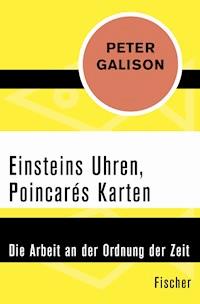
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Peter Galison zeigt, wie eng die Grundgedanken der »Speziellen Relativitätstheorie« mit gleichzeitigen Entwicklungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie verknüpft waren. Eine fundamentale Theorie der Physik bekommt ihren reichen weltlichen Kontext zurück. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Peter Galison
Einsteins Uhren, Poincarés Karten
Die Arbeit an der Ordnung der Zeit
Aus dem Englischen von Hans Günter Holl
FISCHER E-Books
Inhalt
1 Gleichzeitigkeit
Die wahre Zeit konnten Uhren niemals anzeigen – da war sich Newton sicher. Selbst die größten Meisterwerke der Uhrmacherkunst vermochten nur blasse Abbilder jener höheren, absoluten Zeit zu bieten, die nicht der Menschenwelt angehörte, sondern dem »Sensorium Gottes«. Gezeiten, Planeten, Monde – alles in der Welt bewegte oder veränderte sich, wie Newton meinte, vor dem Hintergrund einer einzigen, stetig fließenden Zeit. In Einsteins elektrotechnischer Welt war jedoch kein Platz für ein solches »ewig gleichmäßig ablaufendes Ticktack«, ließ sich die Zeit nicht mehr ohne Rückgriff auf ein Netzwerk oder Verbundsystem von Uhren sinnvoll definieren, schon weil sie aus der Perspektive bewegter und ruhender Systeme unterschiedlich schnell abläuft: Ereignisse, die ein stationärer Beobachter als gleichzeitig wahrnimmt, scheinen für einen bewegten Beobachter nacheinander zu erfolgen. So löst sich »die Zeit« in »Zeiten« auf. Ein schwerer Schlag, der das solide Fundament der Newton’schen Physik erschütterte, und Einstein machte sich darüber keine Illusionen. Als er später seine autobiographischen Notizen abfasste, hielt er einen Moment ein, um Isaac Newton gleichsam persönlich über die Jahrhunderte hinweg anzusprechen. Im Blick auf die durch seine Relativitätstheorie außer Kraft gesetzte Verabsolutierung von Raum und Zeit schrieb er: »Newton, verzeih’ mir; du fandest den einzigen Weg, der zu deiner Zeit für einen Menschen von höchster Denk- und Gestaltungskraft eben noch möglich war.«[1]
Diese radikale Umwälzung des Zeitverständnisses ging von einem ebenso außergewöhnlichen wie leicht beschreibbaren Gedanken aus, an dem sich Physik, Philosophie und Technik noch heute orientieren: Um bei fernen Ereignissen von Gleichzeitigkeit sprechen zu können, müssen wir unsere Uhren synchronisieren, und das setzt einen Signalaustausch voraus, in dem es die Übertragungszeit der Signale zu berücksichtigen gilt. Was könnte einleuchtender sein? Doch diese verfahrensgestützte Definition der Zeit lieferte das letzte noch fehlende Stück im Puzzle der Relativität und veränderte dadurch die gesamte Physik von Grund auf.
Alles Folgende kreist um die Methodik der Uhrenkoordination, und so einfach das Thema auch erscheinen mag, es ist doch gleichermaßen hochfliegend abstrakt wie bodenständig konkret. Die Materialisierung der Simultanität erfolgte um die Jahrhundertwende in einer ganz anderen als unserer heutigen Welt, grenzten damals doch Höchstleistungen auf dem Gebiet der theoretischen Physik direkt an den profan materialistischen und imperialistischen Ehrgeiz, ein erdumspannendes, telegraphisch nutzbares Kabelnetz einzurichten, um Eisenbahnen aufeinander abzustimmen und die geographischen Karten zu vervollständigen. Ingenieure, Philosophen und Physiker arbeiteten dabei eng zusammen; der New Yorker Bürgermeister hielt Vorträge über die Konventionalität der Zeit; der Kaiser von Brasilien wartete an der Atlantikküste darauf, dass telegraphische Zeitsignale aus Europa eintrafen, und zwei führende Wissenschaftler der Epoche, Albert Einstein und Henri Poincaré, ordneten die Gleichzeitigkeit unterschiedlichen Schnittpunkten im Spannungsfeld von Physik, Philosophie und Technik zu.
Die Zeiten Einsteins
Wegen seiner nachhaltigen Wirkungen in diesem Spannungsfeld wurde Einsteins 1905 publizierte Arbeit »Zur Elektrodynamik bewegter Körper« zum bekanntesten physikalischen Aufsatz des 20. Jahrhunderts, und sein zentrales Thema ist die Aufhebung der absoluten Zeit. Seine Argumentation unterscheidet sich, zumindest in der herkömmlichen Deutung, so radikal von der älteren, »praktisch« angelegten klassischen Mechanik, dass der Text zu einem Modell für revolutionäres Denken wurde und für eine Sichtweise, die sich grundlegend vom substantiell-anschaulichen Weltverständnis abwandte. Einsteins neue, teils philosophisch, teils physikalisch begründete Auffassung der Gleichzeitigkeit gilt seither als ein irreversibler Bruch zwischen der modernen Physik und den früheren Vorstellungen von Raum und Zeit.
Einstein eröffnete seinen Aufsatz über das Relativitätsprinzip mit dem Hinweis auf eine im damaligen Verständnis der Elektrodynamik bestehende, aber in den Naturphänomenen selbst nicht anzutreffende Asymmetrie. Um 1905 vertraten nahezu alle Physiker die Ansicht, dass Wellen – ob des Lichts, des Wassers oder des Schalles – auf ein Medium angewiesen seien. Im Fall des Lichts (oder der oszillierenden elektromagnetischen Felder, aus denen es bestand) dachte man dabei an einen alles durchdringenden »Äther«, dessen Einführung die meisten Physiker des ausgehenden 19. Jahrhunderts als einen der großen Fortschritte ihrer Zeit erachteten und die Hoffnung hegten, er werde – sofern erst einmal umfassend verstanden, veranschaulicht und mathematisch formalisiert – eine einheitliche wissenschaftliche Erklärung der Naturphänomene ermöglichen, von der Wärme und dem Licht bis zum Magnetismus und der Elektrizität. Doch gerade der Äther brachte die von Einstein abgelehnte Asymmetrie mit sich.[2]
Nach der üblichen physikalischen Deutung, so schrieb Einstein, sei es anhand des erzeugten Stromes ununterscheidbar, ob sich, jeweils auf den Äther bezogen, ein bewegter Magnet einer ruhenden Spule oder eine bewegte Spule einem ruhenden Magneten nähert. Allerdings sei der Äther selbst nicht nachweisbar. Daher gab es aus Einsteins Sicht nur ein relevantes Phänomen: die Annäherung von Spule und Magnet, die in jener einen (durch das Leuchten eines Lämpchens bezeugten) Strom induziert. Die Elektrodynamik (bestehend einerseits aus den Maxwell’schen Gleichungen über das Verhalten elektromagnetischer Felder, andererseits aus Kraftgesetzen über die Feldbewegungen geladener Teilchen) bot nach der damals herrschenden Meinung zwei grundverschiedene Erklärungen für das Geschehen. Als ausschlaggebend galt, was sich gegenüber dem Äther bewegte: die Spule oder der Magnet. Im ersten Fall (ruhender Magnet, bewegte Spule) folgte aus den Maxwell’schen Gleichungen, dass auf die Elektrizität der Spule bei Bewegung im Magnetfeld eine Kraft einwirkte, die einen Stromfluss auslöste und das Lämpchen leuchten ließ. Im zweiten Fall (bewegter Magnet, ruhende Spule) verstärkte sich aufgrund der Annäherung das Magnetfeld im Umkreis der Spule, was (nach den Maxwell’schen Gleichungen) wiederum ein elektrisches Feld erzeugte, das den Strom durch die Spule und den Glühdraht des Lämpchens schickte. In der üblichen Darstellung machte es also einen ganz erheblichen Unterschied, ob man den Magneten oder die Spule als Ausgangspunkt wählte.
In Einsteins Neufassung des Problems blieb nur ein Phänomen übrig: Die Annäherung von Spule und Magnet, verbunden mit dem Leuchten des Lämpchens. Aus seiner Sicht verlangte ein beobachtbarer Vorgang auch nur eine Erklärung, und diese sollte ganz ohne den Äther auskommen. Insofern erschienen die ruhenden respektive bewegten Bezugssysteme der Spule und des Magneten bloß als zwei Sichtweisen auf ein und dasselbe Phänomen. Einstein zufolge ging es hier um ein Grundprinzip der Physik: die Relativität.
Fast dreihundert Jahre zuvor hatte Galilei die Bezugssysteme auf eine ganz ähnliche Weise in Frage gestellt. Wenn ein Schiff mit gleichförmiger Geschwindigkeit über das Meer glitt, so überlegte er, ließ sich seine Bewegung in einer abgeschlossenen Kabine unter Deck durch kein noch so raffiniertes mechanisches Experiment feststellen. Ein Fisch würde dort nicht anders durchs Aquarium schwimmen als an Land, ein Wassertropfen ebenso geradlinig zu Boden fallen. Es gab einfach keine Möglichkeit, mit Hilfe der Mechanik zu ermitteln, ob ein solcher Raum »in Wirklichkeit« ruhte oder sich bewegte. Darin erblickte Galilei eine grundlegende Eigenschaft der Fallgesetze, deren Formulierung ihm vieles verdankt.
Dieses traditionelle Verständnis von Relativität in der Mechanik griff Einstein auf, als er die »Relativität« 1905 zum Prinzip erhob und erklärte, physikalische Prozesse blieben völlig unbeeinflusst davon, in welcher Art von gleichförmig bewegten Bezugssystemen sie ablaufen. Ihm zufolge sollte das Relativitätsprinzip nicht nur für fallende Tropfen, aufspringende Bälle und schwingende Federn gelten, sondern auch für die vielfältigen Effekte der Elektrizität, des Magnetismus und des Lichts.
Dem Relativitätspostulat, wonach man unmöglich ermitteln kann, welches Inertialsystem »in Wirklichkeit« ruht, fügte Einstein eine noch erstaunlichere Annahme hinzu, nämlich dass sich Licht immer gleich schnell ausbreite – mit etwa dreihunderttausend Kilometern pro Sekunde –, unabhängig von der Geschwindigkeit, mit der sich die Lichtquelle bewegt. Für handfeste Dinge gilt das offensichtlich nicht. Ein Zug rollt im Bahnhof ein, und der Schaffner wirft einen Postsack in Fahrtrichtung auf den Bahnsteig: In diesem Fall fliegt der Sack zweifellos mit dem Zugtempo plus der Wurfbeschleunigung auf einen dort wartenden Beobachter zu. Anders, so Einstein, im Fall des Lichts. Schwenkt A in Sichtweite von B eine Laterne, dann sieht dieser das Licht mit dreihunderttausend Kilometern pro Sekunde auf sich zukommen, und daran würde sich auch nichts ändern, wenn A auf einem Zug stünde, der sehr schnell (zum Beispiel mit halber Lichtgeschwindigkeit) auf ihn zuraste. Einsteins zweitem Postulat zufolge spielt es für das Fortpflanzungstempo des Lichts überhaupt keine Rolle, ob und wie schnell sich die Lichtquelle bewegt.
Einsteins Lesern mussten diese beiden Annahmen durchaus plausibel erscheinen (zumindest teilweise). Nicht nur kannte man, wie erwähnt, das Relativitätsprinzip in der Mechanik schon seit Galilei, sondern neuerdings hatte sich (unter anderen) auch bereits Poincaré mit seinen Problemen und Aussichten in der Elektrodynamik befasst.[3] Und wenn das Licht lediglich aus einer Erregung von Wellen in einem starren, alles durchdringenden Äther bestand, so lag die Vermutung nahe, dass seine Ausbreitung nicht von der Quelle abhing, sofern das Bezugssystem gewählt wird, in dem der Äther ruht. Schließlich gilt das Gleiche normalerweise auch für den Schall: Nach der Abstrahlung breitet er sich gewöhnlich stets mit konstanter Geschwindigkeit durch die Luft aus.
Doch wie konnte Einstein seine beiden Behauptungen miteinander in Einklang bringen? Nehmen wir an, in dem äthergestützten Bezugssystem, in welchem der Äther ruht, brennt eine Lampe. Müsste sich deren Licht nicht für einen gegenüber dem Äther bewegten Beobachter schneller oder langsamer fortpflanzen, je nachdem, ob es aus seiner Perspektive von hinten oder vorne käme? Und wenn sich dergestalt Schwankungen in der Lichtgeschwindigkeit beobachten ließen: Wie stünde es dann um das Relativitätsprinzip (da man nun doch eindeutig feststellen könnte, ob man sich gegenüber dem Äther bewegt oder nicht)? Allerdings war in der Tat keine solche Abweichung messbar. Selbst die raffiniertesten optischen Experimente ergaben keinerlei Hinweise auf eine Bewegung durch den Äther.
Daher meinte Einstein, man habe die elementaren Begriffe der Physik bisher ungenügend durchdacht und eine genauere Analyse werde den scheinbaren Widerspruch zwischen Relativitätsprinzip und konstanter Lichtgeschwindigkeit auflösen. Also beschloss er, noch einmal ganz vorne anzufangen und grundsätzlich zu fragen: Was ist Länge? Was ist Zeit? Was ist Gleichzeitigkeit? Obwohl jedermann wisse, dass die Physik des Elektromagnetismus und der Optik auf Zeit-, Längen- und Simultanitätsmessungen beruhe, sei man bei der Ermittlung dieser Leitgrößen zu nachlässig vorgegangen. Wie ließen sich durch Maßstäbe und Uhren eindeutige Raum- und Zeitkoordinaten für die beobachteten Phänomene gewinnen? Die unter Physikern vorherrschende Ansicht, man müsse zuerst die komplexen Kräfte untersuchen, die für den Zusammenhalt der Materie bürgten, zäumte für Einstein das Pferd vom Schwanz her auf. In seinen Augen gebührte die Priorität der Kinematik, der Frage also, wie sich Uhren und Maßstäbe bei gleichförmiger, unbeschleunigter Bewegung verhalten. Erst dann könne man sich sinnvoll mit den Problemen der Dynamik auseinander setzen (zum Beispiel mit der Frage, wie sich Elektronen unter dem Einfluss elektrischer oder magnetischer Kräfte verhalten).
Einstein zufolge konnte die Physik zu widerspruchsfreien Aussagen gelangen, wenn die Darstellung von Zeit und Raum überzeugend geklärt würde. Für räumliche Messungen benötigte man ein Koordinatensystem, worunter er gewöhnliche starre Maßstäbe verstand. Zum Beispiel: Dieser Punkt liegt bei sechs Zentimetern auf der x-, neun auf der y- und zweiundvierzig auf der z-Achse. So weit, so gut. Doch dann kam das Überraschende – die Umdeutung der Zeit, in der hellhörige Kollegen wie der Mathematiker und Physiker Hermann Minkowski den springenden Punkt der Argumentation sahen.[4] Einstein schrieb: »Wir haben zu berücksichtigen, dass alle unsere Urteile, in welchen die Zeit eine Rolle spielt, immer Urteile über gleichzeitige Ereignisse sind. Wenn ich z.B. sage: ›Jener Zug kommt hier um 7 Uhr an‹, so heißt dies etwa: ›Das Zeigen des kleinen Zeigers meiner Uhr auf 7 und das Ankommen des Zuges sind gleichzeitige Ereignisse‹.«[5] Bezüglich der Gleichzeitigkeit an einem Ort ergaben sich keine Probleme. Findet ein Ereignis direkt in der Nähe meiner Uhr statt, etwa wenn der Zug um Punkt sieben neben mir hält, so sind diese beiden Ereignisse offenbar gleichzeitig. Schwierig wird es erst, wenn wir einen Zusammenhang zwischen räumlich distanten Ereignissen herstellen müssen. Was heißt es zu sagen, zwei weit auseinander liegende Ereignisse seien gleichzeitig? Wie vergleiche ich das Ablesen meiner Uhr hier mit der um Punkt sieben Uhr erfolgenden Ankunft des Zuges dort, in einem fernen Bahnhof?
Newton löste das Zeitproblem durch ein absolutes Ideal: Die Zeit als solche konnte keine Sache »gewöhnlicher« Uhren sein. Doch als Einstein ein Verfahren verlangte, um dem Ausdruck »gleichzeitig« eine strenge Bedeutung zu geben, ließ er die Lehre von der absoluten Zeit hinter sich. Auf einer anscheinend philosophischen Ebene bestimmte er jenes Verfahren durch ein Gedankenexperiment, das lange Zeit nichts mit der Arbeit in Laboratorien und Fabriken zu tun zu haben schien. Er fragte: Wie lassen sich Uhren über große Abstände hinweg synchronisieren, also »an verschiedenen Orten stattfindende Ereignisreihen miteinander zeitlich verknüpfen, oder – was auf dasselbe hinausläuft – Ereignisse zeitlich werten, welche in von der Uhr entfernten Orten stattfinden.« Sein erster Vorschlag: »Wir könnten uns allerdings damit begnügen, die Ereignisse dadurch zeitlich zu werten, dass ein samt der Uhr im Koordinatenursprung befindlicher Beobachter jedem von einem zu wertenden Ereignis Zeugnis gebenden, durch den leeren Raum zu ihm gelangenden Lichtzeichen die entsprechende Uhrzeigerstellung zuordnet.«[6] Da sich das Licht jedoch mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet, ist dieses Verfahren nicht unabhängig vom Standort der Uhr. Angenommen, X steht an einem Punkt in der Nähe von A und in einiger Entfernung von B und Y genau in der Mitte zwischen A und B.
Von A und B gehen jeweils Lichtsignale aus, die X gleichzeitig erreichen. Kann er daraus nun schließen, dass auch beide gleichzeitig abgesendet wurden? Selbstverständlich nicht. Das von B kommende Signal hatte bis zu ihm einen sehr viel weiteren Weg zurückzulegen als das von A, und dennoch erreichten beide ihn gleichzeitig. Daher muss B früher gesendet haben als A. Nehmen wir an, X beharre auf einer gleichzeitigen Ausstrahlung der Signale von A und B, da sie schließlich gleichzeitig bei ihm eintrafen. Damit käme er ernsthaft in die Bredouille, denn in diesem Fall müsste der genau auf halbem Wege stehende Y ja das Signal B’s vor dem A’s empfangen haben. Um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden, wollte Einstein die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse »A sendet Licht aus« und »B sendet Licht aus« nicht vom Standort des Empfängers abhängig machen. Als Kriterium für Simultanität ist »der gleichzeitige Empfang von Signalen« vollständig ungeeignet, ein erkenntnistheoretischer Trugschluss, der keine widerspruchsfreie Erklärung zu stützen vermochte.
Um diesen Trugschluss auszuräumen, schlug der junge Einstein ein besseres System vor: Ein Beobachter A im Zentrum des Bezugssystems sendet ein Lichtsignal aus, wenn seine Uhr Punkt zwölf Uhr anzeigt. Ein im Abstand d befindlicher Beobachter B empfängt das Signal und stellt seine Uhr auf zwölf plus der Übertragungszeit des Lichts von A nach B, also zwölf plus (Entfernung ÷ Lichtgeschwindigkeit). Das Licht reist bekanntlich mit dreihunderttausend Sekundenkilometern. Ist B beim Empfang des Signals sechshunderttausend Kilometer von A entfernt, so stellt er seine Uhr auf 12:00:02 Uhr, das heißt zwölf plus zwei Sekunden. Wäre er neunhunderttausend Kilometer entfernt, so ergäbe sich 12:00:03 Uhr.
1.1 Zentraluhr. In seinem Aufsatz von 1905 über »Zur Elektrodynamik bewegter Körper« mit den Grundgedanken der speziellen Relativitätstheorie führte Einstein – allerdings ablehnend – ein Schema ein, bei dem eine Zentraluhr Signale an alle Nebenuhren schickte und diese damit koordinierte, zum Beispiel alle übereinstimmend auf 3 Uhr stellte, wenn der Impuls zu diesem Zeitpunkt eintraf. Das Problem lag allerdings in den unterschiedlichen Distanzen der Filialen vom Zentrum, sodass die näheren ihr Signal früher erhielten als die ferneren. Einstein lehnte das System ab, weil in ihm die Simultanität zweier Uhren von der völlig willkürlichen Wahl des Standorts jener »Zentrale« abhing.
Auf diese Weise könnten sich A, B und alle sonst an dieser Koordinierungsübung Beteiligten darauf einigen, ihre Uhren synchronisiert zu haben. Eine Änderung des Zentrums würde daran nichts ändern, denn alle Uhren berücksichtigen ja bereits die Übertragungszeit des Lichtsignals. Das gefiel Einstein: keine privilegierte »Zentraluhr« und doch eine eindeutige Definition von Simultanität.
Mit dem Verfahren der Uhrenkoordination hatte Einstein sein Problem gelöst. Durch dessen strenge Anwendung und dank seiner beiden Ausgangsprinzipien konnte er zeigten, dass zwei in einem Bezugssystem gleichzeitige Ereignisse dies in einem anderen nicht sein mussten. Denn die Längenmessung bewegter Objekte setzt stets voraus, dass man die Lage zweier Punkte gleichzeitig bestimmt: Wer einen fahrenden Bus ausmessen will, muss gleichzeitig die Position der Vorderfront und des Hecks ermitteln. Insofern begründet die Relativität der Gleichzeitigkeit auch eine solche der Länge. In meinem Bezugssystem ergibt die Messung eines relativ zu mir bewegten Metermaßes weniger als einen Meter.
1.2 Einsteins Koordination. Eine bessere, weil nicht willkürliche Lösung, sah Einstein darin, nicht auf den Zeitpunkt der Signalemission abzustellen, sondern auf jenen der Sendeuhr plus der Übertragungsdauer bis zur jeweils adressierten Uhr. Auf diese Weise gab es keine privilegierte »Zentraluhr« mehr, sondern man konnte von jeder beliebigen ausgehen und sie für das weitere Verfahren als Bezugspunkt wählen.
Hinter Einsteins Relativitätsprinzip steckt jedoch weit mehr als die bloße Uhrenkoordination. Ohne Übertreibung könnte man behaupten, dass die Beherrschung der Elektrizität und des Magnetismus die große Leistung in der Physik des 19. Jahrhunderts darstellte. Auf der Seite der Theorien hatte der britische Physiker James Clark Maxwell gezeigt, dass Licht aus elektrischen Wellen bestand, und mit seinen Gleichungen Elektrodynamik und Optik zusammengeführt. Was die Praxis angeht, so hatten der Dynamo die Großstädte elektrifiziert, elektrische Straßenbahnen deren Aussehen verändert und die Telegraphie den Markt, das Nachrichtenwesen und die Kriegführung transformiert. Auf der Suche nach dem unfassbaren Äther unterzogen Physiker das Licht Ende des 19. Jahrhunderts erstaunlich präzisen Messungen und verfeinerten ihre Untersuchung der elektromagnetischen Phänomene, um das Verhalten des gerade erst wissenschaftlich anerkannten Elektrons zu klären. Diese Bemühungen machten für viele führende Physiker (nicht nur Einstein und Poincaré) die Elektrodynamik bewegter Körper zu einem der schwierigsten, grundlegendsten und dringlichsten der naturwissenschaftlichen Probleme. Die Klärung dieser Fragen bis ins letzte Detail nachgezeichnet zu haben, gehört zu den großen Leistungen der Wissenschaftsgeschichte (und bildet den Hintergrund für dieses Buch).[7]
Die Erkenntnis, dass die Uhrensynchronisation eine unabdingbare Voraussetzung für die Definition der Gleichzeitigkeit bildet, brachte nach Einsteins eigener Darstellung als letzter entscheidender Schritt seine lange Suche nach der Lösung zum Abschluss. Dies – die Koordinierung der Zeit – ist das Thema dieses Buchs. Er selbst hielt die Erneuerung des Zeitbegriffs für den erstaunlichsten Aspekt der Relativitätstheorie. Doch mit dieser Ansicht konnte er sich nicht einmal bei seinen Anhängern sofort durchsetzen. Manche akzeptierten die Relativitätstheorie erst, als Experimente zur Elektronenablenkung sie zu stützen schienen. Andere warteten ab, bis Physiker und Mathematiker sie umgearbeitet und in eine vertrautere, weniger stark auf die Relativität der Zeit ausgerichtete Form gebracht hatten. Dank zahlreicher Begegnungen, Briefe, Aufsätze und Erwiderungen war 1910 eine stetig wachsende Zahl von Physikern bereit, der Revision des Zeitbegriffs eine zentrale Bedeutung beizumessen, und in den folgenden Jahren stellten dann viele Philosophen und Physiker die Uhrensynchronisation als den großen Triumph ihrer jeweiligen Disziplin und des modernen Denkens schlechthin dar.
Jüngere Physiker wie Werner Heisenberg orientierten sich in den zwanziger Jahren bei der Entwicklung der Quantentheorie bewusst an Einsteins vermeintlich entschiedener Ablehnung aller Begriffe, die sich – gleich dem der absoluten Zeit – auf keine messbaren Größen bezogen. Heisenberg bewunderte insbesondere Einsteins These, wonach sich der Simultanitätsbegriff ausschließlich auf Uhren bezog, die durch ein eindeutiges und beobachtbares Verfahren gestellt waren. Er und seine Mitstreiter bestanden ganz entschieden auf dem Kriterium der Beobachtbarkeit: Wer etwas über die Position und den Impuls eines Elektrons sagen will, soll angeben, mit welchem Verfahren er die beiden Größen messen kann. Und sofern man nicht beide gemeinsam messen könne, so existierten Ort und Impuls eben nicht gleichzeitig. Einstein hat diese Schlussfolgerung bekanntlich abgelehnt, obwohl Quantenphysiker ihm dann entgegenhielten, sie hätten doch nur seine kritische Einstellung gegenüber Zeit und Gleichzeitigkeit auf das Atom ausgedehnt. Doch es war längst zu spät; Einstein konnte den Geist der Relativität nicht wieder in die Flasche zurückzwingen. Vor allem befürchtete er, die neue Physik könne seine beharrliche Forderung nach überprüfbaren Verfahren übertreiben und dabei übersehen, dass die Theorie ihrerseits erst bestimmt, was man überhaupt beobachten kann. Oder wie Einstein einmal spöttelte: »Einen guten Witz darf man nicht zu oft erzählen.«[8]
Der gute Witz fand rasche Verbreitung. Der Psychologe Jean Piaget machte die Untersuchung der »intuitiven« Zeitvorstellung beim Kind zu einem zentralen Forschungsgegenstand. Einsteins Verfahren der Zeitkoordination diente auch bald schon als das Hauptmodell für eine neue Ära der Wissenschaftstheorie. Die Physiker, Soziologen und Philosophen des »Wiener Kreises« priesen auf ihrer Suche nach einer neuen, betont antimetaphysischen Philosophie die durch synchronisierte Uhren definierte Gleichzeitigkeit als das Vorbild für sinnvolle, verifizierbare wissenschaftliche Begriffe. Auch andernorts in Europa und in den Vereinigten Staaten sahen fortschrittlich gesinnte Philosophen (und Physiker) die durch Signalaustausch gesicherte Gleichzeitigkeit als ein herausragendes Beispiel für wohlbegründetes Wissen an, das jeder müßigen metaphysischen Spekulation zu trotzen vermochte.[9] Aus der Sicht des vielleicht bedeutendsten amerikanischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Willard Van Orman Quine, war letztlich jegliches Wissen vorläufig (selbst die Logik nahm er davon nicht aus). Doch als er sich mit der wissenschaftlichen Erkenntnis als solcher befasste, wählte er Einsteins auf Uhren und Lichtsignale gestützte Definition der Simultanität als etwas allem Anschein nach Haltbares, das es »bei künftigen konzeptionellen Korrekturen noch am ehesten zu bewahren« gelte.[10] In einem durch gewaltige Umbrüche der Wissenschaften geprägten Jahrhundert der Philosophie und in einem Klima der Feindseligkeit gegenüber jeder Form von feststehenden, ewigen Wahrheiten gab es kaum ein höheres Lob.
Selbstverständlich bewunderten nicht alle die Relativität der Zeit; manche machten sie lächerlich, andere versuchten, die Physik vor ihr zu schützen. Doch seit den zwanziger Jahren erkannten Physiker und Philosophen weitgehend an, dass Einsteins Frage nach den Grundlagen der Zeit einen Standard für die wissenschaftliche Begriffsbildung setzte, der etwas Konkreteres, Fasslicheres verlangte als Newtons metaphysische Idee des Absoluten. Einstein selbst erklärte, das kritische Denken David Humes (der im 18. Jahrhundert überzeugend darlegte, dass die Aussage »A verursacht B« nichts anderes bedeute als die regelmäßige Zeitfolge »erst A, dann B«) habe ihm eine scharfe philosophische Waffe gegen den absoluten Zeitbegriff an die Hand gegeben. Eine sehr wichtige Rolle spielte für ihn auch das Werk des Wiener Physikers, Philosophen und Psychologen Ernst Mach, der sich entschieden gegen Begriffe ohne jeden Wahrnehmungsbezug wandte, wobei Newtons »scholastische« Verabsolutierung des Raumes und der Zeit ganz oben auf der Liste jener Abstraktionen stand, denen sein Verdikt galt. Einstein untersuchte die Zeit auch durch die Brille der Arbeiten von Kollegen, wie Hendrik A. Lorentz und Henri Poincaré. Alle diese spekulativen und philosophischen Argumentationsstränge (sowie andere, denen wir später noch begegnen werden) sind fester Bestandteil unserer Geschichte der Zeit und der Zeitmessung, doch bliebe eine rein geistesgeschichtliche Betrachtung letztlich in Abstraktionen stecken. Aus dieser Sicht hätte der Philosoph und Physiker Einstein mit fulminanten Gedankenexperimenten gegen Newtons verstaubtes Dogma einer absoluten Zeit gewütet und ein wissenschaftlich-technisches Establishment aus den Fugen gebracht, das längst viel zu ausgeklügelt war, um noch grundsätzliche Fragen über Zeit und Gleichzeitigkeit stellen zu können. Aber ist eine solche Darstellung ausreichend?
Kritische Opaleszenz
Gewiss blickten Einstein und Poincaré oft auf ihr Werk zurück, als hätte es seinen Ursprung ganz jenseits der materiellen Welt gehabt. Hier lohnt der Blick auf eine Ansprache, die Einstein Anfang Oktober 1933 vor großem Publikum in der Londoner Royal Albert Hall hielt, wo sich Wissenschaftler, Politiker und viele andere versammelt hatten, um Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge und vertriebene Wissenschaftler zu unterstützen. Da Gegendemonstranten die Veranstaltung zu stören drohten, waren tausend Studenten als »Ordner« aufgezogen. Einstein beklagte, dass sich über Europa blinder Hass, Gewalt und Krieg zusammenbrauten, forderte die Welt auf, entschlossen gegen Versklavung und Unterdrückung vorzugehen, und beschwor die Verantwortlichen, den akut drohenden wirtschaftlichen Zusammenbruch noch abzuwenden. Dann ließ er das Thema der brisanten politischen Lage und der weltweiten Krisen plötzlich fallen, so als habe ihn das Unheil der aktuellen Ereignisse über die Maßen strapaziert, und begann in einer ganz anderen Tonlage unvermittelt über Abgeschiedenheit, Kreativität und Ruhe zu reflektieren, über Augenblicke, in denen er, ganz in abstrakte Gedanken versunken und von der anregenden Eintönigkeit der Landschaft inspiriert, vor sich hin gesonnen hatte. »Schließlich empfahl er zur Verblüffung der Hörer noch ein eigenwilliges akademisches Beschäftigungsprogramm, indem er die dem Denken förderliche Ruhe auf Leuchttürmen und Feuerschiffen ins Spiel brachte: ›Wäre es nicht möglich, solche Stellen mit jungen Leuten zu besetzen, die über wissenschaftliche Probleme insbesondere mathematischer oder philosophischer Natur nachdenken wollen?‹«[11]
Man ist versucht, sich seine Jugend geradeso vorzustellen, und das Büro im Berner Patentamt, wo er sich seinen Lebensunterhalt verdiente, als eine Art Feuerschiff weit draußen auf hoher See zu begreifen. Ganz im Sinne der von ihm selbst beschriebenen Idylle ungestörter Kontemplation sehen wir in Einstein den Philosophen und Wissenschaftler, der den Bürolärm und die Stimmen auf dem Flur überhörte, um die Grundlagen seines Fachgebiets neu zu überdenken und Newtons auf die Verabsolutierung von Raum und Zeit gestütztes Denkgebäude zum Einsturz zu bringen. Von Newton zu Einstein: Allzu leicht stellt man sich diese Umwandlung der Physik als eine Kollision gegensätzlicher Theorien vor, die weit über der Sphäre von Maschinen, Erfindungen und Patenten schweben, und Einstein selbst hat zur Entstehung dieses Bildes einiges beigetragen, da er wiederholt den Beitrag des reinen Denkens zur Entwicklung der Relativitätstheorie betonte: »Denn das Wesentliche im Dasein eines Menschen von meiner Art liegt in dem, was er denkt und wie er denkt, nicht in dem, was er tut oder erleidet.«[12]
Unter Einstein stellen wir uns meist einen in höhere Sphären verlorenen Menschen vor, der wie ein Medium Umgang mit den Geistern der Physik pflegt, von der Freiheit Gottes bei der Erschaffung der Welt spricht, über Patentanträge stöhnt, da sie ihn von der Naturphilosophie abhalten, und mit imaginären Uhren und fiktiven Zügen eine Welt der reinen Gedankenexperimente bewohnt. Roland Barthes hat einer solchen Phantasieperson in seinem Aufsatz »Einsteins Gehirn« nachgespürt, worin der Wissenschaftler nur noch als eine zerebrale Masse erscheint, als die Ikone der Intelligenz schlechthin, als ein Zauberer und zugleich als eine körperlose Denkmaschine ohne soziale und psychische Existenz.[13]
Barthes dürfte gewusst haben, dass zu den Wissenschaftlern, die hoch über der materiellen Welt zu schweben schienen, auch Henri Poincaré gehörte, der außergewöhnliche französische Universalgelehrte, der unabhängig von Einstein eine genau durchgearbeitete mathematische Physik entwickelte, die ebenfalls das Relativitätsprinzip enthielt. In stilistisch ausgefeilten Essays unterbreitete er seine Ergebnisse einem breiten gebildeten Publikum und sondierte zugleich die Grenzen und Errungenschaften der modernen, aber auch der klassischen Physik. Ähnlich wie Einstein stellte sich Poincaré als Freigeist dar und beschrieb in einem eindrucksvollen Bericht über den Ablauf eines kreativen Schubes, wie er auf die Theorie neuartiger Funktionen kam, die später in mehreren Bereichen der Mathematik eine bedeutende Rolle spielen sollten:
»Seit vierzehn Tagen mühte ich mich ab zu beweisen, dass es keine derartigen Funktionen gibt, wie doch diejenigen sind, die ich später Fuchs’sche Funktionen genannt habe; ich war damals sehr unwissend, täglich setzte ich mich an meinen Schreibtisch, verbrachte dort ein oder zwei Stunden und versuchte eine große Anzahl von Kombinationen, ohne zu einem Resultate zu kommen. Eines Abends trank ich entgegen meiner Gewohnheit schwarzen Kaffee und ich konnte nicht einschlafen: die Gedanken überstürzten sich förmlich; ich fühlte außerordentlich, wie sie sich stießen und drängten, bis sich endlich zwei von ihnen aneinander klammerten und eine feste Kombination bildeten. Bis zum Morgen hatte ich die Existenz einer Klasse von Fuchs’schen Funktionen bewiesen. […] Ich brauchte nur noch die Resultate zu redigieren, was in einigen Stunden erledigt war.«[14]
Nicht nur bei der Erklärung der von ihm entdeckten Funktionen, sondern auch in allen seinen bemerkenswerten philosophischen und naturwissenschaftlichen Aufsätzen analysierte Poincaré physikalische und andere Probleme mit Hilfe fiktiver, frei erfundener Situationen, in denen sich imaginäre Wissenschaftler gleichsam schwebend durch idealisierte Alternativwelten bewegen konnten: »Man nehme an, dass ein Mensch auf einen Planeten versetzt sei, dessen Himmel beständig mit einer dicken Wolkenschicht bedeckt wäre, und zwar derart, dass man niemals die anderen Gestirne bemerken könnte; auf diesem Planeten würde man leben, als ob derselbe im Raume isoliert wäre. Dieser Mensch könnte indessen bemerken, dass sich der Planet dreht, entweder indem er die Abplattung nachmisst (was man gewöhnlich mit Hilfe astronomischer Beobachtungen bewerkstelligt, was man aber auch mit rein geodätischen Hilfsmitteln ausführen kann), oder, indem er das Experiment des Foucault’schen Pendels wiederholt. Die absolute Rotation des Planeten würde also völlig klar gestellt werden.«[15] Wie so oft benutzte Poincaré hier eine erfundene Welt, um einen wirklich bestehenden philosophisch-physikalischen Zusammenhang aufzuzeigen.
Sicher könnte man – sogar mit Gewinn – Einstein und Poincaré als abstrakte Denker lesen, denen vor allem vorschwebte, philosophische Unterscheidungen anhand rein hypothetisch phantasierter, reich mit Metaphern ausgestatteter Welten zu verdeutlichen. Vermutlich hatte Poincaré eine solche Welt vor Augen, als er zum Beispiel derart heftige Temperaturschwankungen beschrieb, dass sich Objekte beim Auf- oder Absteigen darin stark verlängern respektive verkürzen würden. Entsprechend ließen sich seine und Einsteins Angriffe auf Newtons absolute Gleichzeitigkeit auch als bloß metaphorische Gedankenspielereien mit imaginären Eisenbahnzügen, fiktiven Uhrenmodellen und abstrakten Telegraphen auffassen.
Kehren wir zu Einsteins zentraler Frage zurück. Mit einem, wie es scheinen mag, kurios metaphorischen Gedankenexperiment wollte er herausfinden, was es bedeuten soll zu sagen, dass ein Zug um sieben Uhr ankommt. Lange habe ich gedacht, er gehe hier einer der Fragen nach, die man sich (so er selbst) eigentlich nur als Kind stellt, während Einstein zeit seines Lebens daran festhielt.[16] War das die Naivität des abgehobenen Genies? So betrachtet, wären Fragen nach Raum und Zeit zu elementar, als dass Berufswissenschaftler noch darauf kämen. Doch lag das Gleichzeitigkeitsproblem wirklich unter der Wahrnehmungsschwelle professionellen Denkens? Fragte sich damals, um 1904 oder 1905, tatsächlich sonst niemand, was es bedeutet, hier an dieser Stelle zu sagen, dass ein weit entfernter Beobachter einen Zug um sieben Uhr ankommen sieht? War der Einfall, die Gleichzeitigkeit distanter Ereignisse durch Austausch elektrischer Signale zu definieren, ein rein philosophisches Konstrukt, das der übrigen Welt um die Jahrhundertwende vollkommen fern lag?
1.3 Der Berner Hauptbahnhof um 1865. Eines der ersten Gebäude in Bern, die mit mehreren koordinierten Uhren ausgestattet wurden; zwei sieht man an der offenen Seite direkt oberhalb der ovalen Bögen. (Quelle: Bürgerbibliothek Bern, Negativ 12572.)
Mir selbst lag das Relativitätsprinzip fern genug, als ich vor einiger Zeit in einem nordeuropäischen Bahnhof stand und geistesabwesend auf die eleganten Uhren entlang des Bahnsteigs schaute. Sie zeigten alle dieselbe Minute an. Seltsam. Gute Uhren. Dann bemerkte ich, dass sogar die Sekundenzeiger im Gleichschritt marschierten. Diese Uhren sind nicht nur gut, dachte ich da, sie sind auch koordiniert. Solche koordinierten Uhren musste auch Einstein vor Augen gehabt haben, als er 1905 an seinem Aufsatz arbeitete und zu verstehen versuchte, was mit der Simultanität distanter Ereignisse gemeint sein könnte. Tatsächlich lag direkt gegenüber dem Berner Patentamt der alte Hauptbahnhof, dessen Fassade und Bahnsteige zahlreiche koordinierte Uhren zierten.
1.4 L'Horloge-mère in Neuchâtel. Die schön ornamentierten Zentraluhren waren sehr wertvoll und der ganze Stolz ihrer Kommunen. Meist erhielten sie, genau wie diese, ihre Signale von einer Sternwarte und gaben sie über Telegraphenkabel weiter. (Quelle: Favarger, L'Électricité [1924], S. 414.)
1.5 Normaluhr, Schlesischer Bahnhof in Berlin. Nach dieser Uhr richtete sich die Zeit der vielen von dort abgehenden Bahnlinien. (Quelle: Favarger, L'Électricité [1924], S. 470.)
Doch wie so vieles in der Technikgeschichte, liegen die Ursprünge der koordinierten Uhren im Dunkeln. Welche der zahlreichen Komponenten eines technischen Systems soll als dessen prägendes Merkmal gelten? Die Nutzung der Elektrizität? Die Koppelung zahlreicher Uhren? Die Fernsteuerung? Jedenfalls begannen die Briten Charles Wheatstone und Alexander Bain schon in den 1830er und 1840er Jahren, wenig später auch der Schweizer Mathias Hipp und zahlreiche andere Erfinder in Europa und Amerika, eine Vielzahl weit auseinander liegender Uhren über einen Stromkreis mit einer Zentraluhr zu verbinden, die sie in den verschiedenen Sprachen als horloge-mère, master clock oder »primäre Normaluhr« bezeichneten.[17]
In Deutschland führte Leipzig als erste Stadt ein elektrisch gesteuertes Uhrensystem ein, und als Nächste folgte Frankfurt am Main. In der Schweiz leitete Hipp (der damals einem Telegraphenbetrieb vorstand) erste Schritte in die Wege und setzte 1890 im Berner Bundeshaus die Zeiger von hundert Uhren gleichzeitig in Gang. Wenig später umfasste die Uhrenkoordination Genf, Basel, Neuchâtel und Zürich mitsamt ihren Bahnlinien.[18]
Einstein war daher nicht nur von der Technik der Uhrenkoordination umgeben, sondern lebte in einem der großen Zentren, in dem wegweisende Neuerungen auf diesem Gebiet erfunden, gebaut und patentiert wurden. Gab es noch andere bedeutende Wissenschaftler, die sich wie er mit den fundamentalen Gesetzen des Elektromagnetismus und den philosophischen Grundlagen der Zeit befassten und dabei im Mittelpunkt dieser weitreichenden Bemühungen um die Uhrensynchronisierung standen? Ganz sicher gab es mindestens einen.
Etwa sieben Jahre bevor der damals sechsundzwanzigjährige Patentbeamte 1905 die Gleichzeitigkeit in seinem berühmten Aufsatz neu definierte, hatte Henri Poincaré frappierend ähnliche Ideen vorgetragen. Der vielseitige Gelehrte galt weithin als einer der größten Mathematiker des 19. Jahrhunderts, nachdem er nicht nur einen Großteil der Topologie entwickelt, sondern auch gewaltige Beiträge zur Himmelsmechanik und zur Elektrodynamik bewegter Körper geleistet hatte. Ingenieure lobten seine Arbeiten auf dem Gebiet der drahtlosen Telegraphie. Ein breites Publikum verschlang seine Bestseller über die Philosophie der Konventionen, den Wert der Wissenschaft und die »Naturwissenschaft als Selbstzweck«.
Einen der für unseren Gegenstand bemerkenswertesten Aufsätze veröffentlichte Poincaré 1898 in der Revue de Métaphysique et de Morale unter dem Titel »La mesure du temps«. Darin attackierte er die populäre, zuerst von dem einflussreichen französischen Philosophen Henri Bergson vertretene Auffassung, wonach wir Zeit, Synchronität und Dauer intuitiv zu erfassen vermögen. Poincaré erklärte dagegen, Gleichzeitigkeit sei lediglich eine Konvention, eine Übereinkunft zwischen Menschen, ein Vertrag, den man geschlossen hatte, nicht weil er unbedingt der Wahrheit entsprach, sondern weil er unseren menschlichen Bedürfnissen am besten entsprach. Als solche müsse man die Simultanität formal definieren, und dafür biete sich das Verfahren an, durch den Austausch elektromagnetischer Signale (das heißt telegraphischer Impulse oder Lichtblitze) koordinierte Uhren abzulesen. Wie Einstein 1905, hatte Poincaré schon 1898 erklärt, um die Gleichzeitigkeit verfahrenstechnisch zu definieren, müsse man bei jedem telegraphisch übermittelten Zeitsignal die Übertragungszeit berücksichtigen.
Kannte Einstein den Artikel von 1898 oder eine andere wichtige Abhandlung Poincarés aus dem Jahr 1900, als er 1905 seinen Aufsatz schrieb? Obwohl es keine überzeugenden Belege für eine Bejahung oder Verneinung dieser Frage gibt, lohnt es die Mühe, ihr im engeren wie auch weiteren Sinne nachzugehen. Denn im Grunde muss Einstein diesen speziellen Aufsatz gar nicht rezipiert haben, da man sich seinerzeit auch in philosophischen und gelegentlich in physikalischen Zeitschriften mit dem Thema befasste. Die elektromagnetischen Methoden der Uhrensynchronisation faszinierten das Publikum um die Jahrhundertwende so sehr, dass sogar eines der wissenschaftlichen Lieblingsjugendbücher Einsteins sie ausführlich behandelte.[19] Als er seinen Aufsatz schrieb, sorgten bereits viele über Land und durchs Meer gelegte Kabel für eine weltweite Uhrenkoordination. Das synchronisierte Zeitmessgerät war allgegenwärtig.
Wie Kommentatoren fast routinemäßig Einsteins Ausführungen über Züge, Signale und Gleichzeitigkeit als ausgedehnte Metaphern und literarisch-philosophische Gedankenexperimente begreifen, so versteht man heute auch Poincarés Aussagen im übertragenen Sinne. Angeblich nehmen sie als philosophische Spekulationen bereits Einsteins spezielle Relativitätstheorie vorweg und zeugen von der tiefen Einsicht eines glänzenden Autors, dem lediglich der intellektuelle Mut fehlte, sie bis zu ihrer revolutionären logischen Konsequenz weiterzuführen. So sehr haben wir uns an diese Darstellung gewöhnt, dass es inzwischen als ein Gemeinplatz erscheint, Poincarés Wissen um die Zeitkoordination als ein völlig isoliertes, von seinem Umfeld gänzlich losgelöstes philosophisches Aperçu zu behandeln. Doch weder Poincaré noch Einstein schwebten im luftleeren Raum, als sie sich über das Zeitproblem äußerten.
Poincaré fragte: Nach welchen Regeln beurteilen Wissenschaftler die Gleichzeitigkeit, und was ist sie? Als abschließendes – und überzeugendstes – Beispiel zog er die Längenbestimmung heran: Um ihre jeweilige Position zu ermitteln, mussten Seeleute oder Geographen genau das gleiche Simultanitätsproblem lösen wie Poincaré in seinem Aufsatz, nämlich die Pariser Zeit errechnen, ohne selbst in Paris zu sein.
Die geographische Breite ist leicht feststellbar. Strahlt der Polarstern senkrecht über mir, stehe ich am Nordpol, befindet er sich auf halber Höhe, so bin ich auf der Breite von Bordeaux, und berührt er den Horizont, so liegt mein Standort in Äquatornähe etwa auf der Breite Ecuadors. Dabei spielt es keine Rolle, wann ich die Breitenmessungen vornehme, denn der Winkel des Polarsterns bleibt an jedem Ort gleich. Die Ermittlung der Längendifferenz zweier Orte ist dagegen weitaus schwieriger, da zwei Beobachter gleichzeitig weit voneinander entfernt astronomische Messungen vornehmen müssen. Ohne Erdrotation gäbe es keine Probleme: Beide würden gen Himmel blicken und (zum Beispiel) feststellen, welche Sterne direkt unterhalb des Polarsterns stehen. Dann könnten sie auf einer Himmelskarte leicht ihre relativen Längen ablesen. Doch die Erde dreht sich nun einmal, und um die Längendifferenz genau zu bestimmen, müssen wir sicher sein, die Positionen der Sterne (bzw. der Sonne oder der Planeten) exakt gleichzeitig zu messen. Nehmen wir an, ein Kartograph in Nordamerika kennt die Pariser Zeit und registriert, dass die Sonne bei ihm genau sechs Stunden später aufgeht als in der Seinemetropole. Da eine Erdumdrehung vierundzwanzig Stunden dauert, weiß der Kartograph, dass er sich auf einem Längengrad befindet, der sechs Vierundzwanzigstel (also ein Viertel) des Erdumfanges (das heißt neunzig Grad) westlich von Paris liegt. Aber woher weiß er die Pariser Uhrzeit?
In »Das Maß der Zeit« schrieb Poincaré, der Kartograph habe zwar bei der Abfahrt einen auf die Pariser Ortszeit eingestellten Präzisionszeitmesser eingepackt, aber der Transport solcher Chronometer bringe sowohl theoretische als auch praktische Probleme mit sich; daher könnten der Forscher und die Pariser Kollegen stattdessen an ihren jeweiligen Standorten ein astronomisches Ereignis verfolgen (beispielsweise das Hervortreten eines der Monde hinter dem Jupiter) und dann ihre Beobachtungen für gleichzeitig erklären. Doch hat dieses Verfahren seine Tücken. Zum einen ist die Verfinsterung von Jupitermonden nicht so leicht bestimmbar, und zum anderen bedürfte die so festgestellte Zeit auch aus prinzipiellen Gründen einer Korrektur, da das Jupiterlicht auf unterschiedlichen Bahnen zu den irdischen Beobachtungsposten gelangte. Eine letzte Möglichkeit bestünde darin, auf telegraphischem Wege elektrische Zeitsignale zwischen dem Forscher und Paris auszutauschen, und auf dieses Verfahren setzte Poincaré:
»Es ist klar, dass die Aufnahme des Signals in Berlin zum Beispiel später erfolgt als die Aufgabe des gleichen Signals in Paris. Das ist die Regel von Ursache und Wirkung, die oben besprochen worden ist.
Aber um wie viel später? Gewöhnlich vernachlässigt man die Dauer der Übertragung und betrachtet die beiden Ereignisse als gleichzeitig. Aber um streng zu sein, müsste man wieder eine kleine Korrektion machen, die eine umständliche Rechnung erfordert. Man macht sie in der Praxis nicht, weil sie viel geringer sein würde als die Beobachtungsfehler; ihre Notwendigkeit besteht nichtsdestoweniger für unsern Gesichtspunkt einer strengen Definition.«[20]
Das intuitive Zeitverständnis reicht Poincaré zufolge nicht aus, um Gleichzeitigkeitsfragen zu klären, und man dürfe sich keiner Täuschung hingeben. Jedenfalls müssten zur Intuition formale Messvorschriften hinzutreten: »Welcher Art aber sind diese Regeln? Es sind keine allgemeinen, keine genauen Regeln, sondern eine Menge kleiner, auf jeden besonderen Fall anwendbarer Vorschriften. Diese Regeln drängen sich uns nicht auf, und man könnte sich damit unterhalten, andere zu erfinden; jedoch würde man nicht von ihnen abweichen können, ohne den Wortlaut der physikalischen, mechanischen, astronomischen Gesetze viel weitläufiger zu machen. Wir wählen also diese Regeln, nicht weil sie wahr sind, sondern weil sie die bequemsten sind.«[21] Alle diese Konzepte – »die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse oder ihre Aufeinanderfolge und die Gleichheit zweier Zeiträume« – müssten derart definiert werden, dass sich die Naturgesetze so einfach wie möglich formulieren lassen. »Mit anderen Worten, alle diese Regeln, alle diese Definitionen sind nur die Früchte eines unbewussten Opportunismus.«[22] Die Zeit hat also Poincaré zufolge nicht den Status einer absoluten Wahrheit, sondern den einer Konvention.
Welche Zeit ermitteln die Kartographen für Berlin, wenn es in Paris zwölf schlägt? Welche Zeit ist es später, wenn der Zug im Berner Hauptbahnhof einfährt? Diese Fragen, die Poincaré und Einstein sich stellten, erscheinen auf den ersten Blick verblüffend einfach. Und Ähnliches gilt für die Antwort: Zwei voneinander entfernte Ereignisse sind gleichzeitig, wenn man an beiden Orten auf koordinierten Uhren dieselbe Zeit abliest – Punkt zwölf in Paris, ebenso in Berlin. Solche Urteile betreffen unausweichlich Konventionen über Verfahren und Messregeln. Wer nach der Gleichzeitigkeit fragt, will also wissen, wie man Uhren koordiniert. Poincarés und Einsteins Vorschlag lautete: Man sende ein elektromagnetisches Signal von einer Uhr zur anderen und berücksichtige dabei die Übertragungszeit des Signals (bei annähernd Lichtgeschwindigkeit). Eine einfache Idee mit atemberaubenden Konsequenzen – für die Begriffe des Raumes und der Zeit, für die neue Relativitätstheorie, für die moderne Physik, für die konventionalistische Philosophie, für die Überziehung der Erde mit einem elektronischen Navigationsnetz und für unser Ideal gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis.
Und nun geht es mir um folgende Fragen: Wie ging man um die Jahrhundertwende bei der Herstellung von Gleichzeitigkeit praktisch vor? Wie kamen Poincaré und Einstein auf den Einfall, sie durch ein konventionell festgelegtes Verfahren der Uhrenkoordination mittels elektromagnetischer Signale zu definieren? Diese Fragen sprengen einen rein biographischen Ansatz (wobei es gewiss viel mehr Einstein- als Poincaré-Biographien gibt), und ich strebe hier auch keine Chronologie der philosophischen Zeitvorstellungen an, für die man bis weit hinter Aristoteles zurückgehen müsste; ebenso wenig eine Entwicklungsgeschichte der allgemeinen oder speziell elektrischen Zeitmessung und schließlich auch keine Synopse der im 19. Jahrhundert weithin akzeptierten Begriffe der Elektrodynamik, die Poincaré und Einstein benutzten, als sie sich um eine Neufassung der Elektrodynamik bewegter Körper bemühten.
Vielmehr präsentiere ich einen Querschnitt durch Physik, Technik und Philosophie, folge den Spuren synchronisierter Uhren, die uns kreuz und quer durch Zeit und Raum führen, von den unterseeischen Kabeln bis zu den preußischen Armeen auf ihrem Marsch, von der Philosophie des Konventionalismus bis in den Kernbereich der Physik und der Relativität. Man nehme ein Kabel des im 19. Jahrhundert geschaffenen Telegraphennetzes auf und folge seinem Verlauf: Es zieht sich durch den Atlantik bis zu den felsigen Stränden Neufundlands hinauf, reicht von Europa über den Pazifik bis in den Hafen von Haiphong und windet sich am Meeresgrund die afrikanische Westküste entlang. Folgt man den über Land verlegten Drähten und Kabeln aus Eisen, Guttapercha und Kupfer, so zieht sich der Weg bis über die Anden, ins senegalesische Hinterland sowie kreuz und quer über den amerikanischen Kontinent, von Massachusetts bis San Francisco. Kabel verliefen den Eisenbahnstrecken entlang, durchquerten Ozeane und verbanden die Baracken kolonialer Expeditionen mit den Prachtbauten großer Sternwarten.
Doch die Telegraphenkabel kamen nicht allein, sondern gingen Hand in Hand mit ehrgeizigen nationalen Projekten, mit Kriegführung, Industrialisierung, Forschung und Eroberung, waren augenfällige Zeichen internationaler Konventionen über Längengrade, Zeiten und elektrische Maßeinheiten. Und weder im 19. noch im 20. Jahrhundert ging es bei der Uhrenkoordination jemals allein um das simple Verfahren des Signalaustauschs. Poincaré gehörte zu den Verwaltern des globalen elektrischen Zeitnetzes, und Einstein arbeitete als Experte in der zentralen Schweizer Prüfstelle für neue Elektrotechniken. Angesichts dieser weltumspannenden Synchronisation springt geradezu ins Auge, was an der modernen Physik so modern ist und warum Einstein ebenso wie Poincaré jeweils an dieser Moderne teilhatten.
Selbstverständlich können wir etwas lernen aus dem erstaunlichen Gegensatz zwischen dem Zeitbegriff Newtons aus dem 17. und dem Einsteins und Poincarés aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die beiden Konzepte sind gleichsam Monumente einer Kollision zwischen früher Neuzeit und Moderne: Auf der einen Seite stehen Raum und Zeit als Modalitäten des göttlichen Sensoriums, auf der anderen als Produkte von Maßstäben und Uhren. Doch der Kontrast zwischen den beiden Epochen darf uns nicht blind machen für das uns hier vor allem interessierende Naheliegende, namentlich den Alltag von 1900, in dem man – das heißt nicht nur Poincaré und Einstein – sich daran gewöhnt hatte, Zeit, Konventionen, Technik und Physik als ein großes Ganzes zu betrachten. Während es damals durchaus sinnvoll erschien, Maschinen und Metaphysik in einen Topf zu werfen, hat sich diese Nachbarschaft zwischen Dingen und Gedanken offenbar ein Jahrhundert später aufgelöst.
Vielleicht können wir uns eine derart enge Verbindung zwischen Wissenschaft und Technik heute deshalb kaum noch vorstellen, weil wir uns an historische Schubladen gewöhnt haben: Für das Geistige ist die Ideengeschichte zuständig, für Schichten, Gruppen und Institutionen die Sozialgeschichte und für Personen in ihrem Umfeld die Biographie oder Mikrogeschichte. Wenn das Verhältnis zwischen reiner und angewandter Wissenschaft zur Debatte steht, folgt man abstrakten Ideen gelegentlich bis ins Labor, in Industriebetriebe und in den Alltag hinein, geht gelegentlich auch umgekehrt vor und erhebt sich von profanen technischen Apparaturen über die Stufenleiter der Abstraktionen bis zum Theoretischen – von der Werkstatt ins Labor, ans Reißbrett und schließlich gar in die höheren Sphären der Philosophie. Tatsächlich läuft es in den Naturwissenschaften oft so ab: Aus ätherischen Dämpfen scheinen sich reine Ideen zu bilden und in gewöhnlicher Materie niederzuschlagen. Doch umgekehrt scheinen Ideen sich auch ausgehend vom Alltäglichen und Handfesten zu ätherischer Existenz zu sublimieren. Die folgende Darstellung der Zeitkoordination entspricht keinem der beiden Bilder – fortschreitende Sublimation oder Niederschlag. Wir brauchen ein anderes.
Stellen wir uns ein Meer vor, über dem eingeschlossen eine Atmosphäre aus Wasserdampf liegt. Bei Erwärmung verdunstet das Wasser, kühlt sich als Dampf ab, kondensiert und fällt als Regen ins Meer. Steigen jedoch der Druck- und die Temperatur derart an, dass sich der Dampf durch die Ausdehnung des Wassers stark verdichtet, Flüssigkeit und Gas schließlich die gleiche Dichte erreichen, so geschieht kurz vor diesem kritischen Zustand etwas äußerst Seltsames. Wasser und Dampf bleiben nicht stabil, sondern Blasen aus Wasser und Dampf beginnen zwischen den beiden Aggregatzuständen – gasförmig und flüssig – zu schwanken, wobei die Größe der Blasen von kleinen Molekülgruppen bis zu Sphären fast von der Größe des gesamten Systems reicht. Im kritischen Zustand selbst lösen die unterschiedlichen Tropfengrößen Lichtbrechungen aller Wellenlängen aus: Die kleineren machen violettes, die größeren rotes Licht, bis schließlich das ganze Spektrum erscheint wie auf der Perlmuttschicht einer Muschel. Eine derartige Lichtreflexion bei Phasenwechseln mit heftigen Schwankungen bezeichnet man als »kritische Opaleszenz«.
Genau dieses Bild brauchen wir für die Zeitkoordination. Zu seltenen Gelegenheiten geschehen wissenschaftlich-technische Durchbrüche, die sich nicht klar und eindeutig technisch, wissenschaftlich oder philosophisch einordnen lassen. So stieg die Koordination der Zeit in dem halben Jahrhundert nach 1860 weder in langsamen gleichmäßigen Schritten von der Technik aus hinauf in die dünne Luft der Wissenschaft und Philosophie, noch erwuchsen die Ideen zur Synchronisation der Zeit aus dem reinen Denken, um dann ihren Niederschlag in den Komponenten und Abläufen von Maschinen und Fabriken zu finden. Vielmehr entsprach die Zeitkoordination, angesichts ihres ständigen Schwankens zwischen abstrakten und konkreten Ausformungen sowie ihrer stark wechselnden Größenordnung, den heftigen Phasenwechseln der kritischen Opaleszenz.
In den Archiven nahezu aller Städte Europas und Nordamerikas (und sogar noch weit darüber hinaus) findet man Belege für den damals um die Jahrhundertwende geführten Kampf um die Koordinierung der Zeit. Dort stapeln sich die Akten von Eisenbahndirektoren, Nautikern und Juwelieren, aber auch Wissenschaftlern, Astronomen, Ingenieuren und Unternehmern. Bei der Zeitkoordination ging es ebenso darum, in Schulen die einzelnen Klassenzimmeruhren zentral zu steuern, wie die öffentlichen Uhren von Städten, Eisenbahnlinien oder ganzen Nationen zu koordinieren, wobei man vielfach erbittert über das Vorgehen stritt. Berücksichtigt man auch die Staatsarchive, so erweitert sich die Liste der Mitwirkenden um Anarchisten, Demokraten, Kosmopoliten, Generäle.
Angesichts dieses Stimmengewirrs möchte ich zeigen, dass die Uhrensynchronisation schließlich nicht mehr nur Verfahrensfragen betraf, sondern auch die Abstimmung zwischen den Sprachen von Wissenschaft und Technik. Die Entwicklung der Zeitkoordination um 1900 war kein geradliniger Fortschritt zu immer genaueren Uhren, sondern eine Entwicklung, in der Physik, Industrie, Philosophie, Kolonialismus und Kommerz aufeinander prallten. In jedem Moment ging es um praktische ebenso wie um ideale Ziele; ebenso um im Nassverfahren auf eisenverstärkte Kupferdrähte geschichtetes Guttapercha wie um die kosmische Zeit. Zeitregulierung wurde so unterschiedlich interpretiert, dass sie in Deutschland die nationale Einheit symbolisieren und genauso gut im Frankreich der Dritten Republik die vernünftige Vollendung der Revolution verkörpern konnte.
Im Folgenden werde ich den Durchgang der Synchronisierung durch die Phase kritischer Opaleszenz verfolgen und dabei Poincarés und Einsteins neues Konzept der Simultanität in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir die industrielle Fertigung der Zeit und ihre Vertriebskanäle untersuchen, führt unser Weg immer wieder an zwei bedeutsame, ganz unmittelbar mit den von Einstein und Poincaré benutzten Metaphern assoziierte Stätten: das Pariser Bureau des Longitudes und das Berner Patentamt. Aufgrund ihrer Tätigkeit in diesen beiden Zentren standen Poincaré und Einstein als Vorkämpfer, Wortführer, Beobachter und Koordinatoren an den Zusammenflüssen verschiedener Strömungen der Zeitkoordination.
Der Argumentationsgang
Da sich die Geschichte der Zeitkoordination nicht als eine Entwicklung darstellen lässt, die von einer aus Eisenbahnern, Erfindern und Naturwissenschaftlern gebildeten Kerngruppe ausgehend immer weitere Kreise zog, müssen wir ständig wechseln zwischen lokalen und globalen Darstellungen. Im zweiten Kapitel, »Kohlen, Chaos & Konventionen«, präsentiere ich Poincaré auf eine zunächst vielleicht ungewohnt erscheinende Weise. Denn wer hätte bei der Lektüre seines 1902 publizierten Bestsellers La science et l’hypothèse (Wissenschaft und Hypothese) wohl gedacht, dass der Autor kurz zuvor als studierter Bergingenieur die gefährlichen, unter starkem wirtschaftlichen Druck arbeitenden Kohlegruben Nordfrankreichs inspiziert hatte? Dass er jahrzehntelang in leitender Stellung – 1899 (und dann erneut 1909 und 1910) sogar als Präsident – im Pariser Bureau des Longitudes tätig war? Oder dass er zu den Herausgebern und Autoren einer bedeutenden elektrotechnischen Fachzeitschrift gehörte, in der theoretische Abhandlungen über Grundfragen der Elektrodynamik direkt neben solchen über die Unterwasserkabel und die Elektrifizierung der Städte standen?
Um die Erneuerung – und radikale Säkularisierung – des Zeitbegriffs zu verstehen, müssen wir Poincaré anders verorten, denn solange wir ihn nur als philosophisch denkenden Mathematiker einerseits und mathematischen Physiker andererseits sehen (was er freilich beides war), steht seine konventionalistische Auffassung der Gleichzeitigkeit stets in zweidimensionaler Verflachung da, zumal sein Interesse an der Technik kein bloßes Hobby war. Ich betrachte Poincaré auch nicht als abgehobenen Denker, der gelegentlich auf ein paar philosophische, mathematische oder physikalische »Hilfsmittel« zurückgriff, um bestimmte Probleme zu lösen. Vielmehr möchte ich zeigen, dass er sich in einem dichten Geflecht von Interessen bewegte, aus denen an einigen entscheidenden Schnittpunkten weitgehend in sich schlüssige physikalische (philosophische oder technische) Strategien hervorgingen. Poincaré pickte sich aus dem Wissen, das ihm sein Studium an der École Polytechnique beschert hatte, nicht einzelne Verfahrensweisen heraus, sondern war insgesamt deren Produkt: Wie er selbst es einmal ausdrückte, trugen die Ehemaligen voller Stolz ihr »Fabrikzeichen«. Diese Prägung ließ ihn mit gleich starkem Engagement ein Grubenunglück untersuchen, die innere Struktur und Stabilität des Sonnensystems analysieren und Fragen der reinen Mathematik erörtern. In einer Nahaufnahme Poincarés wird dieser prinzipielle Zusammenhang zwischen konkreten und abstrakten Belangen deutlich, und auf ihn kommt es maßgeblich an, um nachvollziehen zu können, warum Poincaré immer wieder darauf bestand, den Begriff der Gleichzeitigkeit aus den unterschiedlichen, aber sich überschneidenden Perspektiven von Physik, Philosophie und Technik zu betrachten.
Doch die Prägung durch das Studium an der École Polytechnique (und die sich anschließende Tätigkeit als Mineninspekteur und Mathematiker) grenzt noch nicht das ganze Terrain ein, auf dem sich die Säkularisierung der Zeit vollzog, denn dieses reichte weit über Frankreich hinaus bis in die aneinander stoßenden Kabel- und Schienennetze, deren Ausbau die Großmächte mit halsbrecherischer Geschwindigkeit vorantrieben. Diese Systeme an ihren häufig umstrittenen Grenzen kompatibel zu machen, setzte Regeln und Konventionen voraus, sodass man in den 1870er und 1880er Jahren – manchmal unter erheblichen Mühen – versuchte, die Kollisionen der unterschiedlichen Längen- und Zeitmaße auf dem Verhandlungsweg abzumildern. Damit lassen wir im dritten Kapitel, »Die telegraphische Weltkarte«, die Nahaufnahme des zweiten hinter uns zurück.
Stattdessen treten hier das globale Geflecht der Kabelnetze und die internationalen Konflikte in den Blickpunkt. Im ausgehenden 19. Jahrhundert trat die Notwendigkeit allgemein gültiger Konventionen nirgends deutlicher zutage als bei der Anfertigung von Weltkarten. Angesichts des rapide wachsenden Seehandels wuchs bei den Nautikern die Unzufriedenheit über höchst unterschiedliche und vielfach unzuverlässige Längeneinteilungen. Grund zum Unmut hatten auch die Kolonialbehörden, die immer neue Landstriche erobern, Rohstoffquellen ausbeuten und Eisenbahnen bauen sollten. Für alle diese Zwecke benötigte man genaues Kartenmaterial, und die verschiedenen Forderungen stießen 1884 zusammen, als sich zweiundzwanzig Staaten bei einer Konferenz im amerikanischen Außenministerium mühsam darauf verständigten, den Nullmeridian – also den Ausgangspunkt der Längenmessung – durch das englische Greenwich laufen zu lassen. Enttäuscht und erzürnt über diesen Triumph des britischen Empire, forderte Frankreichs Delegation im Gegenzug die Dezimalisierung der Zeit, um so die neue Weltkarte wenigstens in diesem Bereich mit dem Stempel der aufgeklärten Vernunft zu versehen.
Das vierte Kapitel, »Poincarés Karten«, setzt dann Mitte der 1890er Jahre auf dem Höhepunkt des französischen Feldzuges für eine vernünftige Zeitmessung ein, an dem sich Poincaré maßgeblich beteiligte. Aufgrund des offiziellen Auftrages, mit Hilfe eines interministeriellen Ausschusses den noch aus Revolutionszeiten stammenden Vorschlag einer Dezimalisierung der Uhr und damit der Kreiseinteilung zu prüfen, musste er sich ganz direkt mit konkurrierenden Ansätzen für eine neue Konvention der Zeitmessung auseinander setzen. Zugleich stieg er in die Führungsriege des Bureau des Longitudes auf, dessen Hauptaufgabe darin bestand, durch weltweite Uhrenkoordination eine höchst präzise Weltkarte herzustellen. Auf diesem Umweg über die Geodäsie und Synchronisation in Europa, Afrika, Asien und den beiden Amerikas können wir schließlich Poincarés Anregung aufgreifen, Simultanität als eine Konvention zu behandeln. Wenn sich Gleichzeitigkeit nur durch Synchronisierung von Uhren herstellen ließ, sollte man dabei genauso vorgehen wie Kartographen bei der Bestimmung von Längengraden, nämlich telegraphische Signale einsetzen. Dieser in kartographischer wie zeitmetaphysischer Hinsicht zeitgemäße Schritt war von außerordentlicher Bedeutung, da er den absoluten theologischen Grundbegriff Newtons durch ein Verfahren ablöste: Wo einst die ruhige Hand Gottes geherrscht hatte, ging es nun um die technische Herstellung von Synchronizität.
Bei seiner Analyse der Zeit aus dem Jahr 1898 zog Poincaré weder die Elektrodynamik noch das Relativitätsprinzip heran, sondern stellte diesen Zusammenhang erst 1900 her, als er sich erneut mit älteren Arbeiten des holländischen Physikers Hendrik Antoon Lorentz befasste, der 1895 eine raffiniert aufgebaute Theorie des Elektrons vorgelegt hatte. Im Blick auf das äthergestützte ruhende Bezugssystem, für das die (Maxwell’schen) Gleichungen über das elektromagnetische Feld gelten sollten, postulierte Lorentz eine »wahre Zeit«. Nehmen wir an, ein Gegenstand – zum Beispiel ein Eisenblock – bewege sich gegenüber dem besagten Bezugssystem und die Maxwell’schen Gleichungen stellten die elektromagnetischen Felder innerhalb und außerhalb des Metalls zutreffend dar. Wie ließen sich nun die Verhältnisse aus der Perspektive eines mit dem Objekt bewegten Bezugssystems beschreiben? Es schien, als würden die physikalischen Zusammenhänge erheblich komplizierter, wenn man auch eine Bewegung des Bezugssystems durch den Äther berücksichtigen musste. Doch Lorentz fand heraus, dass er durch eine Umdefinition der Felder und der Zeitvariablen auf ähnlich einfache Gleichungen wie im Fall des ruhenden Bezugssystems kam. Da er in dieser Definition die Zeit eines Ereignisses von seinem Ort abhängen ließ, bezeichnete er sie als »lokal« – benutzte also die in der Alltagssprache gebräuchliche Vorstellung einer (von der geographischen Länge abhängigen) »Ortszeit« etwa in Leiden, Amsterdam oder Djakarta –, nur dass seine lokale Zeit eine mathematische Fiktion darstellte, die Gleichungen vereinfachen helfen sollte.
Poincaré hatte seinen Zeitaufsatz, wie gesagt, erstmals im Januar 1898 in einer philosophischen Zeitschrift publiziert. Sein Ansatz, dass die Uhrenkoordination durch telegraphischen Signalaustausch die Basis für eine konventionelle Definition der Simultanität bilden konnte, beruhte auf technischen und philosophischen Überlegungen, die absolut nichts mit der Physik bewegter Körper zu tun hatten. Doch in seinem zweiten, 1900 veröffentlichten Aufsatz dehnte Poincaré die von Lorentz eingeführte »lokale Zeit« mit drastischen Folgen auf wirklich (und nicht nur theoretisch) bewegte Bezugssysteme aus. Zwar hängte er seine Modifikation, Lorentz’ rein mathematisch angelegte Größe als eine praktisch »scheinbare« Lokalzeit aufzufassen, nicht an die große Glocke, doch das Konzept hatte sich verändert. Bei Poincaré verlor die lokale Zeit ihren fiktiven Charakter und wurde zu dem, was Beobachter in bewegten Bezugssystemen auf ihren Uhren einstellen mussten, um zu berücksichtigen, ob ein Signal im Äther mit Rücken- oder Gegenwind reiste.
Durch Poincarés 1900 vorgelegte Deutung der Lokalzeit geriet die elektrische Koordination und Synchronisation von Uhren plötzlich in den Schnittpunkt aller drei Bereiche: der Physik, der Philosophie und der Geodäsie. Wiederum in Reaktion auf Lorentz – der seine »lokale Zeit« 1904 modifiziert hatte, um die Maxwell’schen Gleichungen in fiktiv bewegten Bezugssystemen den Gleichungen im »wahren« Bezugssystem, in welchem der Äther ruhte, noch ähnlicher zu machen – griff Poincaré das Thema 1905/06 ein drittes Mal auf. Er übernahm den Ansatz, überarbeitete aber (unter anderem) die Definition der lokalen Zeit in dem Sinne, dass eine exakte mathematische Übereinstimmung zwischen gedachten bewegten Bezugssystemen und dem wahren, ruhenden herauskam. Doch entscheidend war für ihn nicht diese kleine Veränderung der Lorentz’schen Theorie, sondern der Beweis, dass koordinierte, gegenüber dem Äther bewegte Uhren aus der Sicht ihrerseits bewegter, und zwar leibhaftiger, Beobachter exakt die reformierte Lorentz’sche Lokalzeit anzeigen würden. Das Relativitätsprinzip hatte also Bestand, auch wenn Poincaré weiterhin zwischen »scheinbarer« und »wahrer« Zeit unterschied. Damit stellte er 1906 die Uhrenkoordination durch Lichtsignale in den Mittelpunkt dreier Grundausrichtungen der modernen Erkenntnis – der technischen, der philosophischen und der physikalischen.
Der französische Universalgelehrte hatte bei geodätischen Vermessungen begonnen, war dann zu einem antimetaphysischen Modell der Konventionalität übergegangen und fand schließlich den Weg zur Relativität. Aus seinen physikalischen – aber auch philosophischen, technischen und politischen – Prioritäten spricht die Überzeugung, dass sich die Welt durch anschauliche, vernünftige Maßnahmen verbessern lässt. Begeistert trieb er Probleme bis ins Extrem, um sie dann zu lösen. Mit dem Optimismus eines fortschrittlichen Ingenieurs war er immer bereit, auch wichtige Streben und Stützen seiner Konstruktionen auszutauschen, bestand jedoch stets darauf, die von »unseren Vätern« aufgebaute Welt zu achten, zu erhalten und zu verbessern.
Das fünfte Kapitel ist »Einsteins Uhren« gewidmet, allerdings nicht dem prophetischen, ganz in der Mathematik versunkenen weltberühmten Einstein von 1933 oder 1953, sondern dem Bastler, der daheim in der Berner Kramgasse mit großem Perfektionismus an selbst gebauten Maschinen herumtüftelte, während er tagsüber im Patentamt Entwürfe und Anträge prüfte. Hier begegnet uns weder der gefeierte Einstein aus dem Berlin der Weimarer Republik noch der alternde Anachoret, der sich in Princeton der Suche nach einer Weltformel verschrieb, sondern der Himmelsstürmer von 1905. Obgleich die technische Infrastruktur der Eisenbahnen, Telegraphen und ferngesteuerten Uhren in der Schweiz erst relativ spät entstand, war die Synchronisierung der Zeit dort eine entschieden öffentliche Angelegenheit – und Bern bildete ihr Zentrum. Von dort strahlte die Elektrifizierung gleichsam ab und erreichte schließlich die Uhrenindustrie des Jura, die öffentlichen Plätze der Städte, die Eisenbahnen und nicht zuletzt auch das Patentamt. Damit befand sich Einstein mitten im Geschehen.
Allerdings ging er ganz anders an das Problem der Uhrenkoordination heran als Poincaré, wollte als Häretiker und Außenseiter die Physik der Väter nicht erwerben und besitzen, sondern ersetzen. So verstand er die Synchronisation, wie überhaupt sein ganzes physikalisches und philosophisches Trachten, als kritische Überprüfung von Grundannahmen. Er betrieb keinen schrittweisen methodischen Aufbau, zumal die meisten Elemente seiner relativistischen Prämissen schon beisammen waren, bevor er sich dem Zeitproblem zuwandte. So hatte er den von Poincaré mühevoll verteidigten Äther bereits 1901 preisgegeben, befasste sich seit langem mit kritischen Analysen in den Grenzbereichen von Physik und Philosophie und sezierte seit drei Jahren zusammen mit seinen Kollegen im Patentamt die Maschinerie der Zeit. Als Einstein sich 1905 entschloss, die Gleichzeitigkeit durch elektrisch koordinierte Uhren zu definieren, ging es ihm nicht wie Poincaré darum, noch angesichts eines gleichsam fiktiven Äthers zwischen »scheinbarer« und »wahrer« Zeit zu differenzieren, sondern dieses profane Verfahren brachte eine Gedankenkette zum Abschluss, an der er seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitete. Es gab keinen Äther, sondern nur wirkliche Felder und Teilchen, und nur die tatsächliche, von Uhren angezeigte Zeit.





























