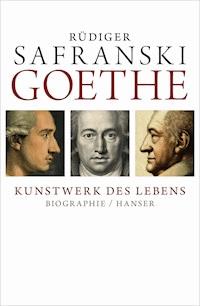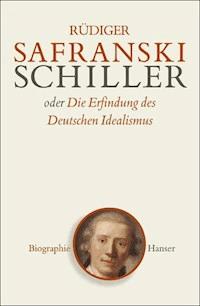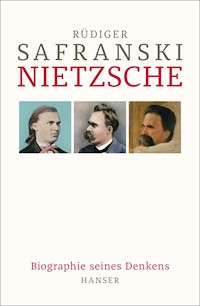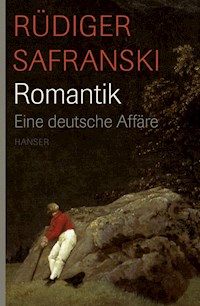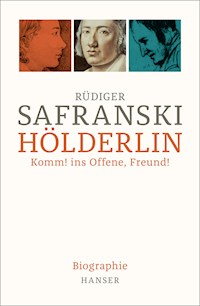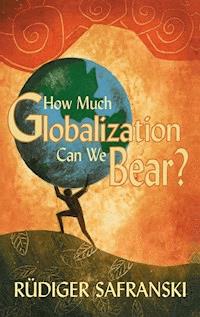Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie kommen wir damit zurecht, auf uns allein gestellt zu sein? Rüdiger Safranski über den Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft. Eine ganz besondere Geschichte der Philosophie Jeder Mensch ist zunächst einmal ein Einzelner. Das kann zur Belastung werden, vor der ein Leben in Gemeinschaft schützt, das kann aber auch den Ehrgeiz wecken, die eigene Individualität zu kultivieren. Zwischen beiden Polen unserer Existenz hat es immer wieder eindrucksvolle Versuche gegeben, einzeln zu sein. Davon erzählt Rüdiger Safranski in seinem neuen Buch. Er beginnt bei Michel de Montaigne und führt über Rousseau, Diderot, Kierkegaard, Stirner und Thoreau bis zur existentialistischen Philosophie des 20. Jahrhunderts. Dabei nähert er sich aus immer anderen Richtungen der Frage, wie weit wir es ertragen, Einzelne zu sein – eine Frage, die sich ganz überraschend in unser alltägliches Leben gedrängt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wie kommen wir damit zurecht, auf uns allein gestellt zu sein? Rüdiger Safranski über den Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft. Eine ganz besondere Geschichte der PhilosophieJeder Mensch ist zunächst einmal ein Einzelner. Das kann zur Belastung werden, vor der ein Leben in Gemeinschaft schützt, das kann aber auch den Ehrgeiz wecken, die eigene Individualität zu kultivieren. Zwischen beiden Polen unserer Existenz hat es immer wieder eindrucksvolle Versuche gegeben, einzeln zu sein. Davon erzählt Rüdiger Safranski in seinem neuen Buch. Er beginnt bei Michel de Montaigne und führt über Rousseau, Diderot, Kierkegaard, Stirner und Thoreau bis zur existentialistischen Philosophie des 20. Jahrhunderts. Dabei nähert er sich aus immer anderen Richtungen der Frage, wie weit wir es ertragen, Einzelne zu sein — eine Frage, die sich ganz überraschend in unser alltägliches Leben gedrängt hat.
Rüdiger Safranski
Einzeln sein
Eine philosophische Herausforderung
Hanser
Inhalt
Vorbemerkung
Kapitel 1: Die Renaissance und der neu erwachte Sinn für den Einzelnen
Kapitel 2: Luther oder der Einzelne und sein Gott
Kapitel 3: Montaigne. Das Schaukeln der Dinge und die Zuflucht im eigenen Selbst
Erste Zwischenbetrachtung
Kapitel 4: Rousseau. Der Einzelne und die Angst vor der Freiheit der Anderen
Kapitel 5: Diderot. Der Einzelne als geselliges Genie
Kapitel 6: Stendhal oder der Einzelne mit Stil
Zweite Zwischenbetrachtung
Kapitel 7: Kierkegaards Einzelner und die Entdeckung der Existenz
Kapitel 8: Stirner. Der Einzelne, der sein’ Sach’ auf Nichts gestellt hat
Kapitel 9: Thoreau. Rückzug und Vereinzelung als Experiment
Dritte Zwischenbetrachtung
Kapitel 10: Stefan George und Georg Simmels individuelles Gesetz, Max Webers innerer Dämon
Kapitel 11: Ricarda Huchs Glaube und die Kritik der Entpersönlichung
Kapitel 12: Im Schatten des Zeitalters der Massen
Kapitel 13: Existenzphilosophie. Jaspers und Heidegger
Kapitel 14: Hannah Arendt. Das Anfangenkönnen und das Zwei-in-einem
Kapitel 15: Jean-Paul Sartres Wende im Krieg. Vom individuellen zum engagierten Existentialismus
Kapitel 16: Ernst Jünger. Der Einzelne als Stoßtruppführer und Waldgänger
Schlussbetrachtung
Literatur
Nachweise
Personenregister
Dem Freund Ulrich Wanner
Ein Einzelner, wie er im Buche steht
Vorbemerkung
Einzeln sein: Da denkt man sogleich an Selbstverwirklichung.
Selbstverwirklichung hatte einst einen guten Klang, als damit vor allem politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Befreiung gemeint war. Inzwischen ist der frühere Glanz etwas matt geworden, denn Selbstverwirklichung bedeutet heute oft nur: Alles muss raus, also Selbstdarstellung um jeden Preis, oder: Alles muss rein, also Selbstverwirklichung im Konsum.
Gewiss lässt sich Selbstverwirklichung anspruchsvoller denken, auch heute noch. Aber dann wird wohl ein Moment von Selbstüberwindung mitgedacht werden müssen.
Selbstüberwindung galt früher als ein Weg, zu sich selbst zu kommen. Es ging immer auch um Arbeit an sich selbst, um Überwindung von Hemmnissen, Illusionen, Gewohnheiten, es ging auch um Bändigung des Triebhaften, um Aufhellung des Dunklen. Keinesfalls genügte es, sich gehen zu lassen.
Für die Menschen, die hier vorgestellt werden, ist solche Selbstüberwindung immer auch im Spiel beim Versuch, ein Einzelner zu sein und darüber nachzudenken.
Einzeln sein bedeutet, aus einer Tatsache — jeder ist einzeln — eine Aufgabe zu machen, für das Leben und für das Denken. Dann bemerkt man, wie schwierig es ist zu unterscheiden, ob man selbst oder die Gesellschaft in einem denkt und empfindet.
Einzeln sein bedeutet, dass man zwar immer irgendwo dazugehört, doch auch imstande ist, für sich allein stehen zu können, ohne seine Identität nur in einer Gruppe zu suchen oder seine Probleme nur auf die Gesellschaft abzuwälzen. Es bedeutet auch, Abstand halten und womöglich auf Zustimmung verzichten zu können.
Hier wird keine durchgehende Geschichte erzählt, auch wenn die chronologische Abfolge der Kapitel eine solche Erwartung nahelegt. Immerhin gibt es einige auffallende historische Zusammenhänge auf dieser Wegstrecke zwischen dem erneuten Erwachen eines Individualgefühls in der Renaissance und den existentialistischen Entwürfen, ein Einzelner zu sein, als Antworten auf die großen kollektiven Katastrophen des 20. Jahrhunderts.
Es wird hier auch keine umfassende Theorie über das Einzeln-Sein versucht. Das wäre wohl auch paradox, denn wenn man den Einzelnen wirklich ernst nimmt, dann gibt es eben nur Einzelfälle, die jeweils zu denken geben.
Kapitel 1
Die Renaissance und der neu erwachte Sinn für den Einzelnen
Jeder ist ein Einzelner. Aber nicht jeder ist damit einverstanden und bereit, etwas daraus zu machen. Es kommt stets darauf an, wie der Einzelne die Probleme seiner Einzelheit annimmt und erträgt, Einsamkeit etwa oder schicksalhafte Gegebenheiten aus biologischen Prägungen und gesellschaftlichen Zufällen. Übernimmt man sie oder hadert mit ihnen, versucht man sie zu verbergen vor sich und den anderen? Entwickelt man das Eigene, oder gleicht man sich an? Meistens entscheidet man sich für irgendetwas dazwischen, und doch gibt es auch die Flucht in das Nicht-Eigene, wobei keiner er selbst ist, sondern jeder wie der andere.
Wer als Einzelner seine Eigenheit entdeckt und annimmt, möchte zwar sich selbst gehören, aber doch auch zugehörig bleiben. Diese Spannung bleibt. Denn man kann die Vereinzelung unfreiwillig erleiden, und man kann sie freiwillig in Kauf nehmen im Kampf um seine Eigenheit. Dabei lockern sich wohl die Bindungen an die Familie und andere Gesellschaftsverbände. Wer sich als Einzelner erlebt, steht im Freien, ohne sich deshalb schon befreit zu fühlen. Denn er merkt, wie sehr er auf Anerkennung angewiesen bleibt, insgeheim oder ausdrücklich. Der Einzelne, der auf seiner Eigenheit besteht, begnügt sich nicht mit dem einfachen Dazugehören, er will vielmehr in dem anerkannt werden, was ihn von anderen unterscheidet. Nicht das Gleichsein, sondern der Unterschied soll anerkannt werden.
Von der Einzelheit her lassen sich Gesellschaftstypen unterscheiden, je nachdem ob sie die Einzelheit begünstigen und gar zum Gesellschaftszweck erheben oder sie eher hemmen. Es geht also nicht nur darum, wie viel Einzelheit der Mensch überhaupt will und erträgt, sondern auch darum, welche gesellschaftlichen Begünstigungen oder Beeinträchtigungen er dabei erfährt.
Vieles spricht dafür, dass es, vor allem in Westeuropa, eine gesellschaftliche Entwicklung in Richtung Individualisierung gegeben hat und noch gibt. Zuletzt hat Andreas Reckwitz mit Blick auf die Spätmoderne von einer Logik des Singulären gesprochen. Schon Norbert Elias hatte die Grundzüge dieser Entwicklung analysiert und Jacob Burckhardt sie am Beispiel der italienischen Renaissance geschildert, diesem nach der griechischen Antike wohl zweiten großen Durchbruch einer Individualkultur.
Wenn der Einzelne auf sich selbst aufmerksam wird, neigt er dazu, sich der Gesellschaft insgesamt gegenübergestellt zu sehen, als handelte es sich um zwei Substanzen, hier drinnen das Ich, dort draußen die Gesellschaft und dazwischen das Spiel der Wechselwirkungen. Norbert Elias hat auf die optische Täuschung hingewiesen, die diesem Modell zugrunde liegt. Wir stehen nämlich der Gesellschaft niemals einfach gegenüber, denn wir sind und bleiben stets in ihr enthalten, auch dann, wenn wir uns von ihr vermeintlich absetzen. Individualisierung ist selbst ein gesellschaftlicher Prozess. Sie steht nicht in einem Gegensatz zur Gesellschaft, sondern ist das Ergebnis einer gesellschaftlichen Differenzierung, die es dem Einzelnen erlaubt, sich für bedeutungsvoll zu halten. Das Ich, das sich in seiner vermeintlichen Unverwechselbarkeit der Gesellschaft entgegensetzt, unterliegt einer Selbsttäuschung und weigert sich einzusehen, dass die Gesellschaft … nicht nur das Gleichmachende und Typisierende, sondern auch das Individualisierende (ist). Daraus entsteht notwendigerweise ein Spannungsverhältnis zwischen Individualität und Gesellschaftlichkeit, zwischen Ich und Wir. Im Blick auf die Geschichte dieses Spannungsverhältnisses konstatiert Norbert Elias: Auf den früheren Stufen … neigte sich die Wir-Ich-Balance zumeist stark nach der Seite des Wir. Sie neigt sich in neuerer Zeit oft recht stark nach der Seite des Ich.
In der Epoche der italienischen Renaissance, an der Schwelle zur Neuzeit, hatte sich diese starke Ichbezogenheit glanzvoll gezeigt. Jacob Burckhardt schildert die individualisierende Wende der Welt- und Selbstwahrnehmung: Im Mittelalter lagen die beiden Seiten des Bewusstseins — nach der Welt hin und nach dem Innern des Menschen selbst — wie unter einem gemeinsamen Schleier träumend oder halbwach. Der Schleier war gewoben aus Glauben, Kinderbefangenheit und Wahn; durch ihn hindurchgesehen erschienen Welt und Geschichte wundersam gefärbt, der Mensch aber erkannte sich nur als Rasse, Volk, Partei, Korporation, Familie oder sonst in irgendeiner Form des Allgemeinen. In Italien zuerst verweht dieser Schleier in die Lüfte; es erwacht eine objektive Betrachtung und Behandlung des Staates und der sämtlichen Dinge dieser Welt überhaupt; daneben aber erhebt sich mit voller Macht das Subjektive; der Mensch wird geistiges Individuum und erkennt sich als solches.
Die gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse Oberitaliens, in denen sich die Geburt des Individuums in dem von Burckhardt bezeichneten Sinne vollzog, befanden sich auf einer Entwicklungshöhe, die im restlichen Europa erst Generationen später erreicht wurde.
Politisch gab es in Oberitalien keinen homogenen, von einer Zentralgewalt durchherrschten Raum, weder das Heilige Römische Reich noch die päpstliche Universalkirche war stark genug, um den Aufstieg der Stadtstaaten, besonders den von Florenz, hindern zu können. Auch politisch also war nicht die Form des Allgemeinen (Burckhardt) vorherrschend, sondern die partikulare Macht der Städte, die untereinander höchst gewaltsam konkurrierten. Die einzelnen Stadtherrschaften, ob republikanisch oder autokratisch, verhielten sich in der Arena des polyzentrischen Kräftespiels wie eigensinnige Individuen, denen es darum ging, sich abzugrenzen, sich zu behaupten und womöglich den eigenen Machtbereich auszudehnen. Dieser teilweise mörderische Wettbewerb der Mächte entfesselte zugleich eine beispiellose kulturelle Dynamik. Es gab partikulare Herrschaften, keine Oberherrschaft. Das Allgemeine verschwand im Besonderen. Der Papst, eigentlich das geistliche Oberhaupt des Abendlandes, war eine Macht unter anderen. In Mailand herrschten die Sforza, in Florenz die Medici, in Mantua die Gonzaga, in Ferrara die Este, dazu die Seerepubliken Genua und Venedig, die über Europa hinausblickten. Der Kirchenstaat der Päpste, eigentlich das geistige Oberhaupt des Abendlandes, war eine Macht unter anderen und lauerte zusammen mit dem aragonischen Königreich Neapel vom Süden her wie der Kaiser und der französische König vom Norden her auf eine Gelegenheit, in dieses machtpolitisch zersplitterte und doch kulturell erblühende Oberitalien, einem frühen Laboratorium des modernen Europa, einzugreifen. Als dann später die Zentralmächte, zuerst Frankreich und später Habsburg, ihre Oberherrschaft über diesen Raum errichteten und damit der politischen Zersplitterung ein Ende setzten, war es auch mit der kulturellen Blüte vorbei, wobei sich wieder einmal zeigt, dass politische Einheitsgebilde der kulturellen Entwicklung nicht günstig sein müssen. So war es schon im antiken Griechenland, das kulturell blühte in der Epoche der zahlreichen Stadtstaaten und das seine kulturelle Produktivität einbüßte, als es nur noch Teil des mazedonischen und dann des Römischen Reiches war. Auch Deutschland fand zur kulturellen Hochblüte um 1800 in einem politisch zersplitterten Land, während die Reichsgründung 1870 kulturelle Verflachung mit sich brachte. Der machtpolitisch zersplitterte Raum, dieser höherstufige Individualismus der verschiedenen Machtgebilde im oberen Italien, gehört jedenfalls zu den Voraussetzungen einer Renaissance, die auch sonst das neue Selbstbewusstsein von Individualität begünstigte und zum Ausdruck brachte.
Der Individualismus der Renaissance bedeutet, dass der Einzelne ermuntert oder auch gezwungen wird, sich seiner selbst bewusst zu werden, weil die traditionellen Bindungen, Gesetze und Glaubenswelten ihre Autorität verlieren. Das ist auch eine Wirkung der Geldwirtschaft, die sich hier deutlich früher als im übrigen Europa durchsetzt. Geld versachlicht die Herrschaftsbeziehungen und vereinzelt jene Menschen, die auf dem Lande, herausgelöst aus dem feudalen Verband, zu individuellen Pächtern und in den Städten, entbunden vom Zunftzwang, zu sogenannten freien Arbeitern werden. Auch das bedeutet Individualisierung, nämlich den ökonomischen Herren nunmehr als Vereinzelte gegenübertreten zu müssen. In den oberen Rängen der Gesellschaft sind Rittertum und feudale Herren verschwunden und haben Platz gemacht für eine Geldaristokratie, die sich nicht durch Herkommen, sondern durch wirtschaftlichen Erfolg legitimiert. Oberitalien und die Toskana erleben zur Zeit der Renaissance eine Blüte des Frühkapitalismus, der mit seinen Verwertungskalkülen und seiner Rechenhaftigkeit genuin gesellschaftliche Bereiche, und zwar nicht nur die ökonomischen, durchdringt. Die Geldwirtschaft ergreift auch die religiöse Welt und heckt den Ablasshandel aus, die Kirche wird zur Bank, wo spirituelle Gnadenschätze — die guten Taten der Vergangenheit und das Martyrium der Heiligen — deponiert und gegen handfestes Geld getauscht werden können, eine raffinierte metaphysische Finanzwirtschaft mit Luftbuchungen in Gestalt heiliger Wertschöpfungen. Auf diese Idee musste man erst einmal kommen: ein Beispiel dafür, wie der neue Geist des Geldes überall Unternehmungslust, Neugier, Wagemut und Erfindungsgeist weckt. Der Seelenhandel finanzierte den Bau des Petersdoms, der Seehandel die großen Entdeckungsreisen mit den ersten Weltumrundungen. Leonardo da Vinci malt nicht nur das rätselhafte Lächeln der Mona Lisa, sondern macht sich mit seinen waffentechnischen Erfindungen bei Cesare Borgia nützlich.
Das Selbstbewusstsein derer, die sich als unverwechselbare Einzelne fühlen, ist groß. Sie wissen und genießen es, dass sie sich von anderen unterscheiden. Es gibt Menschen, die man nicht anders als Durchgang von Speisen, Vermehrer von Kot und Füller von Abtritten nennen muss, weil durch sie nichts anderes auf der Welt erscheint … als volle Latrinen, notiert Leonardo da Vinci in seinen »Philosophischen Tagebüchern«.
Das ist ein stolzer, unbarmherziger, unsentimentaler Blick auf jene, von denen man sich unterscheiden will. Freilich füllt man auch selbst die Latrine. Doch vielleicht, so die Hoffnung, hinterlässt man einige unverwechselbare, gar unvergängliche Spuren. Erst in der Renaissance wird es üblich, die Bilder zu signieren. Leonardo da Vinci bewahrt sogar seine Entwürfe auf, manche davon ebenfalls signiert. Es soll möglichst wenig verloren gehen, denn darauf kommt es an: irgendeine Erinnerung im Geiste der Sterblichen zu hinterlassen. Auf daß dieser unser armseliger Lebenslauf nicht umsonst verfließe …
Das ist noch recht bescheiden formuliert im Vergleich zu anderen Bekundungen gesteigerten künstlerischen Selbstbewusstseins. Tizian erzählte gerne, wie Kaiser Karl V. bei einer Porträtsitzung ihm den Pinsel aufgehoben habe, der ihm entglitten war. Als man Michelangelo tadelte, seine beiden Büsten der Medici hätten doch gar keine Ähnlichkeit mit den Dargestellten, soll der geantwortet haben: Wem wird das in zehn Jahrhunderten auffallen?
Ein Jahrhundert früher wirkten die bildenden Künstler zumeist noch anonym im Schatten ihrer Gilden, Zünfte und Bruderschaften. Jetzt treten sie hervor. Die Kunst emanzipiert sich vom Geist des Handwerks. Sie hat etwas ganz Individuelles anzubieten. Etwas treibt in ihr, das höher ist als alle Vernunft. Es ist nicht nur, wie in der Tradition, die religiöse Höhe. Die Kunst hat jetzt ihren eigenen Himmel, und der Künstler selbst wird Genius. In der Epoche der Renaissance kommt der künstlerische Geniekult auf. Raffael wurde bereits zu Lebzeiten der »göttliche« genannt. An ein religiöses Mandat war dabei nicht gedacht. Hinlänglich bekannt war, dass dieser Künstler fromme Sujets wählte, ohne selbst sonderlich fromm zu sein. Oft fehlte diesen Bildern die Demut gegenüber ihren heiligen Gegenständen und Themen. Es kam eben vor allem auf das »Wie«, nicht auf das »Was« an. Der Künstler selbst will sich zeigen. Die stark gefühlte Bedeutsamkeit des Subjektiven sucht sich zu behaupten gegen die Tradition des Objektiven. Diese Subjektivität war aber noch nicht hemmungslos expressiv, sondern hielt sich in den Grenzen eines verbindlichen Schönheitsideals. Doch galt Schönheit nicht mehr als etwas objektiv Gegebenes, sondern als Ergebnis einer Verwandlung im Geiste des Subjektes, als etwas Absichtsvolles, auch Reflexives, das sich dem Willen zum Originellen verdankt. Schönheit ruht in den Dingen, doch das Subjekt muss sie erst sichtbar machen. So erscheint die Schönheit als gelungene Verbindung zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven. Das illustriert die von Vasari überlieferte Anekdote von dem Sterbenden, der sich weigerte, bei der Letzten Ölung das Kreuz zu küssen, weil er es als nicht genügend schön empfand.
Es ist der geschmackvolle Mensch, letztlich der Künstler, der an den Dingen und Menschen die Schönheit zur Erscheinung bringt: ein säkulares Priestertum. Der Künstler erleuchtet die Welt, lässt sie in Schönheit glänzen, aber dient er auch der Erkenntnis? Leonardo da Vinci stellt sich in seinen »Philosophischen Tagebüchern« die Frage, was denn die bildende Kunst von der Wissenschaft unterscheide, sofern beide der nachahmenden Darstellung des Wirklichen dienen. Seine Antwort: Die bildende Kunst ist von solcher Vortrefflichkeit, dass sie sich nicht nur den Erscheinungen der Natur zuwendet, sondern unendlich viel mehr Erscheinungen, als die Natur hervorbringt. Diese Erscheinungen sind etwas ganz Inwendiges und Eigenes, das die jeweilige Originalität des Künstlers ausmacht. Doch es genügt nicht, dass diese Welt im Künstler schlummert, sie muss herauskommen, erscheinen, wahrnehmbar und verständlich werden für die anderen. Das jeweils Einzelne soll in der Formensprache der allgemeinen Zeichen wiedererkennbar erhalten bleiben.
Gemäß der noch gültigen mittelalterlich-scholastischen Begriffsunterscheidung von Substanz und Attribut wären beim Normalmenschen die Substanz das allgemeine Menschsein und seine Attribute die individuellen Eigenschaften; für den Künstler aber soll das Umgekehrte gelten: Die Substanz ist seine Individualität, und die allgemeine Formensprache, in der sie sich ausdrückt, wären die äußerlichen Attribute.
Wie ist es nun aber zu bewerten, wenn nicht das Ganze dieses Inwendigen zum Ausdruck kommt, wenn also der Künstler bloß etwas ahnen lässt, ohne es wirklich in die Gestalt zu bringen? Hier grenzt sich Leonardo von manchen seiner Kollegen ab, die es bei Ahnungen und Andeutungen belassen und auf nicht darstellbare mystische Geheimnisse verweisen, manchmal mit frommem Augenaufschlag. Größtes Übel ist es, wenn der Gedanke das Werk überragt, notiert Leonardo. Es gilt nicht die Intention, sondern nur das, was wirklich Gestalt geworden ist. Das erst ist Schöpfung, wenn aus dem bloß Möglichen das Wirkliche wird. Schöpfer ist, wer Möglichkeiten in Wirklichkeit verwandelt, so wie Michelangelo vom Stein sagt, in ihm ruhe bereits die Gestalt, man müsse sie erst noch heraushauen, also aus Möglichkeit in Wirklichkeit verwandeln.
Das Mittelalter glaubt in Ehrfurcht vor der göttlichen Schöpfung in den Grenzen der Nachahmung verharren zu müssen. Nun aber wird nicht nur die Schöpfung, sondern der göttliche Schöpfungsakt selbst nachgeahmt und als schöpferische Freiheit ins stolze Selbstbewusstsein des Künstlers aufgenommen.
Von dieser schöpferischen Euphorie des Künstlertums ist Pico della Mirandola erfüllt in seiner berühmten programmatischen Abhandlung »Über die Würde des Menschen«, mit der er 1486 in Rom einen philosophischen Schaukampf zwischen den besten Philosophen zu eröffnen gedachte. Allerdings wagt es keiner, sich mit ihm zu messen, obwohl er sich bereit erklärt hatte, für die Reisekosten aufzukommen. Das ganze Vorhaben wurde von den päpstlichen Stellen natürlich argwöhnisch beobachtet. Gott habe, so schreibt Pico della Mirandola, am letzten Schöpfungstag zum Menschen gesprochen: Ich habe dich in die Mitte der Welt gesetzt, damit du von dort bequem um dich schaust, was es alles in dieser Welt gibt. Wir haben dich weder als einen Himmlischen noch als einen Irdischen, weder als einen Sterblichen noch einen Unsterblichen geschaffen, damit du als dein eigener, vollkommen frei und ehrenhalber schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die Form bestimmst, in der du zu leben wünschst. Es steht dir frei, in die Unterwelt des Viehs zu entarten. Es steht dir ebenso frei, in die höhere Welt des Göttlichen dich durch den Entschluss deines eigenen Geistes zu erheben.
Diesen Entschluss, sich mit eigenen Kräften zum Göttlichen zu erheben, hatte dieser außerordentlich schöne, vielseitig begabte junge Mensch bereits im zarten Alter getroffen, als er in Bologna und Paris den ganzen Kanon von Disziplinen durchstudierte, von der Theologie über Philosophie, Medizin, Musik, Mathematik bis zur Baukunst, dazu noch Arabisch und Hebräisch, Sternenkunde, die Kabbala und auch ein wenig Alchemie. Er verkehrte an den Höfen Europas und wurde wie ein Wunderknabe herumgereicht. Als Jüngling flogen ihm die Herzen der Frauen und der Männer zu. Von keinem ließ man sich das Wesen des platonischen Eros lieber erklären als von diesem Don Juan mit der Aura eines unschuldigen keuschen Mönches. Groß und wohlgebildet, so wird er beschrieben, das Antlitz vom Widerschein des Göttlichen strahlend. In seinem Denken und seinen Reden spiegelten sich alle Gegenstände wechselseitig, und es vollzog sich die große geistige Vereinigung von allem mit allem, eine Vorwegnahme dessen, was Hegel später einmal bacchantischer Taumel nannte, an dem kein Glied nicht trunken ist.
Zu seinen Adelstiteln gehörte der des Grafen von Concordia, passend zu seinen Versuchen, die großen Religionen miteinander zu versöhnen. Anfangs war er nur geistesfromm, nicht eigentlich religiös im christlichen Sinne. Dafür fehlte diesem freundlichen, heiteren und überschwänglichen Menschen das Bewusstsein des Sünders. Schon aus logischen Gründen schien es ihm ungereimt, dass auf ein endliches Vergehen eine unendliche Strafe sollte folgen dürfen. Ein Gott, der solches zuließe, wäre keiner. Unbefangen riskierte der junge Mann die Verfolgung als Häretiker. Lorenzo de’ Medici bot Schutz in Florenz. In den letzten Lebensjahren wurde der mönchische Zug bei ihm stärker. Savonarola beeindruckte ihn. Er verbrannte seine Liebeslyrik und vermachte sein Vermögen einer Stiftung zur Finanzierung der Hochzeitsaussteuer bedürftiger Mädchen. Er selbst blieb unverheiratet und erwog noch kurz vor seinem frühen Tod, in den Dominikanerorden einzutreten. Pico della Mirandola, diese glänzende Erscheinung auf den Bühnen der Renaissance, wurde am Ende demütig, eher untypisch für die Welt der Künstler und Humanisten, in der die neue Lust, ein Ich zu sein, dominierte. Dass er im eminenten Sinn ein Einzelner war, dessen war er sich durchaus bewusst, doch er machte kein sonderliches Aufhebens davon.
Einst waren die Künstler in ihren Werken verschwunden, jetzt treten sie aus ihnen heraus, zelebrieren ihre Sichtbarkeit und werden selbst zum Gegenstand der Verehrung. Es kommen Künstlerbiographien auf, die erste ist Brunelleschi gewidmet. Eine Generation später wird Vasari die Lebensläufe der Künstler der Renaissance wie Heiligenlegenden erzählen. Noch nie waren Künstler, diese Darsteller des gesteigerten Ichs, so gefragt. Die herrschenden Häuser und die Bankiers reißen sich um sie. Die Preise auf dem Kunstmarkt ziehen an, weil der Vatikan bereit ist, jede Summe zu bezahlen. Die Stars unter den Malern leben wie Fürsten und lassen in ihren Werkstätten die erfolgreichen Bilder und Bildmotive in Serie gehen. Wer es sich leisten kann, lässt sich malen oder in Kupfer stechen. Der Markt wird überschwemmt mit Porträts auf Gemälden, Gemmen, Münzen, Medaillons. Gefragt sind die scharfen Profile und die ausdrucksstarken Gesichtszüge, unverwechselbar, individuell sollen sie sein.
Man fühlt sich der beschränkten Charakterisierungskunst früherer Jahrhunderte überlegen, die sich mit der Lehre von den vier Säften und den vier Temperamenten (cholerisch, sanguinisch, melancholisch, phlegmatisch) zufriedengab. Um der Einzelheit gerecht zu werden, ist mehr gefordert.
Jacob Burckhardt spricht vom Schleier … aus Glauben, Kinderbefangenheit und Wahn, der in die Lüfte verwehte und den Blick freigab auf die deutlich erfasste Einzelheit und Individualität. Doch begonnen hatte diese Entwicklung schon mit dem Grundsatz des spätmittelalterlichen Nominalismus: Was existiert, ist individuell. Es gibt nur Einzelheiten. In ihnen ist die ganze Fülle des Wirklichen enthalten, nicht in den Begriffen, den »nomina«, vor allem dann nicht, wenn sie sich zu Kathedralen der Spekulation türmen. Der Nominalist Duns Scotus nannte das wahrhaft Wirkliche, das Einzelne also, die »haecceitas«, die »Dies-da-heit«, das Etwas an seinem einmaligen Raum-Zeit-Punkt. Neben Gott sind diese Einzelheiten in ihrer Fülle das eigentliche Wunder; dazwischen unsere Begriffe, die nicht zu Gott empor- und kaum zu den Einzelheiten hinunterreichen. Die Nominalisten gingen schon so weit, die kirchlichen Lehren zu untergraben, freilich nicht, indem sie Gott leugneten, sondern indem sie darauf bestanden, dass er eben nur geglaubt und nicht begriffen werden könne. Besser, sich von ihm ergreifen zu lassen, statt ihn begreifen zu wollen. Was aber bleibt für den Verstand zu tun? Er soll sich den Einzelheiten zuwenden und den Erfahrungen, die man mit ihnen macht. Einzelheit und Erfahrung — das gehört von nun an zusammen. Leonardo da Vinci notiert in den »Philosophischen Tagebüchern«: Man sagt, daß die Erkenntnis, die von der Erfahrung erzeugt wird, rein handwerksmäßig sei, und nur diejenige wissenschaftlich, die im Geiste entsteht und endet … Doch scheint mir, daß jene Wissenschaften eitel und voller Irrtümer sind, die nicht geboren wurden aus der Erfahrung, der Mutter jeder Gewißheit, oder nicht in einer bekannten Erfahrung enden.
Es genügt ein einzelner Fall, der gegen eine Theorie spricht, und die ganze Konstruktion des Allgemeinen bricht in sich zusammen. Dieser streng falsifizierbare Empirismus unterscheidet Leonardo da Vinci von den Humanisten, der anderen prominenten Geistesbewegung in der Epoche der Renaissance.
Ein Künstler, Wissenschaftler und Ingenieur wie Leonardo blickte in die Welt, die Humanisten aber lasen vor allem in ihren Büchern und schrieben unablässig neue Bücher, philologische, philosophische, polemische. Es entstand ein schon fast modernes Literatentum mit seinen Profilierungskämpfen und Selbstdarstellungsmanövern und einer polemischen Betriebsamkeit, die es vorher so noch nicht gegeben hatte. Man wollte sich abgrenzen, setzte auf den Unterschied um jeden Preis. Die neue Lust, ein Ich zu sein, wurde erfinderisch. Mit den Humanisten tritt — nach den Sophisten im antiken Athen — wieder der Typ des Intellektuellen auf, der individuell um Rang und Ansehen kämpft, insgesamt aber doch zumeist in abhängiger Position verbleibt, eine schwer erträgliche Spannung, die ein latentes Ressentiment zur Folge hat. Das erklärt den häufig gereizten, polemischen Ton untereinander.
So kleinkrämerisch es auch bisweilen unter diesen Leuten zuging, so haben sie doch ihre Verdienste um das freie Denken gegenüber den religiösen Glaubenswelten. Das Leben ist schwer genug, man sollte es durch Religion nicht noch zusätzlich belasten, besser ist, sie hilft und bringt Erleichterung — das ist im Kern die Botschaft des Erasmus von Rotterdam in seinem Buch »Lob der Torheit«. Solcher Humanismus konnte wirklich eine beflügelnde Kraft des Leichtnehmens und der Freundlichkeit sein. Wird der einen andern lieben, der sich selber hasst?, lautet einer der klügsten Sätze dieses damals viel gelesenen Buches.
Nicht zum eigentlichen Kreis der Humanisten gehörte Aretino, doch er nutzte das von ihnen geschaffene Milieu der Selbstdarstellung. Er war ein viel gelesener Spötter, Pamphletist, Journalist, Autor von pornographischen Romanen und Heiligenlegenden, dabei auch Philosoph und Kunstkritiker; ein Virtuose im Umgang mit der Macht des Öffentlichen, ein Selbstdarsteller, der auch vor Gewalt nicht zurückschreckte. Michelangelo drohte er, er würde ihn in der Öffentlichkeit unmöglich machen und als Homosexuellen entlarven, wenn er ihm nicht einige Entwürfe zur Sixtinischen Kapelle überlasse. Seine Feder wurde von den Mächtigen gefürchtet, jedenfalls bezog er zeitweilig Pensionen von Kaiser Karl V. und dem französischen König Franz I.; vom Sultan erhielt er eine schöne Sklavin zum Geschenk. Mit vielen Leuten verbunden, die ihm nützlich sein konnten, war er eine personifizierte Nachrichtenbörse. Manche steckten ihm Informationen oder Verleumdungen zu, die sie gegen andere benützt haben wollten. Er war zu jeder öffentlichen Intrige bereit, wenn man ihn nur bezahlte. Vor Obszönität scheute er nicht zurück, sie musste nur klug sein und guten Stil haben. Mir scheint, schreibt er, wir sollten jenes Ding, das uns die Natur zur Erhaltung unserer Art gibt, um den Hals als Anhängsel oder als Medaillon am Hut tragen. … Es ist der Quell des Menschengeschlechtes, Ambrosia der ganzen Welt. Es hat mich geschaffen, der ich nicht von Pappe bin, und brachte Männer zur Welt wie Bembo und Molza … Tizian, Michelangelo und nach diesen die Päpste, Kaiser, Könige … Daher sollten wir ihm Feste und Virgilien weihen, statt es in Tuch und Seide zu hüllen. Viel eher sollten wir unsere Hände zudecken, denn sie verspielen Geld, bezeugen falsche Eide, nehmen am Wucher teil, … zerren und reißen, teilen Fausthiebe aus, verwunden und erschlagen …
Aretino beeindruckte alle Welt damit, dass ihn nichts beeindruckte, dass er offenbar ohne Furcht war, dass er sich nicht duckte, dabei ohne Bekennerstolz, ohne das Hier stehe ich, ich kann nicht anders (Luther); er konnte immer auch anders, listig und voller Ränke. Er liebte die große Bühne, aber auch die Hintertreppe. Er wollte geliebt werden, doch auch gefürchtet. Ich bin wirklich ein furchtbarer Mensch, sagte er von sich selbst, und Tizian nannte ihn einen Kondottiere der Feder. Er entsprach dem Renaissance-Bild eines »großen Mannes«, versiert in den Spielen der Lust und der Macht, ein Mensch, dem das Hören und Sehen nicht verging, ein Empirist reinsten Wassers, wie Leonardo. Mit Verachtung sprach er von jenem schmutzigen Brauch, der den Augen erzählen will, sie dürften nicht anschaun, was sie mit Entzücken anschaun.
Aretino hat sich selbst zu dem gemacht, der er war. Er kam sozial von ganz unten, geboren in Arezzo, wo man schon zu Lebzeiten das ärmliche Geburtshaus des Berühmten zeigte. Als junger Mann wanderte er nach Rom, und es dauerte nicht lange, dann kannte man ihn überall, in den Gasthäusern und Spelunken, in den Ateliers der Maler und in den Palästen der Prälaten und Kardinäle. Als sein Gönner, Giovanni de’ Medici, starb, ging er nach Venedig. Dreißig Jahre lebte er dort, zuletzt in einem Palazzo am Canal Grande, wo er Hof hielt. Von dort schoss er seine Pfeile ab, nur die Herren von Venedig schonte er, aus nachvollziehbaren Gründen, denn er wollte dort bleiben, wo es ihm so gut gefiel.
Aretino war, wie sein etwas jüngerer Zeitgenosse und Bewunderer Rabelais, der sich von ihm anregen ließ, ein Meister der Enthüllung und Entblößung. Er gab nicht eher Ruhe, als bis der ganze Schleier aus moralischer Heuchelei und frömmlerischen Künstlichkeiten verflogen war. Er wollte die Verhältnisse nackt sehen, zu seinem und des Publikums Vergnügen. Er bevorzugte den karnevalesken Realismus, der sich nichts vormachen lässt und schon allein damit eine individualisierende Kraft beweist. Der Wahn vergesellschaftet, der Realismus vereinzelt. Nur wer sich auf sich selbst verlassen kann, widersteht den gesellschaftlichen Trugbildern. Es sind immer die Gemeinplätze, die von vielen geteilt werden.
Ein weiteres glanzvolles Beispiel für den aufs Politische bezogenen kalten Realismus, der sich der Vereinzelung verdankt und zu klug ist, um Moral und Religion zu ihrem Nennwert zu nehmen, ist Machiavelli (1469—1527). Sohn eines Juristen und ein umfassend gebildeter Geist, hatte er zwischen 1498 und 1512 hohe Ämter in Florenz bekleidet. Das war zu der Zeit, als die Herrschaft der Medici unterbrochen war. Mit der Rückkehr der Medici fiel er in Ungnade und wurde der Mitwirkung an einer Verschwörung gegen sie beschuldigt. Er kam für mehrere Monate in Haft, wurde gefoltert und schließlich wieder freigelassen. Danach zog er sich mit seiner Familie auf sein kleines Landgut in der Nähe von Florenz zurück. Seine Zuflucht waren die Bücher, vor allem die lateinischen Klassiker. In der fleißigen, auf Nutzanwendung bedachten Lektüre dieser Schriften und in der eigenen politischen Erfahrung fand er den Stoff zu seinen eigenen Werken, die ihm erst nach seinem Tode europäischen Ruhm einbrachten. In einem Brief an einen Freund schildert er sein Leben auf dem Lande zu der Zeit, da er an seinem »Il Principe« schrieb, jener Schrift, die er Giuliano de’ Medici, dem gegenwärtigen Herrscher in Florenz, zu widmen gedachte in der unbescheidenen Erwartung, dass sie diesem wichtig werden könnte. Der inzwischen Vereinzelte und Machtlose glaubte also, die Macht belehren zu können. Er verbringe, so heißt es in dem Brief, seine Tage mit den Weinbauern, Waldarbeitern, im Wirtshaus mit den Handwerkern des Dorfes, so mich im Gemeinen wälzend, hebe ich den Kopf aus dem Staub und zeige meinem Schicksal seine Niedertracht … Wenn der Abend kommt, kehre ich nach Hause zurück und gehe in mein Schreibzimmer, und auf der Schwelle werfe ich das schmutzige Alltagsgewand ab und lege königliche Hoftracht an und betrete so passend bekleidet die Hallen der Männer des Altertums, die mich liebevoll aufnehmen, und wo ich mich von der Speise nähre, die mir allein angemessen und für die ich geboren bin. Da kann ich ohne Scheu mit ihnen reden … vergesse allen Kummer, sorge mich nicht um Armut und fürchte den Tod nicht mehr.
Aus der imaginären Unterhaltung mit den großen Staatslenkern und Weisen der Vergangenheit sei sein Buch über die Fürstenmacht entstanden. Er wollte, erklärt er, ihre letzten Zwecke erforschen. Und welches ist der letzte Zweck? Machiavellis Antwort: Der Zweck der Macht ist die Macht selbst. Diese Tautologie ist das Geheimnis der Macht, das man allerdings nur begreift, wenn man sich gegen den kollektiven Wahn, die illusionären Hoffnungen und Erwartungen an die Macht, immunisiert. Das ist nur unter zwei Bedingungen möglich. Entweder man steht als Einzelner außerhalb, also nicht vom Wahn befangen, oder man steht selbst im Zentrum der Macht, in jenem abgeschirmten Raum der zynischen Offenheit.
Machiavelli, vereinzelt und eigentlich machtlos, versucht nun, im Medium der zynischen Offenheit mit der Macht ins Gespräch zu kommen. Deshalb wollte er ja seine Schrift ursprünglich gar nicht veröffentlichen. Von Staffage, Betrug, Irreführung, Heuchelei ist darin die Rede, doch nicht als Themen der Entlarvung von unten, sondern, von oben gesehen, als notwendige und geschickt einzusetzende Instrumente der Macht. Macht ist möglich, weil die Menschen getäuscht werden wollen, und sie ist nötig, weil die Menschen zum Bösen neigen und nur durch Gewalt im Zaum gehalten werden können. Durch Gewöhnung und gute Regierung kann es dahin kommen, dass die Untertanen eine gewisse Anhänglichkeit an ihre Machthaber entwickeln und, von Friedenszeiten begünstigt, sogar zivile Tugenden entwickeln. Auf diesem Boden können da und dort Republiken entstehen, die aber auch die Erhaltung der Staatssouveränität über alles stellen müssen. Auch für sie gilt, so erläutert er an anderer Stelle, dass sie sich nicht primär an der Wohlfahrt der Bürger, sondern eben an der Bewahrung der Staatssouveränität nach innen und außen zu orientieren haben. Unhintergehbar bleibt für ihn die geschichtliche Arena der Staaten und Mächte, die untereinander im ewigen Streit liegen und einen Kampf um Selbstbehauptung führen.
Das individualistische Denken der Renaissance entdeckt in der Staatenwelt einen Individualismus zweiter Ordnung. Die traditionellen überwölbenden Mächte, Reich, Kaisertum, Papsttum, werden als real existierende Mächte zwar in Rechnung gestellt, ihre charismatische Bedeutung einer Über-Ordnung allerdings haben sie verloren. In der Konkurrenz der Mächte herrscht blanker Nihilismus. Kein Himmel wölbt sich über diese selbstbezüglichen irdischen Mächte, die keinem Gott, keinem »höheren« Wert dienen.
Und doch spielt die Religion eine bedeutende Rolle. In den »Discorsi« hat Machiavelli sich dazu geäußert. Religion, schreibt er dort, ist für den klugen Herrscher eine zur Erhaltung der Gesellschaft unentbehrliche Sache. Die Machthaber brauchen selbst nicht zu glauben, sie müssen aber die anderen glauben machen. Ein skeptischer unfrommer Geist ist dazu sogar besser imstande, weil er sein Urteil nicht durch christliche Weichherzigkeit trüben lässt. Diese habe, erklärt Machiavelli, eher die demütigen und beschaulichen Menschen erhoben als die tatkräftigen … Diese Denkungsart, scheint es, hat das Menschengeschlecht schwach gemacht.
Manche brauchen für ihre Tugenden eine Religion, ein stolzer Geist wie Machiavelli braucht sie letztlich nicht. Er holt sie aus sich selbst, und er sieht sie in sich selbst, in seiner Einzelheit, hinreichend begründet.
Doch vergessen wir nicht: Machiavelli blieb auch im Abseits das Mitglied einer kulturell glänzenden Stadtgemeinschaft, die Sinnhaftigkeit und Vitalität genug in sich trug, um es mit dem himmlischen Segen nicht so genau nehmen zu müssen. Gewiss, es gab auch moralische Verwahrlosung. Jacob Burckhardt schildert, wie die Menschen in den Städten ständig damit rechnen mussten, Opfer eines Verbrechens zu werden. Doch es herrschte offenbar kein Klima der Angst, anders als zur selben Zeit in Deutschland. Aretino verspottete Michelangelos »Jüngstes Gericht« in der Sixtinischen Kapelle als kleinmütige Angstmacherei.
Das städtische Leben mit der Vielfalt der konkurrierenden Individuen war ein Brutkessel der Vitalität. In Gang gesetzt wurde eine ungeheure Dynamik der Selbstbehauptung und der Selbststeigerung. Das schloss gegenläufige Ekstasen und Hysterien von schlechtem Gewissen, Büßerdelirien und periodisch auftretende Quartals-Moralismen nicht aus. So geschehen etwa bei der vier Jahre währenden Herrschaft des Savonarola, des düsteren Abtes von San Marco. Doch schließlich wurde man seiner überdrüssig und musste ihn zuerst brennen sehen, damit man ihn wieder verehren konnte.
Kapitel 2
Luther oder der Einzelne und sein Gott
Es musste vieles zusammenkommen, damit es in Deutschland, ähnlich und doch ganz anders als in der Renaissance in Italien, zu jenem reformatorischen Umbruch kam, der ganz Europa verändern sollte; neben den vielen Umständen, die ihm zuarbeiteten, war eine entscheidende Voraussetzung doch der Auftritt eines Einzelnen, jenes Mönches Martin Luther aus Wittenberg, der Epoche machte, bloß weil er ein persönliches Verhältnis zu einem, nein, zu seinem Gott suchte.
Was zusammengekommen war: die Konflikte zwischen den erstarkenden Territorialstaaten und den universalen Traditionsmächten Papst und Kaisertum; Verweltlichung der Kirche, verschwenderische Hofhaltung der Kirchenfürsten, Bestechlichkeit der Kurie, Veräußerlichung des Glaubens durch Reliquien- und Ablasshandel; die Bedrohung des Reiches von außen durch die Türken. Hinter alledem sahen die Menschen apokalyptische Zeichen. Dazu kamen noch andere Herausforderungen durch das Unbekannte: die Entdeckung der Neuen Welt und die Nachrichten über unbekannte Sitten, Gebräuche und Religionen, die von dort eintrafen. Moralische Verbindlichkeiten und Sinnordnungen wurden dadurch fragwürdig. Ungeheure Mengen von Gold aus der Neuen Welt überschwemmten das alte Europa, die Seefahrer brachten neue Krankheitskeime mit. Epidemien und Furcht vor Dämonen breiteten sich aus. Hexen wurden verbrannt, während zugleich eine neue wissenschaftliche Neugier erwachte; die Erfahrung erfuhr eine enorme Aufwertung gegenüber bloß scholastischer Gelehrsamkeit. Mit der Erfindung des Buchdrucks entstand eine lesende Öffentlichkeit; Bildung breitete sich aus. Wachsender Geldverkehr und Lockerung der traditionellen ständischen Bindungen führten zu einer kulturellen Blüte in den Städten, die untereinander im Wettbewerb standen und sich gegen die jeweils übergeordneten Mächte zu behaupten suchten. Der individualistische Geist trat hervor. Es entstand damals auch in Deutschland eine gesellschaftlich-kulturelle Atmosphäre, in der, wie auch in Italien, das Gefühl für die Einzelheit des Einzelnen erwachen konnte. Und solches geschah bei Martin Luther, mit unabsehbaren Folgen.
Ich rekapituliere einige Stationen dieser Geschichte der Selbstentdeckung eines Einzelnen. Sie beginnt damit, dass er aus dem Schatten des Vaters heraustrat. 1505 promovierte der 22-Jährige in Erfurt zum Magister Artium. Der Vater, der es vom nicht erbberechtigten Bauernsohn bis zum mittelständischen Bergbauunternehmer gebracht hatte, hoffte, den sozialen Aufstieg in seinem Sohn fortsetzen zu können. Martin sollte deshalb sein Studium bei den Rechtswissenschaften zu Ende bringen, was ihm Karriereaussichten in Politik oder Verwaltung eröffnen würde. Der Sohn fügte sich, gegen innere Widerstände. Der Vater, hocherfreut, schenkte ihm als Ansporn eine kostbare Edition des »Corpus Juris Civilis« und redete ihn nun mit dem vornehmeren »Ihr« statt »Du« an. Eine Frau mit ordentlicher Aussteuer hatte er ihm auch schon ausgesucht. Martin befand sich also aus Sicht des Vaters auf gutem Weg. Doch der Sohn fühlte sich von der Juristerei abgestoßen. Einem Kommilitonen erklärte er einmal in einer Bierkneipe, ein Jurist sei entweder ein Schalk oder ein Esel. Den empörte das so, dass es zu einer Schlägerei kam, bei der Martin eine stark blutende Wunde davontrug. Die Zechkumpane mussten ihn versteckten, um ihm die Relegation zu ersparen.
Nur wenige Wochen hielt er es bei den Juristen aus. Er wollte zur Theologie wechseln, nicht weil er besonders fromm war, vielmehr trieb ihn zunächst eine philosophische Neugier an, denn zu jener Zeit las er weniger in der Bibel als in Boethius’ philosophischer Erbauungsschrift »Der Trost der Philosophie«.
Im Juni 1505 bat er den Rektor, von Erfurt zu Fuß nach Mansfeld hinüberwandern zu dürfen, um den Vater für den Studienwechsel zu gewinnen. Es waren quälende Tage, denn der Vater, der wieder zum »Du« überging, lehnte die Bitte ab und warf dem Sohn vor, er würde das in ihn investierte Geld missbrauchen. Im religiösen Weltbild des Vaters war für innige Gottesliebe und andere religiöse Sentimentalitäten kein Platz. Er war auf robuste Weise realitätstüchtig. Nach außen hin gut angepasst, diszipliniert und selbstbewusst, trat er in der Familie als cholerischer Machtmensch mit Anfällen von Fürsorglichkeit und Jähzorn auf. Er sei oft fürchterlich geschlagen worden, berichtet Martin Luther später. Geschlagen wurde er jetzt im Sommer 1605 nicht mehr, doch er bekam die Ablehnung des Vaters zu spüren, und es wurde ihm schmerzlich bewusst, dass er noch längst nicht aus seinem Schatten herausgetreten war.
Zerknirscht, ohne die väterliche Zustimmung zum Studienwechsel, zog Martin nach einigen Tagen ab. Auf dem Rückweg kommt es kurz vor Erfurt zu jenem legendenhaft verklärten Ereignis, das am Beginn vieler Erzählungen über die Reformation steht: Auf freiem Feld wird Martin von einem schweren Gewitter überrascht. Sturm, gewaltige Regengüsse; Blitze schlagen ein, in unmittelbarer Nähe. Fast besinnungslos vor Angst wirft sich Martin zu Boden und ruft: »Hilf du, Sankt Anna, ich will ein Mönch werden.«
Die Freunde und Kommilitonen, sogar einige seiner Professoren versuchten ihn zu überzeugen, dass ein solches Gelübde unter Zwang nicht bindend sei. Gleichwohl entschloss er sich, beim Schwarzen Kloster der Augustiner-Eremiten in Erfurt, nur ein paar Schritte von der Universität entfernt, um Aufnahme zu bitten. Er hatte einen Orden der strengen Observanz gewählt, als wollte er dem Vater, bei dem die Mönche als »faule Bäuche« galten, beweisen, dass er eben nicht den bequemen Weg habe wählen wollen.
Formell benötigte Martin nicht die Zustimmung des Vaters und war im Kloster nicht mehr auf die väterliche Unterstützung angewiesen. Er hatte sich also auch in die finanzielle Unabhängigkeit vom Vater hinübergerettet. Der entzog ihm mit einer Art Bannfluch »alle Gonst«. In einem wütenden Brief beschimpft er den Sohn, er solle sich bloß nichts einbilden, es sei der Teufel, der ihn verhext habe.
Was sprach für diesen Schritt ins Kloster? War es der größtmögliche Abstand zur »Welt« und also auch zur Familie? Eigentlich nicht, denn die damaligen Klöster waren gut integriert in eine insgesamt katholische Welt, die Mönche standen sozial eher über den gewöhnlichen Priestern und waren in der Regel nicht sozial isoliert, sondern lebten, wie die Augustiner-Eremiten in Erfurt, mitten in der Stadt und in regem Austausch mit ihr. Die Klöster waren auch Versorgungseinrichtungen für Bürgerliche und Adlige, man konnte sich einkaufen, und wer wollte, konnte ein sehr bequemes Leben dort führen. Man war auch nicht stigmatisiert, wenn man das Gelübde wieder auflöste. Im Kloster zu leben musste also durchaus nicht Weltabkehr bedeuten. Doch genau darauf hatte es Martin offenbar abgesehen. Er wählte ein radikal anderes Leben, als es der Vater für ihn vorgesehen hatte. Er rebelliert gegen das gewöhnliche Leben, er vereinzelt sich, zwar nicht gegenüber dem Kollektiv, dem er nun beitritt, aber gegenüber dem Kollektiv, das er verlässt. Er ist bereit, auf Geld, Karriere und Familie zu verzichten. Doch was genau will er dabei gewinnen?
Zunächst einmal Selbstachtung. Ihn lockte das Kloster nicht als Ort der Geborgenheit, sondern als Übungsplatz der Selbstdisziplinierung. Er wollte sich und auch dem Vater beweisen, dass er nicht das Bequeme, sondern die Selbstüberwindung sucht, dass er nicht als Schwächling und Muttersöhnchen vor der harten Arbeit und den Mühen des sozialen Aufstiegs geflohen ist. Deshalb unterwarf er sich den strengsten Bußübungen, so streng, dass die Ordensoberen gegen die selbstquälerischen Kasteiungen einschritten.
Nun hatte er ja den Sprung ins Kloster gegen den Vater gewagt, um dort ein anderes Selbst als jenes, das der Vater für ihn vorgesehen hatte, zu finden. Doch das scheint ihm nicht zu gelingen. Misstrauisch und gequält beobachtet er sein altes Selbst, das ihn wie sein Schatten begleitet; vielleicht hat der Vater doch recht mit seinem Verdacht, er mache sich nur etwas vor und, schlimmer noch, er sei von Trugbildern des Teufels verhext. Vielleicht ist das alles nur Besessenheit? Es wird berichtet, wie Martin sich im Chor des Erfurter Klosters plötzlich zu Boden geworfen und gebrüllt habe: Ich bin’s nit! Ich bin’s nit … Das war geschehen, als gerade Markus 9,17ff. gelesen wurde, die Schilderung also, wie ein von unreinen Geistern Besessener von Christus geheilt wird. Verzweifelt wehrte sich Martin gegen den Verdacht, auch er könnte ein solcher Besessener sein.
Und da waren dann auch diese unreinen Regungen, wie er sie nennt, sexuelle Gelüste, die als sündig galten. Je argwöhnischer er der Sünde auflauerte, desto dringlicher machte sie sich bemerkbar. Später wird er diesen Mechanismus durchschauen: Je länger wir uns waschen, je unreiner wir werden.
Woher aber diese geradezu hysterische Fixierung auf die Sünde? Der Hinweis auf die kollektive Konjunktur des Sündenbewusstseins der damaligen Zeit ist zu pauschal, um Martins Selbstquälereien und Bußexzesse zu erklären. Martin fühlte sich so selbstquälerisch schuldig, weil er die Sünde nicht als etwas Allgemeines, das man leichthin loswerden konnte, empfand, sondern als etwas ganz Eigenes, das ihn als Einzelnen betraf und herausforderte. Die Sündhaftigkeit, üblicherweise routiniert eingestanden, nahm der junge Martin Luther sehr ernst und sehr persönlich. Deshalb empfand er die Äußerlichkeit des kirchlichen Ablasshandels schon früh als abstoßend. Das waren für ihn Entlastungsangebote, die nicht in die Tiefe seiner verinnerlichten und individualisierten Schuldgefühle hinabreichten. Er war also auch im Bewusstsein seiner Sündhaftigkeit energisch auf sich selbst bezogen, und nichts sollte und durfte ihn davon entlasten — außer eben Gott selbst. Doch das sollte ein Gott sein, der sich nicht hinter Institutionen verbirgt, der nicht in einem gesellschaftlichen Betrieb verschwindet, sondern eben ein Gott, den man persönlich erfahren konnte. Dieser Gott wollte sich ihm noch nicht zeigen. Einstweilen zeigte sich ein Gott, der ihn auf sich selbst, auf seine Sündigkeit zurückwarf — ohne Entlastung. Die reine richtende und strafende Majestät.
So schmerzhaft und hoffnungslos fühlte er sich zurückgestoßen, dass ihm bisweilen Zweifel kamen, ob das wirklich Gott war oder nicht doch ein Teufel, der da mit ihm sein quälendes Spiel trieb. Das wird ihn auch später, etwa in den Tischreden, immer wieder beschäftigen — dieses Vexierspiel zwischen Gott und Teufel, bei dem der eine zur Maske des anderen werden kann, in den Augenblicken der Anfechtung. Dann droht sich nämlich die ganze Glaubenswelt aufzulösen. Was bleibt, ist ein schales Gefühl von Leere und Nichtigkeit. Das Teuflische kann bisweilen dämonisch-erregend wirken, in der Regel aber ist es fad, blass, nichtssagend von der Art des gewöhnlichen Lebens. Das ist für ihn die wahre tentatio tristitiae.
Wenn Luther sich also peitschte und bestrafte, wenn er zitternd vor Kälte lang ausgestreckt auf dem eisigen Boden lag, wenn er bis zur Besinnungslosigkeit seine Gebete murmelte, wenn er fastete bis zur Ohnmacht, so wollte dieser Meister der Selbstquälerei wenigstens die Wirkung eines strengen, doch fernen Gottes am eigenen Leibe spüren. Der ist jedenfalls lebendiger und näher als der Gott des Geredes und der Gebräuche, ein Gott immerhin, der einen zum Einzelnen macht, weil man ihn als Einzelner erleiden muss. Und außerdem war er eine Macht, mit der man die Macht des Vaters aus dem Felde schlagen konnte.
Das zeigte sich im Frühjahr 1507 bei der feierlichen Primiz, der ersten Messe des frisch geweihten Priestermönchs. Der Vater, inzwischen noch wohlhabender geworden, reiste mit großem Gefolge an. Martin fieberte dem großen Augenblick entgegen, die Primiz musste er durchstehen — vor Gott und vor dem Vater. Fast wäre er zusammengebrochen, erzählt er später. Er übersteht die Primiz, der Vater streckt die Waffen und reist wieder ab; nun ist Martin mit seinem anderen gestrengen Vater, der himmlischen Majestät, wieder allein.
So begann Luthers Karriere in der Klosterwelt. Vom Generalvikar Staupitz, der ihm in den Jahren zuvor ein Seelenführer gewesen war und der ihn von Übertreibungen der Bußübungen hatte abhalten wollen, wurde er zusammen mit einem Ordensbruder Ende 1510 nach Rom geschickt, um dort Verhandlungen in Ordensangelegenheiten zu führen.
Er war entsetzt über das Ausmaß der Verweltlichung des dortigen Klerus. Geradezu trotzig widmete er sich seinen Pflichten, absolvierte die vorgeschriebenen Andachten, rutschte auf den Knien die Scala Santa hinauf, besuchte jede Kirche, betete vor jeder Reliquie und verdiente sich so einen ordentlichen Sündenablass, den er gerne den Eltern zukommen lassen wollte. Noch glaubte er an die Wirksamkeit solcher Praktiken. Von Michelangelo, der damals gerade die Sixtinische Kapelle ausmalte, nahm er ebenso wenig Notiz wie von Raffael oder von anderen Werken und Meistern der Renaissance, deren Hochblüte in Rom er hätte erleben können, hätte er dafür ein Auge gehabt.
Nach Deutschland zurückgekehrt, wurde Luther Subprior des Wittenberger Augustiner-Klosters mit der Verpflichtung zu regelmäßigen Predigten in der Pfarrkirche. Von hier aus wird er dann später sein gewaltiges Wort erheben und seine Blitze schleudern. Er übernahm den Lehrstuhl von Staupitz, und mit seiner Ernennung zum Generalvikar der Ordensprovinz war er in seinem Orden fast ganz oben angekommen, doch noch immer ruhelos und zerquält.
Dann, irgendwann zwischen 1513 und 1517, die Angaben Luthers schwanken, das sogenannte »Turmerlebnis«. Luther selbst hat großes Aufhebens davon gemacht, weshalb es auch fester Bestandteil des Luther-Mythos geworden ist. Man nannte es die eigentliche »Geburtsstunde der Reformation«. Sie fand, wie Luther mit seiner Vorliebe für Drastik später gerne hervorhob, auf dem Lokus seiner Turmwohnung statt. Bei der Vorbereitung einer Vorlesung über die Psalmen war sein Blick auf jene Stelle im Römerbrief (1,16/17) gefallen, die ihm wohlbekannt war, weil der von ihm hochgeschätzte Augustin sich häufig auf sie bezog: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht … Sintemal darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie denn geschrieben steht: Der Gerechte wird seines Glaubens leben …
Erst jetzt geht ihm, so berichtet er, die ungeheure Bedeutung dieser Sätze auf. Es sind nicht die Anstrengungen, die Bußübungen, die guten Werke, es ist nicht das, was man von sich aus leisten kann, es ist auch nicht das, was einem die Kirche gewähren kann, wenn man sich regelfromm verhält — das alles ist es nicht, was einen vor Gott gerecht macht. Es ist der Glaube. Der Glaube woran? Der Glaube an Christus, der einen mit dem zornigen, fernen, strafenden, richtenden, gebietenden Gott versöhnt.
Allein der Glaube, allein die Gnade — man könnte meinen, dass diese Grundsätze doch ganz selbstverständlich zur christlichen Überlieferung gehören, auch zu Luthers Zeiten. Tatsächlich sind sie auch Kernbestand der Theologie von Paulus und später von Augustinus. Wie können sie als etwas absolut Neues, den ganzen inneren Menschen Umwälzendes von Luther erlebt werden? Es kann sich nicht um ein Geschehen auf der begrifflichen Ebene handeln, dort sind ihm diese Aussagen selbstverständlich längst bekannt. Es muss etwas anderes sein, was ihm jäh aufgeht oder genauer: was mit ihm geschieht. Ein Wissen muss ihm zur persönlichen Erfahrung geworden sein, und zwar zu einer Erfahrung besonderer Art. Sie ist nicht verknüpft mit einem Machen, sondern mit einem Lassen: ein Augenblick ohne Anstrengung und Anspannung, kein Streben, kein inneres Arbeiten, Denken und Grübeln. Vielmehr hat er das Gefühl: Gott handelt in ihm. Es ist, so schreibt er, das Werk Gottes, das Gott in uns tut. Eine abgründige Paradoxie: Die Kraft des Glaubens kommt aus dem Geglaubten. Der Glaube verdankt sich somit nicht einem Willensimpuls. Er ist keine Tat, kein Werk, wie Luther sagt, sondern ein Geschehen, das den inneren Menschen verwandelt. Deshalb das Gefühl der Gelöstheit, das fröhliche Herz, mit der man diese innere Gnadenwirkung verspürt. Das Grübeln hat ein Ende, Gott nimmt einen in Besitz. Luther, sonst geplagt von der dunklen Besessenheit durch den Teufel, erlebt hier eine helle Besessenheit. Später wird er das in die volkstümliche Redeweise übersetzen, man werde entweder von Gott oder vom Teufel geritten. Sich von Gott reiten lassen, darauf käme es also an.
Wenn Glaube und Gnade alles bewirken und der eigene Wille nichts, setzt man vergeblich auf den Willen zum Glauben; man kann sich nicht zum Glauben überreden, man muss von ihm überwältigt werden. Nicht von sich aus absichtsvoll handeln und bewirken wollen, sondern stattdessen etwas mit sich geschehen lassen — darauf kommt es an. Und es kann jetzt geschehen. Erlösung findet nicht erst nach dem Tod in einem Jenseits statt. Das Jenseits ist schon hier, im Diesseits.