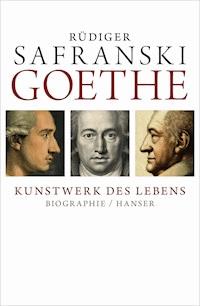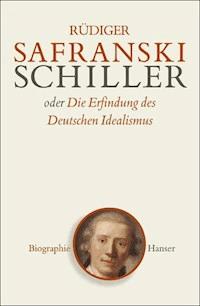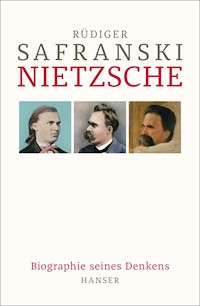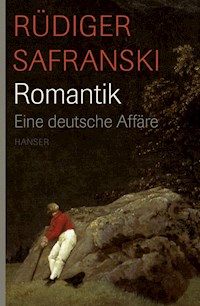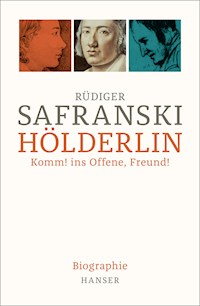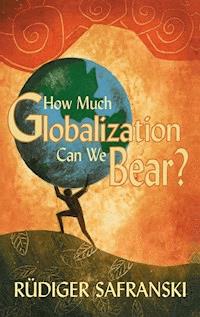Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ihre Freundschaft ist eine Sternstunde des deutschen Geistes: Friedrich Schiller bringt seine Dramen mit Goethes Hilfe auf die Bühne. Johann Wolfgang von Goethe erlebt durch Schiller in Weimar seine zweite Jugend. Dennoch ist ihre gemeinsame Geschichte nicht frei von Konflikten: etwa Schillers Neid auf den bewunderten Goethe oder Goethes Angst vor dem Aufstieg Schillers. Trotz aller Gegensätze lernte Schiller in der Freundschaft, "dass es dem Vortrefflichen gegenüber keine Freiheit gibt als die Liebe". Und jeder der beiden sagte vom anderen: er sei ihm der wichtigste Mensch gewesen. Rüdiger Safranskis Buch ist die spannend erzählte Biographie dieser für die Dichtung in Deutschland so wichtigen Begegnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rüdiger Safranski
Goethe und Schiller
Geschichte einer Freundschaft
Carl Hanser Verlag
eBook ISBN 978-3-446-23516-8
Alle Rechte vorbehalten
© 2009 Carl Hanser Verlag, München
Satz: Gaby Michel, Hamburg
www.hanser-literaturverlage.de
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Inhaltsübersicht
Prolog
Erstes Kapitel
Erste Begegnung 1779. Preisverleihung an der Hohen Karlsschule.
Der Student und der berühmte Dichter auf Besuch. Zeitgeist Sturm und Drang. Goethes und Schillers Natur. Der eine entdeckt den Zwischenkieferknochen, der andere die Freiheit. Die Räuber überhüpfen den Menschen, Iphigenie stellt ihn ruhig. Wirkungswille mit und ohne Maß.
Zweites Kapitel
Zweimal Flucht und Verwandlung. Schiller flieht vor dem Herzog und kommt auf Umwegen endlich nach Weimar. Goethes Flucht nach Italien. Schiller in Weimar unter den Göttern und Götzendienern. Der abwesende Goethe. Alles wartet auf ihn, auch Schiller.
Drittes Kapitel
Schiller und Charlotte von Lengefeld. Ein verliebter Sommer mit der Antike. Begegnung mit Goethe bei den Lengefelds. Goethe bleibt reserviert. Schillers Liebe und Haß. Zwei Liebesgeschichten. Christiane und Charlotte: Goethe bindet sich nach unten, Schiller nach oben.
Viertes Kapitel
Goethe und Schiller herausgefordert von der Französischen Revolution. Schillers Pathos in der Nußschale. Ausblicke auf den Menschenozean. Goethe schließt seinen Kreis. Die große Kunst der Ignoranz. Wider die Aufgeregten. Goethes Kunst als Asyl und Schillers Spielfeld der Revolution. Anmut und Würde. Der gekränkte Günstling der Natur.
Fünftes Kapitel
Schillers Reise nach Schwaben. Verbindung zu Cotta. Gründung der Zeitschrift Die Horen. Literaturbetriebliches. Einladung an Goethe. Goethes Lebenswende. Das Glückliche Ereignis: die Begegnung im Sommer 1794. Schillers großer Geburtstagsbrief. Erster Ideentausch, erster Besuch Schillers im Haus am Frauenplan.
Sechstes Kapitel
Gemeinsame Arbeit am Wilhelm Meister. Der sentimentalische Schiller in der Werkstatt des naiven Genies. Der Spieltrieb. Publikumsreaktionen. Schiller: ... daß es dem Vortrefflichen gegenüber keine Freiheit gibt als die Liebe. Schillers Anregungen und Kritik. Wilhelm Meister – auch nur ein Glückskind?
Siebtes Kapitel
Die Horen. Hohe Ambitionen. Zwei Arten politischer Antipolitik. Goethes gesellige Bildung und Schillers ästhetische Erziehung. Schiller verärgert Fichte. Wieviel Stil braucht die Philosophie? Die Horen in der Krise. Die Römischen Elegien als Rettungsanker. Ärger mit den Schlegels. Das Ende der Horen.
Achtes Kapitel
Goethe in Jena. Lebensbilder einer Freundschaft. Charlotte und Christiane. Abstand zum unordentlichen Liebesleben. Schiller und Christiane bei Mondschein. Die Herren im Gespräch auf dem Feldherrnhügel der Literatur. Die Xenien. Schiller, Egmont und die Grausamkeit. Der Balladensommer 1797
Neuntes Kapitel
Herrmann und Dorothea. Goethe plant die dritte italienische Reise. Schiller will ihn zurückhalten. Hölderlin zwischen den Meistern. Goethes Autodafé vor der Reise. Das Briefgespräch über symbolische Wahrnehmung. Goethe auf Schillers Spuren in Schwaben. Die Tell-Idee.
Zehntes Kapitel
Goethe in der poetischen Dürreperiode. Schillers Angst vor dem Werk und Schaffensrausch. Die philosophische Bude wird geschlossen. Die ästhetische Geistesstimmung. Wallenstein. Die triumphale Rückkehr zum Theater. Goethe hilft und bewundert. Die Idee vom ungeheuren Weltganzen. Schiller im Gartenhaus.
Elftes Kapitel
Über das Epische und Dramatische. Nach Schillers Horen Goethes Propyläen. Antike und kein Ende. Der Sammler und die Seinigen. Ein Familienroman. Gruppenbild mit Schiller. Wieviel Wirklichkeit verträgt die Kunst? Die Lust am Schematisieren. Gegen den Dilettantismus. Fichtes Vertreibung aus Jena. Schillers Umzug nach Weimar.
Zwölftes Kapitel
Die Weimarische Dramaturgie: Gegen das Unnatürliche und das Allzunatürliche. Das Geschmacksregime des Herzogs. Übersetzungsübungen: Goethes Voltaire, Schillers Shakespeare. Goethe der Freund und Vorgesetzte. Maria Stuart. Wieviel Religion und welche? Faust und Faustrecht.
Dreizehntes Kapitel
Goethe hat zu viel Welt, Schiller zu wenig. Romantische Affäre im Hause Schlegel. Das Dreieck Goethe, Schelling und Schiller. Schillers Johanna von Orleans und Goethes Natürliche Tochter. Der Ärger um Kotzebue. Mißstimmung zwischen Goethe und Schiller.
Vierzehntes Kapitel
Schillers Theatererfolge. Verbotene Vivat-Rufe. Goethe tritt Schiller den Tell ab. Der konservative Revolutionär. Madame de Staël in Weimar. Das Angebot aus Berlin. Goethe hält Schiller in Weimar. Letzte Werke. Das Hochstaplermotiv. Demetrius und Rameaus Neffe. Schiller stirbt.
Epilog
oder: Schillers zweite Karriere im Geiste Goethes
Bibliographie
Anmerkungen
Personenregister
Prolog
Freundschaft im eminenten Sinne ist selten. Von Aristoteles wird der Ausspruch überliefert, »meine lieben Freunde, es gibt keinen Freund!« Kant, der sich auf Aristoteles beruft, bemerkt: Freundschaft in ihrer »Reinheit« und »Vollständigkeit« gedacht, sei wohl doch nur ein »Steckenpferd der Romanschreiber«. Wirkliche Freundschaft ist jedenfalls seltener, als es der inflationäre Wortgebrauch vermuten läßt. Goethe und Schiller haben ihre Freundschaft als ein rares, wunderliches Gewächs angesehen, als ein Glück, als ein Geschenk. Es kam ihnen unglaublich vor, was ihnen da gelungen oder zugestoßen war, und sie gerieten in dankbares Staunen darüber. Im Rückblick nannte Goethe die Freundschaft ein glückliches Ereignis. Ein solches bleibt es für uns auch heute noch, denn man wird in der Geschichte des Geistes lange suchen müssen, um etwas Vergleichbares zu finden – daß zwei schöpferische Menschen höchsten Ranges sich über Gegensätze hinweg verbinden zu wechselseitiger Anregung und sogar zu gemeinsamem Werk.
Die Freundschaft der beiden wurde schon damals zur Heldenlegende verklärt. Man machte die Freunde zu Dichterfürsten auf dem literarischen Olymp und nannte sie die »Dioskuren«. Auch Neid und Widerwille regten sich. Wenn man ihnen nicht am Zeug flicken konnte, wollte man wenigstens den einen gegen den anderen ausspielen, eine Hierarchie zwischen ihnen festsetzen. Wer ist der Bedeutendere, oder werden nicht vielleicht sogar beide überschätzt? Offiziell wurden sie bald schon als marmorne Klassiker verehrt, aber in jeder Generation regten sich rebellische Anwandlungen. Als Goethe 1829 den Briefwechsel mit Schiller herausgab, nannte ihn Grabbe eine »Sammlung billetmäßiger Lappalien«, und Börne schrieb, »daß unsere zwei größten Geister in ihrem Hause ... so nichts sind ... das ist ein Wunder, ... eine Verwandlung des Goldes in Blei«.
Goethe und Schiller waren darauf gefaßt, daß man ihrer überdrüssig werden könnte, und übten sich beizeiten in der Kunst der Publikumsbeschimpfung. Ihren Freundschaftsbund verstanden sie auch als Trutzburg, von wo aus sie wohlgelaunt ihre Blitze gegen das zeitgenössische literarische Leben schleuderten.
Goethe und Schiller waren Konkurrenten, ehe sie zu Freunden wurden. Goethe fühlte sich vom Ruhm des Jüngeren bedrängt. Für ihn war Schiller zunächst nichts anderes als eine ungute Erinnerung an den eigenen, inzwischen überwundenen Sturm und Drang. Und Schiller sah in Goethe eine stolze Prüde, der man ein Kind machen muß, um sie vor der Welt zu demütigen. Es mußte einiges geschehen, ehe Schiller an Goethe schreiben konnte: Wie lebhafthabe ich ... erfahren ..., daß es dem Vortrefflichen gegenüber keine Freiheit gibt als die Liebe und Goethe Schiller gegenüber erklärte: Sie haben mir eine zweite Jugend verschafft und mich wieder zum Dichter gemacht, welches zu sein ich so gut als aufgehört hatte.
Was hier im einzelnen geschehen war, davon erzählt dieses Buch. Wie der junge Schiller den bewunderten Goethe bei der Preisverleihung an der Karlsschule als Gast des Herzogs zum ersten Mal erblickte. Wie es in den nächsten Jahren zu einer eigenartigen Parallelität der Lebensläufe kam: Zweimal Flucht und Verwandlung. Schiller flieht aus Stuttgart und dem Machtbereich des Herzogs. Goethe flieht nach Italien. Für beide ist es eine Befreiung zu neuem Künstlertum. Zweimal auch ein neuer Liebesbund. Schiller und Charlotte, Goethe und Christiane. Goethe verliebt und bindet sich sozial nach unten, Schiller nach oben. Dann die mühsame Annäherung, Schiller tastet sich zu Goethe vor, der aber hält auf Abstand. Im Sommer 1794 in Jena schließlich das glückliche Ereignis der gelungenen Begegnung. Von da an beginnt der Briefwechsel, wohl das bedeutendste gemeinsame Werk der beiden und die wichtigste Quelle dieses Buches. Von 1794 bis zum Tode Schillers im Mai 1805 währt die Freundschaft. Die Polarität der Temperamente und Charaktere bewirkt bei jedem eine Steigerung der schöpferischen Kräfte, bei Goethe vor allem in den ersten, bei Schiller in den letzten Jahren der Freundschaft.
Montaigne sieht in der gelungenen Freundschaft einen Vorgang, wie »zwei Seelen miteinander verschmelzen«. So aber verhielt es sich bei der Freundschaft zwischen Goethe und Schiller nicht. Sie waren nicht ein Herz und eine Seele, und zu ihrem Glück strebten sie das auch nicht an. Es hätte bei ihren so verschiedenen Naturen notwendig zu Enttäuschungen geführt. Goethe hielt sich an jene Maxime, die er im Dezember 1798 in einem Brief an August Herder so formulierte: Wenn wir immer vorsichtig genug wären und uns mit Freunden nur von Einer Seite verbänden, von der sie wirklich mit uns harmonieren, und ihr übriges Wesen weiter nicht in Anspruch nähmen, so würden die Freundschaften weit dauerhafter und ununterbrochner sein. Gewöhnlich aber ist es ein Jugendfehler, den wir selbst im Alter nicht ablegen, daß wir verlangen, der Freund solle gleichsam ein anderes Ich sein, solle mit uns nur ein Ganzes ausmachen, worüber wir uns denn eine Zeit lang täuschen, das aber nicht lange dauern kann.
Goethe hatte sich mit Schiller tatsächlich zunächst nur von einer Seite verbunden, und auch Schiller war vorsichtig genug, die Verbindung nicht zu sehr zu belasten. Was sie aber verband, war bedeutend genug. Es war das für sie Wichtigste: die Arbeit am eigenen Werk, die in der Freundschaft zu einer gemeinsamen Arbeit wurde. Die beglückende Erfahrung, daß dies zwischen ihnen überhaupt möglich war, ließ diese Verbindung über eine nur partielle Berührung weit hinausgehen. Und doch blieb der Werkbezug das Zentrum und die Basis: Sich wechselseitig zu helfen und zu befördern, im intensiven Austausch von Gedanken und Empfindung, das war der erklärte Zweck der Freundschaft. Neigung, ja sogar Liebe hilft alles nichts zur Freundschaft, schreibt Goethe, die wahre, die tätige, produktive besteht darin, daß wir gleichen Schritt im Leben halten, daß er meine Zwecke billigt, ich die seinigen, und daß wir so unverrückt zusammen fortgehen. Schiller nennt eine solche Freundschaft ein auf wechselseitige Perfektibilität gebautes Verhältnis. und Goethe, wenn er den Ertrag der Freundschaft mit einem Wort bezeichnen wollte, erklärte, sie habe ihn gefördert. Es handelte sich also um einen Bund zur wechselseitigen Hilfe bei der Arbeit an sich selbst, ein gemeinsames Unternehmen der Selbststeigerung. Die Geschichte der Freundschaft von Goethe und Schiller ist eine praktische Probe aufs Exempel der Bildungsidee im Zeitalter der deutschen Klassik.
Goethe bekannte einmal, daß die so bedeutend klingende und kanonische Anweisung ›Erkenne dich selbst‹ ihm stets verdächtig vorgekommen sei, weil man beim Blick in sich selbst niemals genau unterscheiden könne zwischen dem Gefundenen und dem Erfundenen. Er empfiehlt den Umweg über die Welt, denn der Mensch kennt nur sich selbst, sofern er die Welt kennt und von ihr erkannt wird. Deshalb, erklärt Goethe, habe er in reiferen Jahren, statt sich im inneren Spiegelkabinett zu verirren, die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, in wiefern andere mich wohl erkennen möchten, damit ich in und an ihnen, wie an so viel Spiegeln, über mich selbst und über mein Inneres deutlicher werden könnte. In dieser Hinsicht mußte Schiller für ihn ein Glücksfall sein. Einen besseren Bewußtseinsspiegel konnte er kaum finden als bei Schiller, diesem Reflexionsgenie. Goethe nahm Schiller in Anspruch, um einiges Licht in sein überreiches Innenleben zu bringen. Warum war es überreich? Ganz einfach: Weil er so viel Welt in sich aufgenommen hatte. Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf.
Anders Schiller. Er klagt über seinen Mangel an Welterfahrung. An Goethe schreibt er 1795: Es kommt mir oft wunderlich vor, mir Sie so in die Welt hinein geworfen zu denken, indem ich zwischen meinen Papiernen Fensterscheiben sitze, und auch nur Papier vor mir habe. Schiller, zwischen seinen papiernen Fensterscheiben, hatte überschüssige Reflexionskraft. Seine geistige Potenz wurde von seinem Erlebnisstoff nicht vollständig aufgebraucht. Er konnte sie dem Freund zur Verfügung stellen, um diesem als Spiegel zu dienen und sich selbst mit Welt anzureichern. Mit Goethe bot sich ihm ein ganzer Kontinent, wenn nicht zur Besitzergreifung, so doch zur Erkundung an. Außerdem ließ ihn Goethe, dieses Genie der Intuition, Zutrauen fassen in die eigenen Kräfte des Unbewußten. Erst in der Freundschaft mit Goethe lernte Schiller, daß die schöpferischen Antriebe in einem Bereich wurzeln, der seiner Natur nach nicht begriffen werden kann. Die beiden ergänzten sich auf wunderbare Weise: der eine sorgte für Helligkeit und Bewußtheit, der andere für schöpferische Verbindung mit dem Dunklen und Unbewußten. Die beiden Regionen – Idee und Erfahrung, Freiheit und Natur, Begriff und Vieldeutigkeit – zusammenzuführen, war ihr gemeinsames Ideal. Sie selbst und noch mehr die Nachwelt nannten es – das Klassische.
So hatten die Freunde Freude aneinander und nahmen sich wechselseitig in Gebrauch. Fahren Sie fort, schreibt Goethe, mich mit meinem eigenen Werke bekannt zu machen, und Schiller antwortet: Der reiche Wechsel Ihrer Phantasie erstaunt und entzückt mich, und wenn ich Ihnen auch nicht folgen kann, so ist es schon ein Genuß und Gewinn für mich, Ihnen nachzusehen.
Als Schiller starb, wußte Goethe, daß für ihn damit eine Epoche seines Lebens zu Ende ging. So innig war inzwischen das Verhältnis der beiden geworden, daß Goethe Zelter gegenüber, dem Freund der späteren Jahre, bekannte: Ich dachtemich selbst zu verlieren, und verliere nun einen Freund und in demselben die Hälfte meines Daseins.
Schiller starb, ohne die Epoche dieser Freundschaft abschließend resümieren zu können. Er steckte noch mitten in der Arbeit, in der gemeinsamen Arbeit. Er überprüfte gerade Goethes Anmerkungen zu Diderot. In seinem letzten Brief schreibt er: Indessen seh ich mich gerade bei diesem ... Artikel in einiger Controvers mit Ihnen.
Diese Freundschaft, die reich ist an Aspekten und Geschichten, war doch vor allem dies – ein kontroverses Gespräch bis zum Ende. Eben deshalb läßt sich so viel damit anfangen.
Anmerkungen zu diesem Kapitel
Erstes Kapitel
Erste Begegnung 1779. Preisverleihung an der Hohen Karlsschule.
Der Student und der berühmte Dichter auf Besuch. Zeitgeist Sturm und Drang. Goethes und Schillers Natur. Der eine entdeckt den Zwischenkieferknochen, der andere die Freiheit. Die Räuber überhüpfen den Menschen, Iphigenie stellt ihn ruhig. Wirkungswille mit und ohne Maß.
Am 11. Dezember 1779 machen der Weimarer Herzog Karl August und der Geheime Legationsrat Goethe, auf der Rückreise von Bern Station in Stuttgart, wo sie Gäste des württembergischen Herzogs sind. Karl Eugen persönlich führt die Gäste durch die Hohe Karlsschule, die er stolz seine »Pflanzstätte« nannte. Die Studenten drängen sich, den berühmten Autor des »Götz« und des »Werther« leibhaftig sehen und vielleicht einen Blick von ihm erhaschen zu können. Dazu gibt es Gelegenheit. Am 14. Dezember wird das Stiftungsfest der Karlsschule im Neuen Schloß gefeiert, mit Musik, Reden und Chorgesang. Im blumengeschmückten Festsaal zeigen sie sich: vorne in der Mitte steht Karl Eugen, zu seiner Rechten der Weimarer Herzog, zur Linken Goethe, würdevoll steif. Er ist nur zehn Jahre älter als Schiller, aber er steht dort vor ihm, über ihm, wie eine alte Macht aus einer höheren Welt. Iffland erlebte ihn damals auch zum ersten Mal: »Goethe hat einen Adlerblick, der nicht zu ertragen ist. Wenn er die Augenbrauen in die Höhe zieht, so ist, als ginge der Hirnknochen mit«. Die Jahrgangspreise werden verteilt. Die Ausgezeichneten treten vor, knien nieder und küssen zum Dank den Rockzipfel des Herzogs. Schiller erhält drei Silbermedaillen und Diplome in medizinischen Fächern. Auch er muß knien und küssen. Er bedauert es, sich nicht bemerklich machen zu können, und wagt es nicht, den Blick seitlich schräg nach oben zu lenken, wo Goethe über ihn hinwegblickt.
Goethe stand zu diesem Zeitpunkt zwar immer noch in dem Ruf, ein »Stürmer und Dränger« zu sein, aber er war es nicht mehr. Kurz vor Antritt dieser Reise hatte er im Tagebuch notiert: Andre Zeiten andre Sorgen. Stiller Rückblick aufs Leben, auf die Verworrenheit, Betriebsamkeit ... Wie ich besonders in Geheimnissen, dunklen imaginativen Verhältnissen eine Wollust gefunden habe ... Wie kurzsinnig in menschlichen und göttlichen Dingen ich mich umgedreht habe ... wie nun kein Weg zurückgelegt sondern vielmehr ich nur dastehe wie einer der sich aus dem Wasser rettet und den die Sonne anfängt wohltätig abzutrocknen ...
Seine Haltung ist neuerdings bemüht würdevoll. Eine Veränderung, die von seiner näheren Umgebung, die ihn anders kennen und schätzen gelernt hatte, mit Befremden aufgenommen wurde – »statt der allbelebenden Wärme«, schreibt Wieland, »ist politischer Frost um ihn her. Er ist immer gut und harmlos, aber – er teilt sich nicht mehr mit«. Das Befremden, das er bewirkte, hat Goethe gespürt. In einem Brief an Charlotte von Stein vergleicht er sich am 13. September 1780 mit einem Vogel der sich aus einem guten Entzweck ins Wasser gestürzt hat, und dem, da er am Ersaufen ist, die Götter seine Flügel in Flossfedern nach und nach verwandeln. Die Fische die sich um ihn bemühen begreifen nicht, warum es ihm in ihrem Elemente nicht sogleich wohl wird. Warum sollen die anderen mit ihm ihr Behagen haben, wenn es ihm selbst daran fehlt? Warum sollten sie nicht von ihm befremdet sein, da er doch selbst auch von sich und seiner neuen Rolle befremdet ist?
Da stand nun also dieser »frostige« Goethe steif und Ehrfurcht gebietend auf der Empore des Neuen Schlosses in Stuttgart, womöglich hat er sich gelangweilt. So ziehen wir an Höfen herum, schreibt er zwei Wochen später an Frau von Stein, frieren und langeweilen, essen schlecht und trinken noch schlechter. Hier jammern einen die Leute, sie fühlen wie es bei ihnen aussieht und ein fremder macht ihnen bang. Sie sind schlecht eingerichtet, und haben meist Schöpse und Lumpen um sich.
In Stuttgart hatten diese Schöpse und Lumpen Goethe davor gewarnt, beim württembergischen Herzog den Fall Schubart zur Sprache zu bringen. Die Geschichte um den Publizisten und ehemaligen Organisten Christian Friedrich Daniel Schubart war damals in aller Munde. Schubart hatte sich vom reichsstädtischen Ulm aus mit dem Herzog angelegt, indem er den Verkauf von württembergischen Landeskindern für Englands Kolonialkriege anprangerte und Karl Eugens Mätresse Franziska von Hohenheim als »Lichtputze, die glimmt und stinkt« verspottete. Man lockte Schubart mit falschen Versprechungen auf württembergischen Boden und verhaftete ihn. Als Schubart im Februar 1777 auf dem Hohen Asperg in den Kerker geworfen wurde, war der Herzog mit seiner Franziska zugegen – diese Genugtuung wollten sich die beiden Gekränkten nicht entgehen lassen.
Die Ereignisse waren noch in frischer Erinnerung, und Schubart saß immer noch als persönlicher Gefangener des Herzogs in dem feuchten Turmverlies, durfte nicht lesen und schreiben und keinen Besuch empfangen; es wuchs aber in ganz Deutschland sein Ruhm als Märtyrer des freien Wortes. Man setzte Petitionen auf, verfaßte Gedichte auf den gefangenen Freiheitsfreund. Im fernen Weimar setzte sich Herder für Schubart ein und gab ihm in den »Briefen zur Beförderung der Humanität« einen Ehrenplatz in der Heldengalerie von Kämpfern für Freiheit und Menschlichkeit.
Schubarts Frau erhoffte sich von Goethe Beistand. »Gott, dachte ich, vielleicht ist auch dieser ein göttliches Werkzeug, uns Freunde zu erwerben«. Über einen Mittelsmann trat sie an Goethe heran, der seine Bereitschaft bekundete, mit der Frau Verbindung aufzunehmen. Dazu kam es nicht. Karl Eugen ließ Goethe abschirmen. Helene Schubart war verzweifelt, »laut spricht mein Herz mit ihm, und doch darf ich es bei denen Umständen nicht wagen, ihn zu suchen ...«. Unter den Studenten, die fast alle für Schubart »glühten«, versprach man sich viel von Goethes Hilfe. Tatsächlich wurden Schubarts Haftbedingungen wenig später erleichtert. Das hatte aber gewiß nichts mit Goethe zu tun, dessen politisches Gewicht seine Bewunderer überschätzt haben mochten.
»Goethe war überhaupt unser Gott«, erinnert sich Georg Friedrich Scharffenstein, Schillers Kommilitone. Goethe war mit dem Erscheinen des Schauspiels »Götz von Berlichingen« 1773 und dem Roman »Die Leiden des jungen Werther« 1774 für die ehrgeizigen und literaturbesessenen jungen Leute in kurzer Zeit zum Inbegriff des »Genies« geworden. Seine Person trat deutlich faßbar hinter seinem Werk hervor und man spekulierte, wie sonst nur noch bei Jean Jacques Rousseau, über die biographischen Hintergründe des Werkes. Goethes Ruhm war Symptom eines Wandels im literarischen Leben. Schreiben, Lesen und Leben rückten näher zusammen. Man wollte das eigene Leben in der Literatur wiedererkennen und aufgewertet finden, man wollte sich selbst finden, aber auch den Autor, der plötzlich mit seiner Biographie interessant wird, und wenn er es noch nicht ist, sich interessant zu machen versucht. Diese Aufwertung des Persönlichen, auf Seiten des Lesers und des Autors, gehörte zum Geniekult jener Jahre. Es hatte zum Beispiel mächtiges Aufsehen in der literarischen Öffentlichkeit erregt, als Goethe, wenige Wochen vor seinem Besuch in Stuttgart, im Park von Ettersburg einen Roman seines Freundes Fritz Jacobi, »Woldemar«, an eine Eiche nagelte und hernach, vom Baumwipfel herab, Spottverse deklamierte. Das war einer der Rückfälle Goethes in den Sturm und Drang gewesen. Auch in Stuttgart hatte man davon gehört. Schiller hatte es gefallen.
Skandale gehörten zum Personenkult der Geniezeit. Ein Künstler legt ein Werk vor. Gut. Das genügt aber nicht. Besser, man macht das eigene Leben zum Kunstwerk, das die Neugier und Deutungslust des Publikums anregt. Goethe hatte es vorgemacht. Man redete schon damals über sein Leben, über die Jahre in Frankfurt, über seine Geliebten, über die Frage, wieviel Goethe steckt im »Werther«, über das tolle Treiben mit dem jungen Herzog in den ersten Weimarer Jahren. Angefangen hatte Goethes Ruhm mit dem »Götz von Berlichingen«. Der Erfolg des »Götz« beruhte auf der Umkehrung traditioneller Vorstellungen von Rang und Ansehen: Mitglieder alter Familien fragten beim berühmten Autor an, ob er denn nicht auch ihr Geschlecht verewigen wollte. Weil Goethe sich nicht dazu bereit fand, setzte ein Baron von Riedesel, Freiherr zu Eisenach, Erbmarschall in Hessen, einen Preis von 20 Dukaten aus für ein Schauspiel, welches seine Familie so berühmt machen sollte wie die der Berlichingen. Der Preis sollte bei der Leipziger Messe 1777 vergeben werden, und der Freiherr war kühn genug, sich Lessing als Preisrichter zu wünschen. Es fand sich aber keiner, der sich der Riedesels annahm. Der »Götz« stellte eben alles in den Schatten, ausführlich wurde sogar die Frage erörtert, ob wirklich, wie bei Goethe, die rechte Hand des Ritters aus Eisen war oder doch die linke. Ein Göttinger Rezensent entschied sich für die rechte mit dem Argument, daß die rechte Hand »in der Tat einem Ritter so unentbehrlich« war, »als sie manchem Edierer, Kompilierer, Rezensierer ist, nur im Unterschiede, daß der Ritter doch noch mehr im Kopfe bei ihr brauchte«.
Der »Götz« war ein nationaler, der »Werther« wurde ein europäischer Erfolg. Die Wertherkleidung – gelbe Weste und Hose, blauer Frack und braune Stulpenstiefel – ist bis zum heutigen Tage der seltene Fall, daß eine Modewelle in Deutschland von der Literatur ihren Ausgang nahm und ihren Ursprung nicht, wie gewöhnlich, in Frankreich, England oder Amerika hatte. Auch soll es da und dort zu nachahmenden Selbstmorden gekommen sein. Der »Werther« wurde zum Kultbuch einer ganzen Generation. Der junge Bonaparte hatte ihn siebenmal gelesen. Er fand die unglückliche Liebe ergreifend, die Gesellschaft aber zu schlecht dargestellt, was er später bei der berühmten Erfurter Begegnung von 1808 Goethe gegenüber tadelnd anmerkte. Auch bei Bonaparte hatte die Begeisterung für den Roman die Neugier auf die Persönlichkeit des Autors gelenkt. Der skeptische Lessing, der schon den »Götz« kritisiert hatte, nahm auch den »Werther« ungnädig auf, doch konnte er sich dem Bann des biographischen Interesses nicht entziehen: er veröffentlichte die philosophischen Schriften jenes K. W. Jerusalem, der als Modell für das Schicksal Werthers galt. Lessing wollte zeigen, daß jener Jerusalem ein ganz anderer »Kerl« gewesen sei als »Werther« und sein Autor.
Als Goethe Ende 1775 der Einladung von Karl August an den Hof nach Weimar Folge leistete, verfolgte man gespannt die weitere Entwicklung dieses »Kerls«. Würde der Dichter, der die höfische Gesellschaft kritisiert hatte, auf den Fürsten abfärben oder umgekehrt der Fürst auf den Dichter? Würde der Dichter höfisch oder der Fürst genialisch werden? Zunächst sah es so aus, als sei es der junge Herzog, der seinem Mentor nacheiferte. Man erzählte sich, wie schlimm es Goethe mit seinem jungen Herzog trieb, auf der Jagd, bei Zechgelagen und Landpartien mit dörflichen Schönheiten. Goethe habe, hieß es, den beschaulichen Musensitz zum Hauptquartier des Geniewesens gemacht. Wirklich zog Goethe andere Autoren des Sturm und Drang, Lenz, Klinger, Kaufmann, die Brüder Stolberg, die damals noch nicht fromm waren, wie ein Kometenschweif hinter sich her. Es gab Feste, über die sich die Weimarer Philister noch Jahrzehnte später erregten. »Unter andern wurde damals«, schreibt Böttiger, »ein Geniegelag gehalten, das sich gleich damit anfing, daß alle Trinkgläser zum Fenster hinausgeworfen, und ein paar schmutzige Aschenkrüge, die in der Nachbarschaft aus einem alten Grabhügel genommen worden waren, zu Pokalen gemacht wurden.« Man überbot sich in Gesten und Auftritten, die ungebührlich wirken sollten. Lenz spielte den Narren, Klinger verzehrte ein Stück rohes Pferdefleisch, Kaufmann fand sich bei der herzoglichen Tafel ein, die Brust bis auf den Nabel nackt, offenes, flatterndes Haar und mit einem gewaltigen Knotenstock. Der Frau von Stein war dieses Geniewesen sehr zuwider, sie klagte in einem Brief an ihren Freund Zimmermann über Goethes »unanständiges Betragen mit Fluchen mit pöbelhaften niedern Ausdrücken«, er verderbe damit sogar den Herzog, der auch in diese »Manieren« falle und neuerdings behaupte, »daß alle Leute mit Anstand ... nicht den Namen eines ehrlichen Mannes tragen könnten«.
Die Kunde vom tollen Treiben in Weimar drang auch zu Klopstock in Hamburg. Er glaubte, die Ehre der »Gelehrtenrepublik« verteidigen zu müssen und schrieb dem 25 Jahre Jüngeren, den er als seinen begabtesten Schüler ansah, einen Ermahnungsbrief: »Der Herzog wird, wenn er sich ferner bis zum Krankwerden betrinkt, anstatt, wie er sagt, seinen Körper dadurch zu stärken, erliegen und nicht lange leben ...«, worauf Goethe schneidend antwortete: Verschonen Sie uns ins Künftige mit solchen Briefen, lieber Klopstock! Sie helfen nichts, und machen uns immer ein paar böse Stunden.
In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre wurden die Nachrichten vom Genietreiben in Weimar spärlicher, aber der Geniebegriff, den Goethe so überzeugend verkörperte, verlor bei jungen Leuten wie Schiller und seinen Freunden an der Karlsschule nichts von seiner Strahlkraft. Genie – das war für sie eine Angelegenheit des Herzens, ein Schlachtruf fast in den geistigen Kämpfen ihrer Gegenwart, an denen sie teilnahmen, wenn auch einstweilen noch aus der Ferne. Goethes Genie stellte alle in den Schatten. Klopstock zum Beispiel. Den aber hatte Schiller zunächst sehr verehrt, nicht anders als Goethe selbst, der sich auch erst frei machen mußte von Klopstock. Schiller durchlebte die Klopstock-Phase, als Goethe sie schon überwunden hatte. Schiller hatte in Klopstocks Oden und im »Messias« die Liebe und Lust gefunden, sich in den endlosen Räumen zu ergehen und doch das Riesige mit dem Winzigen zu verbinden. Klopstock, das war für Schillers Generation der erhabene Sound der Väter: »Nicht in den Ozean / Der Welten alle / Will ich mich stürzen! / ... / Nur um den Tropfen am Eimer, / Um die Erde nur, will ich schweben ...« Auch Schiller hatte sich hineingefühlt in die Pose des Weltenempörers, des gefallenen Engels Abbadona, dem der Himmelsraum zur Wüste und die Welt zu einem Nichts wird.
Für Schiller war Klopstock, wie einst auch für Goethe, ein Abgott der Jugend gewesen. In diesem Alter bevorzugt man das Gigantische, weil man das Leben noch nicht kennt. Im Unterschied dazu lernte Schiller bei Goethe etwas Erhabenes, das nicht, wie bei Klopstock, nach den Sternen, sondern ins volle Leben greift. Als er noch ein Sklave von Klopstock war, schwelgte Schiller im Überirdischen ohne Bodenberührung, bei Goethe aber fand er das Irdische mit überirdischem Glanz. Was Goethe einige Jahre früher gelernt hat, lernt nun auch Schiller: daß das Erhabene hohl bleibt, wenn es sich nicht in des Lebens Fremde hineinbildet.
Goethe wird in »Dichtung und Wahrheit« über Klopstock schreiben: Die Würde des Gegenstandes erhöhte dem Dichter das Gefühl eigner Persönlichkeit. An Goethe begreift Schiller, daß das Gefühl der eigenen Persönlichkeit aus ihr selbst, ihrem schöpferischen Grund, entspringen muß und nicht auf die Würde des Gegenstandes angewiesen ist. Das Genie benötigt nicht den Höhenkamm großer Themen, um groß zu erscheinen. Der geniale Dichter gilt als der »Prometheus« einer zweiten Schöpfung, Hier sitz ich forme Menschen / Nach meinem Bilde ... heißt es in Goethes Prometheus-Ode.
War von Genie die Rede, dachte man in den siebziger Jahren zunächst an Shakespeare. Noch dreißig Jahre zuvor war er in Deutschland fast unbekannt, jetzt gilt er als der Menschenschöpfer schlechthin. Er wetteiferte, schreibt Goethe in seiner Rede auf Shakespeare, mit dem Prometheus, bildete ihm Zug vor Zug seine Menschen nach, nur in Kolossalischer Größe.Shakespeare erhebt sich nicht, wie Klopstock, über die Natur, er ahmt sie auch nicht idyllisch nach, wie die Anakreontiker, er schafft sie aus seiner inneren Natur und trifft eben darum die Wahrheit der äußeren Natur und des Menschengewimmels.
›Natur‹ ist neben ›Genie‹ das andere Zauberwort der Epoche. Beide Begriffe gehören zusammen und stehen in Opposition zu Künstlichkeit und Zwang. Das Genie hält sich nicht an Regeln, sondern gibt sich selber welche, die der eigenen schöpferischen Natur entstammen. Für diesen Gedanken wird später Kant die bündige Formel finden, daß Genie jene Naturgabe ist, welche »der Kunst die Regel gibt«.
Durch seinen Lehrer Jakob Friedrich Abel, der sich mit einer mitreißenden Rede über das »Genie« in der Karlsschule eingeführt hatte, lernte Schiller Shakespeare kennen. »Das Genie«, erklärte Abel in seiner Rede vom 14. Dezember 1776, auf den Tag genau drei Jahre vor Goethes Besuch in der Karlsschule, »das Genie spielt mit kühnen, großen Gedanken wie Herkules mit Löwen. Was hat nicht Shakespeare gelitten? Da schreien und quaken sie zu seinen Füßen, aber noch steht er unerschüttert, sein Haupt in den Wolken des Himmels«. Mit diesem »Löwen« hatte Abel den jungen Schiller in den folgenden Jahren im Unterricht bekannt gemacht. Um psychologischen Begriffen Anschaulichkeit zu geben, pflegte er Stellen aus der Dichtung heranzuziehen. So erläuterte er einmal das Problem der Eifersucht am Beispiel des »Othello«, aus dem er einiges in der Wielandschen Übersetzung vorlas. Abel schildert die Szene so: »Schiller war ganz Ohr, alle Züge seines Gesichts drückten die Gefühle aus, von denen er durchdrungen war, und kaum war die Vorlesung vollendet, so begehrte er das Buch von mir und von nun an las und studierte er dasselbe mit ununterbrochenem Eifer«. Mit Mitschülern tauschte er Mahlzeiten gegen einige Bände Shakespeare. Die Shakespeare-Lektüre überwältigte ihn. Aber zwischen Goethes und Schillers früher Shakespeare-Begeisterung gibt es einen charakteristischen Unterschied. Schiller hat darüber später selbst Auskunft gegeben in dem Aufsatz »Über naive und sentimentalische Dichtung«. Der naive Autor – und dafür steht Goethe – kann sich ohne Beängstigung auf die Natur einlassen, er wird von ihr getragen und er drückt sie aus. Anders der sentimentalische Autor, für den er sich selbst hält – er reflektiert und legt sich die Dinge zurecht, ehe er sie an sich herankommen läßt. Der Wucht der unmittelbaren Natur will er sich nicht aussetzen. Shakespeare aber, schreibt Schiller, wirkte auf ihn damals als unmittelbare Natur. Er bewunderte ihn, hatte aber auch Angst vor ihm. Ich war noch nicht fähig, die Natur aus der ersten Hand zu verstehen,schreibt Schiller im späteren Rückblick auf seine erste Shakespeare-Eindrücke, nur ihr durch den Verstand reflektiertes und durch die Regel zurechtgelegtes Bild konnte ich ertragen. Shakespeare war also für den jungen Schiller noch zuviel reine Natur. Anders der junge Goethe, der von reiner Natur nicht genug haben kann und bei seiner ersten Bekanntschaft mit Shakespeare ausgerufen hatte: Natur! Natur! nichts so Natur als Schäkespears Menschen.
Was galt nun aber dem Sturm und Drang und denen, die in Goethe ihren Abgott sahen, als ›Natur‹ und als ›natürlich‹? Natur ist, was von innen her organisch wächst und sich entfaltet. Was von Natur aus geschieht, kann von außen gehemmt, abgedrängt, verstümmelt werden. Das bewirken künstliche Ordnungen, mechanische Denkweisen, Regeln, die nicht das Gedeihen begünstigen, sondern einschränken. Es war Rousseau, der dem Jahrhundert die entscheidenden Stichworte für das Unbehagen an der Kultur geliefert hatte. Ist der Mensch, so fragt man seit Rousseau, nicht eigentlich ein mitfühlendes Wesen, wird aber im gesellschaftlichen Mechanismus zum Egoismus gezwungen? Ist er nicht eigentlich schöpferisch und muß doch seine Kräfte in beschränkten und geisttötenden Aufgaben vergeuden? Wird ihm durch die herrschende Erziehung und Bildung nicht die ursprüngliche Einheit von Gefühl und Verstand zerstört? Verleitet ihn das Streben nach Eigentum und Besitz nicht dazu, herrschen zu wollen oder sich ängstlich abzugrenzen? Haben ihn die gesellschaftlichen Regeln nicht seiner natürlichen Rechte beraubt?
Diese Fragen kommen aus dem großen Verdacht gegen die herrschenden Verhältnisse. Doch man begnügt sich nicht mit abstrakten Forderungen, es gilt nicht nur das Sollen, sondern man fühlt sich im Bunde mit dem eigentlichen Sein, das auf den Namen ›Natur‹ getauft wird. Auf den Spuren Rousseaus sucht man in der Natur nach der verborgenen Wahrheit, die man den unwahren Verhältnissen selbstbewußt und trotzig entgegenschleudern kann. Drastisch hatte Lenz, der Freund des jungen Goethe, das Problem in seinem Stück »Hofmeister« dargestellt. Da kastriert sich ein Hauslehrer, um sein Fortkommen in einer adligen Familie zu befördern. Die Naturbehinderung am eigenen Leibe ist in letzter Konsequenz die Selbstverstümmelung und Selbstzerstörung. So grell haben es andere nicht dargestellt, aber gemeint war etwas ähnliches, wenn Goethe seinen »Werther« ausrufen läßt: Man kann zum Vorteile der Regeln viel sagen, ohngefähr was man zum Lobe der bürgerlichen Gesellschaft sagen kann ... dagegen wird aber auch alle Regel, man rede was man wolle, das wahre Gefühl von Natur und den wahren Ausdruck derselben zerstören ... O meine Freunde! warum der Strom des Genies so selten ausbricht, so selten in hohen Fluten hereinbraust, und eure staunenden Seelen erschüttert.
Die Natur ist stark, voller Energie, aber ist sie auch immer gut? In Augenblicken beseligten Naturempfindens mag es so scheinen. Wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten, all der Würmgen, den Mückgen, näher an meinem Herzen fühle ... dann, so Werther, ist ihm, als würde der Spiegel seiner Seele der Spiegel des unendlichen Gottes werden. Aber bei anderer Gelegenheit, es ist fast dieselbe Szenerie, verwandelt sich ihm der Schauplatz des unendlichen Lebens in den Abgrund des ewig offnen Grabs. Aus dem Stirb und Werde wird das Fressen und Gefressenwerden, die Natur ein ewig wiederkäuendes Ungeheur. Wenn die äußere Natur dieses zwiespältige Bild bietet, sollte dann die innere, die subjektive Natur sich nicht auch widersprüchlich, abgründig zeigen? Werther endet bekanntlich in der Selbstzerstörung, und es bleiben Zweifel, ob es nur die gesellschaftlichen Beschränkungen sind, die ihn zugrunde richten.
Es ist genau diese Ambivalenz des Goetheschen Naturbegriffs, von der sich der junge Schiller angezogen fühlt, und es ist interessant zu beobachten, was er daraus macht.
Nur wenige Wochen vor Goethes Besuch der Karlsschule war es geschehen, daß Schillers erste medizinische Dissertation über das Thema »Philosophie der Physiologie« abgelehnt worden war, und zwar vom Herzog selbst, der Schiller einst zum Medizinstudium gedrängt hatte, weil er Mediziner brauchte, jetzt aber seine Zöglinge nicht in Berufsstellen unterbringen konnte und deshalb, gestützt auf Gutachten der von ihm abhängigen Professoren, die Dissertation zurückwies: »Dahero glaube ich, wird es auch noch recht gut vor ihm sein, wenn er noch Ein Jahr in der Akademie bleibt, wo inmittelst sein Feuer noch ein wenig gedämpft werden kann ...« Schillers »Feuer« war die Leidenschaft, mit der er auf dem Felde der Physiologie jene Ambivalenz der »Natur« ergründen wollte, die er bei dem bewunderten Goethe gefunden hatte. Schiller will sich als durchdringender Geistererkenner bewähren, der es unternimmt, anders als Shakespeare oder Goethe, nämlich als philosophierender Mediziner, die Seele gleichsam bei ihren geheimsten Operationen zu ertappen, wie er 1781 in der Vorrede zur ersten Auflage der »Räuber« schreibt. Es könnte ja sein – und dieser Schluß drängt sich dem Mediziner auf –, daß die geheimsten Operationen tiefer hinunterreichen in das Schattenreich des Körpers, als es einer stolzen Seele lieb sein kann, die auf ihre Unabhängigkeit pocht und Natur nur als Naturgefühl, nicht aber am eigenen Leibe erleben will. Daß Natur alles ist und daß wir sie ausleben sollten und in ihr unsere Wahrheit finden würden, dieses Dogma des Sturm und Drang, so Schillers Überzeugung, muß sich erst noch bewähren in der konkreten Untersuchung des Zusammenhangs von Geist und Natur, Leib und Seele. Wieviel Freiheit läßt uns die eigene Natur, unser Leib, und wieviel Gestaltungskraft haben wir ihm gegenüber? Das ist eine Frage, die sich Goethe so nie gestellt hätte. Für Goethe war ›Natur‹ das Umhüllende, Tragende, Bewirkende schlechthin. Für Schiller aber war sie ein Widerpart, ein Gegenspieler der Freiheit. Ungefähr zur Zeit von Goethes Besuch hatte er das Protokoll einer Leichenöffnung abzufassen. Darin heißt es: Als man die Brust öffnete, floß eine große Menge gelblichten Blutwassers heraus ... Das Gekrös enthielt eine gelblichte Zähigkeit ... An der obern Hälfte der linken Lunge war etwas Eiterartiges. Das Protokoll endet mit dem Satz: Das Haupt ist nicht geöffnet worden. In seinen Dissertationen – er mußte bis zur endlichen Anerkennung drei verfassen, die alle das Leib-Seele-Problem erörtern – versucht Schiller, mit analytischem Besteck das Haupt zu öffnen, um zu erkunden, ob dort tatsächlich der Sitz der Souveränität auszumachen ist. Dabei spürt man in seinen subtilen Begriffskonstruktionen die hintergründige Wirksamkeit des Goetheschen ambivalenten Naturbildes – liebevoll-lebendiges Gewimmel und sinnverschlingender Abgrund.
Das einzig erhaltene erste Kapitel der ersten Dissertation beschäftigt sich mit der Frage: wie entstehen aus körperlichen Reizen, also aus ›Natur‹, die Phänomene der Bewußtseinswirklichkeit? Angestrebt wird eine in der dritten Dissertation dann vertiefte Analyse der Vorgänge bei der Umwandlung des Physiologischen ins Psychische. Doch die spezielle Untersuchung, die an die zeitgenössische Neurophysiologie anknüpft, wird vorbereitet durch eine große Theorie-Inszenierung. Schiller entwickelt in kühnen Strichen und mit enthusiastischem Schwung eine ganze Philosophie der Liebe als natürliches, kosmisches Prinzip, das den allseitigen Zusammenhang des Lebens bildet, die große Kette der Wesen – dieser Gedanke entspricht Goethes Wehen des Alliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält. Bei Schiller gleicht diese Beschwörung der Liebesphilosophie zu Beginn der physiologischen Untersuchungen der Anrufung einer Muse, die ihn leiten soll, auf daß er nicht, von allen guten Geistern verlassen, in materialistische Anfechtung gerate: Ein kühner Angriff des Materialismus stürzt meine Schöpfung ein. Wenn der Materialismus siegt, dann kann man mit Franz Moor über den Menschen nur noch sagen: der Mensch entstehet aus Morast, und watet eine Weile im Morast, und macht Morast, und gärt wieder zusammen in Morast, bis er zuletzt an den Schuhsohlen seines Urenkels unflätig anklebt. Diese Sichtweise entspricht Goethes Entsetzen vor einer Natur als Abgrund des ewig offenen Grabs.
Das Prinzip der Liebe, das er in die Natur eingeführt sehen möchte, ist für Schiller eine Art Abwehrzauber gegen die Versuchung, die Natur als Abgrund oder als Morast ansehen zu müssen. Solche Liebe ist zunächst wirklich nur ein Prinzip, eine spekulative Größe. Goethes Wehen des Alliebenden ist empfunden, Schillers Liebe ist grandios gedacht, aber eben nur ausgedacht. Sie soll in die Maschine der Körperwelt ein beseelendes Prinzip einführen, sie überbrückt den Riß zwischen Seele und Körper, Geist und Natur und überwindet den Dualismus zwischen Erkenntnis und Wirklichkeit. Es muß Geist in der Natur sein, sonst könnten wir sie gar nicht erkennen: Gleiches nur erkennt Gleiches. Mehrfach und leitmotivisch verwendet Schiller in seiner Liebesphilosophie das Bild von der großen Kette von Kräften, eine Metapher, die ihm eine ehrwürdige Tradition in die Hände spielt und die auch Goethe gerne benutzt. Sie hat seit Platon das abendländische Denken beherrscht. Die große Kette gleitet von oben nach unten herab, als göttliche Emanation, und steigt von unten nach oben auf – gegen den Geist immerwärts fort. Vor allem aber sind die Glieder der Kette nicht einsinnig verbunden wie Ursache und Wirkung. Daraus zieht Schiller den außerordentlich kühnen Schluß: Also kann es nicht sein, daß das Physiologische, zum Beispiel das Nervengeflecht im Gehirn, nur einseitig auf die Geistestätigkeit wirkt, es muß auch eine umgekehrte Kausalität geben, vom Geist auf die Physis. Jedes Glied der großen Kette müßte zugleich Ursache und Wirkung sein. Auf das Nervensystem angewandt, bedeutet das: Es gibt physiologische Vorgänge, die ohne oder gar gegen unseren Willen ablaufen, und solche, die vom Willen veranlaßt werden, die also nichts anderes sind als eine Ursache aus Freiheit. Die Seele hat einen tätigen Einfluß auf das Denkorgan, schreibt Schiller. Wie aber kann Psychisches sich in Physisches umsetzen? Das kann Schiller nicht erklären, er spekuliert über eine sogenannte Mittelkraft. Weiter kommt er damit auch nicht, denn erstens kann er sie nicht nachweisen und zweitens weiß er auch gar nicht genau, wonach er suchen soll – nach etwas Materiellem oder nach etwas Geistigem? Die ominöse Mittelkraft ist wirklich nur eine Idee.
Da sind die Naturforschungen, die Goethe ungefähr zur selben Zeit unternimmt, um einiges handfester, und doch kontemplativer, beseelt vom Schauen, Beobachten und Entdecken; ganz anders als Schiller, der vom Ehrgeiz angetrieben wird, die Natur bei ihren geheimsten Operationen zu ertappen. Auch für Goethe ist, wie für Schiller, die Idee von der großen Kette maßgeblich, näher hin beschäftigt ihn die Frage: wie hat sich der Mensch aus dem Tierreich entwickelt? Um die Kette zu schließen, fehlt ihm noch das »os intermaxillare«, der Zwischenkieferknochen, der sich beim Affen zeigt, aber offenbar nicht beim Menschen. Goethe ahnt: vielleicht bildet er sich beim Menschen im vorgeburtlichen Stadium zurück. Dann bekommt er eines Tages den Schädel eines Embryos in die Hand. An ihm entdeckt er die feine Nahtstelle, die kaum sichtbaren Spuren des Zwischenkieferknochens waren gefunden. Ich habe eine solche Freude, daß sich mir alle Eingeweide bewegen, schreibt er an Frau von Stein, und an Herder am gleichen Tag, am 27. März 1784: Ich habe gefunden – weder Gold noch Silber, aber was mir eine unsägliche Freude macht – das os intermaxillare ... Es soll dich auch recht herzlich freuen, denn es ist wie ein Schlußstein zum Menschen. Das Echo der Fachwelt fiel eher bescheiden aus, worüber sich Goethe selbstverständlich ärgerte: Einem Gelehrten von Profession traue ich zu daß er seine fünf Sinne ableugnet. Es ist ihnen selten um den lebendigen Begriff der Sache zu tun, sondern um das was man davon gesagt hat. Immerhin nahm Professor Justus Christian Loder von der Universität Jena die Entdeckung in sein »Handbuch der Anatomie« auf. Goethe ließ sich nicht beirren, die Knochenlehre hatte es ihm angetan. Er beschäftigte sich anschließend mit dem Horn des Rhinozeros und ließ sich sogar einen Elefantenschädel schicken, den er in seinem Zimmer versteckte, damit man ihn nicht für toll hielt. Schiller spekulierte über eine ominöse Mittelkraft, Goethe aber hatte sein »os intermaxillare«, Mittelglied in der Gestaltenreihe des Lebens.
Zwischenkieferknochen, Rhinozeroshörner und Elefantenschädel lassen sich irgendwie auftreiben, wie aber soll man Freiheit im Gehirn finden, womit sich Schiller abplagt? Er versucht es mit einer Theorie der Aufmerksamkeit. Ist es nicht erstaunlich, daß wir sie nach freier Willkür lenken können, wie einen Lichtstrahl? Ist damit nicht bewiesen, daß wir nicht nur von Reizen abhängen, sondern uns selbst aussuchen können, worauf wir reagieren wollen? Gewährt die vom Willen gelenkte Aufmerksamkeit nicht Einblick in das Wesen der Entscheidungsfreiheit? Beschwingt von einer Entdeckerfreude, die allerdings nichts Knochenhartes in die Hand bekommt – Schiller wird später Goethe zum Vorwurf machen, er betaste ihm zuviel – beschwingt also und stolz präsentiert Schiller sein Fundstück, die Freiheit betreffend: Die Aufmerksamkeit also ist es, durch die wir phantasieren, durch die wir uns besinnen, durch die wir sondern und dichten, durch die wir wollen. Es ist der tätige Einfluß der Seele auf das Denkorgan, der dies alles vollbringt.
Freiheit ist von nun an Schillers großes Thema. Er hat ihr einen Platz zu schaffen gesucht im Physiologischen. Man spürt sie in der intentionalen Bewegung der Aufmerksamkeit, also muß es sie geben oder wie er in der Dissertation schreibt: Die Erfahrung beweist sie. Wie kann die Theorie sie verwerfen. Schiller hatte wie der Sturm und Drang und wie der junge Goethe mit der Heiligsprechung der Natur begonnen, aber er geht nun andere Weg, mit der Freiheit reißt er sich los, überfliegt die Natur, setzt sich ihr sogar entgegen. Das ist nicht ganz ungefährlich. Die Freiheit, sagt Karl Moor, brütet Kolosse und Extremitäten aus.
Zum Zeitpunkt von Goethes Besuch in Stuttgart hat Schiller nicht nur seine erste Dissertation abgeschlossen, sondern er ist auch fast fertig mit den »Räubern«, jenem Stück, das ihn über Nacht berühmt machen wird, womit er einen Erfolg wiederholt, den Goethe zehn Jahre zuvor mit seinem »Götz« erzielt hatte. Es geht um zwei verfeindete Brüder, zwei Extremisten der Freiheit.
Karl ist extremer Idealist, insofern er mit dem Enthusiasmus seines Herzens an eine gute, väterliche Weltordnung glaubt, an eine natürliche Ordnung der Dinge, doch es genügt ein Mißverständnis, eine Schwäche des Vaters und eine Bosheit des Bruders, um Karl unter die Räuber zu treiben, mit denen er dann, als edler Wilder, sich der Raserei einer Rache an der zerrütteten Weltordnung hingibt.
Franz ist extremer Materialist, die Natur hat ihn schlecht behandelt: er ist als zweiter aus dem Mutterleib gekrochen, ein Schicksal, das ihn vom Erbe ausschließt. Die Natur hat ihm eine Bürde von Häßlichkeit aufgeladen: Warum gerade mir die Lappländernase? Gerade mir dieses Mohrenmaul? Diese Hottentottenaugen? Die Natur ist grausam, sie ist nicht gerecht, warum sollte er es sein. Er ist von ihr geschlagen, also schlägt er zurück.
Das ist wieder das Bild der ambivalenten Natur: die Alliebende und der Abgrund.
Für Karl ist sie die Alliebende, die schöne und gute Ordnung; für Franz ist sie der Abgrund. Beide handeln entsprechend der Art, wie sie Natur erleben und deuten. Der eine, indem er als Rächer der zeitweilig zerrütteten Weltordnung auftritt, der andere, indem er den räsonierenden Bösewicht gibt. Ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, daß ich nicht Herr bin. Beide, und das ist für Schiller entscheidend, handeln frei, doch in Reaktion auf ihr Naturerleben. Der Mensch, das soll das Stück zeigen, ist nicht nur, was die Natur, sondern was seine Freiheit aus ihm macht. Franz nimmt sich die Freiheit, böse zu sein und begeht dann Selbstmord. Karl, bereit für seine Taten zu büßen, überantwortet sich dem Gericht.
In einer Selbstrezension von 1782, verfaßt kurz nach der Uraufführung, kritisiert Schiller die mangelnde Wirklichkeitsnähe seiner Figuren. Sie seien nicht nach der Natur gebildet, der Verfasser habe, schreibt Schiller, die Menschen überhüpft. Das empfand man auch im fernen Weimar so, jedenfalls verständigten sich Goethe und Wieland darauf. Der junge Mann aus Schwaben habe nun wirklich übertrieben mit seinen Kopfgeburten.
Tatsächlich, die Menschen wie sie üblicherweise und im Durchschnitt sind, werden überhüpft, einem Experiment mit Extremen zuliebe. Das Stück ist eine solche Experimentalanordnung für extreme Charaktere, die monströs aber folgerichtig das Prinzip ihrer Existenz – die Freiheit - zur Entfaltung bringen bis hin zur Katastrophe.Schiller wird beim Thema Freiheit bleiben, aber er weiß, daß er mehr nach der Natur arbeiten muß. Als Mediziner hat er für mehr Freiheit in der Natur plädiert, als Dichter aber wird er noch lernen müssen, mehr Natur bei der Freiheit gelten zu lassen.
Einerseits widerstrebt ihm das, denn Schiller ist vom Bewußtsein des Machens und nicht des Geschehenlassens erfüllt. Er empfindet die Natur nicht als etwas, das ihn gnädig trägt und gedeihen läßt. Andererseits wird er von der Idee der Selbstvervollkommnung angetrieben, und die macht ihn lernbegierig. Nun will er auch noch das Natürliche lernen. Deshalb seine Selbstrezensionen. Auch bei späteren Werken, insbesondere beim »Don Karlos«, wird Schiller auf das Mittel der öffentlichen Selbstbeurteilung zurückgreifen. Dabei scheut er sich nicht, eigene Fehler deutlicher zu benennen, als es die Rezensenten tun. Er will seine Entwicklung als Autor vor den Augen des Publikums absolvieren. Das fällt ihm nicht schwer, weil für ihn die poetische Arbeit weniger ein intimer, expressiver Vorgang ist, der am besten im Dunkeln bleibt, sondern ein bewußtes Machen und Experimentieren. Der öffentliche Raum, die Wirkungsstätte seiner Werke, ist bei Schiller immer im Blick. Das war bereits in den früheren Jahren so. Die Mitschüler berichten, daß Schiller gerne die eigenen Gedichte vortrug und Kritik nicht scheute. Auffällig ist auch sein rhetorischer Stil. Die Wirkungsabsichten sind immer dominant. Schon der kleine ›Fritz‹ predigte seinen Spielgefährten in der schwarzen Küchenschürze vom Stuhl herab. Berühmt ist auch jene Szene in einem Wald bei Stuttgart, wo Schiller auf einer verborgenen Lichtung seinen Freunden mit Pathos und Empörergeste einiges aus den entstehenden »Räubern« zum besten gibt. Scharffenstein gegenüber soll er geäußert haben: »Wir wollen ein Buch machen, das aber durch den Schinder absolut verbrannt werden muß«, ein Satz, der dann fast gleichlautend einem Räuber in den Mund gelegt wird. Schiller wollte das tintenklecksende Säkulum provozieren, und er stellte sich genüßlich vor, wie seine räuberischen Kraftgenies in die hausväterliche Welt der grassierenden Rührstücke einbrechen würden. Zunächst hat er nicht zu hoffen gewagt, daß solches geschehen könnte, aber als es dann geschah, war es wie die Erfüllung eines Traumes.
Zwei Jahre nach den »Räubern« spricht Schiller im Anschluß an eine Aufführung des »Fiesko« zum ersten Mal über jenen Willen zur Macht, der ihn antreibt und den nur ein Theaterautor kennt, der sein Publikum in der Gewalt hat. Heilig und feierlich war immer der stille, der große Augenblick in dem Schauspielhaus, wo die Herzen so vieler Hunderte, wie auf den allmächtigen Schlag einer magischen Rute, nach der Phantasie eines Dichters beben ... wo ich des Zuschauers Seele am Zügel führe und nach meinem Gefallen einem Ball gleich dem Himmel oder der Hölle zuwerfen kann – und es ist Hochverrat an dem Genius – Hochverrat an der Menschheit, diesen glücklichen Augenblick zu versäumen, wo so vieles für das Herz kann verloren oder gewonnen werden.
Schiller gehört zur neuen Generation, die anders über literarische Wirksamkeit denkt als noch Goethe, der seine Werke schuf, als ob er sich nur an Liebhaber wendete; er übergab sie der Öffentlichkeit und wartete gelassen ab, was daraus wird. Auch nachdem er mit seinen ersten beiden großen Werken, dem »Götz« und dem »Werther«, eine solche gewaltige Wirkung beim Publikum erzielt hatte, schrieb Goethe immer noch im Kammerton des überschaubaren Freundeskreises. Er verstand sich durchaus nicht als Berufsschriftsteller. Obwohl er später, zusammen mit Schiller, eine harsche Kritik am Dilettantismus formulieren wird, fährt er damit fort, sein Schreiben als eine Liebhaberei im höheren Sinn anzusehen. Er stellte sich so, als sei er von seinen Wirkungen geradezu überrascht. Anders Schiller. Nach der Flucht aus Stuttgart mußte er sich als Berufsschriftsteller verstehen. Das entsprach auch seinem Wirkungswillen. Er operierte stets an der Front der möglichen Wirkungen. Von dorther, vom Effekt, war seine Arbeit am Werk bestimmt. Schiller war kein Autor, der nur von innen kommt, Intimität war nicht seine Sache. Das Drama ist für Schiller eine streng kalkulierte Affekterregungskunst, eine Maschine zur Herstellung großer Gefühle.
Goethe bevorzugt, seitdem er in Weimar ist, das Gedämpfte, Zurückgenommene. Ein Beispiel dafür ist die erste Fassung der »Iphigenie« von 1779, die für die Liebhaber-Bühne in Weimar gedacht war. Sie wurde gut aufgenommen, vor allem der schönen Kostüme wegen, auch Goethe selbst, der den Orest spielte, machte eine gute Figur, aber eine Affekterregungskunst war das nicht. Sollte es auch nicht sein, die Herzogin hatte sich noch zu erholen von einer schwierigen Geburt. Moderates war gefragt. Dazu paßt Iphigenie, sie ist eine reine Seele, freilich auch nichts anderes. Keine lauten Töne, keine Kontraste, alle sind edel, auch die Nebenfiguren, sogar der Barbarenkönig verzeiht, und im heiligen Hain weht laue Luft. Goethe an Frau von Stein am 23. Mai 1779: Es ist wie mit der Liebe die ist auch monoton. Als Schiller später, aus Freundschaft, das Stück für die Bühne bearbeiten wollte, hatte er seine liebe Not damit. Für ihn war es ein Organismus, der sein reiches Leben nicht nach außen dringen läßt, eine verschlossene Auster.
Goethe selbst, wenn er spielte oder vorlas, gab sich zurückhaltend, mied das große Pathos, den groben Effekt, die schrillen Töne. Seine Stimme war sonor, modulationsreich, sein Mienenspiel sparsam. Ganz anders der junge Schiller. Seine Wirkungsbesessenheit kannte noch kein Maß.
Es war wenige Wochen nach Goethes Besuch in Stuttgart, daß der Geburtstag des Herzogs feierlich begangen wurde. Die Studenten durften ein Schauspiel aufführen und Schiller wurde mit der Auswahl und Einstudierung beauftragt. Er wählte Goethes »Clavigo« und für sich selbst die Hauptrolle. Es muß eine denkwürdige Aufführung gewesen sein. Ein Augenzeuge berichtet: »Wie spielte er? Ohne alle Übertreibung darf man sagen – abscheulich. Was rührend und feierlich sein sollte, war kreischend, strotzend und pochend; Innigkeit und Leidenschaft drückte er durch Brüllen, Schnauben und Stampfen aus, kurz sein ganzes Spiel war die vollkommenste Ungebärdigkeit, bald zurückstoßend, bald lachenerregend.« An einer Stelle, wo es in der Regieanweisung heißt, Clavigo bewegt sich mit höchster Verwirrung auf seinem Sessel, »fuhr Schiller in so wilden Zuckungen auf dem Stuhle herum, daß die Zuschauer lachend erwarteten, er falle herunter«.
Dieser Mißerfolg war ihm zunächst noch keine Lehre gewesen. Unverdrossen fuhr er fort, sich für einen guten Schauspieler zu halten. In Mannheim, nach der Flucht aus Stuttgart, liest er den Schauspielern seinen »Fiesko« vor. Wieder ein Fiasko. Die Schauspieler suchen das Weite. Nach der verheerenden Lesung kam Schiller keinen Augenblick auf die Idee, daß die üble Wirkung etwas mit seinem Vortragsstil zu tun haben könnte. Im Gegenteil. Er beklagte sich über den Unverstand der Schauspieler und sprach die Drohung aus, er werde, sollte ihm das Dichten für das Theater keinen Erfolg bringen, als Schauspieler auftreten, da eigentlich doch niemand so deklamieren könne wie er.
Auch in dieser Hinsicht wird der Wirkungsbesessene noch lernen, seinen Furor in Grenzen zu halten.
Anmerkungen zu diesem Kapitel
Zweites Kapitel
Zweimal Flucht und Verwandlung. Schiller flieht vor dem Herzog und kommt auf Umwegen endlich nach Weimar. Goethes Flucht nach Italien. Schiller in Weimar unter den Göttern und Götzendienern. Der abwesende Goethe. Alles wartet auf ihn, auch Schiller.
Goethe zur Zeit seines Besuches in Stuttgart ist ein Mann mit Doppelleben. Einerseits der förmliche, ein wenig steife hohe Regierungsbeamte und hinter dieser Schutzwehr der Poet und Künstler, wobei die Sicherungssysteme immer weiter ausgebaut werden. Sonst war meine Seele, schreibt er an Charlotte von Stein am 17. Mai 1778, wie eine Stadt mit geringen Mauern, die hinter sich eine Zitadelle auf dem Berge hat. Das Schloß bewacht ich, und die Stadt ließ ich in Frieden und Krieg wehrlos, nun fang ich auch an die zu befestigen.
In seine Zitadelle eingeschlossen, fern und unnahbar, so mochte Goethe auf Schiller gewirkt haben damals bei der Preisverleihung an der Hohen Karlsschule. Tatsächlich wird bei Goethe ein Ausbruch nötig sein, die Flucht nach Italien, um zu verhindern, daß die Selbsteinmauerung in Amt und Würden nicht den schöpferischen Impuls abtötet. Auch Schiller muß aus dem Lebenskreis, in den ihn sein Herzog festhält, ausbrechen; auch er muß fliehen, um sich wieder in den Besitz seiner selbst zu bringen. Zweimal also Flucht und Verwandlung.
Zuerst Schiller. Seine Flucht hängt mit dem Erfolg seines ersten Stückes zusammen. 1781 hat er »Die Räuber« abgeschlossen. Er sucht einen Verlag und eine Bühne, rechnet mit einem ordentlichen Honorar. Sein Gehalt als Regimentsmedicus beträgt nur 18 Gulden im Monat, Goethe verdient das Zehnfache. Noch sieht Schiller sich nicht als Berufsschriftsteller. Eigentlich müßte er bei einer Veröffentlichung oder einer Aufführung den Herzog um Erlaubnis fragen, ein gefährliches Unterfangen bei einem Text, in dem es von Tiraden gegen die Tyrannei wimmelt. Warum sind Despoten da? Warum sollen sich tausende, und wieder tausende unter die Laune Eines Magens krümmen, und von seinen Blähungen abhängen? Schiller versucht, das Stück am Herzog vorbei zu lancieren.
Die Suche nach einem Verleger bleibt aber erfolglos und deshalb entschließt er sich, es auf eigene Kosten für hundertvierzig Gulden, das sind zwei Drittel seines Jahreseinkommens, drucken zu lassen. Er leiht sich Geld, die Schulden werden ihn bis in seine Weimarer Zeit verfolgen. Das Stück macht bei Erscheinen im Sommer 1781 großes Aufsehen. Man liest es auch in Weimar. Die »Erfurtische Gelehrte Zeitung« urteilt: »Haben wir je einen teutschen Shakespeare zu erwarten, so ist es dieser«. Die Mannheimer Bühne bekundet Interesse. Man wünscht aber, um mißliebige politische Anspielungen zu vermeiden, eine Verlegung der Handlung ins sechzehnte Jahrhundert, in die Zeit des »Götz von Berlichingen«, der immer noch in Mode ist. Dagegen verwahrt sich Schiller: Alle Charaktere sind zu aufgeklärt zu modern angelegt, daß das ganze Stück untergehen würde, wenn die Zeit, worin es geführt wird, verändert würde. Schiller hat noch nicht die Prominenz, um mit seinen Einwänden durchzudringen.
Am 13. Januar 1782 findet in Mannheim die legendäre Uraufführung statt, bei der das Theater, wie ein Augenzeuge schreibt, einem »Irrenhause« glich und sich fremde Menschen »schluchzend in die Arme« fielen. Das ist der Durchbruch. Schiller schreibt an den Intendanten: ich glaube, wenn Deutschland einst einen dramatischen Dichter in mir findet, so muß ich die Epoche von der vorigen Woche zählen. Aber noch wagt er es nicht, sein Leben ausschließlich dem Theater und dem Schreiben zu widmen.
Zweimal reist Schiller heimlich ins benachbarte Mannheim zur Aufführung seines Stückes. Er hätte den Herzog um Erlaubnis bitten müssen. Er wird verwarnt und bestraft. Der Konflikt mit dem Herzog spitzt sich im August 1782 zu: den Herzog erreicht eine Beschwerde, von der er ärgerliche Verwicklungen mit der Schweiz befürchtet. In den »Räubern« , heißt es, würde Graubünden verleumdet. Gemeint war ein Ausspruch des Räubers Spiegelberg, zu einem Spitzbuben wills Grütz – auch gehört dazu ein eigenes Nationalgenie, ein gewisses, daß ich so sage, S p i t z b u b e n k l i m a, und da rat ich dir, reis du ins Graubünder Land, das ist das Athen der heutigen Gauner. Der Herzog verbietet seinem Regimentsmedicus bei Strafe der Kassation oder der Festungshaft jede weitere nicht-medizinische Schriftstellerei. Damit ist für Schiller ein Bleiben in Stuttgart unmöglich geworden. Er entscheidet sich für die Flucht.
Er hatte lange gezögert, weil er dem Vater, der vom Herzog abhängig war, nicht schaden wollte. Und als er sich dann doch für die Flucht entschied, weihte er ihn nicht ein, um ihm die Möglichkeit zu geben, später reinen Gewissens erklären zu können, daß er nichts gewußt habe von den Plänen des Sohnes. Die Entscheidung zur Flucht beschwingt Schiller. Tag und Nacht arbeitet er an seinem nächsten Stück, dem »Fiesko«. Den Fluchttag setzt er auf den 22. September 1782. Es ist der Tag des Festes, das der Herzog für eine zu Besuch in Stuttgart weilende russische Großfürstin gibt. Am Abend dieses Tages würden alle Gäste und halb Stuttgart auf den Beinen sein, um das grandiose Schauspiel einer Festbeleuchtung auf der Solitude und eines krönenden Feuerwerkes zu sehen. Das würde, so rechnet Schiller, ein günstiger Augenblick sein, um unbemerkt zu entkommen. Die Flucht gelang.
Von der Straße nach Mannheim aus sieht Schiller am nächtlichen Himmel den roten Schein des großen Feuerwerks. Unter dieser Illumination beginnt er sein neues Leben für die Kunst. Aber es gibt Augenblicke, da bekommt Schiller Angst vor der eigenen Courage. Soll er wieder in den Machtbereich des Herzogs zurückkehren, wenn auch nur dem Vater zuliebe? Doch Schiller wußte, daß er inzwischen eine öffentliche Person war, er hatte einen Ruf zu verlieren. Die Nachricht von seiner Flucht hatte sich wie ein Lauffeuer in Stuttgart und darüber hinaus verbreitet. Es dauerte nicht lange, dann wußte das ganze literarische Deutschland davon. Schiller fühlte sich von der Figur, zu der er im öffentlichen Leben geworden war, in die Pflicht genommen. Die Flucht war ein Befreiungsschlag, aber jetzt war er nicht mehr frei gegenüber diesem Akt der Freiheit. Eine Handlung ist mehr als eine Idee, diese läßt sich zurücknehmen, jene nicht; man kann sie nur verraten. Das aber wollte Schiller nicht. Er kehrt nicht zurück, auch wenn er in Mannheim Verhältnisse vorfindet, die ihn demütigen: ein Theaterautor gilt auch nicht viel mehr als ein Dienstbote. Wenn ihn das Elend in Mannheim allzu sehr niederzudrücken droht, richtet er sich an dem Gedanken auf, daß er nicht darum dem Herzog widerstanden hat, um jetzt von einer anderen Misere überwältigt zu werden. Er erinnert sich des Satzes von Karl Moor: Die Qual erlahme an meinem Stolz! Er muß sich seinen Stolz bewahren, denn die Flucht ist noch nicht zu ende. Es geht das Gerücht, der Herzog werde die Auslieferung beantragen. Also noch einmal fliehen. Schiller bringt sich Ende 1782 im thüringischen Bauerbach in Sicherheit, in einem Gutshaus der Henriette von Wolzogen, der Mutter eines Schulfreundes und seines späteren Schwagers.
Am 7. Dezember 1782 kommt er im verschneiten Bauerbach an. Es ist ein winziges, einsam gelegenes Dorf. Schiller fühlt sich wie ein Schiffbrüchiger, der sich mühsam aus den Wellen gekämpft hat. Doch es ist gut für ihn gesorgt. Das Haus ist geputzt, im Kamin brennt ein Feuer, Bettwäsche liegt bereit, die Speisekammer ist gefüllt. Bald genießt er die Ruhe. Dem Freund Andreas Streicher schreibt er: keine Bedürfnisse ängstigen mich mehr, kein Querstrich von außen soll meine dichterischen Träume, meine idealischen Täuschungen stören. Er beginnt mit der Arbeit am »Don Karlos«. Am 14. April 1783 schreibt er an den späteren Schwager Wilhelm Friedrich Hermann Reinwald über seine Hauptfigur, den Prinzen: Ich muß ihnen gestehen, daß ich ihn gewissermaßenstatt meines Mädchens habe.
Nach einem Jahr wagt Schiller es, wieder nach Mannheim zurückzukehren, bleibt dort noch einmal zwei Jahre in subalterner Stellung beim Theater. Eine heikle Liebesgeschichte mit Charlotte von Kalb sorgt für Verwirrung. Charlotte, eine wunderliche Frau, melancholisch und exzentrisch. Sie war einem Herrn von Kalb in die Ehe gegeben worden, dem jüngeren Bruder von Goethes Vorgänger in der Weimarer Finanzkommission. Goethe stand im Briefwechsel mit dieser Frau, die schwärmerisch in ihre Träume und Phantasien versunken war. Sie ist begeistert von Goethe und nun auch von Schiller, dem sie in Aussicht stellt, ihn bei Gelegenheit mit dem großen Goethe bekannt zu machen. Das ist zwar verlockend, aber Schiller wehrt doch ab. Er fühlt sich als jemand geliebt, der er noch nicht ist. Wenn er dann der sein wird, schreibt er ihr einmal, werde ich nie vergessen, wieviel ich davon jenem schönen und reinen Verhältnisse schuldig bin