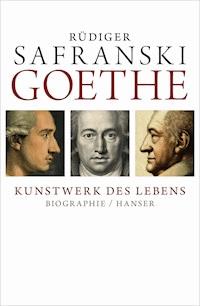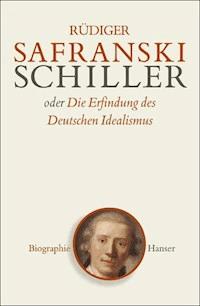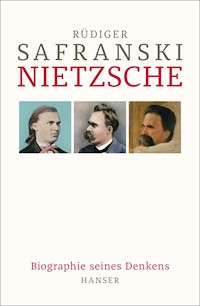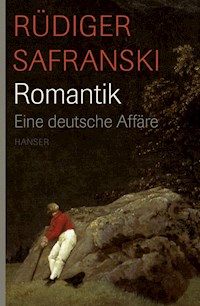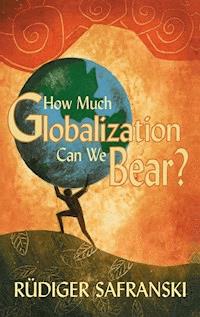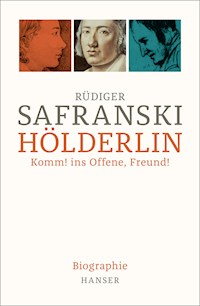
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zum 250. Geburtstag Friedrich Hölderlins: Rüdiger Safranskis Biographie über den großen unbekannten Dichter Dies ist die Geschichte eines Einzelgängers, der keinen Halt im Leben fand, obwohl er hingebungsvoll liebte und geliebt wurde: Friedrich Hölderlin. Als Dichter, Übersetzer, Philosoph, Hauslehrer und Revolutionär lebte er in zerreißenden Spannungen, unter denen er schließlich zusammenbrach. Erst das 20. Jahrhundert entdeckte seine tatsächliche Bedeutung, manche verklärten ihn sogar zu einem Mythos. Doch immer noch ist Friedrich Hölderlin der große Unbekannte unter den Klassikern der deutschen Literatur. Der 250. Geburtstag im März 2020 ist eine gute Gelegenheit, sich ihm und seinem Geheimnis zu nähern. Rüdiger Safranskis Biografie gelingt das auf bewundernswerte Weise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dies ist die Geschichte des Dichters Friedrich Hölderlin, die Geschichte eines Einzelgängers, der keinen Halt im Leben fand, obwohl er hingebungsvoll liebte und geliebt wurde. Als Dichter, Übersetzer, Philosoph, Hauslehrer und Revolutionär lebte er in zerreißenden Spannungen, unter denen er schließlich zusammenbrach. Seelisch tief verwundet, verbrachte er die zweite Hälfte seines Lebens im Tübinger Turm. Erst das 20. Jahrhundert entdeckte seine tatsächliche Bedeutung, manche verklärten ihn sogar zu einem Mythos. Und so folgt Rüdiger Safranski auch den Spuren, die Hölderlin in der Nachwelt hinterlassen hat.
Rüdiger Safranski
HÖLDERLIN
Komm! ins Offene, Freund!
Biographie
Carl Hanser Verlag
INHALT
Vorwort
Erstes Kapitel
Herkommen. Ehrbarkeit. Hölderlin hält auf sich. Die Väter sterben, die Mutter bleibt. Götter der Kindheit. Mutterbeziehung. Köstlin. Wunderkind Schelling.
Zweites Kapitel
Denkendorf. Klösterliches. Brief an Köstlin. Pietistische Seelenprüfung. Selbstbehauptung einer Seele gegen das »Weltliche«. Angst vor Selbstverlust. Das liberale Maulbronn. Erste Liebesgeschichte. Pindars Flug und Klopstocks Größe. Als Dichter zur Welt kommen.
Drittes Kapitel
Tübinger Stift. Lust zu lernen. Hölderlin studiert Kant und Spinoza. Die Vernunft und die Gründe des Herzens. Religion der Liebe. Der Freundesbund und das »Reich Gottes«. Hegel. Schelling. Revolutionärer Enthusiasmus im Stift. Der »Genius der Kühnheit«.
Viertes Kapitel
Philosophische Thronerhebung der schöpferischen Einbildungskraft. Selbstermächtigung. Der Dichterbund. Magenau. Neuffer. Stäudlin. Frühe Hymnen, allzu erhaben. Literatur und Leben. Hölderlin kein Romantiker. Die Gräkomanie, Schillers »Die Götter Griechenlands« und Hölderlins Antike. Wiederkehr der Götter? »Hyperions« Beginn.
Fünftes Kapitel
Die Zeit im Stift geht zu Ende. Politische Unruhen. Renz. Besser ein Hofmeister als ein Prediger. Charlotte von Kalb. Hölderlin bei Schiller in Ludwigsburg. Elise Lebret. Abschied und Aufbruch nach Waltershausen.
Sechstes Kapitel
Waltershausen. Aus der Ferne die Freundschaften erneuern. Liebesgeschichten ohne Belang. Marianne Kirms. »Hyperion«. Das erste Fragment. Griechenland hat Konjunktur und die Romanform. Hölderlin sucht den Erfolg beim Publikum. Vorrede zu »Hyperion«. Exzentrizität und Sündenfall. Suche nach dem erfüllten Sein. Ekstatische Augenblicke, doch nicht von Dauer.
Siebtes Kapitel
Schiller veröffentlicht das »Hyperion«-Fragment. Schwierigkeiten mit dem Zögling. Das Onanie-Problem. Trennung vom Hause Kalb. Jena. Schillers »liebster Schwabe«. Misslungene Begegnung mit Goethe. Fichtes »Ich« und Hölderlins Suche nach dem Sein. »Urtheil und Seyn«. Umarbeitungen des »Hyperion« unter philosophischem Einfluss.
Achtes Kapitel
Plötzliche Abreise aus Jena. Schillers Nähe gesucht und geflohen. In die Philosophie verstrickt. Quälende Widersprüche. Philosophie der Freiheit und der junge Schelling. Philosophie oder Poesie. »Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus«. Die Stiftung einer neuen Mythologie und die Schönheit.
Neuntes Kapitel
»An die Natur« – von Schiller abgelehnt. Die Liebesgeschichte mit Susette beginnt. Idylle von Bad Driburg. Der Erotiker Wilhelm Heinse als Aufsichtsperson. »Ardinghello und die glückseligen Inseln«. Französischer Vormarsch. Politische Enttäuschung und Hoffnung auf die deutsche Kulturnation. Selbstbehauptungsträume. »Die Eichbäume« – von Schiller angenommen.
Zehntes Kapitel
»Hyperion« – die endgültige Fassung. Was dazugekommen ist. Der politische Kampf, die Enttäuschung. Alabanda und Sinclair. Diotima und Susette. Neues Selbstbewusstsein. Die Schimpfrede gegen die Deutschen. Das Göttliche. Hölderlins Verzückungsspitzen. »Hyperion« als Roman über die Geburt eines Dichters. Goethe und Schiller beraten sich über Hölderlin. Krise im Hause Gontard. Hölderlins Abgang.
Elftes Kapitel
Mit Sinclair nach Rastatt. Neue Freunde. Revolutionäre Erwartungen. »Empedokles«. Alles auf eine Karte setzen, politisch und persönlich. Vereinigungsmystik und Politik. Die dramatische Form geht verloren, der politische Anlass auch. Das Eigene im »Empedokles«. Zeitschriftenprojekt – gescheitert. Der heimliche Briefwechsel mit Susette. Aussichtslosigkeit.
Zwölftes Kapitel
Hölderlin bleibt im Verborgenen. Sein Dichten aber öffnet sich gewaltig. Der begnadete Sommer 1800 in Stuttgart bei Landauer. Komm! ins Offene, Freund! Die großen Hymnen und Elegien. »Der Gang aufs Land«. »Menons Klagen um Diotima«. »Der Archipelagus«. »Brod und Wein«.
Dreizehntes Kapitel
Die Wonnen der Gewöhnlichkeit. »Abendphantasie«. Hauptwil. Vaterländisches. Der revolutionsfromme Hölderlin. Der Friede von Lunéville. Zeitenwende, Eschatologisches. »Friedensfeier«. Die Geburt eines Gedichtes aus einem anderen. »Wie wenn am Feiertage …« und »Hälfte des Lebens«. Heimkunft. Hilferuf an Schiller. »Sie können mich nicht brauchen.«
Vierzehntes Kapitel
Die Winterreise nach Bordeaux. Der Zauber des Ortes. Rätselhafte Abreise. Spekulationen. Unter den Schlägen des Apoll. Susettes Tod. Ankunft in Stuttgart und Nürtingen, verwirrt, verwahrlost. Raserei. Gegen die Mutter. Mit Sinclair nach Regensburg. Die »Patmos«-Hymne. »Andenken«.
Fünfzehntes Kapitel
Querfeldein nach Murrhardt, zu Schelling. Hölderlins Sophokles-Übersetzungen. Das Fremde wird fremder. Umsiedlung nach Homburg. Verhängnisvolle Tafelrunden in Stuttgart. Die Denunziation Blankensteins. Sinclairs Verhaftung. Hochverratsprozess. Hölderlin im Fadenkreuz. »Ich will kein Jacobiner seyn!« Hölderlin zerstört das Klavier. Abtransport.
Sechzehntes Kapitel
In Autenrieths Psychiatrie. Beim Schreinermeister Zimmer. Im Turm, Zimmer mit Aussicht. Lebbarkeit. Immer noch ein schöner Mann. Briefe an die Mutter. Am Klavier, singen. Gedichte aus dem Stegreif. Wie verrückt? Die Hauptquellen: Varnhagen von Ense, Wilhelm Waiblinger und Christoph Schwab. Wenn die Phantasie sich auf Kosten des Verstandes bereichert. Hölderlins sanfter Tod.
Siebzehntes Kapitel
Romantiker entdecken Hölderlin. Bettine und Achim von Arnim. Brentano, Görres. Die treuen Schwaben, das Junge Deutschland. Die ersten Ausgaben. Der junge Nietzsche liest Hölderlin. Hellingrath und Stefan George entdecken Hölderlin. Der Durchbruch. Der Missbrauch. Heidegger liest Hölderlin. Nach 1945: Unendlicher Deutung voll!
Literatur
Zeittafel
Register
VORWORT
Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht, / Aufzubrechen. So komm! daß wir das Offene schauen, heißt es in Hölderlins »Brod und Wein«, der schönsten und gewaltigsten Elegie in deutscher Sprache.
Eine Annäherung an Hölderlin wird wohl kaum gelingen, wenn man unempfindlich bleibt für göttliches Feuer, wie immer man sich seine Bedeutung zurechtlegen mag.
Was also ist das für ein Feuer, das in Leben und Poesie Hölderlins brennt? Das ist die Frage, der dieses Buch nachgeht.
Wenn Hölderlin später auf sein Leben zurückblickte, kam es ihm so vor, als hätte er schon immer gedichtet. Das poetische Wort war ihm wie Luft zum Atmen. In der Poesie war er ganz für sich und zugleich verbunden mit einem Ganzen, in imaginärer Gemeinschaft. Noch einmal »Brod und Wein«: Vater Aether! so riefs und flog von Zunge zu Zunge / Tausendfach, es ertrug keiner das Leben allein; / Ausgetheilet erfreut solch Gut und getauschet, mit Fremden, / Wirds ein Jubel …
Poesie war für Hölderlin Lebensmittel, im höchsten Sinne und in Einsamkeit und Verbundenheit. Die Mutter konnte das nicht begreifen, sie wollte ihn zum Pfarrer machen. Und der junge Hölderlin ging zunächst brav den dorthin führenden Weg, in Württemberg waren das die Stationen: Klosterschule Denkendorf, dann Maulbronn und schließlich das Tübinger »Stift«.
Dort begeisterte sich der Poet, als der er sich immer schon fühlte, auch für die Philosophie, von der damals eine erregende Aufbruchsstimmung ausging. Hegel, Schelling und Hölderlin bildeten zusammen im »Stift« einen Freundschaftsbund, den sie ihre »unsichtbare Kirche« nannten. Das war keine unbedeutende Episode in der Geschichte der Erfindung des Deutschen Idealismus.
Wenn es 1796 in dem legendären Dokument des gemeinschaftlichen Philosophierens der Freunde – später das »älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus« genannt – kühn und jugendlich beschwingt heißt: »wir müssen eine neue Mythologie haben«, dann war das ein Versprechen, das jeder der Freunde auf seine Weise erfüllen wird; doch es war Hölderlin, dem es nicht genügte, über die Mythologie zu philosophieren. Er setzte sein Leben daran, sie poetisch zu schaffen. Dazu aber musste er sich von der Philosophie befreien, die ihn zunächst doch so befeuert hatte. Als Poet ging er über sie hinaus. In den besten Momenten der Inspiration konnte er schreiben: Was bleibet aber, stiften die Dichter.
Der Freundschaftsbund mit Hegel und Schelling löste sich auf. Doch Hölderlin blieb nicht allein. Dieser außerordentlich schöne junge Mann war immer von Menschen umgeben, die seine Nähe suchten. Frauen verliebten sich in ihn und Männer. Die Höhepunkte waren die Liebesgeschichte mit Susette Gontard in Frankfurt und die Freundschaft mit Isaak von Sinclair.
Susette und Hölderlin fanden sich, konnten aber nicht beieinanderbleiben. Eine tragische Geschichte, verklärt im Bilde Diotimas im »Hyperion«, Hölderlins einzigem Roman. Sinclair, auch er im »Hyperion« gespiegelt, zog Hölderlin, den begeisterten Republikaner, in seine revolutionären Umtriebe. So geriet auch Hölderlin ins Fadenkreuz staatlicher Ermittlungen. Das hat gewiss seinen geistigen Zusammenbruch am Ende beschleunigt.
Hölderlin, auf der Flucht vor dem Pfarramt, suchte sein Auskommen als Hofmeister und musste immer wieder um finanzielle Unterstützung betteln bei der Mutter, die sein nicht unbeträchtliches, vom Vater geerbtes Vermögen verwaltete. Hätte sie den Sohn ausgezahlt, so wäre Hölderlins Leben sicherlich anders verlaufen. Die innerliche Unabhängigkeit muss ohnehin erkämpft werden, doch mehr äußere Unabhängigkeit hätte ihm manche Demütigung erspart.
Hölderlin blieb als Dichter zeitlebens ein Geheimtipp. Schiller versuchte ihn zu fördern. Goethe war gönnerhaft, mehr nicht. Bevor Hölderlin Anfang 1802 nach Bordeaux ging, schrieb er einem Freund: sie können mich nicht brauchen.
Nach der geheimnisumwitterten Rückkehr aus Bordeaux ein halbes Jahr später verschwand Hölderlin allmählich in sich selbst. Doch es gelangen ihm noch geniale Verse, bis er dann im Herbst 1806 von Homburg nach Tübingen in die Psychiatrie geschafft wurde. Ein Jahr später nahm ihn in Tübingen der Schreinermeister Zimmer in seinem Hause auf, wo er die zweite Hälfte seines Lebens, sechsunddreißig Jahre lang, im Turmzimmer verbrachte, mit einem wunderbaren Blick auf den Neckar, dem er in früheren Tagen ein Gedicht gewidmet hatte.
In den ersten Jahren gab es Anfälle von Raserei, dann wurde er friedlich, war wach, nicht stumpf, redete unablässig mit sich selbst, war auch ansprechbar, wenn es sich um Menschen handelte, bei denen er unbefangene Zuneigung spürte. Seinen Stolz bewahrte er sich. Hölderlin wusste sehr wohl, dass er Hölderlin war, auch wenn er sich bisweilen anders nannte. Manchmal aber war er auch traurig. Dann dichtete er, am Pulte stehend und mit der linken Hand das Metrum klopfend: Das Angenehme dieser Welt hab’ ich genossen, / Die Jugendstunden sind, wie lang! Wie lang! Verflossen, / April und Mai und Julius sind ferne, / Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne!
So lebte er hin, bis 1843.
Seinen großen Durchbruch erlebte er nicht mehr. Der setzte erst um 1900 ein. Seitdem ist Hölderlin im kulturellen Gedächtnis unvergessen. Aber eben als »Klassiker« oder als fast schon mythische Figur. Sehr fern jedenfalls.
Deshalb sei, mit aller Behutsamkeit, diese Annäherung versucht. Komm! ins Offene, Freund!
ERSTES KAPITEL
Herkommen. Ehrbarkeit. Hölderlin hält auf sich. Die Väter sterben, die Mutter bleibt. Götter der Kindheit. Mutterbeziehung. Köstlin. Wunderkind Schelling.
Friedrich Hölderlin, am 20. März 1770 in Lauffen am Neckar geboren, wuchs auf im Milieu der schwäbischen »Ehrbarkeit«. So nannte sich selbstbewusst die Elite des höheren Mittelstandes, bestehend hauptsächlich aus Beamten des Staates und der evangelischen Landeskirche. Frommer Lebenswandel, wenigstens äußerlich, war hier Pflicht, man achtete untereinander streng darauf. Hier rekrutierte die Kirche ihren Nachwuchs, beaufsichtigt und finanziell gefördert vom Landesherrn. Man blieb gesellschaftlich unter sich, heiratete auch untereinander. So kam es zu weitverzweigten Verwandtschaftsbeziehungen im Milieu, und so konnte man auf eine gemeinsame Geschichte zurückblicken. Die Hölderlins gehörten zu dieser »Ehrbarkeit«, sogar auf besondere Weise. Denn Hölderlins Mutter, eine Pfarrerstochter aus dem Zabergäu, stammte ab von der sogenannten »schwäbischen Geistesmutter« Regina Bardili (1599–1669). Über sie war Friedrich Hölderlin weitläufig verwandt mit Schelling, Hegel, Uhland und Karl Friedrich Reinhard, auch ein ehemaliger Stiftler, der es im revolutionären Frankreich bis zum französischen Außenminister brachte.
In diesen Kreisen förderte man sich gegenseitig, achtete streng auf die Reputation, gab sich zumeist fromm, tüchtig, selbstbewusst und stolz auf die eigene Moral, mit der man sich absetzte von der beargwöhnten Sittenlosigkeit am Fürstenhof.
Der Vater Heinrich Friedrich war, wie schon der Großvater, Klosterhofmeister. Er verwaltete die Güter des säkularisierten Regiswindis-Klosters in Lauffen. Ein angesehener, einträglicher Posten. Schon der Großvater hatte es in seinem Amt zu einigem Vermögen gebracht, das Heinrich Friedrich, ein geschäftstüchtiger Jurist, zu mehren verstand. Doch viel Zeit hatte er nicht dafür, denn schon 1772, nur zwei Jahre nach Friedrich Hölderlins Geburt, starb dieser heitere, gesellige, den weltlichen Freuden zugewandte und bis dahin offenbar kerngesunde Mann ganz unerwartet an einem Schlaganfall.
Eine wirkliche Erinnerung an diesen frühen Verlust hatte Friedrich wohl nicht, auch wenn er im Knabenalter die Beerdigungsszene melodramatisch heraufbeschwört: Der Leichenreihen wandelte still hinan, Und Fakelnschimmer schien’ auf des Theuren Sarg, … Als ich ein schwacher stammelnder Knabe noch, O Vater! lieber Seeliger!dich verlohr.
Die junge Mutter blieb alleine zurück mit drei Kindern, Friedrich, einer einjährigen Schwester, die bald darauf starb, und der kurz nach dem Tod des Vaters geborenen Schwester Maria Eleonora Henrike, genannt Rike.
Die »schöne Witwe«, wie man die Mutter nannte, blieb nicht lange allein. Ein Freund des verstorbenen Vaters, Johann Christoph Gok, warb um sie. Er war Sohn eines einfachen Schulmeisters, zählte also noch nicht zur »Ehrbarkeit«, doch als tüchtiger Amtsschreiber in Lauffen war er auf gutem Weg dorthin. Gok war, wie auch zuvor Hölderlins Vater, eng befreundet mit dem einflussreichen Oberamtmann Bilfinger. Als der nach Nürtingen versetzt wurde, zog Gok nach und begründete dort mit Bilfingers Unterstützung eine Weinhandlung. Zwischen ihm und der »schönen Witwe« spann sich bald eine Beziehung an. Gok war wohl kein berechnender Mensch, er galt als aufrichtig und uneigennützig, und doch wird ihn die Aussicht auf eine sehr gute Partie beflügelt haben, denn die junge Witwe war eine vermögende Frau.
Der Oberamtmann Bilfinger, Taufpate der Hölderlin-Kinder, riet zur Heirat, und die Mutter selbst war nicht abgeneigt. Sie sei, schreibt Hölderlins Halbbruder Karl rückblickend, bewogen worden, »durch die Sorge für die Erziehung ihrer Kinder u. für die Verwaltung ihres Vermögens … einem bewährten Freunde ihres frühverstorbenen Gatten, dem Kammer Rathe Gock, welcher kurz … vorher nach Nürtingen gezogen war, ihre Hand zu geben«. (Zit. n. Wittkop, 5)
»Kammerrat« war Gok allerdings vor der Heirat noch nicht. Den Titel kaufte ihm die angetraute Witwe. Sie investierte überhaupt einiges Geld in ihren zweiten Mann. Noch vor der Hochzeit erwarb sie ein größeres Anwesen in Nürtingen, den sogenannten »Schweizerhof« mit den dazugehörenden Ländereien. Der Weinkeller wurde reichlich mit Vorräten gefüllt, was sich allerdings als Verlustgeschäft erweisen sollte. Gok kannte sich im Weinhandel noch nicht gut aus; doch so war er eben, unbekümmert, tatendurstig und voller Selbstvertrauen. Der in großen Mengen gelagerte saure Wein verkaufte sich schlecht, was Johanna noch in ihrem späteren Testament tadelnd vermerkte, wie sie überhaupt ihrem zweiten Ehemann vorwarf, dass er zu großspurig mit dem Gelde wirtschaftete, das ihm nicht gehörte.
Mit Bilfingers Unterstützung und gesichert durch Johannas Vermögen, bemühte sich Gok erfolgreich um das Amt des Bürgermeisters von Nürtingen. 1776 wurde er gewählt. Selbstverständlich gab es Neider seines allzu schnellen Aufstiegs in die »Ehrbarkeit«, doch sonst amtete er zur allgemeinen Zufriedenheit. Johanna konnte stolz auf ihn sein. Rang und Ansehen zählten bei ihr viel, und diesen Ehrgeiz gab sie auch an den Sohn weiter, der stolz darauf war, zur »Ehrbarkeit« zu gehören. In der Tübinger Stifts-Zeit schlug er einmal einem sozial unter ihm stehenden Hilfslehrer den Hut vom Kopf, weil der sich geweigert hatte, ihn zuerst zu ziehen, wie es seine standesgemäße Pflicht gewesen wäre. Friedrich Hölderlin hielt sehr auf sich.
In dem weitläufigen, zugleich städtisch und landwirtschaftlich geprägten Anwesen des »Schweizerhofes« erlebte Friedrich eine Kindheit, an die er sich später gerne erinnert, ein Ort der Knabenfreude, der Stunden des Spiels und des Ruhelächelns. Rückblickend stellte er sich, etwa in dem Vers-Entwurf des »Hyperion«, als verträumten Knaben dar, der von seinen Spielgefährten immer wieder in die Wirklichkeit zurückgeholt werden muss:
Oft sah und hört’ ich freilich nur zur Hälfte,
Und sollt’ ich rechtwärts gehn, so gieng ich links,
Und sollt ich eilig einen Becher bringen,
So bracht’ ich einen Korb, und hatt’ ich auch
Das richtige gehört, so waren, ehe noch
Gethan war, was ich sollte, meine Völker
Vor mich getreten, mich zum Rath, und Feinde,
Zu wiederholter Schlacht mich aufzufordern,
Und über dieser größern Sorg’ entfiel mir dann
Die kleinre, …
Diß kostete mich tausend kleine Leiden.
Verzeihlich war es immer, wenn mich oft
Die Klügeren mit herzlichem Gelächter
Aus meiner seeligen Ekstase schrökten, …
(MAI, 521; Vs. 218–227, 233–236)
Die Gärten der Kindheit um den »Schweizerhof« herum waren für Hölderlin im Rückblick der Ort der ersten Bekanntschaft mit dem Göttlichen:
Da ich ein Knabe war,
Rettet’ ein Gott mich oft
Vom Geschrei und der Ruthe der Menschen,
Da spielt’ ich sicher und gut
Mit den Blumen des Hains,
Und die Lüftchen des Himmels
Spielten mit mir
O all ihr treuen
Freundlichen Götter!
Daß ihr wüßtet,
Wie euch meine Seele geliebt!
Zwar damals rieff ich noch nicht
Euch mit Nahmen, auch ihr
Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen
Als kennten sie sich.
Doch kannt’ ich euch besser,
Als ich je die Menschen gekannt,
Ich verstand die Stille des Aethers
Der Menschen Worte verstand ich nie.
Mich erzog der Wohllaut
Des säuselnden Hains
Und lieben lernt’ ich
Unter den Blumen.
Im Arme der Götter wuchs ich groß.
(MAI, 167f.; Vs. 1–7, 16–32)
Die Worte der Menschen um ihn herum, so erinnerte er sich, empfand er immer schon als zu laut in der Stille des Aethers. Ob er aber schon damals den Äther, also die Luft und Atmosphäre, als eine Art göttliche Naturmacht wirklich erlebt hat oder ob es sich hier zwanzig Jahre später um eine Rückprojektion handelt, lässt sich nicht entscheiden. Jedenfalls spielte der moralische Gott des pietistischen Milieus, in dem er aufwuchs, in den verklärenden Kindheitserinnerungen nur eine geringe Rolle. Er sieht sich vielmehr liebevoll behütet von den zahllosen, noch namenlosen Göttern, die eher aus der griechisch-antiken denn aus christlicher Sphäre zu stammen scheinen.
Nürtingen liegt in einer anmutigen sanften Landschaft am Fuße der Schwäbischen Alb, umgeben von fruchtbarem Ackerland, dazwischen Obst- und Blumengärten, an den Neckarauen die Uferweiden mit Pappelalleen; im weiteren Umkreis Wiesenhügel, von denen da und dort Kapellen herabschauen.
Nürtingen hatte Stadtrecht seit dem 14. Jahrhundert. Man war stolz darauf und auf die städtischen Einrichtungen, eine Lateinschule, ein Krankenhaus, landständische Ämter, ein stattlicher Markt und mehrere Kirchen. Doch in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 1750 hatte ein Großfeuer gewütet, das 133 Gebäude in Schutt und Asche legte. Betroffen war der ganze mittelalterliche Stadtkern. Die Stadt war zügig wiederaufgebaut worden, Hölderlins Nürtingen war also eine weitgehend neu gebaute Stadt. Die Brandkatastrophe ließ den pietistischen Geist, der hier auch zuvor schon lebendig war, aufs Neue mächtig aufflammen. Noch bis in die achtziger Jahre hinein, Hölderlins Schulzeit, waren von den Kanzeln Mahnungen zu hören wie diese: »Was mag wohl Ursach dieses erbärmlichen Straf-Gerichts Gottes gewesen seyn? Gewis, keine andere als diese, weil deine Bürger und Einwohner der Stimme Gottes nicht gehorchet …« (Zit. n. Wittkop, 4) Das geistliche Stadtregiment war damals streng und duldete nur ungern die traditionellen Volksfeste, etwa die »Nürtinger Maitage«, zu denen aus der ganzen Umgebung die Leute strömten. Es gab Musik und Tanz und Theater. Besonders für die Kinder und Jugendlichen ein freudiger Höhepunkt des Jahres. Doch man bemühte sich, das Vergnügen nicht ins Kraut schießen zu lassen. So ließ man die Komödie mit einem Gottesdienst beginnen, was einen zeitgenössischen Beobachter zu der spöttischen Bemerkung veranlasste: »Das Komische des Ganzen kontrastirte sehr mit dem feyerlichen Anfang einer Betstunde …« (Zit. n. Wittkop, 15) In Nürtingen war man fromm, nach außen wenigstens.
In diesem bürgerlich-braven Nürtingen spielte sich Hölderlins gut behütete Kindheit ab. Man ließ den begabten Knaben gewähren, und der Stiefvater war gut zu ihm. An ihn denkt Hölderlin später mit Wehmut zurück und nennt ihn eine immerheitere Seele.(MAII, 775)
Den Tod des ersten Vaters hatte er nicht wirklich erlebt, der des zweiten aber war ihm sehr nahe gegangen. Es geschah im März 1779, da war Hölderlin neun Jahre alt. Der Bürgermeister Johann Christoph Gok hatte sich bei einer Überschwemmung, wo er überall helfend zur Stelle war, so verausgabt, dass er wenige Wochen später an den Folgen einer starken Erkältung starb. Die Erinnerung an diesen Tod blieb schmerzlich. Ein Gedicht des Sechzehnjährigen, »Die Meinige«, ist ihm gewidmet:
Ach als einst in unsre stille Hütte
Furchtbarer! herab dein Todesengel kam,
Und den jammernden, den flehenden aus ihrer Mitte
Ewigteurer Vater! dich uns nahm;
Als am schröklich stillen Sterbebette
Meine Mutter sinnlos in dem Staube lag –
Wehe! noch erblik ich sie, die Jammerstätte,
Ewig schwebt vor mir der schwarze Sterbetag –
(MAI, 22; Vs. 25–32)
In einem Brief vom 18. Juni 1799 an die Mutter führte Hölderlin seinen Hang zur Trauer auf diesen Todesfall zurück. Damals sei seine Seele, schrieb er, zum ersten Mal auf jenen Ernste gestimmt worden, der ihn seitdem niemals ganz verlassen habe. (MAII, 775)
Nach dem Tod des geliebten Stiefvaters war Friedrich nun gänzlich auf seine Mutter angewiesen. Seine Beziehung zu ihr war merkwürdig und lässt viele Fragen offen. Innig und liebevoll blieb der Ton der Briefe bis etwa 1802, also bis zum ersten Zusammenbruch. Als die Mutter wieder einmal über die räumliche Entfernung des Sohnes klagte, schrieb er ihr: der fromme Geist, der zwischen Sohn und Mutter waltet, stirbt zwischen Ihnen und mir nicht aus. (18. Juni 1799; MAII, 774)
Ein frommer Geist verband die beiden, wenngleich Hölderlins Frömmigkeit zu diesem Zeitpunkt (1799) eine andere war als die der Mutter. Die war strenggläubig, orthodox, von pietistischer Innerlichkeit. Hölderlin respektierte die Frömmigkeit der Mutter, aber verbarg vor ihr seine ganz persönliche andere Frömmigkeit, die über das Christliche hinausging. Doch gab es hier immerhin eine Möglichkeit zur Verständigung. Die aber gab es nicht bei dem, was für Hölderlin zur Mitte seines Daseins wurde, beim – Dichten. Die Mutter hat es hartnäckig ignoriert und missbilligt, wenn es ihn von den Studien- und Berufspflichten abzubringen drohte. Die Dichter gehörten für sie ganz einfach nicht zu der »Ehrbarkeit«. Ein einziges Mal nur hat sie sich nach Hölderlins literarischen Erzeugnissen erkundigt und den Sohn ausdrücklich gebeten, ihr etwas zu schicken. Als Hölderlin diesem Wunsche nachkam und ihr das Gedicht »An die Parzen« schickte, in dem das Motiv der Todesbereitschaft nach gelungenem Werk anklingt – Doch ist mir einst das Heil’ge, das am / Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen, / … / Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt! (MAI, 188) –, da schickt er sogleich einen Brief hinterher, der ihre Ängste zerstreuen soll: Überhaupt, liebste Mutter! muß ich Sie bitten, nicht alles für strengen Ernst zu nehmen, was Sie von mir lesen. (8. Juli 1799; MAII, 789) Die Mutter hatte keinen Zugang zur Poesie und verstand auch nicht die poetische Leidenschaft ihres Sohnes. Später war sie davon überzeugt, dass letztlich die Poesie ihren Sohn zugrunde gerichtet habe. Hölderlin sollte Pfarrer werden, das war ihr Wunsch, und in diese Richtung drängte sie den Sohn. Frau und Kinder, ein Pfarrhaus mit einem Platz auch für sie im Alter, so wollte sie es haben, und dafür hielt sie das ererbte Geld zusammen.
Trotz der Spannungen und Gegensätze blieb Hölderlin der Mutter lange Zeit tief verbunden, anhänglich und abhängig zugleich. Es fiel ihm schwer, sich selbst zu achten, wenn er sich nicht von der mütterlichen Achtung beschirmt wusste. Dann fürchtete er zu verwildern: Darf ichs Ihnen einmal sagen? wenn ich oft in meinem Sinn verwildert war, und ohne Ruhe mich umhertrieb unter den Menschen, so wars nur darum, weil ich meinte, daß Sie keine Freude an mir hätten. (11. Dezember 1798; MAII, 720)
Hölderlin hat fleißig an seine Mutter geschrieben. Der größte Teil seiner Briefe ist an sie gerichtet. Diese Briefe sind herzlich, doch immer auch respektvoll, manchmal auf ängstliche Weise förmlich und verkrampft; auch Taktik ist im Spiel. Er möchte sie nicht beunruhigen, er verharmlost manches, verschweigt vieles. Von seinen Liebesgeschichten schreibt er nichts, doch ständig beteuert er, wie sehr er sie liebe. Er scheut den Konflikt mit ihr. Allerdings wehrt er sich, wenn sie ihm, der selbst seinen Hang zur Traurigkeit bekennt, mit ihrer Traurigkeit ein schlechtes Gewissen macht oder ihn sonst wie unter Druck setzt. Er weiß zwar, dass die Mutter manches zu leiden gehabt hatte – zwei Ehemänner und drei Kinder waren ihr gestorben –, und doch kam es vor, dass der Neunzehnjährige sie ein wenig altklug ermahnte, es sei ihre Christenpflicht, sich nicht der allzugroßen Traurigkeit zu ergeben, und er empfiehlt ihr, sich desschönen Frülings zu erfreuen. (April/Mai 1789; MAII, 450) So wehrte er sich gegen sie und die Bedrückung, die von ihr ausging. Ein anderes Mal schrieb er: Sie sollten nur nicht in einen geheimen Bund sich mit dem Schmerz einlassen, und nicht zu generos ihn in sich walten lassen. (10. Juli 1797; MAII, 660)
Doch wie seltsam, die Mutter, die unablässig über das Leben ihres Sohnes gewacht hatte, wird sich daraus nach dem Zusammenbruch fast vollständig zurückziehen. Wahrscheinlich hat sie zwischen 1807 und ihrem Tod 1828 den Sohn im Tübinger Turm niemals besucht. In den ersten Jahren dort überkamen Hölderlin Anfälle von Raserei, wenn ihn jemand auch nur von ferne an Familie und Verwandtschaft erinnerte.
Hölderlin hatte in seiner Hofmeister-Zeit die Mutter immer wieder um Geld anbetteln müssen. Eigentlich aber war es sein eigenes Geld, worum er bat. Beim Tode des Stiefvaters Gok wurde das Erbe aus der ersten Ehe zwischen ihr und den Kindern aus dieser Ehe, also Rike und Friedrich, geteilt. Der Halbbruder Karl geht zunächst leer aus, denn in der zweiten Ehe hatte es keinen Zugewinn gegeben, und Gok selbst hatte kein Vermögen in die Ehe eingebracht. Diese Konstellation wird Hölderlins Verhältnis zu seinem Halbbruder beeinträchtigen, weil der nicht studieren durfte, sondern sich mit einer Ausbildung zum Amtsschreiber begnügen musste. Karl haderte mit seinem Schicksal und musste sich von Friedrich in zahlreichen pädagogisch gemeinten Briefen trösten lassen. Friedrich wollte den sechs Jahre jüngeren Karl an der Welt seines Geistes Anteil nehmen lassen, und Karl wird ihm dankbar dafür sein, doch auch begreifen, dass es besser ist, sich für seine eigene Welt zu entscheiden. Er vollzog diese Wendung mit allem Ernst. Tüchtig wie er war, machte er in seinem Beruf Karriere und brachte es bis zum Domänenrat für die Weingüter um Stuttgart. Eine angesehene Stellung. Er galt als der beste Kenner des württembergischen Weines, verfasste auch ein Buch darüber. 1831 wurde er in den Adel erhoben. Es war Karl Gok, der in den zwanziger Jahren eine Sammlung der Gedichte Hölderlins anregte, die dann Uhland besorgte. Als der Band im Juni 1826 erschien, sandte Karl Gok ihn an den Bruder mit den Worten: So sind nun die Früchte Deiner trefflichen Dichtung der Welt erhalten, und Dein Angedenken wird in diesen von jedem tief fühlenden gebildeten Menschen stets verehrt werden. (25.7.1826; MAII, 960) Eine direkte Antwort Hölderlins ist nicht überliefert. Doch als ein Besucher einmal bemerkte, die Gedichte seien gut redigiert, äußerte Hölderlin verärgert, er brauche diese Hilfe nicht, er selbst könne wohl am besten die eignen Werke redigieren.
Nach dem Tode der Mutter 1828 kam es zu einem Erbschaftsstreit, weil Rike darauf drängte, den Anteil Friedrichs zu schmälern, mit der Begründung, dass der langjährige Versorgungsaufwand den Vermögensanteil des Bruders fast aufgebraucht hätte. Das zuständige Gericht folgte dem Antrag allerdings nicht und verwies auf eine Verfügung der Mutter, der zufolge dem Sohn, »wenn er im Gehorsam bleibt«, nichts von den Ausgaben abgezogen werden sollte.
Hölderlin war beim Tode der Mutter, deren Aktivvermögen auf 19.000 Gulden (mehrere Hunderttausend heutigen Geldes) angewachsen war, ein ziemlich vermögender Mann, wovon er aber wohl kaum etwas mitbekam. Er war es eigentlich schon vorher, denn bei der Erbteilung nach dem Tode des leiblichen Vaters 1774 entfielen auf den vierjährigen Friedrich einige Tausend Gulden, die von der Mutter in Pfandbriefe und Darlehen umgewandelt wurden, deren Wert im Laufe der Jahre sehr gewachsen war. Die Mutter war durchaus geschäftstüchtig, doch nicht auf eigene Bereicherung aus. Sie wollte dem Sohn und der Schwester, die zu ihrer Heirat dann ausgezahlt wurde, die Zukunft sichern. Bei Hölderlin war das indes eine Zukunft nach ihrem Wunsche: Er sollte Pfarrer werden. Deshalb verwaltete sie treuhänderisch den Vermögensanteil des Sohnes, weil sie damit Druck auf ihn ausüben und ihn in einer gewissen Abhängigkeit halten konnte. Hölderlin seinerseits aber fehlte der Mut, die freie Verfügung über seinen Vermögensanteil, der ihm zustand, einzufordern. Hätte er es getan, sein Leben wäre anders verlaufen. Er hätte vielleicht die Pfarrerausbildung früh beendet, hätte sich vielleicht auch nicht durch die oft demütigenden Hofmeisterstellen quälen müssen. Er hätte überhaupt freier aufspielen können. Es ist eine tragische Ironie in seinem Lebensschicksal, dass ihm die damals so wichtige finanzielle Unabhängigkeit erst in einem Augenblick zufiel, als er im Tübinger Turm nun wirklich nichts mehr damit anfangen konnte.
Der Schreinermeister Zimmer, Hölderlins treu sorgender Hauswirt in Tübingen, überlieferte das Gerücht, die Mutter habe bei ihrer ersten schwierig verlaufenen Schwangerschaft das Gelübde getan, dass, sollte es ein Sohn werden, er »dem Herrn zu bestimmen« sei (KA3, 677), dass er also von Anfang an dem geistlichen Beruf geweiht gewesen sei, wogegen sich Hölderlin dann stets gesträubt habe, weil ihn die Theologie nicht anzog. Er hätte, wie Zimmer sich ausdrückt, »zuviel Naturfilosofie« gehabt.
Tatsächlich hatte es die Mutter auf die Theologie bereits abgesehen, als Hölderlin in Nürtingen in die Lateinschule gegeben wurde. Es war die Vorbereitung auf die drei Landesexamen, zuerst für die Klosterschulen Denkendorf und Maulbronn, zuletzt für das Tübinger Stift. Beginnend also bei den Vierzehnjährigen, wurde in Württemberg mit staatlicher Unterstützung und durch zahlreiche Prüfungen streng kontrolliert die Begabungselite für die protestantischen Kirchenämter ausgesiebt.
Die Lateinschule genügte der Mutter nicht, sie bezahlte noch einen Zusatzunterricht durch den Diakon Nathanael Köstlin, was für den heranwachsenden Hölderlin allerdings ein Glücksfall war. Denn der Knabe hing an dem zugleich gelehrten und warmherzigen Mann, der Autorität ausübte, ohne zu bedrücken. Köstlin verbreitete, heißt es in einer zeitgenössischen Schilderung, »einen eigenen Eindruck von Reinheit des Daseyns« und ein »mildes Wohlwollen«, weshalb man ihm »Ehrfurcht« und »Liebe« entgegenbrachte. (Zit. n. Wittkop, 20) Dieser Mann war für Hölderlin auch deshalb von Bedeutung, weil er bei ihm dessen Neffen kennenlernte, das zehnjährige »Wunderkind« Schelling, das bereits mühelos Lateinisch und Griechisch lesen konnte. Schelling wird sich später noch daran erinnern, wie er von älteren Schulkameraden schikaniert wurde und der fünf Jahre ältere Hölderlin die Aufgabe übernahm, ihn zu schützen. Anders als Hölderlin brauchte Schelling Denkendorf und Maulbronn nicht zu besuchen, weil er dort nichts mehr lernen konnte. Der Vater, ein hochgebildeter Pfarrer, unterrichtete ihn einstweilen so lange, bis er die Sondererlaubnis erhielt, als Fünfzehnjähriger ins »Stift« einrücken zu dürfen. Dort traf er dann wieder auf Hölderlin, und die beiden wohnten, zusammen mit Hegel, eine Zeit lang auf derselben Stube.
Für Hölderlin war dieser Nathanael Köstlin, der Onkel Schellings, ein wichtiger Mentor der Jugendjahre. Hölderlin wird sich später immer wieder nach ihm erkundigen, und Köstlin seinerseits wird den Werdegang seines ehemaligen Zöglings mit Anteilnahme verfolgen.
ZWEITES KAPITEL
Denkendorf. Klösterliches. Brief an Köstlin. Pietistische Seelenprüfung. Selbstbehauptung einer Seele gegen das »Weltliche«. Angst vor Selbstverlust. Das liberale Maulbronn. Erste Liebesgeschichte. Pindars Flug und Klopstocks Größe. Als Dichter zur Welt kommen.
Am 1. Oktober 1784 zieht Friedrich Hölderlin nach einem gut bestandenen ersten Landesexamen in die Klosterschule Denkendorf, die zwar nur sieben Kilometer entfernt liegt und doch zu einer in sich abgeschlossenen anderen Welt gehört. Mit den verträumten Götterstunden im Garten war es vorbei, er fühlte sich eingesperrt in die grauen Mauern des alten Klosters und von den strengen Regeln eingeschränkt. Nach Hause durften die Schüler nur in den Ferien, und Familienbesuche im Kloster sah man nicht gerne. Teilnahme am Gottesdienst, mehrmals am Tage, war Pflicht. Wer ihn schwänzte, wurde mit Entzug des Tischweins bestraft. Die Lektüre fand unter Aufsicht statt, selbst bei den erbaulichen Werken wurde vor dem Extravaganten, etwa dem Mystischen oder Hochspekulativen, gewarnt, geistige Erkundungen auf eigene Faust waren nicht gerne gesehen. Am besten las man fleißig in der Bibel, aber auch dort nicht »gewisse« Stellen. »Leichtsinnige« Romane, etwa Goethes »Werther«, waren verboten. Auch sonst hatte man sich keusch und züchtig zu geben. Vor Tee und Kaffee wurde gewarnt, sie regten zu sehr auf. Von den haus- und landwirtschaftlichen Anlagen der Klosterschule sollten sich die Schüler fernhalten, denn der Umgang mit dem Dienstpersonal schickte sich nicht für sie: Schließlich sollten sie auf ihre künftige Standesehre achten. Wirtshäuser waren ebenso tabu wie Kartenspiel, Kegeln, Lärmen und öffentliche Tanzvergnügen. Die Zöglinge aus gut situierten Familien wurden vor »Üppigkeit« gewarnt und durften keine Gegenstände von »unzeitiger Galanterie« oder gar »allerlei eitle Meubel« mitbringen. Es sollte in den Klostermauern karg und bescheiden zugehen, eben nicht »weltlich«. Ein pietistischer Geist war spürbar, dem alles »Weltliche« zunächst einmal verdächtig ist.
Mit alldem wurde die biographische Zäsur betont, die Grenze zu einer Vergangenheit, die man hinter sich zu lassen hatte. Möglichst wenige Erinnerungen an zu Hause, keine sentimentale Anhänglichkeit! Die Pietisten setzten auch sonst auf Bekehrung, es sollte, mit Paulus gesprochen, ein neuer innerer Mensch »angezogen« werden. Damit sollte im Schulkloster begonnen werden. Nicht nur die Lebensweise war mönchisch, auch das äußere Habit, keine »weltförmige Kleidung in und außer dem Closter« (KA3, 595), befiehlt die Schulordnung. Bisweilen werden die Regeln zwar locker gehandhabt, doch nur hinter dem Rücken des Vorstehers. Die Schüler hingen von der Gnade eines Menschen ab, dessen besondere Merkmale »Geiz, Heimtückigkeit und Unverschämtheit« waren, wie sich ein Mitschüler später erinnerte. Doch auch ohne diesen Tyrannen war die Tageseinteilung tyrannisch: 59 Lehr- und Lernstunden die Woche, peinlich genau geregelter Tageslauf von fünf Uhr morgens bis acht Uhr abends, nur zwei einstündige Pausen, die der Schüler für sich verbringen konnte, sonst lebte man immer in der Gruppe und unter Aufsicht. Unter diesem Mangel an Gelegenheit, einsam vor sich hin zu träumen, hat der junge Hölderlin besonders gelitten und auch daran, dass er hier keinen Lehrer fand, dem er sich hätte öffnen können.
Deshalb war es für ihn ein Glück, dass er sich noch für einige Zeit an den verehrten und geliebten Diakon Köstlin in Nürtingen wenden durfte. Der erste Brief, der sich aus Hölderlins Korrespondenz erhalten hat, ist an ihn gerichtet.
Der junge Hölderlin hat sich Köstlin zum Seelenführer und Beichtvater erwählt. Man merkt dem Brief an, dass Friedrich schon einige Übung in pietistischer Selbstbeobachtung und Seelenerforschung besaß, diese eigentümliche Verbindung von Innigkeit und Misstrauen gegen sich selbst. Er fühle sich, schreibt er, als rechter Christ, empfinde auch viele gute Rührungen, doch womöglich seien die gar nicht echt, sondern rührten bloß von seiner natürlichen Empfindsamkeit her und würden sich deshalb wohl als unbeständig erweisen. Auch seinem innigen Naturgefühl könne er nicht trauen. Liebt er die Natur und die Natureinsamkeit nicht gegen die Menschen? Er habe sich dabei ertappt, dass er in solchen schwelgerischen Augenblicken dazu neige, die Menschheit zu verachten. Ist solches menschenfeindliche Wesen nicht Hochmut? Wenn er dann aber, aus schlechtem Gewissen, sich den gewöhnlichen Menschen gegenüber bemüht freundlich gibt, ist das womöglich auch nicht recht, denn es verbirgt sich darin das Bestreben, vor den Menschen zu gefallen, aber nicht vor Gott. So wendet er seine Gefühle hin und her, schon einigermaßen virtuos, so dass man ihm die wirkliche seelische Not eigentlich nicht glaubt. Das Verlangen nach einsamem Selbstgenuss in der Natur und die Scheu gegenüber Menschen sind gewiss aufrichtig empfunden, aber ob er darin tatsächlich eine Sünde sieht, ist fraglich. Denn dieses Schreiben wirkt zu abgeklärt, fast wie ein Probestück pietistischer Seelenerforschung. Er wolle dem verehrten Köstlin, schreibt er, seine Gedanken zu jener kniffligen Frage vorlegen, wie man doch Klugheit in seinem Betragen, Gefälligkeit und Religion verbinden könne. (November 1785; MAII, 393)
Wenn in diesem Brief das bei den Pietisten stets auf der Lauer liegende Sündengefühl sich bemerkbar gemacht haben sollte, so war es damit zwei Jahre später vorbei, als er nämlich seinem Freund Immanuel Nast schrieb: Denn sage mir, Freund, warum soll ich … meine unschuldigste Handlungen für Verbrechen auslegen lassen. (Januar/Februar 1787; MAII, 398)
Eine Bemerkung im Brief an Köstlin deutet ein Problem an, das Hölderlin auch künftig zu schaffen machen wird: der kleinste Umstand jagte mein Herz aus sich selbst heraus (MAII, 393), schreibt er und bekennt damit seine Störanfälligkeit: er muss gegen äußere Umstände und Einflüsse immer wieder um den Selbstbesitz ringen. Die Angst treibt ihn um, er könnte sich verloren gehen. Er glaubt sich gegen Mächte wehren zu müssen, die ihn aus sich selbst heraustreiben. Aus dieser Gefühlslage entwickelte sich seine Liebe zu den großen Helden der Antike: Sie waren ihm Vorbild, weil sie in sich selbst ruhen. Zwar erleiden sie Schlimmes, doch sie gehen sich nicht verloren. Selbstverlust ist das Schlimmste, das wird für den fünfzehnjährigen Hölderlin zur Gewissheit.
Doch wie bewahrt man seine Seele? Die gewöhnliche pietistische Antwort: in der Zwiesprache mit Gott, im Gebet und in der Christusnachfolge – im Gegensatz zur »Welt« und den sogenannten »Weltleuten«. Die scharfe pietistische Trennung – hier geistlich, dort weltlich – wirkt bei Hölderlin nach, doch es beginnt schon jetzt eine charakteristische Umwandlung: Die Selbstbehauptung der Seele gegen das »Weltliche« wird zunehmend der Poesie übertragen. Tausend Entwürfe zu Gedichten beschäftigen ihn, schrieb er 1784 aus Denkendorf. In diesen Gedichten lebte und webte er, hier hatte er seine geistige und einstweilen auch seine geistliche Existenz, die ihn vor den Zumutungen des gewöhnlichen Lebens an diesem als öde empfundenen Ort bewahrte. Nur wenige Gedichte aus dieser Zeit haben sich erhalten. Es geht in ihnen fast immer um Seelenzuflucht, um den Augenblick der Übereinstimmung mit sich, zumeist beim Erlebnis von schöner oder erhabener Natur, fern von der Menschenwelt: Aus der Welt, wo tolle Thoren spotten, / Um leere Schattenbilder sich bemühn, / Flieht der zu euch, der nicht das schimmernde Getümmel, / Der eitlen Welt, nein! nur die Tugend liebt. (MAI, 10)
Nach zwei Jahren Denkendorf und nach dem bestandenen zweiten Landesexamen bezog Hölderlin die Klosterschule in Maulbronn. Unter den 29 Schülern seines Jahrgangs – der sogenannten »Promotion« – belegte er den sechsten Platz. Die Bewertung war nicht so gut wie noch in Nürtingen, womöglich eine Folge seines Leidens an den Verhältnissen in Denkendorf.
Auch in Maulbronn waren Schule und Internat in einer ehemaligen Klosteranlage untergebracht. Die Architektur war ehrfurchtgebietend, die Atmosphäre aber war hier freundlicher und liberaler als in Denkendorf. Es gab hier nur neunzehn Lehrstunden auf die Woche verteilt, die übrige Zeit sollte gemäß reformierter Erziehungsgrundsätze für das Selbststudium genutzt werden. Die Kontrolle war nicht sonderlich streng. Lesen konnten die Zöglinge, was sie wollten, wenn sie nur gewitzt genug waren, es sich zu besorgen. Es kursierte die neueste Literatur des »Sturm und Drang«; Hölderlin las zum ersten Mal Schillers »Räuber«. Er hatte sich auch die Vertonung von Karl Moors Lobrede auf den als Tyrannenmörder verehrten Brutus besorgt und wollte sie zu Schillers Ehre auf dem Klavier einüben, so hart es gehen wird mit meinem Geklemper.(An Nast, Januar 1787, MAII, 396) Bedenkt man, dass der hochberühmte Schiller ein vom Herzog immer noch verfolgter und geächteter Autor war, so kann Hölderlins Bewunderung für ihn und die »Räuber« durchaus als Aufsässigkeit gelten. Hölderlin wusste allerdings nicht, mit welch starken Worten Schiller in der »Rheinischen Thalia« von 1785 mit dem eigenen Stück ins Gericht gegangen war. Er hatte selbstkritisch den mangelnden Realismus als Folge des tyrannisch eingeschränkten Lebens auf der Karlsschule beklagt und allein die feurige »Leidenschaft für die Dichtkunst« sich zugutegehalten. Nur die Mischung aus poetischer Leidenschaft und Ahnungslosigkeit konnte, so Schiller, jene lebensfremden »Ungeheuer« auf die Bühne bringen. Die »Räuber« seien das »Beispiel einer Geburt …, die der naturwidrige Beischlaf der Subordination und des Genius in die Welt setzte«. (Schiller V, 855) Da es im Kloster Maulbronn wohl ähnlich lebensfern zuging wie an der Karlsschule, waren die Schüler von Maulbronn wohl auch so empfänglich für die rebellischen »Ungeheuer« in Schillers Phantasiegeburten.
Der Zeitgeist des »Sturm und Drang« überwand also die Klostermauern von Maulbronn. Hölderlin war dafür besonders empfänglich. Er wurde wegen seiner poetischen Leidenschaft für das Heroische von den Kameraden bisweilen sogar gehänselt, worüber er sich dann bei seinem neuen Freund Immanuel Nast, Schreibergehilfe in Leonberg, bitter beschwerte. Aber er haderte auch mit sich selbst. Wenn er doch nicht nur in der Poesie, sondern auch im wirklichen Leben mehr Wollust, Hader, Raufsucht hätte, so schrieb er, dann würde er sich besser behaupten können. Die Schwäche im praktischen Leben macht ihm die Liebe zur Poesie verdächtig: Ja, Bester, gerade das, was mich trösten solte, das liegt am schwersten auf mir. (Januar/Februar 1787; MAII, 399) Die Poetisierung des Heroischen fungiert als Ersatzhandlung. Angeregt von Klopstocks »Messias«, fühlt er sich in Adramelech ein, einen rebellischen Höllenbewohner, verruchter noch als der Satan selbst – … verzweifle König der Hölle, / Nur Adramelech bleibt groß.(MAI, 13f.) Starke Töne finden sich auch in dem »Der nächtliche Wanderer« überschriebenen kurzen Gedicht mit deutlichen Anklängen an eine Szene der »Räuber«:
Hu! Der Kauz! wie er heult,
Wie sein Furchtgeschrei krächt
Erwürgen – ha! du hungerst nach erwürgtem Aas
Du naher Würger komme, komme.
Sieh! er lauscht, schnaubend Todt –
Ringsum schnarchet der Hauf
Des Mordes Hauf, er hörts, er hörts, im Traume hört’ ers
Ich irre Würger, schlafe, schlafe.(MAI, 13)
Ungeheuer der Nacht und die Heroen der Hölle auf der einen Seite, auf der anderen Seite die heroischen Lichtgestalten, wie etwa Alexander der Große mit einer Rede an seine Soldaten:
Ihr, Söhne Thraciens, ihr deren Hand
Nur tapfre Waffen eures Sieges kennt,
Seht, wie der Feind von Gold belastet ist,
Euch, Brüder, ziert es besser, denen’s nicht
Die Weichlichkeit als Sclaven geben wird,
Euch mahnts an euern Muth, an euren Sieg.
(MAI, 16; Vs. 57–62)
Hier wird verächtlich von sklavischer Weichlichkeit gesprochen, von Weichheit indesist in einer Selbstcharakteristik die Rede, die sich etwa zur selben Zeit in einem Brief an Nast findet. Es ist ein Brief, der in tiefer Nacht geschrieben wurde, wie Hölderlin eigens vermerkt, um seine Bedeutung zu unterstreichen. Darin klagte er, wie üblich, über die rohe Welt um ihn herum, doch dann folgt eine luzide Selbstanalyse: Du darfst Dich auch nicht wundern – wann bei mir alles so verstümmelt – so widersprechend aussieht – Ich will Dir sagen, ich habe einen Ansaz von meinen Knabenjahren – von meinem damaligen Herzen – und der ist mir noch der liebste – das war so eine wächserne Weichheit, und darinn ist der Grund, daß ich in gewissen Launen ob allem weinen kan – aber eben dieser Theil meines Herzens wurde am ärgsten mishandelt so lang ich im Kloster bin … und daher hab ich nebenher einen traurigen Ansaz von Roheit – daß ich oft in Wuth gerathe … wann kaum ein Schein von Beleidigung da ist. O es schlägt nicht dem Deinen gleich – mein Herz – es ist so bös – ich habe ehmalen ein bessers gehabt – aber das haben sie mir genommen – und ich muß mich oft wundern, wie Du drauf kamst – mich Deinen Freund zu heißen. Hier mag mich keine Seele – izt fang’ ich an, bei den Kindern Freundschaft zu suchen … (Januar 1787; MAII, 397)
Er schätzt die Weichheit des Herzens, doch er leidet auch an ihr, weil sie ihn so verwundbar macht; zu schnell fühlt er sich beleidigt, braust in jähem Zorn auf, kann sogar bösartig werden, was er sogleich bitter bereut. Dieses Hin und Her, diese Unausgeglichenheit macht ihm keine Freunde. Doch er übertreibt. So allein ist er nicht. Er hat auch in Maulbronn Freunde, wie auch später Männer und Frauen die Nähe dieses schön anzusehenden geistvollen Menschen suchen. Im Tübinger Stift sagte man, es sei, als schreite »Apoll« durch den Raum, wenn Hölderlin im Speisesaal sich das Essen holte.
Es gibt eine Einsamkeit, zu der man verurteilt ist, und eine, die man sucht. Unter der einen leidet man, die andere genießt man. Solchen Genusses wegen zog sich Hölderlin gerne zurück. Wieder eine Stunde wegphantasirt!, schrieb er. (An Nast, Februar 1787; MAII, 398) Es ergehe ihm besser in seinem anderswo, in der geräumigen Geborgenheit seiner poetischen Träume, dort könne er die anderen Menschen nur bedauern, allerdings nur so lange, bis er bemerkt, dass er mit einem Teil seines Wesens doch auch zu dieser gewöhnlichen Welt gehöre.
Immer wieder kommt er auf diese wächserne Weichheit zurück. Er schildert, wie er mit warmem Gefühl und Hingabe aus sich herausgeht, um dann auf erkältende Gleichgültigkeit zu stoßen, die häufig nichts weiter als alltägliche Unaufmerksamkeit ist. Wer sich ganz gibt, wird sich von jeder weniger hingebungsvollen Reaktion zurückgestoßen fühlen, auch wenn kaum ein Schein von Beleidigung da ist. Zum ersten Mal schildert hier der junge Hölderlin den Kälte-Schock, von dem noch häufig in den Briefen und Gedichten die Rede sein wird. Ich friere und starre in den Winter, der mich umgiebt, heißt es in einem der letzten Briefe aus Nürtingen, kurz vor dem Zusammenbruch. (MAII, 596)
Diese luziden Selbstanalysen finden sich in Briefen an den wohl besten Freund der Maulbronner Jahre, Immanuel Nast, Neffe des Klosterverwalters von Maulbronn, ähnlich wie später Hölderlins Halbbruder Karl zum Amtsschreiber ausgebildet, obwohl er gerne studiert hätte. Immanuel schloss sich dem jüngeren Hölderlin an, um mit einer Bildungswelt verbunden zu bleiben, von der er sich sonst zu seinem Leidwesen abgeschnitten fühlte.
Hölderlins Briefe an ihn sind einerseits vertraulich, doch in bestimmter Hinsicht auch unaufrichtig. Denn Hölderlin hatte sich kurz nach seinem Einzug in Louise Nast verliebt, die Tochter des Klosterverwalters und also die Cousine von Immanuel; diese heimliche Beziehung – die Stelldicheins fanden in einem verborgenen Winkel des Klostergartens statt – dauerte bereits ein Jahr, ehe Hölderlin sie dem Freund gestand. Anfangs hatte er ihm sogar eine handfeste Lüge aufgetischt, als er zwei Monate nach dem Beginn der Liebschaft im Januar 1787 an ihn schrieb: ich bin der einzige – der … kein Frauenzimmer … hier kennt. (MAII, 397) Erst ein Jahr später, im November 1787, ringt er sich zu einem Geständnis durch: Der Freund werde in Bälde von einem lieben Mund erfahren, wo die Quelle all meiner Freuden, all meiner Leiden, all meiner Klagen sei. (MAII, 410)
Ob Immanuel gekränkt war, weil Hölderlin ihm seine Liebschaft so spät erst gestand, wissen wir nicht, da dessen Briefe nicht erhalten sind. Auffällig ist allerdings die überschwängliche und auch ostentative Anteilnahme Hölderlins an einer Liebesgeschichte Nasts, so als hätte er etwas gutzumachen.
Vom Briefwechsel zwischen Hölderlin und der um zwei Jahre älteren Louise sind nur einige wenige Schreiben erhalten geblieben. Nach einem gemeinsamen Spaziergang auf einem der Hügel um Maulbronn schrieb er: Unaussprechlich wohl war mirs, als ich … Deinen Kuß noch auf meinen Lippen fühlte … (18. April 1788; MAII, 421) Sie verabreden, zur selben Stunde in Schillers »Don Carlos« zu lesen. So sei man sich nahe. Er fließe jetzt von Gedichten über, schreibt er. Bei seinen Spaziergängen habe er eine Schreibtafel dabei, auf der er Verse notiert – und wieder löscht. Einige dieser Louise gewidmeten Verse – »An Stella« – hatte er aber doch aufbewahrt. Es zeigt sich ein von Zweifel geplagter Verliebter: Du gute Stella! wähnest du mich beglückt, / Wann ich im Thale still und verlassen, und / Von dir vergessen wandle, wann in / Flüchtigen Freuden dein Leben hinhüpft? (MAI, 41) Ihn quält mithin die Vorstellung, die Geliebte könnte vergnügt sein, ohne dies Glück ihm zu verdanken, später ein Zentralmotiv der unglücklichen Liebe Hyperions zu Diotima. Hier klingt es bereits an, allerdings noch recht undramatisch. Melodramatisch aber geht es zu in einem anderen Gedicht an »Stella«. Todesphantasien werden schwelgerisch ausgesponnen: Stella! ach! wir leiden viel! wann nur das Grab – / Komme! komme kühles Grab! nimm uns beide! (MAI, 19) Louise hat sich die Friedhofsromantik gefallen lassen, wird sich aber gleichwohl später als durchaus lebenstüchtig erweisen. Bei Hölderlins Abschied von Maulbronn dichtet sie: »Gott! wie wechseln doch die Stunden / Jezt mit Freuden dan mit Schmerz / … / Lauert schon das bange scheiden, / Wie ein Dieb auf unser Glük«. (MAII, 416)
Zunächst hoffte sie auf eine deutliche Erklärung des Geliebten, sie wünscht eine Art Verlöbnis zur Überbrückung der Zeit der Trennung, die mit Hölderlins Umzug ins Tübinger Stift nahte. In einem Brief wurde sie für ihre Verhältnisse recht deutlich. Nach einem Stoßgebet – »O Gott lieber Vater an Deiner Hand werden sie doch auch vorüber gehen die Jahre der Trennung« (Neujahr 1789; MAII, 435) – kommt der Wink mit dem Zaunpfahl: »nich lange mehr wird wieder ein Paar aus meiner Freundschaft das Band der ewigen Treue knupfen«. Gegen Ende der Maulbronner Zeit, im Herbst 1788, wurde endlich Hölderlins Mutter eingeweiht, die nichts einzuwenden hatte gegen dieses Mädchen aus gutem Hause. Auch die Nasts gehörten ja zur »Ehrbarkeit«.
Einige Briefe gingen nach dem Abschied noch zwischen Maulbronn und Tübingen hin und her. Noch Ende Januar 1789 schrieb Hölderlin: O lieber Gott! was müssen das für seelige Tage sein, da wir auf ewig vereint so ganz für einander leben.(MAII, 439) Noch eine Weile träumten beide von einer gemeinsamen Zukunft. Für Louise hatten diese Träume einigen Realitätsgehalt, weil sie sich der Zustimmung von Hölderlins Mutter sicher sein konnte: »Wie michs freute daß Deine liebe gute Mutter o darf ich sagen meine Mutter, so gut von unserer Lage sprach, wirst Dirs denken können liebes Herz.« (März/April 1789; MAII, 445) Doch manchmal befielen sie auch Zweifel, dann ging sie auf den Friedhof und weinte so »manche Träne«.
Ihre düsteren Vorahnungen erwiesen sich als berechtigt. Im April 1789 erhielt sie den Brief, mit dem Hölderlin die Beziehung beendete. Er schickte den Ring, den sie getauscht hatten, und einige ihrer Briefe zurück und schrieb dazu: es ist und bleibt mein unerschütterlicher Vorsaz, Dich nicht um Deine Hand zu bitten, bis ich einen Deiner würdigen Stand erlangt habe. (MAII, 446) Gemeint ist damit nicht der bürgerliche Stand, etwa die von der Mutter gewünschte Pfarrstelle. Sein unbefriedigter Ehrgeiz, zu dem er sich bekennt, bezieht sich allein auf sein Dichtertum. Darin gründet sein ganzes Selbstgefühl. Der würdige Stand wäre erst mit dem Dichterruhm erreicht. Falls dieser Ehrgeiz nicht befriedigt würde, könnte er auch mit ihr nicht ganz heiter, ganz froh, u. gesund werden. Er würde ihr mit seinen Klagen über die Welt nur zur Last fallen. Mit starken Worten warnte er sie vor seiner Unleidlichkeit und empfahl ihr, sich nach einem anderen, einem Würdigeren umzuschauen. Sie solle sich durch die Treuegelöbnisse bloß nicht gebunden fühlen. Er möchte jedenfalls nicht schuld daran sein, wenn sie ihre Chancen nicht nutzte. Und dann malt er ihr auch noch die Szene aus, sie an der Seite ihres künftigen Gatten zu sehen – u. euer beider Freund zu sein. (MAII, 446–447)
Die enttäuschte und auch empörte Louise wandte sich an Hölderlins Mutter, die ihrerseits dem Sohn Vorwürfe machte und ihn mit ihrer Traurigkeit, wie üblich, unter Druck setzte. Er verteidigte sich mit dem Argument, es sei doch alles mit Louise abgesprochen gewesen. Weinerlich und zugleich kühl wies er jede Schuld von sich: Und daß ich von einer Person, die mir so teuer war, über meine Veränderung, die sie selbst für nötig einsah, u. die mich tausend Kämpfe kostete, Vorwürfe hören muß, daß ich denken muß, du machst dem Mädchen traurige Tage – O liebe Mamma! so viel hab’ ich doch nicht verdient!! (Frühjahr 1789; MAII, 451)
Der Mutter verschwieg er seinen unbefriedigten literarischen Ehrgeiz, den eigentlichen Grund der Trennung, doch gewiss hatte Louise ihr davon berichtet, und deshalb konnte Hölderlin darauf anspielen, indem er die Welt der Bücher ausdrücklich als das Einzige hervorhebt, was ihn in dieser misslichen Situation trösten kann.
Mit diesem Ehrgeiz ist es ihm so ernst, dass er ihn in seinen Gedichten aus dieser Zeit häufig zum Thema macht: Lebt wohl, ihr güldnen Stunden vergangner Zeit, / Ihr lieben Kinderträume von Größ’ und Ruhm, / Lebt wohl, lebt wol ihr Spielgenossen, / Weint um den Jüngling er ist verachtet! (MAI, 79; Vs. 33–36)
Hölderlin hatte, wie so viele Kinder, einst von abenteuerlichen Heldentaten geträumt. Nun träumte er sich in die Rolle des ruhmreichen, lorbeerbekränzten Dichters hinein. Nicht nur als Tagtraum, sondern wie ein Lebensprogramm ist der poetische Ehrgeiz ausgesprochen in dem Gedicht »Mein Vorsaz«.
O Freunde! Freunde! die ihr so treu mich liebt!
Was trübet meine einsame Blike so?
…
Ists heißer Durst nach Männervollkommenheit?
Ists leises Geizen um Hekatombenlohn?
Ists schwacher Schwung nach Pindars Flug? ists
Kämpfendes Streben nach Klopstoksgröße?
(MAI, 43–44; Vs. 1–2, 9–12)
Solange Pindars Flug und Klopstoksgröße noch nicht erreicht sind, ist ihm das Leben eine Qual, und er kann den Freunden nur bedrückt unter die Augen treten. Erst mit dem gelungenen Gedicht kommt er richtig zur Welt.
Hier klingt ein Motiv an, das in einem späteren Gedicht, »An die Parzen«, sich wundervoll entfaltet:
Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,
Daß williger mein Herz, vom süßen
Spiele gesättiget, dann mir sterbe.
Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht
Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht;
Doch ist mir einst das Heil’ge, das am
Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen,
Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel
Mich nicht hinab geleitet; Einmal
Lebt ich, wie Götter und mehr bedarfs nicht.
(MAI, 188)
Der junge Hölderlin ließ sich, sosehr ihn der Sturm und Drang animierte, doch nicht für dessen wilden Stil gewinnen, er nahm sich vielmehr Klopstock und vor allem Pindar zum Vorbild, den antiken Dichter der Hymnen und Preisgesänge im hohen Stil. Nicht das Expressive und Subjektive, sondern das Erhabene und Objektive zog ihn an. Mit dem Ausdruck Pindars Flug bedient sich Hölderlin eines überlieferten metaphorischen Topos für dessen olympische Höhenlage. Klopstock verkörperte für ihn den Typus des Dichter-Priesters, des Erfinders neuer Psalmen, die neben den alten würdig bestehen können. Für den jungen Hölderlin geht es bei seinem Dichten nicht darum, seelische Unterwelten in sich selbst zu erkunden, sondern sich aufzuschwingen in eine Welt des erhabenen, überpersönlichen Geistes. Das bloß Private ist ihm zu eng. Der junge Poet, der noch im Verborgenen fleißig seine Kladden vollschreibt, imaginiert eine öffentliche Sphäre, wo es um die großen Themen des Menschlichen und Göttlichen geht, rhetorisch ausgeklügelt und im Ornat strenger poetischer Formen, die anknüpfen eben an Pindar und an die von Klopstock wiederbelebte Oden- und Hymnentradition.
Bemerkenswerte poetische Fertigkeiten hatte sich Hölderlin inzwischen angeeignet, er beherrschte komplizierte Reimfolgen, Versmaße, Strophenformen. Auch hier das Strenge, die Hinwendung zum Objektiven, Überpersönlichen. Die Sprache soll nicht einfach leicht und widerstandslos aus subjektivem Befinden herausströmen, sie soll sich brechen am Widerstand verbindlicher Formen. Ausdruck genügt nicht, auf Steigerung kommt es an. Das nimmt der junge Hölderlin von Klopstock auf. »Bey dem Gesange kommen wir außer uns«, las Hölderlin bei Klopstock, »bey dem Liede zerfließen wir in froher Wehmut.« Das Zerfließenwollen entspricht zwar bisweilen seiner Stimmung, doch nicht seinem Bild vom Dichter. Der soll sich vor Weichlichkeit hüten, der soll Mann sein. Deshalb zieht der junge Hölderlin im Sinne Klopstocks den »Gesang« dem »Liede« vor. Im Gesange aber, so Klopstock, gehört es für den Dichter zu den »Hauptpflichten, daß er schnell von einem großen Gedanken zum andern forteile. Er fliegt von Gebirge zu Gebirge, und läßt die Thäler, wie schön und blumenvoll sie auch seyn möchten, unberührt liegen.« (Zit. n. Gaier, 25)
Ganz unberührt bleiben bei Hölderlin diese »Thäler« nicht, er lässt sich zu ihnen herab, kostet ihre Schönheit wenigstens für Augenblicke aus, dann zieht ihn wieder das Höhere an: O ihr seid schön, ihr herrliche Schöpfungen! / Geschmükt mit Perlen blizet das Blumenfeld; / Doch schöner ist des Menschen Seele, / Wenn sie von euch sich zu Gott erhebet. (MAI, 27; Vs. 17–20)
Der junge Hölderlin fühlte gewiss eine Berufung zum Dichter, doch ob er daraus auch einen Beruf machen könne, fragte er sich und wenig später bei einem Besuch den berühmten Schubart, den württembergischen Freiheitsdichter und Märtyrer der engagierten Poesie, den der Herzog zehn Jahre lang eingekerkert hatte. Bei dieser Frage erkundigte sich Schubart nach den Vermögensverhältnissen und den Einkünften Hölderlins. Von der Poesie könne man nicht leben, man müsse für sie leben, erklärte er dem jungen Poeten, der einigermaßen eingeschüchtert vor ihm stand. Er empfahl, die Pfarrstelle nicht zu scheuen, denn sie würde ihm ein gesichertes Einkommen verschaffen und ihm erlauben, nebenher zu dichten. Schubart sah kein Problem darin, aber Hölderlin. Konnte er wirklich Pfarrer werden, wenn der Gott der protestantischen Kirche, dem er dienen sollte, nicht mehr der seine war? Es kamen ihm große Zweifel.
In den Osterferien 1787 wird er der Mutter zum ersten Mal seinen Widerwillen gegen den Pfarrerberuf gestanden haben, denn im April, wieder zurück in Maulbronn, schrieb er ihr, sie brauche sich keine Sorgen mehr zu machen, er habe sich anders besonnen und sie könne nun sicher sein, daß mir nie mehr der Gedanke kommen wird aus meinem Stand zu treten – Ich sehe jezt! man kan als Dorfpfarrer der Welt so nüzlich, man kann noch glüklicher sein, als wenn man, weis nicht was? wäre. (MAII, 404f.)
Er blieb in der Spur und wechselte ein Jahr später ins Tübinger Stift. Die feierliche Promotion fand am 21. Oktober 1788 statt. Zuvor aber, während der letzten Sommerferien, sammelte er die lyrische Ernte seiner Klosterschuljahre und fertigte von den Gedichten, die vor seinem Urteil bestehen konnten, Reinschriften an. Dieses Manuskriptheft wird ihn von nun an begleiten und ihn daran erinnern, dass der Dorfpfarrer wohl doch nicht das Ziel seiner Wünsche und seines Ehrgeizes ist.
DRITTES KAPITEL
Tübinger Stift. Lust zu lernen. Hölderlin studiert Kant und Spinoza. Die Vernunft und die Gründe des Herzens. Religion der Liebe. Der Freundesbund und das »Reich Gottes«. Hegel. Schelling. Revolutionärer Enthusiasmus im Stift. Der »Genius der Kühnheit«.
Am 1. Oktober 1788