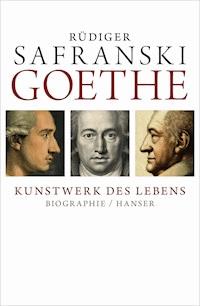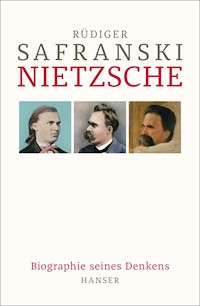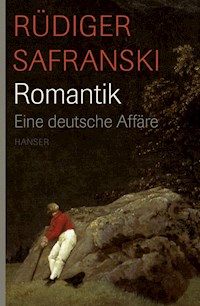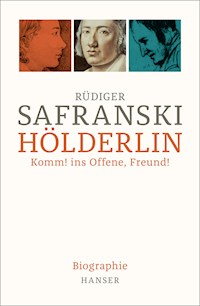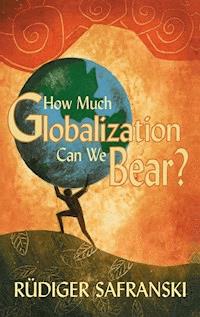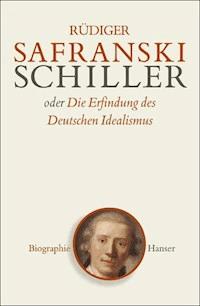
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Friedrich Schiller: Jugendliches Genie, Revolutionär, Dichter. Rüdiger Safranski entstaubt in seiner großen Schiller-Biographie eine der schwungvollsten Gestalten unserer Literatur. Friedrich Schiller läutete mit seinem Enthusiasmus die Epoche der deutschen Geistesgeschichte ein, die man später den "Deutschen Idealismus" genannt hat. Mit diesem großen Buch über Schillers Leben und Denken könnte seine Renaissance beginnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 999
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser eBook
Auch das Schöne muß sterben! Das Menschen und Götter bezwinget,Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus.
Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher,Und an der Schwelle noch, streng, rief er zurück sein Geschenk.
Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Wunde,Die in den zierlichen Leib grausam der Eber geritzt.
Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter,Wann er, am skäischen Tor fallend, sein Schicksal erfüllt.
Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töchtern des Nereus,Und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn.
Siehe! Da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle,Daß das Schöne vergeht, daß das Vollkommene stirbt.
Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten, ist herrlich,Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.
Rüdiger Safranski
Friedrich Schiller
oderDie Erfindung desDeutschen Idealismus
Carl Hanser Verlag
ISBN 3-446-24202-9
Alle Rechte vorbehalten
© 2004/2012 Carl Hanser Verlag München Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Inhaltsübersicht
Prolog
Erstes Kapitel
Herkommen. Der sagenhafte Vetter. Abenteuer des Vaters. Die Idylle von Lorch. Der Stock. Den Vater achten und überbieten. Der Mutter Leid. Rokoko in Ludwigsburg. Lebensgaloppade des Herzogs. »Bist du närrisch geworden, Fritz?«
Zweites Kapitel
Väterliche und mütterliche Frömmigkeit. Der kleine Prediger. Karlsschule. Der Herzog erzieht. Der Knabe und die Macht. Scharffenstein: der ideale und der wirkliche Freund. Klopstock. Schillers erste Gedichte: Lesefrüchte. Den Träumen der Jugend treu.
Drittes Kapitel
Das Jahr 1776. Veränderungen des Ortes und der Zeit. Der Geist des Sturm und Drang. Herder und die Folgen. Eine Jahresfeier an der Karlsschule. Die große Ermunterung: Abels Rede über das Genie. Shakespeare lesen.
Viertes Kapitel
Popularphilosophie. Die anthropologische Wende. Die Karriere des Empirismus. Im »Audienzsaal des Geistes« das Leben zur Sprache bringen: Shaftesbury, Rousseau, Herder. Schiller zwischen den Fronten. Schiller lernt bei Ferguson und Garve: »Das Haupt ist nicht geöffnet worden«.
Fünftes Kapitel
Entscheidung für die Medizin. Über den Grenzverkehr zwischen Körper und Seele. Schillers Dissertationen. Das kosmische Mandat der Liebe. Die »große Kette der Wesen«. Rätselhafter Übergang von Materie in Geist. Neurophysiologische Irrgänge. Wie frei ist das Gehirn? Der Lichtstrahl der Aufmerksamkeit. Trübe Stimmungen. Affäre Grammont. Streicher sieht Schiller.
Sechstes Kapitel
Schillers Rückblick auf die »Räuber«-Zeit. Schubart der Märtyrer. Empörung und Erfahrungsarmut. Räuberwelten und »Die Räuber«: Experimentalanordnung für philosophische Ideen und extreme Charaktere. Ideen-Theater und Affekterregungskunst. Auch die Schönheit muß sterben. Glückliche Augenblicke unter dem Theaterhimmel.
Siebtes Kapitel
Als Militärarzt in Stuttgart. Verzweifelte Kraftmeierei. Die poetische und die wirkliche Laura. Schwäbische Literaturfehde. Aufführung der »Räuber«. Stuttgarter Misere. Flucht nach Mannheim.
Achtes Kapitel
Mannheim. Das neue Leben. Ermutigung zum Mut. Mißlungene Lesung des »Fiesko«. Enthusiasmus und Kälte. Entstehung des Stückes. Maskenspiele der Verschwörung. Offenes Ende. Unvorhersehbarkeit der Freiheit. Flucht aus Mannheim. Verzweiflung in Frankfurt. Oggersheim. Streicher spielt Klavier. Auf dem Weg nach Bauerbach.
Neuntes Kapitel
Freundschaft mit Reinwald. Vexierbriefe. Werben um Charlotte von Wolzogen. Rückruf nach Mannheim. »Kabale und Liebe«. Die Liebesphilosophie auf dem Prüfstand. Die soziale Maschine des Bösen.
Zehntes Kapitel
Zurück nach Mannheim. Kabale am Theater. Politische Verdächtigung. Die Kündigung. Der gekündigte Theaterautor kämpft für die Gerichtsbarkeit der Bühne. Der »unglückliche Hang zum Vergrößern«. Schuldenmisere. Der Brief aus Leipzig. Vorgefühl der großen Freundschaft. Charlotte von Kalb.
Elftes Kapitel
Nach Leipzig. Körner. Huber. »Rheinische Thalia«. Enthusiasmus der Freundschaft. »Seid umschlungen...«. Der philosophische Briefroman. Noch einmal die Philosophie der Liebe. Kälteschock des Materialismus. Der Enthusiasmus lernt Realismus. Sich neu gebären.
Zwölftes Kapitel
Entstehung des »Don Karlos«. Handlungshemmung und Menschheitspathos. Die Karriere des Marquis Posa. Zögern vor dem großen Auftritt. Wechsel zum Roman »Der Geisterseher«. Von der Verschwörung von Links zur Verschwörung von Rechts. Verschwörer, Geheimbünde und Charismatiker. Der Marquis Posa und die Dialektik der Aufklärung.
Dreizehntes Kapitel
Angebot aus Hamburg. Liebeskomödie. Abschied von den Freunden. Weimar: die berühmte Schneckenhauswelt. Die Weimarer Götter. Wieland, Herder und die anderen. Zum ersten Mal Kant. »Der Abfall der Niederlande«. Warum Geschichte?
Vierzehntes Kapitel
Die Anfechtungen eines Künstlers. Risiken der Einbildungskraft. Selbstermunterung. Der Traum der Antike. »Die Götter Griechenlandes«. Das wiedergewonnene Selbstbewußtsein: »Die Künstler«. Der verliebte Sommer in Rudolstadt. Die Schwestern Charlotte und Karoline. Vorspiel mit Goethe.
Fünfzehntes Kapitel
Jena. Die Stadt und ihr Geist. Burschenherrlichkeiten. Der große Auftritt: die Antrittsvorlesung. Optimistische Geschichtsphilosophie und ihr Widerruf im »Geisterseher«. Teleologie als ob. Versiegelte Botschaften. »Die Sendung Moses«. Die Erfindung des Monotheismus. Das Nichts hinter dem »Verschleierten Bild zu Sais«. Nach der Entzauberung: die ästhetische Religion.
Sechzehntes Kapitel
Revolution als gegenwärtiger Mythos. Schillers Vorsicht. »Ob die späte Vernunft die frühe Freiheit noch findet?« In der Haselnußschale auf dem Menschenozean. Völkerfrühling und Liebesfrühling. Verlobung. Heirat. Überfluß von Ideen. Die eifersüchtige Charlotte von Kalb. Wie aktuell ist der »Dreißigjährige Krieg«? Schiller: der deutsche Plutarch. Hochgefühle. Zusammenbruch. Todesnähe. Auferstehung.
Siebzehntes Kapitel
Leben mit der Krankheit. Entscheidung für Kunst und Kant. Die »Revolution der Denkungsart«. Über Kant hinaus. »Kallias«-Briefe. »Schönheit ist Freiheit in der Erscheinung«. Das ästhetische Fest der Freiheit. Die Schrecken der Revolution. Mainzer Republik. Forster. Hubers Verwicklungen. Das Ethos des Dichters. »Anmut und Würde«. Kant korrigieren. Die schöne Seele. Goethes Ärger über »gewisse Stellen«.
Achtzehntes Kapitel
Das Erhabene und die Krankheit. Die Reise nach Schwaben. Der erste Besuch Hölderlins. Der alte Herodes stirbt. Danneckers Büste. Pläne mit Cotta. Rückkehr nach Jena. Fichtes Revolution. Die neue Lust, ein Ich zu sein. Schicksale des Ichs. Jenaer Romantik. Goethe und Schiller nähern sich einander.
Neunzehntes Kapitel
Goethe und Schiller: »Glückliches Ereignis«. Schmelzende und energische Schönheit. »Über die ästhetische Erziehung des Menschen«. Was auf dem Spiel steht. Goethe und Schiller, naiv und sentimentalisch. Der Kentaur.
Zwanzigstes Kapitel
»Horen«-Auftritt. Ärger mit den Schlegels. Romantische Opposition. Revierkämpfe mit Fichte. Hölderlins Liebe und Schmerz. Leitmedium Literatur. Die streitlustigen Dioskuren. Die »Xenien«. Ans Werk.
Einundzwanzigstes Kapitel
Angst vor Wallenstein. Aufschub. Mitwirken an Goethes »Wilhelm Meister«. Warum es dem Vortrefflichen gegenüber keine Freiheit gibt als die Liebe. Lob der Undeutlichkeit. Warum nur die Philosophie das Philosophieren unschädlich machen kann. Wallenstein und der dreifache Wille zur Macht. Machtmensch und Möglichkeitsmensch. Rituale der Freundschaft: Goethe, Humboldt. Abschied von Jena.
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Rückkehr nach Weimar. Theaterleben. Männerphantasien über schöne Seelen: Maria Stuart oder die schuldige Unschuld. Schillers Glaube. Johanna von Orleans Magie und der große Magnetiseur Napoleon. Volkstümliches, Romantisches. Der Sturz aus der Begeisterung. Die Braut von Messina oder das antike Schicksal. Ans Publikum denken.
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Der Tell-Stoff. Wie Goethe ihn an Schiller abtritt. Schillers Kulturpatriotismus. »Deutsche Größe«. Lob der Langsamkeit. »Wilhelm Tell«, das Festspiel der Freiheit. Aus der bedrohten Idylle in die Geschichte und wieder zurück. Konservative Revolution. Tyrannenmord. Brutus oder der heilige Drachentöter. Volkstümlichkeit. Kotzebue oder die vorweggenommene Satire auf die Schillerfeiern.
Vierundzwanzigstes Kapitel
Schillers Adel. Fernweh. Wenn die Freiheit Segel setzt. Die raumgreifende Madame de Staël. Reise nach Berlin. Aus aufgegebenen Werken. Weltumrundung. Demetrius. Die Macht aus dem Nichts. Das Hochstaplermotiv. Schillers Felix Krull. Das Betriebsgeheimnis der Kunst. Das Ende.
Zeittafel
Literatur
Nachweis der Zitate
Register der Werke Schillers
Personenregister
Für Gisela Maria Nicklaus,
die sich dieses Buch gewünscht hat
Prolog
Nach Schillers Tod am 9. Mai 1805 wurde die Leiche obduziert. Man fand die Lunge »brandig, breiartig1 und ganz desorganisiert«, das Herz »ohne Muskelsubstanz«, die Gallenblase und die Milz unnatürlich vergrößert, die Nieren »in ihrer Substanz aufgelöst und völlig verwachsen«. Doktor Huschke, der Leibmedicus des Weimarer Herzogs, fügte dem Obduktionsbefund den lapidaren Satz hinzu: »Bei diesen Umständen muß man sich wundern, wie der arme Mann so lange hat leben können«. Hatte nicht Schiller selbst davon gesprochen, daß es der Geist sei, der sich seinen Körper baut? Ihm war das offenbar gelungen. Sein schöpferischer Enthusiasmus hielt ihn am Leben über das Verfallsdatum des Körpers hinaus. Heinrich Voß, Schillers Sterbebegleiter, notierte: »Nur bei seinem2 unendlichen Geiste wird es erklärbar, wie er so lange leben konnte«.
Aus dem Obduktionsbefund läßt sich die erste Definition von Schillers Idealismus ablesen: Idealismus ist, wenn man mit der Kraft der Begeisterung länger lebt, als es der Körper erlaubt. Es ist der Triumph eines erleuchteten, eines hellen Willens.
Bei Schiller war der Wille das Organ der Freiheit. Die Frage, ob es einen freien Willen geben könne, beantwortete er eindeutig: Wie sollte er nicht frei sein dieser Wille, da jeder Augenblick einen Horizont von ergreifbaren Möglichkeiten eröffnet. Man hat zwar stets begrenzte aber unerschöpfliche Möglichkeiten vor sich. Insofern ist Freiheit offene Zeit.
Doch es geht nicht nur um die Wahl zwischen Möglichkeiten, noch entscheidender ist der schöpferische Aspekt der Freiheit. Man kann auf Dinge, Menschen und auf sich selbst einwirken nach Maßgabe von Ideen, Absichten, Konzepten. Die schöpferische Freiheit bringt etwas in die Welt, das es ohne sie nicht geben würde, sie ist immer auch eine creatio ex nihilo. Sie ist auch die Kraft der Vernichtung, ebenso kann sie den üblen Wirkungen widerstehen, zum Beispiel den Schmerzattacken des Körpers. Schiller hatte ein kombattantes Verhältnis zur Natur, auch der eigenen. Der Körper ist dein Attentäter! Darum erklärte Schiller, daß wir unsern physischen Zustand, der durch die Natur bestimmt werden kann, gar nicht zu unserm Selbst rechnen, sondern als etwas Auswärtiges und Fremdes (V, 502) zu betrachten hätten.
Damit konnte sich sein großer Antipode und Freund Goethe nicht anfreunden. Er nannte das Schillers »Evangelium3 der Freiheit« und meinte, er seinerseits »wollte die Rechte der Natur nicht verkürzt wissen«.
Das wiederum erschien Schiller abwegig. Ihm war die Natur mächtig genug, sie braucht keinen Beistand; beistehen sollte man den bedrohten Rechten des Geistes und die Macht der Freiheit sichern. Das Abenteuer der Freiheit war Schillers Leidenschaft, und deshalb wurde er zu einem Sartre des späten 18. Jahrhunderts. Schillers Idealismus besteht in der Überzeugung, daß es möglich ist, die Dinge zu beherrschen statt sich von ihnen beherrschen zu lassen. Wie Sartre erklärt er: es kommt darauf an, etwas aus dem zu machen, wozu man gemacht wurde.
Die ihn näher kannten, berichten übereinstimmend, daß Schiller fast immer angespannt, tätig, konzentriert gewesen sei, neugierig und hellwach bis zum Mißtrauen. »Das Wirkliche4«, erzählt seine Frau Charlotte, »machte einen ängstlichen Eindruck auf ihn«. Anders als Goethe besaß Schiller kein ruhiges und gelassenes Weltvertrauen. Er fühlte sich von keiner gnädigen Natur getragen. Alles muß man selbst machen! So wurde er zu einem Athleten des Willens, im Leben und im Werk.
Am Anfang die Misere? So schlecht aber geht es ihm nicht. Eine liebevolle Mutter, ein zumeist abwesender Vater. Kleinbürgerliche, nicht elende Verhältnisse. Die Welt der Kindheit ist fast idyllisch. Dann aber gerät er an der Karlsschule in die Gewalt eines oft tyrannischen Herzogs. Den wirklichen Vater liebt er, den Landesherrn aber, der wie ein Vater ihn bis in den Schlafsaal verfolgt, fürchtet er – bis er gegen ihn rebelliert. Ein häufig krankes Kind, zu schnell gewachsen, pickelig, steif, unbeholfen. Seinen Körper bewohnt er nicht. In der Schuluniform sieht er aus wie eine Vogelscheuche. Das Äußere, in dem er steckt, mag er nicht. Es regt sich etwas in ihm und stößt überall an. Er fühlt sich ins Dasein geworfen, er antwortet mit Entwürfen, immer hat er irgendwelche Projekte, nur so läßt sich das Leben ertragen. Oft ist er gehemmt, seine Bewegungen stocken, dann plötzlich löst er sich und redet, schnell, unabsehbar, überfließend. Wer ihm zuhört, weiß bald nicht mehr, wo ihm der Kopf steht.
Schillers Enthusiasmus erwächst aus dem Lebensekel, den es immer wieder zu überwinden gilt und dem er in seinen »Räubern« kraftvollen Ausdruck geben wird. In diesem genialischen Stück, das wie ein Naturereignis in die deutsche Theaterlandschaft einbricht, verfolgt Schiller die Spur zum Ursprung des Bösen: er entdeckt den Skandal der Sinnlosigkeit und Ungerechtigkeit einer Natur, die den einen bevorzugt, den anderen benachteiligt. Man ist in schlimme Zufälle verwickelt, es gibt gute Gründe, dem Leben zu mißtrauen. So könnte ein giftiges Ressentiment entstehen. Dem schöpferischen Leben zuliebe kämpft Schiller dagegen an. Sein Enthusiasmus für die Freiheit hat deshalb auch die Bedeutung einer selbstverordneten Entgiftungskur. Schiller wird sie besonders nötig haben in der Begegnung mit Goethe. Die Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft mit Goethe – ein Glücksfall und Glanzpunkt der deutschen Kulturgeschichte – war nur möglich, weil Schiller sich zu der Einsicht durchrang, daß es dem Vortrefflichen gegenüber keine Freiheit gibt als die Liebe (an Goethe, 2. Juli 1796).
Schiller hat ohne Scheu vor dem Kurzschluß zwischen Person und Menschheit die Liebe zur Weltmacht erklärt. Als junger Mann entwickelte er eine Philosophie der Liebe, die das altehrwürdige kosmophile Thema von der ›Großen Kette der Wesen‹ fortschreibt. Schiller war ein Meister der Autosuggestion, er konnte sich selbst steigern und hineinsteigern in dieses: Seid umschlungen, Millionen... (I, 133). Doch konnte er sich auch wieder herunterkühlen bis zur nihilistischen Schreckensstarre. Er kannte den Abgrund von Sinnlosigkeit, weshalb in seinen Visionen der Menschheitsverbrüderung immer auch ein protestantisches ›Trotz alledem‹ zu spüren ist. Es gibt die Schillersche Wette: das wollen wir doch einmal sehen, wer wen über den Tisch zieht, der Geist den Körper oder der Körper den Geist!
Schiller wird beweisen wollen, daß es nicht nur ein Schicksal gibt, das man erleidet, sondern auch eines, das man selbst ist. Es konnte ihm nicht entgehen, daß die eigene Schicksalsmächtigkeit anziehend und ansteckend wirkt. Daher seine Begabung für die Freundschaft, daher sein Charisma. Sogar Goethe ließ sich von Schillers Enthusiasmus mitreißen. Schließlich hat Schiller eine ganze Epoche in Schwung gebracht. Diese Beschwingtheit und was daraus wurde, besonders auf dem Felde der Philosophie, hat man später »Deutscher Idealismus« genannt, und Beethoven hat sie in Töne gesetzt: Freude, schöner Götterfunken... (I, 133).
Zu schildern ist, wie Schiller an sich selbst gearbeitet hat, ein Leben als Drama und Inszenierung. Als er berühmt war, wurde er zur öffentlichen Seele. Seine Krisen, Umwandlungen und Verwandlungen geschahen vor den Augen eines Publikums, das bewundernd und staunend diesem Lebenstheater zusah. Goethe hat später die Proteus-Natur seines Freundes geradezu verklärt: »Er war5 ein wunderlicher großer Mensch. Alle acht Tage war er ein anderer und ein vollendeterer«.
Schillers Werke sind die Spielformen dieser Lebensarbeit. Er hielt sich an den von ihm formulierten Grundsatz: der Mensch ist... nur da ganz Mensch, wo er spielt (V, 618). Das Spiel der Kunst ist die Epiphanie der Freiheit. Wie Nietzsche hätte auch Schiller sagen können: wir haben die Kunst, damit wir am Leben nicht zugrunde gehen.
Aus der Perspektive Schillers gewinnt der Idealismus wieder Glanz. Idealismus – daran ist nichts Veraltetes, wenn man ihn so versteht, wie ihn Schiller verstanden hat: der Freiheit eine Gasse; der Geist, der sich den Körper baut. So war Schiller auch ein großer Anreger der Philosophie am Ende des 18. Jahrhunderts. Er ist maßgeblich beteiligt an den epochalen philosophischen Ereignissen zwischen Kant und Hegel. Es wird davon zu erzählen sein, wie Schiller mitwirkte bei der Erfindung des Deutschen Idealismus; wie er zusammen mit Goethe zum Zentralgestirn des deutschen Geisteslebens werden konnte. Schiller – ein Kraftwerk der Anregungen auch für seine Gegner. Die Romantiker haben die Abgrenzung von ihm gebraucht, um sich selbst zu finden. Indem sie von ihm loskommen wollen, werden sie ihn nicht los.
So kommt es zur großen Oper des Geistes: in einem historischen Augenblick beispielloser schöpferischer Dichte stehen sie alle auf derselben Bühne, Goethe, Herder, Wieland, Moritz, Novalis, Hölderlin, Schelling, die Schlegels, Fichte, Hegel, Tieck – in ihrer Mitte Schiller, der Meister des Glasperlenspiels.
Schiller hat Epoche gemacht und deshalb gelangt man auf seiner Spur in die Biographie der Epoche von Klassik und Romantik. Im Hintergrund das politische Drama, das mit der Französischen Revolution beginnt.
Die Deutschen, sagte Heinrich Heine einmal, hätten nur im »Luftreich des Traumes« ihre Revolution gemacht.
Vielleicht war der Idealismus ein Traum. Und die wirkliche Revolution? Vielleicht war sie ein schlechter Traum. Schiller, als er mit fünf Jahren Verspätung 1798 das Diplom der französischen Ehrenbürgerschaft in die Hände bekam mit den Unterschriften von Danton und all den anderen, die schon längst enthauptet waren, verständigte sich mit Goethe auf die Formel, man habe ihm ein Bürgerrecht zugesandt »aus dem Reiche der Toten« (3. März 1798).
Mit Schiller gelangt man in das andere Schattenreich der Vergangenheit: in das unvergeßliche goldene Zeitalter des deutschen Geistes. Es sind Wunderjahre, die einem helfen, den Sinn für die wirklich wichtigen, für die geistvollen Dinge des Lebens zu bewahren.
Erstes Kapitel
Herkommen. Der sagenhafte Vetter. Abenteuer des Vaters. Die Idylle von Lorch. Der Stock. Den Vater achten und überbieten. Der Mutter Leid. Rokoko in Ludwigsburg. Lebensgaloppade des Herzogs. »Bist du närrisch geworden, Fritz?«
Fast wäre Friedrich Schiller, der Dichter des »Wallenstein«, in einem Militärlager geboren.
Das württembergische Heer, wo der Vater Johann Kaspar Schiller als Leutnant diente, war in Ludwigsburg zusammengezogen zur Vorbereitung auf die »Hessische Kampagne«, eine Militäraktion des Siebenjährigen Krieges. Die Truppen des württembergischen Herzogs kämpften damals auf der Seite Frankreichs und zum Ärger der protestantischen Schwaben gegen Preußen, die Schutzmacht des Protestantismus.
Die Mutter wohnte mit ihrer ersten Tochter im elterlichen Haus in Marbach, von wo aus sie ihren Mann im nahen Ludwigsburg häufig besuchen konnte. Sie hielt sich gerade bei ihm im Feldlager auf, als die ersten Wehen einsetzten. Man brachte sie eilends nach Marbach zurück, wo sie am 10. November 1759 ihr zweites Kind zur Welt brachte. Es wird getauft auf den Namen Johann Christoph Friedrich.
In der Familie des Vaters gab es einen Johann Friedrich, der als Vorbild galt, denn dieser »Vetter« war ein studierter und weltläufiger Mann, der auch Bücher schrieb und übersetzte, ein umtriebiger Projektemacher und Bonvivant, der laut Familiengerücht sogar »Regierungen« beriet. So soll er dem Herzog Karl Eugen empfohlen haben, alle überflüssigen Kirchenglocken zu Kanonen umschmelzen zu lassen. Er kannte sich in der Kameralistik und Pädagogik aus und schmiedete Pläne, wie der Wohlstand des Volkes gemehrt und überhaupt die Leiden der Menschheit abgeschafft werden könnten. Das Ansehen des »Vetters« in der Familie sank allerdings, als es ihm später mißlang, für sein eigenes Wohlergehen hinreichend zu sorgen. Nach seiner Rückkehr aus England, wo er bei den Rosenkreuzern Alchemie betrieben haben soll, gründete er in Mainz ein Verlagsgeschäft, das respektable Bücher über Moralphilosophie und Ökonomie herausbrachte. Doch das Publikum zeigte wenig Interesse, und so blieb der umtriebige Mann auf seinen Verlagsartikeln sitzen. Er kam ins Schuldengefängnis, seine wenigen Besitztümer wurden versteigert. Er verdingte sich als Sprachmeister und verschwand in den achtziger Jahren aus dem Gesichtskreis der Familie. Friedrich Schiller aber blieb neugierig auf diesen »Vetter«, den er nur aus Erzählungen kannte. Im Juli 1783 wollte er ihn besuchen. Er tat es dann doch nicht. Vielleicht wollte er sich eine Enttäuschung ersparen.
Man hatte Friedrich einen Tag nach der Geburt eilig getauft, denn das Kind war so schwächlich, daß man fürchtete, es würde nicht überleben. Trotzdem wurde einiger Aufwand getrieben, es soll zugegangen sein wie bei einer Hochzeit. Die Liste der Taufpaten zeugt vom Ansehen der Familie. Neben jenem ominösen »Vetter« werden genannt: der Regimentskommandeur des Vaters, Oberst von der Gabelentz; die Bürgermeister von Marbach und vom Nachbarort Vaihingen und, zum allseitigen Erstaunen, der berühmte und berüchtigte Oberst Rieger. Dieser landesweit gefürchtete Mann war dem Vater offenbar sehr zugetan.
Oberst Rieger war ein enger Berater des Herzogs, dem er sich unentbehrlich gemacht hatte, weil er es verstand, mit brutalen Rekrutierungsmethoden eine Armee von sechstausend Mann aus dem Boden zu stampfen. Rieger hatte unbegrenzte Vollmacht zur Zwangsaushebung erhalten, und unter seinem Kommando kam es während des Jahres 1757 zu drei groß angelegten Menschenjagden. Eingefangen wurden Bauern, kleine Handwerker und Tagelöhner. Die dabei angewandten Methoden hatte Rieger von den preußischen Werbeoffizieren gelernt. Man griff die Männer in den Wirtshäusern auf, bei Kirchweihen und sonstigen Tanzvergnügungen, wenn sie schon betrunken waren, und sperrte sie so lange ohne Nahrung ein, bis sie ›freiwillig‹ das Handgeld nahmen und sich anwerben ließen. Die so zum Dienst gepreßten Truppen erwiesen sich allerdings als wenig tauglich. Die erste Kriegstat von 1757, mit der das württembergische Heer Aufsehen erregte, war eine Massendesertion. Daraufhin wurde eine »Fahnenflüchtigen-Fangverordnung« erlassen, die von den Kanzeln herab verlesen werden mußte und jedem, der einen Deserteur denunzierte, eine Prämie von achtzehn Gulden versprach. Das Kopfgeld führte zu einem wahren Jagdfieber, das der Oberst Rieger geschickt in organisierte Bahnen lenkte. Wurde ein Verdächtiger benannt, riefen die Glocken zur Treibjagd, Wege wurden versperrt, Brücken besetzt und man stocherte in Heuschobern nach den Fahnenflüchtigen. So erwarb sich Rieger den Ruf des Menschenschinders, Kopfgeldjägers und Sklavenhändlers. Zum Zeitpunkt von Schillers Geburt befand sich der Taufpate Rieger auf dem Höhepunkt seiner Macht. Drei Jahre später aber erfolgt sein Sturz. Schiller wird davon erzählen in »Spiel des Schicksals« – eine Reminiszenz an die württembergische Tyrannenwelt, der er inzwischen glücklich entronnen ist. Es ist eine Geschichte, die sich ein rebellischer Kopf des »Sturm und Drang« nicht besser hätte ausdenken können.
Der Sturz des Oberst Rieger wurde veranlaßt durch seine Neider bei Hofe. Am einflußreichsten war der Graf Montmartin, der Leiter des herzoglichen Kabinetts, der mit Hilfe gefälschter Briefe Rieger als angeblichen Verschwörer bloßstellte. Der Oberst wurde verhaftet, als er mit gewohntem Prunk, von Höflingen und Ordonnanzen umringt, eine Wachparade abnahm. Danach wurde er ohne Prozeß vier Jahre auf dem Hohentwiel eingekerkert. Nach der Freilassung ging er außer Landes und kehrte nach sechs Jahren wieder in die Heimat zurück. Der Herzog nahm ihn gnädig auf und machte ihn zum Kommandanten des Gefängnisses auf dem Hohenasperg. So bekam der ehemalige Häftling die Aufsicht über einen anderen berühmten Häftling, den Dichter und Publizisten Christian Friedrich Schubart, der auch ohne Prozeß eingekerkert worden war, weil er die herzögliche Willkürherrschaft angeprangert hatte. Rieger verschaffte 1781 seinem Patensohn Schiller, der Schubart bewunderte, eine Gelegenheit, den Häftling zu besuchen. Fortan sah Schiller den Oberst in milderem Licht. Als Rieger ein Jahr später an einem Schlaganfall starb, aus Erregung über die Gegenwehr eines Soldaten, den er mißhandelt hatte, verfaßt Schiller ein Gedicht für die Totenfeier: Höher als das Lächeln deines Fürsten / (Ach! wornach so manche geizig dürsten!) / Höher war dir der, der ewig ist (I, 114). An die Geschichte dieses Mannes wurde Schiller wieder erinnert beim Besuch von Schubarts Sohn im Dezember 1788 in Weimar. Danach schrieb er jene Erzählung über das »Spiel des Schicksals«.
Schillers Vater, von seinen Vorgesetzten geachtet, war darum doch kein untertäniger Charakter. Mit unbändiger Energie und praktischem Sinn hatte er sich emporgearbeitet. Da er das meiste sich selbst zu verdanken hatte, war er stolz auf seine Lebensleistung. Er blieb lernbegierig, war beweglich und doch prinzipienfest. Er hatte es nicht leicht, und doch erschien ihm die Welt wohlgeordnet und gerecht eingerichtet. Er glaubte an einen Gott, der für die Menschen sorgt, wenn sie den Mut haben, für sich selbst zu sorgen. Der Herr im Himmel, die Fürsten in der Welt und die Väter im Haus – das war die natürliche Ordnung der Dinge, die ihm festgegründet schien, aber nicht starr, denn dem Tüchtigen war der individuelle Aufstieg möglich. Er selbst empfand sich als lebenden Beweis dafür.
Friedrich Schiller äußerte einmal die Überzeugung, daß sein Vater, der es bis zum Hauptmann und Aufseher aller Park- und Gartenanlagen Württembergs gebracht hatte, noch höher hätte steigen können. Der Vater selbst war mit dem Erreichten zufrieden, zumal er in den späteren Jahren auch noch stolz sein durfte auf den Ruhm seines Sohnes. Kurz vor seinem Tod verfaßte er eine Art Dankgebet, worin es heißt: »Und du6, Wesen aller Wesen, dich hab’ ich nach der Geburt meines einzigen Sohnes gebeten, daß du demselben an Geistesstärke zulegen möchtest, was ich aus Mangel an Unterricht nicht erreichen konnte, und du hast mich erhört. Dank dir, gütigstes Wesen, daß du auf die Bitten der Sterblichen achtest.«
Der Vater Johann Kaspar, 1723 geboren, stammte aus einer im unteren Remstal ansässigen Familie von Bäckern und Weinbauern, bei der über Generationen hin das Schultheißenamt fast erblich geworden war.
Johann Kaspar war begabt und durfte am Lateinunterricht teilnehmen. Da aber der Vater früh gestorben war und acht unversorgte Kinder hinterließ, wurde der Knabe zur Feldarbeit geschickt. Dem suchte er zu entkommen. Bei einem Klosterbarbier erlernte er das Handwerk der Wundarzneikunst. »Sehr mittelmäßig7 mit Kleidern und Wäsche versehen« ging er danach auf Wanderschaft. Sein Sinn stand ihm nach Höherem, er übte sich im Fechten und lernte Französisch. In Nördlingen schloß er sich 1745 einem durchziehenden bayerischen Husarenregiment an. Eine Stelle als Feldscher (Sanitäter) war nicht frei. Doch stellte er sich so geschickt an, daß ihm bald kleinere chirurgische Eingriffe erlaubt wurden. Hautverletzungen durfte er kurieren, Zahnbehandlungen vornehmen und zur Ader lassen. Das Regiment zog nach Holland, wo es im Österreichischen Erbfolgekrieg auf habsburgischer Seite gegen französische Truppen eingesetzt wurde. Johann Kaspar stieg bald zum regulären Militärarzt auf und entwickelte besondere Fertigkeiten bei der Bekämpfung von Seuchen. Da die Soldaten mehr unter der Geschlechtskrankheit als unter den gegnerischen Soldaten zu leiden hatten, spezialisierte sich Johann Kaspar auf die sogenannten ›Galanteriekuren‹. Er verdiente gut und konnte sich vom Ersparten ein Pferd anschaffen. Er kam viel herum in Belgien, Nordfrankreich, Holland. Seinen Regimentskommandeur durfte er sogar auf einer Reise nach England begleiten. Es waren abenteuerliche Jahre. Er wurde verwundet, vom Feind als Spion gefangengenommen, entfloh, lebte in Verstecken und fand schließlich seine Truppe wieder. Er lernte die ›fortschrittliche‹ Welt kennen, die großen Städte, besuchte die neuen Manufakturen, die Steinkohlebergwerke, sah, wie man Land aus dem Wasser gewinnt und Marmor mit einer Maschine zersägt. Das eindringliche Bild des holländischen Gewerbefleißes, das später Friedrich Schiller in seiner Darstellung der »Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung« zeichnet, dürfte auch von den Erzählungen des Vaters angeregt worden sein. Die Niederlande waren für den Vater das gelobte Land.
Mit einem kleinen angesparten Vermögen, mit Instrumenten zum Zähneziehen und Aderlaß, zum Haareschneiden und Rasieren, mit einem ungarischen Sattel und acht Büchern, erbaulichen und medizinischen, mit einigen gut verheilten Wunden und mit robusten Erfahrungen kehrte Johann Kaspar 1749 in die Heimat zurück, ließ sich als Wundarzt in Marbach nieder und heiratete die sechzehnjährige Gastwirtstochter Elisabeth Dorothea Kodweiß.
Die Braut entstammte einer angesehenen Marbacher Familie. Der Brautvater Georg Friedrich Kodweiß war Besitzer des Gasthauses »Zum goldenen Löwen« und Holzinspektor, der das herzogliche Floßbauwesen zu beaufsichtigen hatte. Was Johann Kaspar nicht wußte: der Schwiegervater hatte sich beim Holzhandel verspekuliert und stand vor dem Ruin. So geriet Johann Kaspar, der Aufsteiger, in eine Familie, die dabei war, sozial abzustürzen. Zunächst versuchte er noch, mit seinem ersparten Geld auszuhelfen, aber ohne Erfolg. Das Gasthaus kam unter den Hammer, der Löwenwirt wurde zum Bettler und erhielt als Gnadenbrot den Wächterposten beim Stadttor und als Wohnung das angrenzende kleine Häuschen.
Johann Kaspar wollte den Ruin der Familie nicht weiter mit ansehen, ihm war das Leben in Marbach verleidet, und er hatte Entschlußkraft genug, einen neuen Anfang zu wagen. Es zog ihn wieder zum Militär. Er meldete sich 1753 bei einem neu aufgestellten württembergischen Regiment, die Feldscherstelle war schon besetzt, so gab er sich mit der untergeordneten Stellung eines Schreibers beim Versorgungsstab zufrieden. Bald hatte er sich wieder emporgedient. Als die württembergischen Regimenter auf der Seite Österreichs gegen Preußen in den Krieg eintraten, wurde Johann Kaspar wieder Regimentsmedicus. Er nahm an den Gefechten in Böhmen teil, die für die württembergischen Kontingente wenig ruhmvoll verliefen, weil mehr als die Hälfte der Soldaten desertierten. Johann Kaspar blieb bei der Fahne und hielt, um die angeschlagene Moral der Truppe zu heben, Feldgottesdienste ab; der Militärpfarrer hatte ebenfalls das Weite gesucht. In Anerkennung seiner vielfachen Verwendbarkeit wurde er 1759, im Geburtsjahr Friedrichs, zum Leutnant und zwei Jahre später 1761 zum Hauptmann befördert.
Mit seinem Regiment zog er von einer Garnison in die andere, es war ein ruheloses Leben, die Frau mußte ihrem Mann zusammen mit den beiden kleinen Kindern folgen. 1763 wurde Vater Schiller als Werbeoffizier nach Schwäbisch Gmünd versetzt. Das Wanderleben hatte ein Ende, bei den Schillers konnte sich endlich ein häusliches Familienleben entwickeln. Johann Kaspar betrieb sein Geschäft des Anwerbens ehrlicher als sein ehemaliger Gönner, der Oberst Rieger, dafür aber auch weniger einträglich, und da der Sold für ihn und seine Gehilfen ausblieb, mußte er auf seine Ersparnisse zurückgreifen, um die ihm untergebenen Unteroffiziere bezahlen und seine Familie durchbringen zu können. Der billigeren Lebenshaltungskosten wegen zog man ins benachbarte Dorf Lorch. An diesen Ort wird sich Friedrich Schiller später wie an ein verlorenes Paradies der frühen Kindheit erinnern.
Es war8 ein langgestrecktes Dorf, anderthalb Stunden Fußweg von Schwäbisch Gmünd entfernt an der Rems gelegen. Der Fluß schlängelt sich durch Wiesen, am Rande der Auen erheben sich tannenbewachsene Hügel. Einst hatte hier eine wichtige Handelsroute vorbeigeführt, deshalb war es eine burgenbewehrte Gegend. Schiller kam ins Schwärmen, wenn er von dieser Landschaft seiner Kindheit erzählte. Seine Frau Charlotte berichtet in ihrer nach dem Tode Schillers verfaßten biographischen Skizze: »Es war ein Lieblingsgang des Knaben, auf einen Berg zu steigen, auf dessen Höhe eine Kapelle stand, und wohin die frommen eifrigen Christen die zwölf Stationen der Leidensgeschichte auch symbolisch reuevoll zurücklegten. Das Grab der Hohenstaufen bewahrte noch ein Kloster auf einer anderen Anhöhe, und unter diesen Bildern der Religion wie der ritterlichen Kraft empfing das Gemüt des Knaben seine früheren Eindrücke.« Es mag sein, daß die Erinnerungen an das Hohenstaufergrab auf der Anhöhe bei Lorch und an die Geschichten über das sagenhafte Fürstengeschlecht Schiller später die nie verwirklichte Idee zu einem Drama über den letzten Stauferkaiser Konradin eingaben.
Erinnerlich blieben ihm auch die lateinischen Lehrstunden beim Pfarrer Moser in Lorch. Diesem sanften, auf joviale Weise frommen und gebildeten Mann hat er in den »Räubern« in Gestalt des gleichnamigen Pastors, der dem ruchlosen Franz mutig ins Gewissen redet, ein Denkmal gesetzt. Vielleicht war es auch der Pfarrer Moser, der in dem Knaben den Wunsch weckte, Geistlicher zu werden. Die Schwester Christophine erinnert sich: »Er fing9 auch selbst oft an zu predigen, stieg auf einen Stuhl und ließ sich von seiner Schwester ihre schwarze Schürze statt dem Kirchenrock umhängen. Dann mußte sich alles um ihn herum still und andächtig verhalten und ihm zuhören, außerdem wurde er so eifrig, daß er fortlief und sich lange nicht wieder sehen ließ, dann folgte gewöhnlich eine Strafpredigt. So jugendlich diese Vorträge auch waren, so hatten sie doch immer richtigen Sinn, er reihte einige Sprüche sehr schicklich zusammen und trug sie nach seiner Weise mit Nachdruck vor. Auch machte er eine Abteilung (Gliederung), die er sich von dem Herrn Pfarrer gemerkt hatte.«
Christophine erzählt noch eine andere Anekdote, die das Verhältnis Friedrichs zu seinem Vater beleuchtet. Eine Nachbarin rief einmal den Knaben, der von der Schule kam, ins Haus. Sie wollte ihm von seiner Lieblingsspeise, Brei von türkischem Weizen, zu kosten geben, da kam der Vater zufällig vorbei, ohne ihn zu bemerken. Der Knabe stürzte hervor mit den Worten »Lieber Vater, ich will es gewiß nie wieder tun!«. Der Vater, der nichts zu tadeln fand, schickte ihn nach Hause. »Mit einem entsetzlichen Jammerschrei verließ er seinen Brei, eilte nach Hause, bat die Mutter inständig, sie möchte ihn doch bestrafen, ehe der Vater nach Hause käme, und brachte ihr selbst den Stock. Die Mutter wußte nicht, was das alles bedeuten sollte, denn er konnte vor Jammer kein Wort herausbringen – bestrafte ihn jedoch mütterlich.«
Der Vater war eine Autorität, aber kein Tyrann. Er herrschte patriarchalisch über die Familie. Der Maßstab, nach dem er alles bewertete, war die Pflicht. So wie er selbst sie seinem Landesherrn oder Gott schuldig zu sein glaubte, so sollten die Familienmitglieder in ihm das Maß ihrer Pflichten finden. Er hatte dem Herzog stets treu gedient, auch wenn ihm nicht entging, wie dieser häufig die Rechte eines Landesherrn mißbrauchte und dessen Pflichten vernachlässigte. Das hatte der vorgesetzte Herr mit seinem Gott auszumachen, er selbst aber war als Untertan bestrebt, rechtschaffen zu bleiben. Ungesetzliche Methoden der Rekrutierung oder Veruntreuung konnte man ihm als Werbeoffizier nicht vorwerfen. Pflichtschuldiges Verhalten erwartete er auch von Frau und Kindern. Sie sollten auf sein Kommando hören, auch wenn er, was er durchaus zugab, bisweilen Fehler beging. Er verlangte von ihnen das Vertrauen in seine guten Absichten. Wie ein Gärtner, der er später dann wirklich wurde, betrachtete er die Familie als Pflanzstätte der Rechtschaffenheit. Die Kinder mußten gehegt und gepflegt, aber auch beschnitten werden. Sein Verhalten war nicht von Willkür, sondern von strengem Ordnungssinn bestimmt.
Der junge Schiller hatte die väterliche Weltordnung verinnerlicht, und als er an seinen »Räubern« schrieb, war sie noch so lebendig in ihm, daß er aus der dort dargestellten Zerrüttung der väterlichen Ordnung die tragische Katastrophe hervorgehen ließ. Vielleicht war dieser Glaube an die väterliche Weltordnung auch der Grund, weshalb der Knabe, wie die mitgeteilte Anekdote berichtet, die Nachsicht des Vaters gar nicht verstand und die Strafe forderte, damit die gewöhnliche Ordnung wiederhergestellt würde. Das Kind hatte gelernt, daß man den Stock, mit dem man geschlagen wird, notfalls selbst herbeiholt. Diese väterliche Welt, auch wenn man darunter litt, gab doch auch ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Gewiß fürchtete Friedrich seinen Vater, aber da er ihn auch liebte, wurde aus Furcht Ehrfurcht. Der Jugendfreund Friedrich Wilhelm von Hoven berichtet: »Große Ehrfurcht10 vor seinem Vater bewog ihn vorzüglich zum Fleiß.«
In dem Maße, wie Friedrich nach seinem Eintritt in die Karlsschule unter die Tyrannei des Herzogs geriet, verklärte sich das Bild des Vaters. Es war ja auch der Vater gewesen, der im Januar 1773 dem Herzog, der den begabten Friedrich für seine »Militär-Pflanzschule« gewinnen wollte, die andersgerichteten Wünsche seines Sohnes vortrug. Der wollte nämlich lieber Theologie studieren, was an der Karlsschule nicht möglich war. Zweimal wurde der Vater für den Sohn beim Herzog vorstellig, am Ende ohne Erfolg. Er mußte, um Repressalien zu vermeiden, den Sohn doch in die Hände des Herzogs geben. Dem Knaben wird es wohl so vorgekommen sein, daß die väterliche Macht sich schützend vor ihn gestellt hatte gegen die viel größere Macht des Herzogs. Weil der Vater ihn hatte bewahren wollen, bewahrte der Sohn seinem Vater lebenslang eine fast kindliche Verehrung.
Als der Bruder seines Freundes, der jüngere Hoven, stirbt, und Schiller vorübergehend in eine tiefe Depression verfällt und sich mit Todesgedanken trägt, schreibt er am 19. Juni 1780 seiner Schwester über die Gründe, die ihn am Leben festhalten könnten: Ich habe das Glück vor vielen Tausenden, (das unverdiente Glück) den besten Vater zu haben.
Diesem besten Vater wird er später nach der Flucht aus Stuttgart beweisen wollen, daß in ihm mehr steckt als ein Regimentsmedicus. Er wird zu den Theaterleuten gehen – gegen den Willen des Vaters, der ihm rät, in der vom Herzog vorgezeichneten Laufbahn eines Mediziners zu bleiben. Es werden ihn deshalb Schuldgefühle plagen. An die Schwester schreibt er am 28. September 1785: Ich pochte auf eine innere Kraft, die meinem Vater ganz neu, und schimärisch war, und ich gestehe mit Erröten, daß ich ihm die Erfüllung meiner stolzen Ansprüche noch bis auf diesen Tag schuldig blieb. Ihn hätte es mehr befriedigt, wenn ich, seinen ersten Planen gemäß, in unbemerkter doch ruhiger Mittelmäßigkeit das Brot meines Vaterlandes gegessen hätte.
Woher aber, so fährt er in diesem Brief fort, kommt seine Schnellkraft und sein Ehrgeiz, die ihn in andere Richtung drängen? Sie kommen vom Vater, der auch ehrgeizig war. Der Vater ist hochgekommen, der Sohn will noch höher steigen. Der Vater hat es zum Major und herzoglichen Gärtner gebracht, der Sohn wird nach den Sternen greifen. Dank also dem Vater, denn er hat den Sohn durch sein Vorbild gelehrt, mehr aus sich zu machen. Hätte der Vater es anders gewollt, dann hätte er nicht zugeben sollen, daß... sich mein Ehrgeiz entwickelte, dann hätte er mich mit mir selbst ewig unbekannt erhalten sollen.
Schiller bittet um Geduld: der Vater werde am Sohn schon noch die Früchte jener schöpferischen Unrast sehen, die er in ihm gepflanzt hat. Unsern Eltern sage, schreibt er der Schwester, daß sie von jetzt an um mich ganz unbesorgt sein sollen. Alle ihre Wünsche und Projekte mit mir, werden weit unter meinem... glücklichen Schicksal bleiben.
Schiller achtet den Vater, und gerade darum will er ihn überbieten. Er wollte triumphieren in einer Welt, die für ihn väterlich bestimmt blieb.
Die Mutter war eine sanfte, fromme, liebevolle Frau; sicher und tatkräftig in den häuslichen Angelegenheiten, aber unsicher bis zur Schüchternheit und Ängstlichkeit draußen in der Welt. Sie hat unter ihrem Mann gelitten – das gesteht sie ihrem Sohn in einem Brief, den sie anläßlich der schweren Erkrankung ihres Mannes am 28. April 1796 schreibt. »Überhaupt, bester11 Sohn, muß ich Ihm mein Herz ganz entdecken, weil ich nicht weiß, ob ich es noch kann. O wie glücklich wäre ich, wenn meine Leiden auch bald zu Ende wären! Der Papa denkt niemals so zärtlich und würde alles in vierundzwanzig Stunden vergessen haben, wenn er wieder gesund und in seine Baumschule gehen könnte; eine Magd würde ihm alles versehen, was eine Frau tun könnte. Sein Betragen ist schon viele Jahre gegen die Seinigen sehr gleichgültig, und ist immer mehr auf seine Leidenschaften und Begierden, durchzutreiben, was er sich in Kopf gesetzt, als auf der Seinigen Wohl bedacht.«
Wir wissen nicht, was Schiller der Mutter auf diesen Brief geantwortet hat. Erhalten geblieben ist ein Brief vom 9. Mai 1796 an die Schwester Christophine, wo er Bezug nimmt auf das mütterliche Geständnis: Wie rührte michs, daß sie ihr Herz mir öffnete, und wie wehe tat mirs, sie nicht unmittelbar trösten und beruhigen zu können. Die Lage der lieben Unsrigen war doch erschrecklich.
Das Schicksal der Mutter war das übliche: Mühe und Arbeit, zahlreiche Schwangerschaften, einen Jungen und fünf Mädchen brachte sie zur Welt, zwei davon starben bald nach der Geburt. Sie hätte den Töchtern gern eine höhere Bildung und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht, was aber ihrem Mann unschicklich erschien und zu kostspielig war. Wie auch sonst hatte die Mutter kaum eine Chance, sich gegen den Vater durchzusetzen. Sie hat sich damit abgefunden, geschuftet und in den freien Stunden Balladen und geistliche Lieder gelesen, und erst viele Jahre später, als es mit dem Vater allmählich zu Ende ging, konnte sie mit ihren Kindern über ihr Schicksal reden.
Drei Jahre, von Anfang 1764 bis Ende 1766, lebten die Schillers in Lorch. Im Dezember 1766 ließ sich der Vater zu seinem Regiment in die Garnison Ludwigsburg zurückversetzen. Nachdem er drei Jahre keinen Sold erhalten und nach dem Verkauf seines Weinberges in Marbach nichts mehr zusetzen konnte, hatte er untertänig aber energisch den ausstehenden Sold verlangt und um die Versetzung nach Ludwigsburg gebeten. Der Wunsch wurde ihm erfüllt, der ausstehende Sold aber wurde ihm erst einige Jahre später gezahlt.
Ludwigsburg. Die Schillers kamen in eine Stadt, die dabei war, eine Metropole des europäischen Rokoko zu werden. Es war die Zeit, die der Herzog selbst später die Jahre seiner »Lebensgaloppade« nannte. Er preßte das Land aus und nahm überall in Europa Kredite auf – Voltaire zum Beispiel lieh ihm zweihundertsechzigtausend Gulden –, um eine beispiellose Prachtentfaltung ins Werk zu setzen. Ludwigsburg wurde tatsächlich zu einem zweiten Versailles, der Ruhm der Residenz verbreitete sich, in Scharen strömte hier zusammen, was Rang, Namen und vor allem Geld genug hatte, um es zu verspielen. William Thackeray läßt in seinem Roman »Barry Lyndon« den gleichnamigen Helden, einen Glücksritter, der die glänzende und bereits morbide höfische Welt am Vorabend der Französischen Revolution durchstreift, auch in der Residenz Ludwigsburg Station machen. Er schildert eine Welt, die der junge Schiller als neugieriger Zaungast erlebte.
»An keinem12 Hofe Europas«, läßt Thackeray seinen Barry Lyndon berichten, »wurde dem Vergnügen gieriger nachgejagt und wurde es großartiger genossen. Der Fürst residierte nicht in seiner Hauptstadt S., sondern hatte sich, um in jeder Hinsicht den Hof von Versailles nachzuahmen, einige Meilen von seiner Hauptstadt entfernt einen prächtigen Palast bauen und ihn mit einer aristokratischen Stadt umgeben lassen, die ausschließlich die Edelleute, Offiziere und Beamte seines luxuriösen Hofstaates bewohnten. Seine Untertanen wurden allerdings hart bedrückt, damit er sich diese Pracht leisten konnte, denn das Land seiner Hoheit war klein, und so schloß er sich, weise wie er war, aufs strengste von seinen Landeskindern ab... Die Hofoper wurde nur noch von der französischen übertroffen, und das glänzende herzogliche Ballett, für das seine Hoheit Unsummen ausgab, war in Europa einzigartig. Ich glaube, ich habe nie wieder in meinem Leben soviel Pracht auf einer Bühne bewundern können.«
Aus der idyllischen Weltabgeschiedenheit eines Dorfes kam das Kind in eine Stadt, die bis in jeden Winkel von dieser höfischen Welt geprägt war, ein jäher Wechsel von der Natur in die Kultur. Justinus Kerner, der auch in Ludwigsburg aufwuchs, erzählt, wie man überall in den breiten Straßen, den Linden- und Kastanienalleen die Hofleute »in seidenen13 Fräcken, Haarbeuteln und Degen« unter den Arkaden am Marktplatz lustwandeln sah. An Sommerabenden brannte man Feuerwerke ab. Tag und Nacht amüsierte sich der Hof und ließ sich dabei gern zusehen. Opern, Konzerte, Redouten und Jagden lösten einander ab. In der Galerie am Schloß standen siebzig Spieltische, die eifrig frequentiert wurden. Wie in einem riesigen Aquarium tummelte sich die vergnügliche Gesellschaft. Berühmt waren die Winterfeste. Bei dieser Gelegenheit ließ der Herzog einen Teil der Parkanlagen mit Glaswänden und einer Kuppel einfassen, Öfen verbreiteten Wärme, tausende von Glaslampen zauberten einen prachtvollen Sternenhimmel an die Decke. Da ging man dann durch Weingärten voll Trauben, kam zu Orangenhainen mit Nachbildungen antiker Statuen. In diesem Zaubergarten gab es dramatische Darstellungen und Ballettaufführungen. Einmal ließ der Herzog im Sommer die Allee von der Solitude nach Ludwigsburg mit Salz bestreuen, um eine Schlittenfahrt zu veranstalten. Der Herzog und sein Gefolge glitten mit Schlitten, die von vier Hirschen gezogen wurden, an den aufgestellten Orangenbäumen und am staunenden Volk vorbei.
Zu den Aufführungen im Hoftheater hatten die Offiziere mit ihren Familien freien Zutritt. Hier erlebte Friedrich die ersten Opern- und Theateraufführungen. Der Herzog scheute keine Kosten, um die besten Sänger und Schauspieler aus Europa zu verpflichten, für den weltberühmten Tänzer de Vestris zahlte er zwölftausend Gulden und konnte doch nicht verhindern, daß dieser nach wenigen Wochen, ohne seinen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, wieder abreiste, um einem verlockenderen Angebot aus Mailand zu folgen. Nachdem Friedrich einige Aufführungen erlebt hatte, schnitt er sich aus Pappe Figuren zurecht, die an Schnüren bewegt wurden, versammelte die Familie und einige Freunde im Wohnzimmer, hängte alte Röcke über eine Leine und brachte kleine selbstgeschriebene Stücke zur Aufführung. Schon damals war Schiller kein guter Vortragskünstler. »Er übertrieb14 durch seine Lebhaftigkeit alles«, berichtet die Schwester Christophine.
Gesehen hat Friedrich seinen Herzog zum ersten Mal, als dieser am 11. Juli 1767 von einem seiner verschwenderischen mehrmonatigen Aufenthalte in Venedig mit seinem Hofstaat zurückkehrte. Man stand in Ludwigsburg Spalier, um den Landesherrn zu begrüßen, der Venedig überstürzt verlassen hatte, weil seine Schulden ins Unermeßliche gestiegen waren. Für die Rückreise mußte er seinen Hausschmuck verpfänden.
Zu diesem Zeitpunkt währte die Regierungszeit des Herzogs schon ein Vierteljahrhundert. Karl Eugen hatte mit sechzehn Jahren die Herrschaft angetreten, zuvor war er bei Friedrich dem Großen erzogen worden, der ihm die folgende Ermahnung auf den Weg gab: »Denken Sie15 ja nicht, daß das Land Württemberg für Sie geschaffen worden ist, vielmehr, daß die Vorsehung Sie auf die Welt hat kommen lassen, um dieses Volk glücklich zu machen. Ziehen Sie immer dessen Wohlsein Ihrer eigenen Annehmlichkeit vor.« Der Herzog beherzigte diese Ermahnung nicht. Um die aufwendige Hofhaltung finanzieren zu können, verkauft er Soldaten, zuerst an den französischen König, später an England für den überseeischen Einsatz. Schiller wird in einer berühmten Szene aus »Kabale und Liebe« darauf anspielen. Der Herzog erhob gegen den Willen der Landstände Abgaben und verordnete Frondienste, was er nach der Verfassung des Landes nicht durfte. Den Rechtsvertreter der Landstände, den in ganz Deutschland bekannten Johann Jakob Moser, der die Opposition gegen diese Willkür anführte, ließ er für fünf Jahre ins Gefängnis werfen. Beim Reichsgericht in Wien war wegen dieser Rechtsbeugungen ein Prozeß anhängig, der nach einigen Jahren 1770 endlich zum Abschluß kam. Es wurde dem Herzog untersagt, einseitig Steuern auszuschreiben, und er wurde verpflichtet, den Landständen zurückzugeben, was er ihnen geraubt hatte. Der Herzog beugte sich, seine wilden Jahre waren zu Ende, er hatte sich ausgetobt. Das Maitressenwesen und die Beutezüge auf die schönen Schwäbinnen wurden eingestellt, er verliebte sich in die schöne Seele Franziska von Bernardin, die spätere Gräfin von Hohenheim, die ihren sänftigenden Einfluß auf Karl Eugen auszuüben begann, und so verfiel er auf das Projekt, einen kleinen Menschenpark anzulegen: Offiziers- und Beamtennachwuchs sollte herangezogen werden. Aus einem Militär-Waisenhaus wurde 1771 die »Militär-Pflanzschule« auf der Solitude, aus der dann später die Hohe Karlsschule hervorging, die Lehr- und Leidensstätte des jungen Friedrich Schiller.
In Ludwigsburg wohnten die Schillers zusammen mit einer anderen Offiziersfamilie, den von Hovens, im Hause des Hofbuchdruckers Christian Friedrich Cotta. Friedrich freundet sich mit den beiden Söhnen des Hauptmanns von Hoven an. Der jüngere, August, starb 1780; der ältere, Friedrich Wilhelm, blieb ein lebenslanger Freund. Gemeinsam besuchte man die Ludwigsburger Lateinschule, wo Friedrich viermal jeweils am Ende des Schuljahres das Landesexamen erfolgreich ablegte, was eine Voraussetzung für die spätere Aufnahme in das Tübinger Theologenstift war. Friedrich sollte und wollte evangelischer Geistlicher werden. Am Tage vor seiner Konfirmation beobachtete die Mutter, wie Friedrich ausgelassen auf der Straße herumtobte, und ermahnte ihn, er möge sich doch mit angemessenem Ernst auf die heilige Handlung vorbereiten. Daraufhin verfaßte der Knabe sein erstes Gedicht. Es ist nicht erhalten geblieben, es muß aber ein allzu gefühlvoller frommer Erguß gewesen sein, denn der Vater, als er die Verse las, sagte nur: »Bist du16 närrisch geworden, Fritz?«
Zweites Kapitel
Väterliche und mütterliche Frömmigkeit. Der kleine Prediger.Karlsschule. Der Herzog erzieht. Der Knabe und die Macht.Scharffenstein: der ideale und der wirkliche Freund.Klopstock. Schillers erste Gedichte: Lesefrüchte.Den Träumen der Jugend treu.
»Närrisch« nannte der Vater seinen Sohn, der sich plötzlich so herzbewegt fromm zeigte. Das war nicht nach dem Geschmack des Vaters in religiösen Dingen. Religion galt ihm als Sanktionierung einer gesellschaftlichen Lebensordnung, und sich pünktlich und gewissenhaft daran zu halten, war ihm Frömmigkeit genug. Die Mutter aber gab sich gern den weichen Stimmungen der Religion hin. Sie las in den pietistischen Andachtsbüchern des Johann Albrecht Bengel, rezitierte gern geistliche Lieder, die sie auswendig wußte. Das Empfindsame, Poetische an der Religion zog sie an, und sie weckte auch in ihren Kindern den Sinn dafür. »Einst17«, erzählt Christophine, »da wir als Kinder mit der Mutter zu den lieben Großeltern gingen, nahm sie den Weg von Ludwigsburg nach Marbach über den Berg. Es war ein schöner Ostermontag, und die Mutter teilte uns unterwegs die Geschichte von den zwei Jüngern mit, denen sich auf ihrer Wanderung nach Emmaus Jesus zugesellt hatte. Ihre Rede und Erzählung wurde immer begeisterter, und als wir auf den Berg kamen, waren wir alle so gerührt, daß wir niederknieten und beteten. Dieser Berg wurde uns zum Tabor.« Der Vater vermittelte den Kindern eine Religion des Verstandes, die Mutter eine des Herzens, zwei Arten von Frömmigkeit, denen im religiösen Leben Württembergs verschiedene institutionelle Ausdrucksformen entsprachen.
Da gab es auf der einen Seite die evangelische Kirche. Eine Institution, die zusammen mit den Städten und dem Adel zu den Landständen gehörte, die ihre verfassungsmäßigen, altwürttembergischen Rechte der Steuerhoheit und Selbstverwaltung gegen die Übergriffe des Herzogs zu verteidigen hatten. Die Kirche verstand sich als politische Ordnungsmacht, und ihre Orthodoxie war zum spirituell ausgetrockneten Verhaltenskodex geschrumpft. Seele und Herz konnten hier wenig Befriedigung finden. Das mußte der junge Friedrich Schiller im Konfirmandenunterricht erfahren, als er es mit einem geistlichen Präzeptor zu tun bekam, der Fehler beim Aufsagen des Katechismus mit Stockschlägen bestrafte. Ein Schulfreund erzählt, wie jeder »mit zitternder Angst« sein Sprüchlein aufsagte. Wenn alles seine Richtigkeit hatte, gab es eine Belohnung. Einmal hatte Friedrich mit seinem Schulfreund zusammen vier Kreuzer Belohnung erhalten und die beiden waren mit dieser Barschaft hinausgewandert zum Hartenecker Schlößle, einem beliebten Ausflugsort, um dort zu vespern. Aber das durch korrektes Aufsagen des Katechismus verdiente Geld reichte noch nicht einmal für Käse mit Brot. Die beiden zogen weiter zum Nachbardorf Neckarweihingen. Dort fanden sie nach mehreren vergeblichen Anfragen ein Gasthaus, wo sie für ihre kleine Barschaft Milch und Brot bekamen. Schiller, erzählt der Schulfreund weiter, stieg »auf einen Hügel, wo wir Neckarweihingen und Harteneck übersehen konnten, segnete das Wirtshaus, wo wir gespeist wurden, und verfluchte Harteneck und die übrigen Wirtshäuser mit einer so poetisch-prophetischen Emphase, daß ich noch es mir deutlich in das Gedächtnis zurückrufen kann.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!