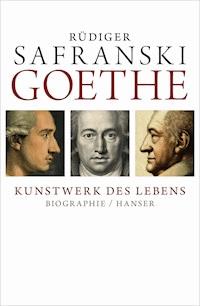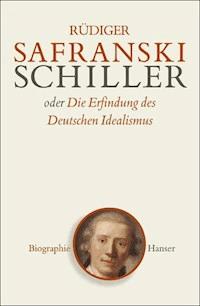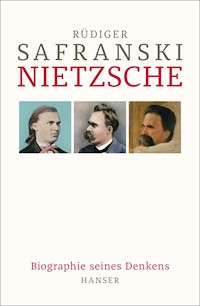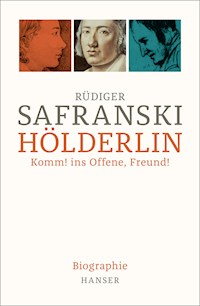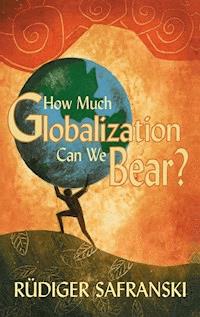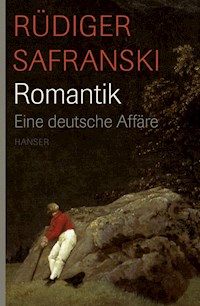
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Romantik, neben dem Idealismus der Inbegriff des deutschen Geistes, ist in aufgeklärten Zeiten an den Rand gedrängt worden. Rüdiger Safranski holt sie für uns ins Zentrum zurück. Er beschreibt die Romantik als Epoche, ihre Zeitgenossen Tieck, Novalis, Fichte, Schelling, Schleiermacher oder Dorothea Veit, die für die Entfesselung des Genies stehen, für den Aufbruch ins Grenzenlose, für die Lust am Experiment. Und er erzählt die Geschichte des Romantischen, die bis heute fortlebt. Sie handelt von der Karriere des Imaginären und führt über Heine, Richard Wagner, Nietzsche und Thomas Mann bis in die Gegenwart - die Biographie einer Geisteshaltung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Die Romantik, neben dem Idealismus der Inbegriff des deutschen Geistes, ist in aufgeklärten Zeiten an den Rand gedrängt worden. Rüdiger Safranski holt sie für uns ins Zentrum zurück. Er beschreibt die Romantik als Epoche, ihre Zeitgenossen Tieck, Novalis, Fichte, Schelling, Schleiermacher oder Dorothea Veit, die für die Entfesselung des Genies stehen, für den Aufbruch ins Grenzenlose, für die Lust am Experiment. Und er erzählt die Geschichte des Romantischen, die bis heute fortlebt. Sie handelt von der Karriere des Imaginären und führt über Heine, Richard Wagner, Nietzsche und Thomas Mann bis in die Gegenwart — die Biographie einer Geisteshaltung.
Rüdiger Safranski
Romantik
Eine deutsche Affäre
Carl Hanser Verlag
Vorwort
Was man um 1800 die ›Romantische Schule‹ genannt hat, was sich um die Gebrüder Schlegel versammelte, was sich in deren kurzlebiger, aber heftiger Zeitschrift »Athenäum« selbstbewußt und bisweilen doktrinär zu Wort meldete, dieser entfesselte Spekulationsgeist des philosophischen Beginns von Fichte und Schelling, was in den frühen Erzählungen von Tieck und Wackenroder bezauberte als Vergangenheitssehnsucht und als neu erwachter Sinn für das Wunderbare, diese Hinneigung zur Nacht und zur poetischen Mystik bei Novalis, dieses Selbstgefühl des Neuanfangs, dieser beschwingte Geist einer jungen Generation, die zugleich gedankenschwer und verspielt auftrat, um den Impuls der Revolution in die Welt des Geistes und der Poesie zu tragen — diese ganze Bewegung hat selbstverständlich eine Vorgeschichte, einen Anfang vor dem Anfang.
Die jungen Leute, denen es nicht an Selbstbewußtsein mangelte, wollten einen neuen Anfang setzen, aber sie setzten doch auch fort, womit eine Generation früher der ›Sturm und Drang‹ begonnen hatte. Johann Gottfried Herder, der deutsche Rousseau, hatte den Anstoß dazu gegeben. Und deshalb kann man die Geschichte der Romantik mit dem Augenblick beginnen lassen, da Herder 1769 zu einer Seereise nach Frankreich aufbrach, überstürzt und fluchtartig, überdrüssig der beengenden Lebensverhältnisse in Riga, wo sich der junge Prediger mit den Orthodoxen herumschlagen mußte und in ärgerliche literarische Fehden verwickelt war. Unterwegs kommen ihm Ideen, die nicht nur ihn beflügeln werden.
Herder sticht also in See. Hier beginnt unsere Reise auf den Spuren der Romantik und des Romantischen in der deutschen Kultur. Sie führt nach Berlin, Jena, Dresden, wo die Romantiker ihre Hauptquartiere aufgeschlagen hatten und wo sie das Feuerwerk ihrer Ideen abbrannten. Wo sie träumten, kritisierten und phantasierten. Die Epoche der Romantik im engeren Sinne endet bei Eichendorff und E. T. A. Hoffmann, romantische Entfesselungskünstler und doch auch anderweitig gebunden. Der eine ein guter Katholik und Regierungsrat, der andere ein liberaler Kammergerichtsrat. Beides Doppelexistenzen, die nicht auf Romantik festgelegt sind. Eine kluge, eine lebbare Form der Romantik.
Es geht in diesem Buch um die Romantik und um das Romantische. Die Romantik ist eine Epoche. Das Romantische eine Geisteshaltung, die nicht auf eine Epoche beschränkt ist. Sie hat in der Epoche der Romantik ihren vollkommenen Ausdruck gefunden, ist aber nicht darauf beschränkt; das Romantische gibt es bis heute. Es ist nicht nur ein deutsches Phänomen, aber es hat in Deutschland eine besondere Ausprägung erfahren, so sehr, daß man im Ausland bisweilen die deutsche Kultur mit Romantik und dem Romantischen gleichsetzt.
Das Romantische findet sich bei Heine, der es zugleich überwinden will, so wie auch bei seinem Freund Karl Marx. Der Vormärz hat es in die Politik gelegt, in die nationalen und sozialen Träume. Dann Richard Wagner und Friedrich Nietzsche, die keine Romantiker sein wollten, aber es doch waren als Jünger des Dionysos. Ungehemmt romantisch war die Jugendbewegung um 1900. Beim Kriegsbeginn 1914 glaubten Thomas Mann und andere, die romantische Kultur Deutschlands gegen die westliche Zivilisation verteidigen zu müssen. Die unruhigen 20er Jahre sind ein Nährboden für romantische Erregungen, bei den Inflationsheiligen, den Sekten und Bünden, den Morgenlandfahrern; man wartet auf den großen Augenblick, auf politische Erlösung. Heideggers Vision einer seinsgerechten Politik mündet in eine fatale politische Romantik, die ihn Partei nehmen läßt für die nationalsozialistische Revolution. Wie romantisch war der Nationalsozialismus? War er nicht vielleicht doch eher pervertierter Rationalismus als verwilderte Romantik? Ist Thomas Manns »Doktor Faustus« nicht doch eine zu hohe Interpretation des kruden Geschehens (Mann) — ein romantisches Buch also, das über die Romantik zu Gericht sitzt? Dann die Ernüchterungen der Nachkriegszeit, die ›skeptische Generation‹ mit ihrem Vorbehalt gegen das Romantische. Die Reise durch die bizarre deutsche Geisteslandschaft endet bei dem vorläufig letzten größeren romantischen Aufbruch, bei der Studentenbewegung von 1968 und ihren Folgen.
Die beste Definition des Romantischen ist immer noch die von Novalis: Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.
In dieser Formulierung merkt man, daß die Romantik eine untergründige Beziehung zur Religion unterhält. Sie gehört zu den seit zweihundert Jahren nicht abreißenden Suchbewegungen, die der entzauberten Welt der Säkularisierung etwas entgegensetzen wollen. Romantik ist neben vielem, was sie sonst noch ist, auch eine Fortsetzung der Religion mit ästhetischen Mitteln. Das hat ihr die Kraft zur beispiellosen Rangerhöhung des Imaginären gegeben. Die Romantik triumphiert über das Realitätsprinzip. Gut für die Poesie, schlecht für die Politik, falls sich die Romantik ins Politische verirrt. Dort also beginnen die Probleme, die wir mit dem Romantischen haben.
Der romantische Geist ist vielgestaltig, musikalisch, versuchend und versucherisch, er liebt die Ferne der Zukunft und der Vergangenheit, die Überraschungen im Alltäglichen, die Extreme, das Unbewußte, den Traum, den Wahnsinn, die Labyrinthe der Reflexion. Der romantische Geist bleibt sich nicht gleich, ist verwandelnd und widersprüchlich, sehnsüchtig und zynisch, ins Unverständliche vernarrt und volkstümlich, ironisch und schwärmerisch, selbstverliebt und gesellig, formbewußt und formauflösend. Der alte Goethe sagte, das Romantische sei das Kranke.
Aber auch er mochte nicht darauf verzichten.
Erstes Buch
Die Romantik
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.
Eichendorff
Erstes Kapitel
Romantischer Anfang: Herder sticht in See. Die Kultur neu erfinden. Individualismus und die Stimmen der Völker. Vom Schaukeln der Dinge im Strom der Zeit.
Zweieinhalb Jahrhunderte nach Kolumbus und ein Jahrhundert vor Nietzsches Losung: Auf die Schiffe, ihr Philosophen! rührte sich bei einem Abenteurer des Geistes das Verlangen, in See zu stechen und aufzubrechen ins real existierende Ungeheure. Am 17. Mai 1769 verabschiedet sich Johann Gottfried Herder von seiner Gemeinde mit den Worten: Meine einzige Absicht ist die, die Welt meines Gottes von mehr Seiten kennenzulernen. Herder ging an Bord eines Schiffes, das Roggen und Flachs nach Nantes bringen sollte, doch für ihn selbst blieb das Reiseziel noch unbestimmt, vielleicht würde er sich, so dachte er, in Kopenhagen an Land begeben, vielleicht an der nordfranzösischen Küste das Schiff wechseln und fernere Ziele ansteuern. Die Ungewißheit beflügelte ihn, unbesorgt, wie Apostel und Philosophen, so gehe ich in die Welt, um sie zu sehen.
In See stechen hieß für Herder: das Lebenselement wechseln, das Feste gegen das Flüssige, das Gewisse gegen das Ungewisse einzutauschen, es hieß, Abstand und Weite gewinnen. Auch das Pathos eines neuen Anfangs war darin. Ein Konversionserlebnis, eine innere Umkehr, ganz in der Art, wie Rousseau zwanzig Jahre vorher unter einem Baum auf der Straße nach Vincennes seine große Inspiration erlebt hatte: die Wiederentdeckung der wahren Natur unter der Kruste der Zivilisation. Noch ehe Herder neue Menschen, neue Länder und Sitten kennenlernt, macht er also eine neue Bekanntschaft mit sich selbst, mit seinem schöpferischen Selbst. Er überläßt sich, von den sanften Winden der Ostsee geschaukelt, seinem Gedankensturm. Was gibt ein Schiff, das zwischen Himmel und Meer schwebt, nicht für weite Sphären zu denken! Alles gibt hier dem Gedanken Flügel und Bewegung und weiten Luftkreis! Das flatternde Segel, das immer wankende Schiff, der rauschende Wellenstrom, die fliegende Wolke, der weite unendliche Luftkreis! Auf der Erde ist man an einen toten Punkt angeheftet und in den engen Kreis einer Situation eingeschlossen … o Seele, wie wird dir’s sein, wenn du aus dieser Welt hinaustrittst?
Er ist an Bord gegangen, um die Welt zu sehen, schreibt er, doch außer der bewegten Wasserwüste und einigen Küstenlinien sieht er zunächst wenig davon. Dafür aber findet er Zeit und Gelegenheit, sein bisheriges Bücherwissen zu zerstören, um herauszufinden und zu erfinden, was ich denke und glaube. Die Begegnung mit einer fremden Welt wird zur Selbstbegegnung. Das ist das Charakteristische dieses deutschen Aufbruchs: aus beschränkten Bordmitteln und in der Einsamkeit auf hoher See erzeugt sich dieser vom Fernweh gepackte Prediger eine neue Welt; er trifft keine Indianer, stürzt keine Azteken- und Inkareiche, schleppt keine Goldschätze und Sklaven heran, unternimmt keine neue Vermessung der Welt; seine neue Welt ist eine, die im Handumdrehen wieder Buchform annehmen wird. Herder, der das Repositorium voll Papier und Bücher, das nur in die Studierstube gehört, hinter sich lassen wollte, wird am Ende doch wieder von der Bücherwelt eingeholt, denn, noch auf dem Schiff, schwelgt er in literarischen Projekten. Welch ein Werk über das menschliche Geschlecht! den menschlichen Geist! die Kultur der Erde! aller Räume! Zeiten! Völker! Kräfte! Mischungen! Gestalten! Asiatische Religion! und Chronologie und Polizei und Philosophie … Griechisches Alles! Römisches Alles! Nordische Religion, Recht, Sitten, Krieg, Ehre! Papistische Zeit, Mönche, Gelehrsamkeit! … Chinesische, Japanische Politik! Naturlehre einer neuen Welt! Amerikanische Sitten usw. … Universalgeschichte der Bildung der Welt!
Herder zehrte ein Leben lang von den Ideen, die ihm auf bewegter See durch den Kopf gegangen waren. Das Tagebuch, das sie verzeichnete — ein bedeutendes literarisch-philosophisches Dokumente der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts — erschien zwar erst postum 1846 unter dem Titel »Journal meiner Reise im Jahr 1769«, aber der es geschrieben hatte, begegnete nach der Reise 1771 in Straßburg diesem vielversprechenden jungen Mann, Goethe, den das Ideengestöber mächtig anzog und der vieles davon weitergab und fortsetzte, was er von ihm zu hören bekam. Im zehnten Buch von »Dichtung und Wahrheit« erinnert sich Goethe an die zufällige erste Begegnung im Treppenaufgang eines Straßburger Gasthauses, wo Herder für die Zeit einer langwierigen und schmerzhaften Behandlung an den Tränendrüsen Quartier genommen hatte. Goethe schildert, daß ihm Herder vorgekommen sei wie ein Abbé, mit seinem gepuderten und zu Locken aufgesteckten Haar; elegant, wie er die Treppe emporstieg, die Enden des schwarzen seidenen Mantels lässig in die Hosentaschen gesteckt. Goethe war damals der Empfangende, Lernende. Dem fünf Jahre Älteren fühlte er sich in fast allen Belangen unterlegen. Der Umgang war schwierig. Zwar schätzte er Herders ausgebreitete Kenntnisse und tiefe Einsichten, aber er mußte auch dessen Schelten und Tadeln ertragen. Das war er nicht gewohnt, denn bisher, schreibt Goethe, hatten die älteren und überlegenen Personen ihn mit Schonung zu bilden gesucht, ihn vielleicht durch Nachgiebigkeit sogar verzogen. Von Herder aber, der ihm mit seinen Ideen den Kopf neu aufsetzte, konnte man niemals eine Billigung erwarten, man mochte sich anstellen, wie man wollte. Goethe mußte also zuvor seine Eitelkeit überwinden, um sich zu neuen Ansichten täglich, ja stündlich befördern lassen zu können.
Er sah in Herder den Abenteurer des Geistes, der von hoher See zurückgekehrt ist und den frischen Fahrtwind mitbringt, der die Phantasie anregt. So eingestimmt schreibt er ihm am 10. Juli 1772: Noch immer auf der Woge mit meinem kleinen Kahn, und wenn die Sterne sich verstecken, schweb ich so in der Hand des Schicksals hin, und Mut und Hoffnung und Furcht und Ruh wechseln in meiner Brust.
Wahrscheinlich hatte Herders Aufbruch und Ausbruch dem jungen Goethe das Vorbild gegeben für die Studierzimmer-Szene im »Urfaust«, die noch unter dem Eindruck der ersten Begegnung mit Herder entstanden war. Weh! steck ich in dem Kerker noch? / …/ Beschränkt von all dem Bücherhauf, / … / Flieh! Auf hinaus ins weite Land … Wie Faust aus dem dumpfen Mauerloch seiner Studierstube, so war eben auch Herder aus der Rigaer Domkirche geflohen.
Eine Fülle von Ideen sind ihm bei seiner Reise gekommen. Damals liegt noch alles in schöner Verwirrung ungeschieden beieinander. Er sucht noch nach einer Sprache, um das innere Gewoge zu fassen. Die Vernunft, so schreibt er, ist immer eine spätere Vernunft. Sie arbeitet mit Begriffen der Kausalität und kann darum das schöpferische Ganze so nicht begreifen. Warum? Kausale Vorgänge sind vorhersehbar, schöpferische nicht. Deshalb sucht Herder nach einer Sprache, die sich der geheimnisvollen Bewegtheit des Lebens anschmiegt, eher Metaphern als Begriffe. Vieles bleibt vage, angedeutet, geahnt. Bei manchen Zeitgenossen wird Herder mit dem Schwebenden und Schweifenden seiner Sprache Anstoß erregen. Kant beispielsweise schrieb einmal mit ironischer Bescheidenheit an Hamann, dieser möge ihm doch erklären, was sein Freund Herder denke, aber womöglich in der Sprache der Menschen … denn ich armer Erdensohn bin zu der Göttersprache der anschauenden Vernunft gar nicht organisiert. Was man mir aus den gemeinen Begriffen nach logischen Regeln vorbuchstabieren kann, das erreiche ich noch wohl.
Herder war unbescheiden genug, den Begriff der Vernunft erneuern zu wollen — auch gegen Kant, bei dem er zunächst studiert hatte und dem er freundschaftlich verbunden war. Solange Kant, in seiner vorkritischen Phase, kosmologische Spekulationen über die Entstehung des Weltalls, der Sonnensysteme und der Erde anstellte und anthropologische, völkerkundliche und geographische Forschungen vortrug, fühlte sich Herder ihm auch geistig verbunden. Das war nach seinem Geschmack, dieses Staunen vor der Vielfalt der erscheinenden Welt. Als der Königsberger Philosoph aber begann, dem Verstand seine Grenzen vorzurechnen und die Bedeutung der Intuition und Anschauung herabzusetzen, trennten sich die Wege. Die »Kritik der reinen Vernunft« galt Herder als leerer Wortkram und Ausdruck unfruchtbarer Bedenklichkeiten. Wie Hegel eine Generation später hielt er Kant vor, es könnte die Furcht zu irren selbst der Irrtum sein. Er jedenfalls wollte sich von den erkenntniskritischen Präliminarien nicht behindern lassen, sondern ins volle Leben greifen. Herder spricht von der lebendigen im Gegensatz zur abstrakten Vernunft. Die lebendige Vernunft ist konkret, sie taucht ein ins Element der Existenz, des Unbewußten, Irrationalen, Spontanen, also ins dunkle, schöpferische, treibend-getriebene Leben. ›Leben‹ bekommt bei Herder einen neuen, enthusiastischen Klang. Das Echo ist weithin zu hören. Kurz nach der Begegnung mit Herder wird Goethe seinen Werther ausrufen lassen: Ich finde überall Leben, nichts als Leben …
Herders Lebensphilosophie hat den Geniekult des Sturm und Drang (und später der Romantik) angeregt. Bei wem das Leben frei strömen und seine schöpferische Kraft entfalten kann, der gilt dort als Genie. Es begann damals ein lärmender Kult um die sogenannten ›Kraft-Genies‹; darin war viel Inszenierung und Prätention, aber eben mit Schwung und Selbstgewißheit. Der Geist des Sturm und Drang will Geburtshelfer sein für das Genialische, das als bessere Anlage angeblich in jedem schlummert und nur darauf wartet, endlich zur Welt zu kommen.
Im späteren Rückblick auf den Tumult jener Jahre bezeichnete Goethe im zwölften Buch von »Dichtung und Wahrheit« ziemlich ungnädig das Genie als allgemeine Losung für jene berühmte, berufene und verrufene Literarepoche, in welcher eine Masse junger genialer Männer mit aller Mutigkeit und Anmaßung hervorgebrochen sei, um sich im Grenzenlosen zu verlieren.
Goethe und seine Freunde hatten es tatsächlich einigermaßen toll getrieben in dieser genialischen Zeit. Nach seiner Begegnung mit Herder und der Übersiedlung nach Weimar 1776 hatte Goethe diesen beschaulichen Musensitz zum zeitweiligen Hauptquartier des Geniewesens gemacht. Er zog Lenz, Klinger, Kaufmann, die Brüder Stolberg, die damals noch nicht fromm geworden waren, wie einen Kometenschweif hinter sich her. Es gab Festivitäten, von denen die Weimarer Philister noch Jahrzehnte später erzählten. Unter andern wurde damals, so berichtet der Zeitzeuge Carl August Böttiger, ein Geniegelag gehalten, das sich gleich damit anfing, daß alle Trinkgläser zum Fenster hinausgeworfen, und ein paar schmutzige Aschenkrüge, die in der Nachbarschaft aus einem alten Grabhügel genommen worden waren, zu Pokalen gemacht wurden. Man überbot sich in Gesten und Auftritten, die ungebührlich wirken sollten. Lenz spielte den Narren, Klinger tat sich hervor, indem er ein Stück rohes Pferdefleisch verzehrte, Kaufmann fand sich bei der herzoglichen Tafel ein, die Brust bis auf den Nabel nackt, offenes, flatterndes Haar und mit einem gewaltigen Knotenstock. Zu Goethes ›Geniestreichen‹ gehörte eine Reise mit dem herzoglichen Freund zu Pferde, unterwegs wechselte man die Verkleidung und suchte erotische Abenteuer. In Stuttgart, berichtet Böttiger, bekam man den Einfall, an Hof zu gehn. Plötzlich mußten alle Schneider herbei, und Tag und Nacht an Hofkleidern arbeiten. Dann traten die beiden bei der Jahresabschlußfeier der Stuttgarter Akademie in Erscheinung. Da standen die beiden bewunderten Genies auf der Durchreise, der Weimarer Herzog und sein Freund Goethe, als Ehrengäste an der Seite Karl Eugens auf der Empore und beobachteten mit milder Herablassung eine Preisverleihung, bei der ein Schüler ausgezeichnet wurde, der seine Geniekarriere noch vor sich hatte: Friedrich Schiller. Auch er wird in seiner Sturm-und-Drang-Phase das starke Leben feiern und zur Geltung bringen.
Das Leben in seiner gärenden und keimenden Unruhe ist auch etwas Ungeheures, wovor das Bewußtsein zurückschreckt. Herder verweist, wie später Nietzsche, auf den auch beängstigenden ›Abgrund‹ des Lebendigen. Trefflich auch, daß … die tiefste Tiefe unsrer Seele mit Nacht bedeckt ist! Unsre arme Denkerin war gewiß nicht im Stande, jeden Reiz, das Samenkorn jeglicher Empfindung, in seinen ersten Bestandteilen zu fassen: sie war nicht im Stande, ein rauschendes Weltmeer so dunkler Wogen laut zu hören, ohne daß sie es mit Schauer und Angst, mit der Vorsorge aller Furcht und Kleinmütigkeit umfinge und das Steuer ihrer Hand entfiele. Die mütterliche Natur entfernte also von ihr, was von ihrem klaren Bewußtsein nicht abhangen konnte … sie steht auf einem Abgrunde von Unendlichkeit und weiß nicht, daß sie darauf steht; durch diese glückliche Unwissenheit steht sie fest und sicher.
Herders Begriff der lebendigen Natur umfaßt das Schöpferische, dem man sich euphorisch überläßt, aber auch das Unheimliche, das einen bedroht. Es sind gerade diese gemischten Empfindungen, die sich Herder bei seiner Schiffsreise aufdrängen.
Die wichtigsten Ideen, die sich aus dem Gedankentumult auf offener See in der Folgezeit deutlich herausschälen und dann auf die Romantiker einwirken werden, sind die folgenden: Alles ist Geschichte. Das gilt nicht nur für den Menschen und seine Kultur, sondern auch für die Natur. Es ist ein neuer Gedanke, Naturgeschichte als Entwicklungsgeschichte zu verstehen, welche die Vielfalt der natürlichen Gestalten hervorbringt, denn damit wird die göttliche Weltschöpfung in den Naturprozeß hineingenommen. Natur ist selbst jene schöpferische Potenz, die früher in einen außerweltlichen Bereich verlagert wurde. Die Entwicklung durchläuft verschiedene Stufen, die mineralische, die vegetative und die animalische. Jede Stufe hat ihr Recht in sich, aber enthält zugleich den Keim zur jeweils höheren. Und alle Stufen sind Vorstufen des Menschen. Dessen Auszeichnung besteht darin, daß er die schöpferische Potenz, die in der Natur wirkt, nun in eigene Regie nehmen kann und muß. Er kann es aufgrund seiner Intelligenz und der Sprache, und er muß es, weil er instinktarm und darum ungeschützt ist. Die kulturschaffende Potenz ist also Ausdruck sowohl einer Stärke wie einer Schwäche.
Mit diesem Gedanken ist Herder der Vorläufer der modernen Anthropologie, mit dem Menschen als dem kulturschaffenden Mängelwesen. Für Herder gehört die Kulturgeschichte der Menschheit zur Naturgeschichte, aber einer Naturgeschichte, in der die bisher ohne Bewußtsein wirkende Naturkraft im menschlichen Denken und seiner absichtsvollen Schöpferkraft zum Bewußtsein ihrer selbst durchgedrungen ist. Die Umgestaltung des Menschen durch sich selbst und die Bildung der Kultur als Lebensmilieu nennt Herder die Beförderung der Humanität. Humanität steht nicht gegen Natur, sondern ist in bezug auf den Menschen die wahrhafte Realisierung seiner Natur. Herder hat dem 19. Jahrhundert den Begriff einer dynamischen, offenen Geschichte vermacht. Da gibt es keinen Traum einer paradiesischen Vorgeschichte, in die man am besten wieder zurückkehrt. Jeder Augenblick, jede Epoche enthält eine eigene Herausforderung und eine Wahrheit, die es zu ergreifen und umzubilden gilt. Damit begibt sich Herder in scharfen Gegensatz zu Rousseau, für den die gegenwärtige Zivilisation eine Verfalls- und Entfremdungsform menschlichen Lebens darstellt: Das menschliche Geschlecht hat in allen seinen Zeitaltern, nur in jedem auf andre Art, Glückseligkeit zur Summe; wir, in dem unsrigen, schweifen aus, wenn wir wie Rousseau Zeiten preisen, die nicht mehr sind, und nicht gewesen sind, schreibt Herder im »Journal«. Geschichte ist auch nicht ein blindes Ungefähr wie bei den französischen Materialisten, dem Zufall und dem seelenlosen Mechanismus preisgegeben. Sie ist sinnhaft, wenn auch nicht auf ein geistig vorweg erfaßbares Ziel hin geordnet. Die Verwirklichung der Humanität ist eine Art experimentum mundi, ein offener Prozeß, dessen Verlauf vom Menschen abhängt, auch wenn im Hintergrund eine Naturabsicht wirkt. Da diese aber nicht explizit zu erfassen ist, bleibt nichts anderes übrig, als das Werk der Selbstgestaltung nach den Maßstäben zu vollbringen, die sich der Mensch selber setzt. Sie wirken als innerer Kompaß, der die jeweilige Richtung anzeigt, in der ein Höchstmaß an gemeinschaftlicher Selbstentfaltung gefunden werden kann. Der Geschichtsprozeß verläuft nicht linear, sondern vollzieht sich über Brüche und Umbrüche. Mit Stößen und Revolutionen … mit Empfindungen, die hie und da schwärmerisch, gewaltsam, gar abscheulich werden sei zu rechnen, schreibt Herder. Davon solle man sich nicht schrecken lassen, das gehöre zu den vulkanischen Formen, in denen das Neue hervorbricht.
So dynamisch und emphatisch war Geschichte bisher noch nie begriffen worden, und es ist erstaunlich, daß dies ausgerechnet in dem kleinstaatlich zersplitterten und gesellschaftlich zurückgebliebenen Deutschland geschah, wo die reale Geschichte gewissermaßen eingefroren war. Es war wie eine Einstimmung auf das große Ereignis der Französischen Revolution, denn erst dann war es in der Wirklichkeit so weit, daß die Geschichte das zu halten schien, was sich Herder zwei Jahrzehnte zuvor von ihr versprochen hatte.
Es war bisher immer von ›dem Menschen‹ im kollektiven Singular die Rede. Herder aber — und das ist nach dem Begriff der dynamischen Geschichte sein zweiter wirkungsmächtiger Gedanke — hat den Individualismus oder Personalismus und daraus folgend die Pluralität entdeckt.
›Der‹ Mensch ist ein Abstraktum, es gibt nur ›die‹ Menschen. So wie das Leben insgesamt auf jeder Stufe seiner Entwicklung eigenes Recht und eigene Bedeutung besitzt, so verhält es sich auch mit dem Menschengeschlecht. Jedes Individuum prägt in jeweils besonderer Weise das aus, was der Mensch ist und sein kann. Herder vertritt einen radikalen Personalismus. Es gibt die Menschheit als abstrakte Größe, und es gibt die Menschheit, die jeder in sich achten und zur individuellen Gestalt bringen kann. Auf sie kommt es an. Aus dieser Perspektive ist die Geschichte dann nicht nur das große Panorama, vor dem sich der Einzelne abhebt. Die bewegenden Grundkräfte der Geschichte, die man dort draußen entdeckt, müssen und können vom Einzelnen als schöpferische Lebendigkeit in ihm erfahren werden, ein Zusammenhang, den Herder auf seiner Schiffsreise geradezu ekstatisch erlebte. Nur wer das schöpferische Prinzip am eigenen Leib erfährt, wird es auch draußen im Lauf der Welt und in der Natur entdecken. Diesen Gedanken wird Goethe später in den »Maximen« in dem Satz resümieren: Über Geschichte kann niemand urteilen, als wer an sich selbst Geschichte erlebt hat.
Der Einzelne, der sich zum Individuum bildet, ist und bleibt das Sinnzentrum, auch wenn er, was nicht zu leugnen ist, stets einer Gemeinschaft bedarf. Sie aber, so Herder, sollte so organisiert sein, daß jeder seinen individuellen Lebenskeim entfalten kann. Die Gemeinschaft ist eine Verbindung zur gegenseitigen Hilfe bei dieser Entwicklung. Dabei ergibt die Vereinigung der Einzelnen in der Gemeinschaft nicht einfach eine Summe, sondern sie bildet durch das Zusammenwirken einen jeweils besonderen Geist, der aus der Vereinigung entspringt und dem Einzelnen eine geistige Lebensluft gibt. Für Herder ist der Mensch als Individuum eingebettet in der Gemeinschaft, einer Art größerem Individuum. Herder sieht konzentrische Kreise, von der Familie, den Stämmen, den Völkern, Nationen bis hinauf zu der Gemeinschaft von Nationen, die auf ihrem Niveau eine geistige Synthese bilden. In bezug auf die Völker spricht Herder von den Volksgeistern. Wichtig aber ist: Diese größeren Einheiten werden vom Individuum her gedacht. Wie die einzelnen Individuen untereinander, so bilden auch diese größeren Einheiten eine Pluralität — die der Volksgeister.
Um diesen Volksgeistern auf die Spur zu kommen, hat Herder auf seiner Schiffsreise den Plan gefaßt, Volkslieder und sonstige kulturelle Zeugnisse der Völker zu sammeln. Er wird ihn in die Tat umsetzen und damit den Romantikern Anstoß und Vorbild sein, diese Sammeltätigkeit fortzusetzen.
Herder bleibt auch beim Sammeln der alten Volkslieder Individualist. Denn was für den Einzelnen gilt — daß er bei der Entfaltung seiner Eigenart die Eigenart der anderen nicht nur respektieren, sondern als Gewinn ansehen sollte —, gilt auch für die Volksgeister. Viele Völker, viele Stimmen. Die Vielfalt erst läßt den Reichtum des Menschlichen blühen. Engherziger Patriotismus liegt ihm fern. Er will helfen, die anderen Völker in ihren Traditionen besser zu verstehen. Der Denkart der Nationen bin ich nachgeschlichen, und was ich ohne System und Grübelei herausgebracht, ist: daß jede sich Urkunden bildete, nach der Religion ihres Landes, der Tradition ihrer Väter, und den Begriffen der Nationen: daß diese Urkunden in einer dichterischen Sprache, in dichterischen Einkleidungen, und poetischem Rhythmus erscheinen: also mythologische Nationalgesänge vom Ursprunge ihrer ältesten Merkwürdigkeiten.
Herder hatte in Riga in einem bunten Völkergemisch gelebt zwischen Russen, Livländern und Polen. Die Oberschicht, politisch maßgeblich in der unter russischer Oberhoheit stehenden Stadtrepublik, war deutsch. Inmitten der anderen Völkerschaften schärfte sich zwar Herders Sinn für deutsche Kulturtradition, aber er versuchte als Prediger und Seelsorger die Abschottung der deutschen Gemeinde zu durchbrechen — aus Neugier und aus Gerechtigkeitsempfinden gegenüber den zumeist in großer Armut lebenden Livländern und Russen. Herder beruft sich in seiner Einleitung zu der Liedersammlung »Stimmen der Völker« auf seine Rigaer Erlebnisse mit der einheimischen Volkskultur und Dichtung: Wissen Sie also, daß ich selbst Gelegenheit gehabt, lebendige Reste dieses alten, wilden Gesanges, Rhythmus, Tanzes unter lebendigen Völkern zu sehen, denen unsere Sitten noch nicht völlig Sprache und Lieder und Gebräuche haben nehmen können, um ihnen dafür etwas sehr Verstümmeltes oder nichts zu geben.
Der Volkslieder-Sammler Herder vergewisserte sich zwar seiner eigenen kulturellen Wurzeln und war bestrebt, ›deutsche Art und Kunst‹ zu befördern und zu beleben, aber ohne Überheblichkeit. Wenn er sie bei anderen spürte oder wenn er bemerken mußte, daß man ihn selbst so verstand und darum mißverstand, reagierte er sehr ungehalten. Was ist Nation? Ein großer, ungejäteter Garten voll Kraut und Unkraut. Wer wollte sich dieses Sammelplatzes von Torheiten und Fehlern so wie von Vortrefflichkeiten und Tugenden ohne Unterscheidung annehmen und … gegen andre Nationen den Speer brechen? Lasset uns, so viel wir können, zur Ehre der Nation beitragen; auch verteidigen sollen wir sie, wo man ihr Unrecht tut … sie aber ex professo preisen, das halte ich für einen Selbstruhm … Offenbar ist die Anlage der Natur, daß wie Ein Mensch, so auch Ein Geschlecht, also auch Ein Volk von und mit dem andern lerne … bis alle endlich die schwere Lektion gefaßt haben: kein Volk ist ein von Gott einzig auserwähltes Volk der Erde; die Wahrheit müsse von allen gesucht, der Garten des gemeinen Besten von allen gebauet werden … So darf sich auch kein Volk Europas vom andern abschließen, und töricht sagen: bei mir allein, bei mir wohnt alle Weisheit.
Herders Patriotismus war demokratisch und setzte auf die Vielfalt der Kulturen. Viele Wege führen — wohin? Jedenfalls nicht zu einer Herrschaft des einen Volkes über andere, sondern, so Herders Wunschbild, in einen Garten der Vielfalt, wo die Volkskulturen in Abgrenzung, Austausch und wechselseitiger Befruchtung ihre jeweils besten Möglichkeiten entwickeln. Das schöpferische Prinzip, das er in den Volkskulturen am Werke sah, machte ihm auch die Demokratie so sympathisch, daß seine Parteinahme für die Französische Revolution später Goethe verstimmte und dieser seinen Freund Herder gelegentlich einen Jakobiner reinsten Wassers schalt.
Die Entdeckung der dynamischen Geschichte mit allem was daraus folgt, vom stolzen Individualismus bis zur Demut vor den alten Zeugnissen der Volkskultur, bewirkte eine wirkliche Zäsur des abendländischen Geistes. Seitdem ist es selbstverständlich geworden, die Dinge geschichtlich zu sehen. Geschichte relativiert alles. Sie wird selbst zu etwas Absolutem; kein Gott, keine Idee, keine Moral, keine Gesellschaftsordnung, kein Werk können sich ihr gegenüber von nun an als etwas Absolutes behaupten. Selbst das Gute, Wahre, Schöne, einst am Himmel der unwandelbaren Ideen und Offenbarungen fixiert, geraten in den Sog des Werdens — und Vergehens. Auch das Schöne muß sterben, heißt es bei Schiller, und die Götterdämmerung und die Umwertung der Werte werden auch eine Folge des geschichtlichen Bewußtseins sein. Und darum kann man von Herders Gedanken auf offener See sagen: Sie sind schon romantisch, weil sie uns einstimmen auf das Schaukeln der Dinge im Strom der Zeit.
Zweites Kapitel
Von der politischen zur ästhetischen Revolution. Politische Ohnmacht und poetische Kühnheit. Schiller ermuntert zum großen Spiel. Die Romantiker bereiten ihren Auftritt vor.
Zwischen Herders Seefahrt und der Frühromantik ereignet sich ein großer Zeitenbruch, die Revolution in Frankreich. Sie hat dem deutschen intellektuellen Leben Impulse gegeben wie kein anderes politisches Ereignis. Der frühromantische Aufbruch ist Sturm und Drang, der durch die Erfahrung der Revolution hindurchgegangen ist.
In Frankreich waren Dinge geschehen, von denen die Zeitgenossen auch in Deutschland sofort überzeugt waren, daß sie von weltgeschichtlicher Bedeutung seien und noch bei den künftigen Generationen Entsetzen und Bewunderung hervorrufen würden. Es sind Ereignisse, die im Augenblick des Geschehens bereits in mythischem Glanz erstrahlen und als Urszenen der Geburt eines neuen Zeitalters gedeutet werden. Ereignisse, die, kaum geschehen, schon überall, auch im fernen Tübingen, Jena oder Weimar als buchenswert und als ›klassisch‹ empfunden werden: der ›Ballhausschwur‹ am 20. Juni 1789, als die Deputierten des Dritten Standes sich als Nationalversammlung konstituieren und ihre Absicht beschwören, beieinander zu bleiben, bis eine neue Verfassung beschlossen ist; die Entlassung des liberalen Finanzministers Necker am 11. Juli als erster Akt der Gegenrevolution und die darauffolgende Erstürmung der Bastille am 14. Juli; das Wüten der Lynchjustiz; die ersten Aristokraten an der Laterne; die Bildung der Nationalgarde; am 17. Juli die erste Kapitulation des Königs, der sich vor der Nationalgarde verbeugt und die Kokarde nimmt; der Zusammenbruch der Staatsgewalt in den Provinzen, die Revolte der Bauern und der Umsturz in den Städten; die ›große Furcht‹, die das Land in Atem hält; der Beginn der Emigration des Adels — auf der Straße nach Turin flieht die ›Zierde‹ des alten Frankreichs, an der Spitze des Zugs der Tausend die beiden Brüder des Königs — die denkwürdige Nacht vom 3. auf den 4. August, als die Nationalversammlung, berauscht von der eigenen Kühnheit, mit zahllosen pathetischen Dekreten das jahrhundertealte Feudalsystem Frankreichs zerschlägt; die feierliche Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte am 26. August; der zweite große Aufstand in Paris am 5. Oktober, als die Marktfrauen den König und die Nationalversammlung zur Übersiedlung von Versailles nach Paris nötigen.
Aus der Ferne einer späteren Zeit erscheinen die Jahre zwischen 1789 und 1804, als sich Napoleon zum Kaiser krönte, wie ein großer historischer Augenblick, für die Zeitgenossen aber war es ein langwieriger, verwickelter Prozeß. Regierungsformen lösten sich ab, von der absoluten zur konstitutionellen und dann zur parlamentarischen Demokratie, die ihrerseits überging in die jakobinische Diktatur; es folgte das autoritäre ›Direktorium‹ und schließlich die napoleonische Kaiserherrschaft, die restaurative und revolutionäre Elemente verband. Dazwischen die Hinrichtung des Königs, Terror, Kriege, die sowohl die Errungenschaften wie die Schrecken der Revolution auch nach Deutschland trugen.
Die Chance für eine Revolution von unten bestand in Deutschland nicht, wenn man vom Zwischenspiel der Mainzer Republik (1793) absieht, die sich unter französischem Schutz einige Monate halten konnte, nicht ohne daß die Öffentlichkeit regen Anteil daran nahm — auch weil der berühmte Naturforscher, Schriftsteller und Weltumsegler Georg Forster dabei mitwirkte. Das Ende war fatal, für die Republik und für Georg Forster. Die alliierten Truppen — Goethe befand sich mit seinem Herzog in ihrem Gefolge — eroberten im Sommer 1793 die Stadt zurück, und es setzte eine Treibjagd auf die Republikaner ein. Georg Forster aber, der nach Paris gesandt worden war, um den Anschluß der Stadt an Frankreich zu erwirken, starb dort im Januar 1794, verbittert und verarmt. Also keine Revolution von unten. Um so einschneidender aber war die Revolution von oben. Binnen weniger Jahre brach die alte Staatenordnung zusammen, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation versank, und es bildete sich in Deutschland ein neues Staatensystem heraus; regierende Häuser wurden von Napoleon entmachtet, mediatisiert, in den Rheinbundstaaten wurde das bürgerliche Gesetzbuch des napoleonischen Frankreich eingeführt.
Daß die Ereignisse in Frankreich eine Zeitenwende bedeuteten, daß von nun an eine neue Epoche begonnen hatte, war den meisten Schriftstellern und Intellektuellen in Deutschland sofort klar. Dem Pathos der geschichtlichen Stunde konnte man sich kaum entziehen. Ein solches Phänomen in der Menschheitsgeschichte, schreibt Kant, vergißt sich nicht mehr, weil es eine Anlage und ein Vermögen in der menschlichen Natur zum Besseren aufgedeckt hat, dergleichen kein Politiker aus dem bisherigen Lauf der Dinge herausgeklügelt hätte. Auch Hegel datiert, wie Kant, von der Französischen Revolution an eine neue Epoche in der Menschheitsgeschichte: Solange die Sonne am Firmament steht und die Planeten um sie herumkreisen, war das nicht gesehen worden, daß der Mensch sich auf den Kopf, d.i. auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut. Man nahm die Revolution wahr als eine Urszene des gesellschaftsbegründenden Handelns. Was bisher in den aufgeklärten Vertragstheorien, zuletzt bei Rousseau, in eine abstrakte Vorgeschichte und einen ebenso abstrakten Raum hineinprojiziert worden war, von dem glaubte man jetzt, daß es sich vor aller Augen und in greifbarer Gegenwart abspielte. Das gab dem Ereignis die Aura einer, wie Kant sagt, wahrsagenden Geschichte. Wer sich zuvor schon zu den philosophischen Ideen der Freiheit und Gleichheit bekannte, konnte mit dem Revolutionsgegner Friedrich Gentz in der Revolution den praktischen Triumph der Philosophie erblicken. Da es also die eigenen Gedanken waren, die hier zur Tat wurden, konnte man sich noch in der Entfernung als Mittäter empfinden. Nun endlich war der Beweis erbracht, daß Denken und Schreiben die Welt nicht nur interpretiert, sondern sie auch verändert, vielleicht, daß überhaupt die Idee und der Geist die Welt regieren und daß es nur darauf ankommt, die richtigen Gedanken zu finden, die den Nerv der Zeit treffen. Viele Intellektuelle auch außerhalb Frankreichs sahen die Revolution als ›ihre‹ Revolution an, weil sie glaubten, sie hätten sie mitbewirkt. Gerade auch Kants Sympathie für die Revolution, die er trotz aller Bedenken im einzelnen bis an sein Lebensende beibehielt, ist auf ein solches Gefühl der geistigen Teilhabe und Mitverantwortung gegründet. Für ihn war in Frankreich gewissermaßen stellvertretend für die ganze Menschheit der große praktische Versuch unternommen worden, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszukommen.
So kam es, daß die Revolution, zunächst jedenfalls, dem Idealismus Auftrieb gab. Der Idealismus, schreibt Friedrich Schlegel, ist in praktischer Ansicht nichts anders als der Geist jener Revolution, und Hegel erklärt, die Vernunft habe sich wie ein Maulwurf durch das schwere Erdreich hindurchgewühlt und sei nun ans Tageslicht durchgedrungen. Das Bild von der Revolution als Tageslicht oder Morgenröte findet sich bei fast jedem Schriftsteller in den frühen 90er Jahren, mit dem vielleicht eindringlichsten Pathos vorgetragen vom alten Klopstock, den die Revolution zu einem späten lyrischen Frühling verhalf: Der kühne Reichstag Galliens dämmert schon, / Die Morgenschauer dringen den Wartenden / Durch Mark und Bein: o komm, du neue, / Labende, selbst nicht geträumte Sonne!
Die jungen Romantiker gehören zunächst auch zu den Enthusiasten der geschichtlichen Morgenröte. Hölderlin, Hegel und Schelling errichten in Tübingen einen Freiheitsbaum. Schelling will sein Theologiestudium an den Nagel hängen, will dem Pfaffen- und Schreiberlande entkommen und sehnt sich nach den freieren Lüften in Paris. Der Gymnasiast Ludwig Tieck dichtet ein Drama über die Volkserhebung: Nahe dich, Freiheit, / Daß ich mich stürze / Dir in die Arme … Und noch drei Jahre später, 1792, schreibt er an Wackenroder: Oh wenn ich izt ein Franzose wäre! Dann wollt’ ich nicht hier sitzen, dann ——— Doch leider bin ich in einer Monarchie, die gegen die Freiheit kämpft, unter Menschen, die noch Barbaren genug sind, die Franzosen zu verachten … Oh, in Frankreich zu sein — es muß doch ein großes Gefühl sein, unter Dumouriez zu fechten und Sklaven in die Flucht zu jagen und auch zu fallen — was ist ein Leben ohne Freiheit? Wackenroder, dieser zartbesaitete Jüngling, stimmt von ganzem Herzen in Tiecks Enthusiasmus ein, und nachdem das Haupt des Königs gefallen ist, bemerkt er kühl: Die Hinrichtung des Königs von Frankreich hat ganz Berlin von der Sache der Franzosen zurückgeschreckt; aber mich gerade nicht. Über ihre Sache denke ich wie sonst. Aber anders als Tieck gesteht sich Wackenroder ein, daß es ihm wohl doch an Mut fehlt, sich für die Revolution zu schlagen. Allerdings hält sich auch Tiecks Begeisterung in rhetorischen Grenzen. Auf eine praktische Bewährung läßt er es nicht ankommen. Auch der junge Schleiermacher verurteilt am Beginn des ersten Koalitionskriegs die despotischen Absichten der europäischen Fürsten, welche die Revolution zu ersticken trachten, und hält das Gesalbtsein eines Monarchen für keinen hinreichenden Grund, ihm nicht den Kopf abzuschlagen. Fichte veröffentlicht seine »Beiträge zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die Französische Revolution«, worin er dem Volk ausdrücklich das Recht auf eine Revolution zubilligt und erklärt, daß es dabei durchaus auch gewaltsam zugehen könne. Friedrich Schlegels 1796 erschienene Abhandlung »Versuch über den Begriff des Republikanismus« verficht, Kants Verteidigung der repräsentativen Demokratie noch überbietend, die direkte Demokratie, die seiner Ansicht nach auf die Gewaltenteilung — für Kant ein essentieller Bestandteil des Republikanismus — verzichten kann. Zur Zeit der Abfassung dieser Schrift war Schlegel allerdings besonders eng mit den revolutionären Ereignissen verbunden, da er sich in Caroline Böhmer verliebt hatte, die bei der Mainzer Republik als Freundin Georg Forsters tätig mitgewirkt hatte und sich deshalb vor dem Zugriff der Behörden versteckt halten mußte. Caroline wird später den Bruder August Wilhelm heiraten, um dann auf dem Höhepunkt der romantischen Geselligkeit in Jena zu Schelling überzuwechseln.
Auch in den Briefen von Novalis findet sich Revolutionsenthusiasmus. Von Freiheitsglut, Sklaverei, Tyrannenhaß ist dort die Rede. Novalis schwelgt in revolutionärer Metaphorik. Als er seinem Freund Friedrich Schlegel am 1. August 1794 seine Sehnsucht nach Brautnacht, Ehe und Nachkommenschaft gesteht, schildert er die Verwirklichung seiner Wünsche als eine Art Revolution, die ihn endlich aus der häuslichen Bevormundung befreien würde: Wollte der Himmel, meine Brautnacht wäre für Despotismus und Gefängnisse eine Bartholomäinacht, dann wollt ich glückliche Ehestandstage feiern.
Die Revolution hatte eine so gewaltige Ausstrahlung, weil man sich von ihr nicht nur die Beseitigung eines ungerechten Herrschaftssystems versprach, sondern von Herrschaft überhaupt. Die Veränderung der politischen Institutionen würden, so hoffte man, den besseren, den freien Menschen endlich zum Vorschein bringen. Man glaubte, Zeuge eines welthistorischen Experimentes zu sein, bei dem es um die Frage ging: Wieviel freie Selbstbestimmung ist möglich und welche äußeren Gesetze und politische Ordnungen sind dafür nötig?
Viele von denen, die anfangs die Revolution begeistert begrüßten, wandten sich später ab, als Terror und neue Unterdrückung im Namen der Freiheit überhandnahmen. Sogar Georg Forster schreibt am 16. April 1793 aus Paris: Die Tyrannei der Vernunft, vielleicht die eisernste von allen, steht der Welt noch bevor … Je edler das Ding und je vortrefflicher, desto teuflischer der Mißbrauch. Brand und Überschwemmung, die schädlichen Wirkungen von Feuer und Wasser, sind nichts gegen das Unheil, das die Vernunft stiften wird.
Tatsächlich erweist sich die Vernunft tyrannisch mit ihrer Neigung, tabula rasa machen zu wollen, Überlieferungen, Anhänglichkeiten, Gewohnheiten, also die ganze Geschichte, in die man verwickelt ist, zu zerstören. Es ist die Verlockung zum großen Reinemachen, zur Beseitigung einer Tradition, die nur noch als Gerümpel aus großer Zeit gilt. Tyrannisch ist also die unhistorische Vernunft, die sich anmaßt, alles neu und besser zu machen. Tyrannisch ist die Vernunft zweitens, wenn sie sich anmaßt, ein wahres Menschenbild zu entwerfen, wenn sie vorgibt, zu wissen, was im allgemeinen Interesse liegt, wenn sie im Namen des Allgemeinwohls ein neues Regime der Unterdrückung etabliert.
Der Verlauf der Revolution wird diese Tyrannei der Vernunft enthüllen. Es werden zwar die allgemeinen Menschenrechte — Sicherheit des Lebens, des Eigentums und der Meinungsäußerung — proklamiert, aber sie bieten keinen Schutz gegen die Willkür der neuen Volksvertreter, die sich als Dolmetscher des wahren Volkswillens aufspielen und die angeblichen Volksfeinde terrorisieren, zu denen bald jeder gerechnet werden kann, der dem Menschenbild der Wohlfahrtsausschüsse nicht entspricht oder aus anderen Gründen bei den Machthabern in Mißkredit geraten ist.
Diese Tyrannei der Vernunft wird von einer neuen intellektuellen Elite ausgeübt, die das moderne Instrument der Massenmobilisierung zu nutzen weiß. In der Folge der Französischen Revolution betreten zum ersten Mal die Massen die Bühne der Geschichte. Die Pogrome während der Jakobiner-Herrschaft sind unmittelbare Folge dieses historisch neuen Bündnisses zwischen Elite und Mob — ein Vorspiel der totalitären Exzesse im 20. Jahrhundert.
Mit der Revolution entsteht zuerst in Frankreich, dann aber überall in Europa ein neues Politikverständnis. Politik, bisher eine Spezialität der Höfe, läßt sich nun als ein Unternehmen verstehen, das man zur Herzensangelegenheit machen kann. Man muß sich die gewaltige Zäsur klarmachen, die diese Explosion des Politischen zur Folge hat. Die Sinnfragen, für die zuvor die Religion zuständig war, werden jetzt an die Politik gerichtet; ein Säkularisierungsschub, der die sogenannten ›letzten‹ Fragen in gesellschaftlich-politische verwandelt: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind politische Losungen, die ihre religiöse Herkunft kaum verleugnen.
Bis zur Französischen Revolution war Geschichte für die meisten ein schicksalhaftes Geschehen, das wie jede Seuche oder Naturkatastrophe über einen hereinbrach. Die Ereignisse von 1789 lassen bei den Zeitgenossen eine verstehende Wahrnehmung von historischen Abläufen in großem Stil entstehen, die sich, synchron zu ihrer Politisierung, beschleunigen. Die Revolutionsarmeen, die Europa überschwemmen, bringen nicht nur das Ende der alten Kabinetts- und Söldnerkriege, darüber hinaus bedeuten die Volksheere, dieser Inbegriff einer waffenstarrenden Nation, daß die Historie nunmehr auch den kleinen Mann zur Mittäterschaft rekrutiert. In den Sog dieser Politisierung geraten in Deutschland die meisten Schriftsteller, ob sie nun, wie die jungen Romantiker, sich zunächst für die Revolution begeistern oder sich skeptisch verhalten, wie etwa Wieland, oder ob sie, wie Matthias Claudius, zu erbitterten Gegnern werden. Auf allen Seiten ist für eine kurze Zeit das politische Raisonnement vorherrschend, und es sind nicht wenige Autoren, die sich gedrängt fühlen, die Sprachkunst in den Dienst des politischen Handelns zu stellen. Es erscheinen in den ersten Jahren eine Fülle von Schriften, Gedichten, Dramen, deren hervorstechendes Merkmal darin besteht, daß sie politisch Partei nehmen und häufig sogar pamphletistisch oder agitatorisch gerichtet sind.
Es ist genau diese Atmosphäre der politischen Aufgeregtheit, die Goethe so sehr abgestoßen hat. Für ihn bedeutete die Revolution nichts anderes als den verhängnisvollen Beginn des Massenzeitalters, das er haßte und fürchtete, dessen Unvermeidlichkeit er aber auch einsah. So hat denn die Französische Revolution auch bei Goethe Epoche gemacht, wenn auch nicht in dem positiven Sinne wie bei Kant und Hegel. An Jacobi schrieb er am 3. März 1790: Daß die Französische Revolution auch für mich eine Revolution war, kannst du dir denken. Er habe, notiert er im Rückblick in den »Morphologischen Heften«, viele Jahre gebraucht, dieses schrecklichste aller Ereignisse in seinen Ursachen und Folgen dichterisch zu bewältigen. Die Anhänglichkeit an diesen unübersehlichen Gegenstand habe sein poetisches Vermögen fast unnützerweise aufgezehrt. Tatsächlich spielt die Revolution in fast allen seinen Werken der 90er Jahre eine bedeutsame Rolle, teils als ausdrückliches Thema wie in den »Aufgeregten«, im »Bürgergeneral« oder in der »Natürlichen Tochter«, teils als Hintergrund und Problemhorizont wie in »Hermann und Dorothea« oder in den »Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten«.
Was ist für Goethe so schrecklich an der Revolution?
Er versteift sich nicht auf Interessen und Sichtweisen des Adels und der wohlhabenden Gesellschaft, er bemerkt durchaus empörendes Unrecht und Ausbeutung. An Knebel hatte er einige Jahre vor der Revolution geschrieben: Du weißt aber, wenn die Blattläuse auf den Rosenzweigen sitzen und sich hübsch dick und grün gesogen haben, dann kommen die Ameisen und saugen ihnen den filtrierten Saft aus den Leibern. Und so geht’s weiter, und wir haben’s so weit gebracht, daß oben immer in einem Tage mehr verzehrt wird, als unten in einem beigebracht werden kann (17. April 1782). Indem er die Revolution ablehnt, wird er doch nicht zum Fürsprecher des Ancien Régime. Von der Kampagne in Frankreich 1792 schreibt er an Jacobi, ihm sei weder am Tode der aristokratischen noch demokratischen Sünder im mindesten etwas gelegen (18. August 1792). Das Schreckliche an der Revolution ist für ihn nicht, daß alte und womöglich ungerechte und ausbeuterische Besitzstände in Frage gestellt werden. Das läßt sich rechtfertigen. Das Schreckliche an der Revolution ist für ihn, daß es sich hierbei um einen Vulkanausbruch des Sozialen und Politischen handelt. Nicht zufällig beschäftigt er sich in den Monaten nach der Revolution mit dem ihn beunruhigenden Naturphänomen des Vulkanismus im Gegensatz zum Neptunismus, der Theorie von der allmählichen Veränderung der Erdoberfläche durch die Ozeane. Das Allmähliche zog ihn an, das Plötzliche und Gewaltsame stieß ihn ab, in der Natur ebenso wie in der Gesellschaft. Er hielt es mit den Übergängen, nicht mit Brüchen. Er war ein Freund der Evolution, nicht der Revolution.
Aber das Forcierte der Revolution war es nicht allein, was ihn schreckte. Unheimlich war ihm die Vorstellung, daß die Massen verführbar sind, weil sie von Revolutionsmännern, wie Goethe die Demagogen und Doktrinäre gern nannte, in eine Sphäre hineingerissen werden, wo sie sich nicht auskennen. Politik hat es mit den Angelegenheiten der Gesellschaft als ganzer zu tun. Das setzt eine Denkweise voraus, die nicht nur dem eigenen Interesse folgt, sondern für das Ganze Verantwortung übernehmen kann. Der gewöhnliche Mensch aber, so Goethe, kann sich zu diesem Gesichtspunkt nicht erheben, und darum wird er zur Manövriermasse von Agitatoren. Die allgemeine Politisierung begünstigt das Lügen, Belogenwerden und den Selbstbetrug. Man will das Ganze beherrschen und kann sich nicht einmal selbst beherrschen, man will die Gesellschaft verbessern und weigert sich, mit der Verbesserung seiner selbst zu beginnen. Im Rausch der Masse geht die Vernunft unter, und das Durchbrechen niederer Instinkte wird begünstigt. Anschauungsmaterial dafür liefern der staatliche Terror, der im Jahr 1793 durch Frankreich tobt, die Massenhinrichtungen, die Pogrome, die Plünderungen in den besetzten Gebieten. Was ich mir gefallen lasse? / Zuschlagen muß die Masse, / Dann ist sie respektabel, / Urteilen gelingt ihr miserabel. Wo die Revolution die Köpfe nicht abschlug, reichte ihre Macht immerhin aus, sie zu verwirren. Die Politisierung der Öffentlichkeit empfand Goethe als verhängnisvoll. Er nannte sie eine allgemeine Ermunterung zur Kannegießerei. Er litt unter dem endlosen Geschwätz und Debattieren über Ereignisse, die keiner von denen, die in der Zeitung oder am Stammtisch das große Wort führen, beeinflussen können, und er ärgerte sich über die absurde Verkennung der politischen Realitäten in Deutschland bei den Revolutionsfreunden. Das ganze politisierte Zeitungswesen war ihm verhaßt. Von der Kampagne in Frankreich schreibt er: Leider kommen die Zeitungen überall hin, das sind jetzt meine gefährlichsten Feinde (18. August 1792). Er empörte sich über die Unaufrichtigkeit der Fürstenkritiker, die sich, wie etwa Herder oder Wieland, nicht eingestehen mochten, daß sie selbst Nutznießer der Fürstenherrschaft waren.
Goethes Ablehnung der Revolution ist Ausdruck der Überzeugung, daß die allgemeine Politisierung im beginnenden Massenzeitalter eine fundamentale Verwirrung in der Wahrnehmung des Nahen und des Fernen zur Folge hat. Der Mensch, heißt es in »Wilhelm Meisters Lehrjahren«, ist zu einer beschränkten Lage geboren; einfache, nahe, bestimmte Zwecke vermag er einzusehen, und er gewöhnt sich, die Mittel zu benutzen, die ihm gleich zur Hand sind; sobald er aber ins Weite kommt, weiß er weder was er will, noch was er soll, und es ist ganz einerlei, ob er durch die Menge der Gegenstände zerstreut, oder ob er durch die Höhe und Würde derselben außer sich gesetzt werde. Es ist immer sein Unglück, wenn er veranlaßt wird, nach etwas zu streben, mit dem er sich durch eine regelmäßige Selbsttätigkeit nicht verbinden kann. Gegen die politische Leidenschaft setzt Goethe die aus der Kraft der Begrenzung erwachsene Gestaltung der individuellen Persönlichkeit. Da wir das Ganze nicht umfassen können und das Ferne uns zerstreut, so bilde der Einzelne sich zu etwas Ganzem aus — das ist Goethes Maxime und darum gilt: Höchstes Glück der Erdenkinder / Sei nur die Persönlichkeit (West-östlicher Divan). In diesem fast trotzigen Persönlichkeitsideal steckt auch jene glänzende Ignoranz im Dienste des Lebens, die Nietzsche an Goethe gerühmt hat und die zu seiner prometheischen Gestaltungskraft gehört. Eine Gestaltungskraft, die der Lebensformel entspringt: sich die Welt anverwandeln und sie dadurch zur eigenen machen, aber auch nur so viel davon aufnehmen, wie man sich anverwandeln kann. Daraus folgt: Man muß das Unzukömmliche ohne Skrupel draußen halten. Goethes Welt und Leben blieben geräumig genug, trotz seiner Gesten der Abwehr und Abgrenzung.
Zwar kann sich Goethe von den Einflüssen des politisierten Zeitgeistes nicht ganz freihalten — immerhin kauft er für seinen Sohn August eine Spielzeugguillotine —, aber er ist fest entschlossen, seine Zuflucht vor dem Umtrieb in den ruhigen Betrachtungen seiner Naturforschungen zu suchen. Am 1. Juni 1791 schreibt er an Jacobi über seine Beschäftigung mit Optik und Farbenlehre: Indes attachiere ich mich täglich mehr an diese Wissenschaften, und ich merke wohl, daß sie in der Folge mich vielleicht ausschließlich beschäftigen werden. So war es dann doch nicht. Von Kunst und Literatur mochte er sich nicht trennen, sie bildeten für ihn, neben der Naturbeobachtung, das zweite Bollwerk gegen den aufgeregten Zeitgeist. Die ästhetischen Freuden halten uns aufrecht, indem fast alle Welt dem politischen Leiden unterliegt, schreibt er mit provozierender Ironie an den jakobinisch gesinnten Komponisten und Zeitschriftenherausgeber Reichardt. Und einem Bekannten im französisch besetzten Trier empfiehlt er: Wir haben mehr als jemals jene Mäßigung und Ruhe des Geistes nötig, die wir den Musen allein verdanken können. Als er die Arbeit an seinem liegengebliebenen Roman »Wilhelm Meisters Lehrjahre« wieder aufnimmt, teilt er Knebel am 7. Dezember 1793 mit: Jetzt bin ich im Sinnen und Entschließen womit ich künftiges Jahr anfangen will, man muß sich mit Gewalt an etwas heften. Ich denke es wird mein alter Roman werden.
Die Romantiker haben trotz ihrer Elogen auf Goethe dessen Rückzug aus der revolutionären Geschichte durchaus nicht immer gebilligt. Wenn Friedrich Schlegel in dem berühmten »Athenäum«-Fragment Goethes »Wilhelm Meister« zusammen mit Fichtes Wissenschaftslehre in Parallele zur Französischen Revolution setzte und als Ausdruck einer revolutionären Tendenz verstand, die eben nicht laut und materiell, dafür um so nachhaltiger sei, dann mochte Novalis dem nicht zustimmen. Er war der Auffassung, daß sich Goethes Quietismus im »Wilhelm Meister« als Mangel an Poesie ausgewirkt habe. Er nennt das Werk einen prosaischen Roman und vermißt die poetische Kühnheit. Diese aber gilt ihm als Entsprechung zum revolutionären Enthusiasmus in der politischen Welt. Goethe sei in seinen Werken, schreibt er, höchst einfach, nett, bequem und dauerhaft und es komme ihm eher darauf an, etwas Unbedeutendes ganz fertig zu machen — ihm die höchste Politur und Bequemlichkeit zu geben, als eine Welt anzufangen und etwas zu tun, wovon man vorauswissen kann, daß man es nicht vollkommen ausführen wird … Eine neue Welt anzufangen, ob in der Poesie oder der Philosophie, bedeutet für Novalis nichts anderes als den revolutionären Impuls in der Welt des Geistes wirken zu lassen. In solcher revolutionären Stimmung schreibt er im August 1794 an Friedrich Schlegel: Heutzutage muß man mit dem Titel Traum doch nicht zu verschwenderisch sein — Es realisieren sich Dinge, die vor zehn Jahren noch ins philosophische Narrenhaus verwiesen wurden.
Ungefähr zur selben Zeit, da Goethe die Literatur als Asyl gegen die Revolution wählt und die Romantiker sie noch enthusiastisch feiern, fühlt sich Schiller von der Revolution dazu herausgefordert, eine neuartige ästhetische Theorie zu entwickeln. Er wird damit zum Initiator der wenig später unternommenen romantischen Versuche, die Revolution nicht nur als Thema, sondern als produktives Prinzip in die literarisch-philosophische Welt hineinzuziehen. Mit anderen Worten: Schillers Spieltheorie von 1794 ist das Vorspiel zur romantischen Literaturrevolution um 1800.
Auch Schiller hatte die Revolution zunächst begrüßt, war dann aber von ihrem weiteren Verlauf abgestoßen. Kurz nach den Septembermorden von 1792, als fast zweitausend Menschen vom Pariser Mob niedergemacht wurden, und nach der Hinrichtung des Königs, hatte er damit begonnen, eine ästhetische Therapie zu konzipieren, die dabei helfen sollte, die Menschen freiheitsfähig zu machen. Daß sie es noch nicht sind, hätten, so Schiller, die Exzesse der Revolution zur Genüge bewiesen: rohe gesetzlose Triebe hätten sich nach aufgelöstem Band der bürgerlichen Ordnung entfesselt und seien mit unlenksamer Wut ihrer tierischen Befriedigung zu geeilt. Es waren also nicht freie Menschen, die der Staat unterdrückt hatte, nein, es waren bloß wilde Tiere, die er an heilsame Ketten legte. Als Antwort auf die Französische Revolution unternimmt Schiller den unbescheidenen Versuch, das revolutionäre Frankreich mit einer alternativen Revolution, einer geistigen, zu überbieten. Erst das Spiel der Kunst, so Schiller, könne den Menschen wahrhaft frei machen. Zunächst innerlich und später, wenn in Deutschland die Umstände herangereift seien, auch äußerlich. Er setzt große Hoffnungen auf die befreiende Wirkung von Kunst und Literatur. An diese beispiellose Rangerhöhung des Ästhetischen wird die erste Romantikergeneration anknüpfen können.
Die Französische Revolution nennt Schiller einen freigebigen Augenblick, der ein unempfängliches Geschlecht vorgefunden habe. Unempfänglich, weil innerlich unfrei. Was aber bedeutet es, innerlich frei zu sein? Man dürfte nicht von Begierden abhängig sein, gleichgültig, ob man ihnen roh und unzivilisiert oder mit dem Raffinement der Zivilisation folgt. So oder so bleibt der Mensch von seiner Natur beherrscht, ohne sich selbst beherrschen zu können. Aber leben wir nicht in einem Zeitalter der Aufklärung und der Wissenschaft, in einer Periode der Blüte des freien und forschenden Geistes? Nein, sagt Schiller, man dürfe die gegenwärtigen Errungenschaften nicht überschätzen. Aufklärung und Wissenschaft haben sich bloß als theoretische Kultur erwiesen, eine äußerliche Angelegenheit für innerliche Barbaren. Die öffentliche Vernunft hat noch nicht den Kern der Person ergriffen und umgestaltet. Was ist zu tun? Ist nicht der einzige Weg der Befreiung des inneren Menschen der politische Kampf um die äußere Freiheit? Freiheit lernt man doch nur, indem man politisch um sie kämpft. Das jedenfalls werden Fichte und andere Freiheitsfreunde gegen Schiller einwenden, der dieses Konzept des ›learning by doing‹, wie wir heute sagen würden, zurückweist. Sein Argument: Wenn man zu früh die autoritäre Klammer des Staates (des Naturstaates) durch den politischen Kampf schwächt oder gar auflöst, ist Anarchie und damit die vervielfachte Gewalt und Willkür der Egoismen die notwendige Folge: Die losgebundene Gesellschaft, anstatt aufwärts in das organische Leben zu eilen, fällt in das Elementarreich zurück. Vielmehr muß man den Menschen gewissermaßen ein Übungsgelände der Freiheit eröffnen; man muß, während noch der Naturstaat besteht, der die physische Existenz der Menschen sichert, die geistigen Fundamente schaffen, auf denen sich in Zukunft der freie Staat errichten läßt. Man kann das Uhrwerk des Staates nicht zuerst zerstören und sodann ein neues erfinden wollen, sondern es gilt, das rollende Rad während seines Umschwungs auszutauschen.
Warum aber sollte dieser Austausch des rollenden Rades, diese Revolution der Denkungsart, ausgerechnet von der Kunst und dem Umgang mit ihr bewirkt werden können? Weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert. Gewiß kann man behaupten — und Schiller behauptet es auch —, daß die schöne Kunst die Empfindungen schult und verfeinert. Das wäre dann ihr Beitrag zur Zivilisierung. Aber damit begnügt sich Schiller nicht. Die ästhetische Welt ist nicht nur ein Übungsgelände für die Verfeinerung und Veredelung der Empfindungen, sondern sie ist der Ort, wo der Mensch explizit zu dem wird, was er implizit immer schon ist: zum »homo ludens«.
Erst im fünfzehnten seiner Briefe »Über die ästhetische Erziehung des Menschen« findet sich jener Satz, auf den in dieser Abhandlung alles zuläuft und aus dem alles abgeleitet wird, was für Schiller am Kunstschönen von Belang ist. Es handelt sich um eine kulturanthropologische These mit weitreichenden Konsequenzen für das Verständnis der Kultur im allgemeinen und der Moderne im besonderen; eine These auch, mit der Schiller seinen Anspruch, durch ästhetische Erziehung die Krankheit der Kultur kurieren zu können, recht eigentlich begründet. Diese berühmte These lautet: um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.
Welche Spiele? Natürlich sind es für Schiller in erster Linie die Spiele der schönen Literatur und Kunst. Aber er deutet an, daß dabei die ganze Zivilisation auf dem Spiel steht — weil sie eben auch Spiel ist, nämlich eine Einrichtung, die möglichst viele Ernstfälle in spielerische Ersatzhandlungen überführt oder doch wenigstens einen distanzierten Umgang mit ihnen ermöglicht. Schiller ist einer der ersten, die darauf hingewiesen haben, daß der Weg von der Natur zur Kultur über das ›Spiel‹ — und das heißt über Rituale, Tabus, Symbolisierungen — führt. Es wird dem Ernst der Triebe — Sexualität, Aggression, Konkurrenz und Verfeindung — und den Ängsten vor Tod und Krankheit und Verfall etwas von ihrer zwingenden, freiheitsberaubenden Gewalt genommen. So wird die Sexualität zum Spiel der Erotik sublimiert, womit sie aufhört, bloß tierisch zu sein, und wahrhaft menschlich wird. Dazu gehören dann die Verhüllungen, Listen, der Schmuck und die Ironien im Spiel, wodurch sich jene wunderbaren Verdoppelungen ergeben: Man genießt das Genießen, fühlt das Gefühl, liebt das Verlieben, man ist zugleich Akteur und Zuschauer. Solches Spiel erlaubt erst die raffinierte Steigerung, während das Begehren in der Befriedigung erlischt und somit unheilvoll auf den toten Punkt zustrebt: post coitum omne animal triste. Sexualität ist Begierde und Fortpflanzung, Erotik aber eröffnet eine ganze Welt von Bedeutungen.
Das Spiel eröffnet Freiheitsräume. Das gilt auch für die Gewalt. Kultur muß mit ihr rechnen und mit ihr ›spielen‹, zum Beispiel im ritualisierten Wettkampf, in der Konkurrenz, in den Redeschlachten. Das symbolische Universum der Kultur bietet Entlastung von den Ernstfällen, von Tod und wechselseitiger Vernichtung. Sie macht das Zusammenleben der Menschen, dieser gefährlichen Tiere, lebbar. Die Maxime der Kultur lautet: Wo Ernst war, soll Spiel werden.
Selbstverständlich werden wir auch weiterhin sehr ernsthaft unseren Geschäften nachgehen müssen, Beziehungen knüpfen und pflegen, unsere Aufgaben erfüllen, Probleme lösen. Aber es kommt alles darauf an, daß wir gegenüber den uns beherrschenden Begierden und Affekten einen freien Spielraum gewinnen.
Dazu gehört auch eine Freiheit gegenüber bloßen Nützlichkeitserwägungen. Die bürgerliche Gesellschaft, sagt Schiller, steht wie nie zuvor unter dem Diktat der Nützlichkeit. Er beschreibt sie als geschlossenes System der Zweckrationalität und der instrumentellen Vernunft, als eine Gesellschaftsmaschine, fast schon als jenes stählerne Gehäuse, als welches sie Max Weber ein Jahrhundert später bezeichnen wird: Der Nutzen, schreibt Schiller, ist das große Idol der Zeit, dem alle Kräfte fronen und alle Talente huldigen sollen. Auf dieser groben Waage hat das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht, und, aller Aufmunterung beraubt, verschwindet sie von dem lärmenden Markt des Jahrhunderts.
Bei der Kunst kann man lernen, daß die wichtigen Dinge des Lebens — die Liebe, die Freundschaft, die Religion und eben auch die Kunst — ihren Zweck in sich selbst haben, daß sie primär nicht darum sinnvoll sind, weil sie funktional etwas anderem dienen. Die Liebe will die Liebe, die Freundschaft die Freundschaft und die Kunst die Kunst; daß dabei auch noch andere Zwecke realisiert werden, ist selbstverständlich, darf aber nicht beabsichtigt sein. Eine berechnende Freundschaft ist keine, und eine Kunst um der sozialen Nützlichkeit willen ist auch keine. Kunst ist, wie jedes Spiel, autonom. Sie hat Regeln, aber sie gibt sie sich selbst. Sie kann vom Ernstfall nur entlasten, wenn sie sich selbst ernst nimmt. In bezug auf die allgemein herrschende Nützlichkeit ist sie Selbstzweck, also ekstatisch, wie zum Beispiel die Religion, die man auch in ihrem Wesen verkennt, wenn man sie funktionalistisch auf eine gesellschaftsdienliche Rolle einschränkt. Nur wenn die Kunst — ebenso wie die Religion — sich selbst will, kann es geschehen, daß sie auch, gewissermaßen unbeabsichtigt, der Gesellschaft dient.
Kunst also ist erstens Spiel, zweitens Selbstzweck und drittens kompensiert sie das, was Schiller als spezifische Deformation der bürgerlichen Gesellschaft analysiert: das entwickelte System der Arbeitsteilung. Hölderlin und Hegel, später Marx, Max Weber und Georg Simmel werden an Schillers Analyse anknüpfen. Es gibt keine Gesellschaftsanalyse aus dieser Zeit, die wirkungsmächtiger gewesen wäre, als die Schillersche. Die moderne Gesellschaft, schreibt Schiller, hat Fortschritte gemacht auf dem Gebiet der Technik, der Wissenschaft und des Handwerks infolge von Arbeitsteilung und Spezialisierung. In demselben Maße, wie die Gesellschaft im Ganzen reicher und komplexer wird, läßt sie den Einzelnen in Hinsicht auf die Entfaltung seiner Anlagen und Kräfte verarmen. Indem sich das Ganze als reiche Totalität zeigt, hört der Einzelne auf, das zu sein, was er gemäß einem idealisierenden Vorurteil in der Antike gewesen sein soll: eine Person als Totalität im kleinen. Statt dessen findet man heute unter den Menschen nur Bruchstücke, was zur Folge hat, daß man von Individuum zu Individuum herumfragen muß, um die Totalität der Gattung zusammenzulesen. Jeder versteht sich nur auf sein spezielles Handwerk, sei es ein materielles oder ein geistiges. Auch die Politik ist zu einem Maschinenwesen von Spezialisten der Macht geworden, sie wurzelt nicht mehr in der Lebenswelt und ist nicht mehr ein organischer Ausdruck der vereinigten Macht der Individuen: der Genuß wurde von der Arbeit, das Mittel vom Zweck, die Anstrengung von der Belohnung geschieden. Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruchstück aus, ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens, und anstatt die Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts.
Doch gegen die rousseauistischen Träume einer besseren Vergangenheit hält Schiller daran fest, daß, so wenig es auch den Individuen bei dieser Zerstückelung ihres Wesens wohl werden kann, doch die Gattung auf keine andere Art hätte Fortschritte machen können. Um die Anlagen der Gattung als ganzer zu entwickeln, gab es offenbar kein anderes Mittel, als sie unter den Individuen aufzuteilen und sogar einander entgegenzusetzen. Den Antagonismus der Kräfte bezeichnet Schiller als das große Instrument der Kultur, im gesellschaftlichen Ganzen den Reichtum der menschlichen Wesenskräfte zu verwirklichen und ihn in der großen Masse der Einzelnen zu verfehlen. In dieser Analyse wird Hölderlin den Schlüssel zum Verständnis seines Leidens an der Gegenwart finden. Im »Hyperion« heißt es: Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen …