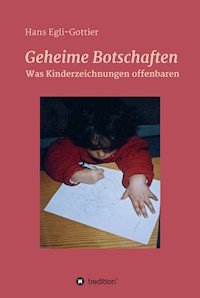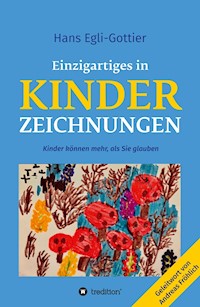
6,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Kinder können viel mehr, als wir glauben! Dieser Satz stammt aus meinem Buch «Geheime Botschaften - Was Kinderzeichnungen offenbaren», auf dem dieser Band basiert. Früher behandelte Themen werden aufgegriffen und weiter geführt. Neues kommt hinzu und es wird auf die Bedeutung eines freilassenden Arbeitsklimas hingewiesen, wo Kinder ihr persönliches Potenzial frei entfalten können, ohne von «Fördereinheiten» früh beeinflusst zu werden. Auch wird auf den großen Wert von Ruhe und Besinnlichkeit als erzieherische Ergänzung zu Unrast und täglicher Geschäftigkeit hingewiesen. Die Schlussfolgerungen entsprechen nicht den gewohnten Erfahrungen. Sie werden deshalb überraschen. Auch dieses Mal gilt es wieder der eigenständigen und geheimnisvollen Bildersprache der Kinder die nötige Aufmerksamkeit zu schenken und ihrer Tiefsinnigkeit nachzuspüren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hans Egli-Gottier
Einzigartiges in
KINDER
ZEICHNUNGEN
Kinder können mehr, als Sie glauben
© 2020 Hans Egli-Gottier
Layout, Cover: Dr. Matthias Feldbaum, Augsburg
Coverabbildung: Regula, 4,8 Jahre, Blumen und Bäume
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40–44, 22359 Hamburg
ISBN:
Hardcover:
978-3-347-09446-8
Paperback:
978-3-347-09445-1
E-Book:
978-3-347-09447-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Einzigartig
Ein Geleitwort von Andreas Fröhlich
Kinder hinterlassen vielerlei Spuren …
Aufmerksam schauen wir auf das, was sie kritzeln, malen, zeichnen, formen. Mit Stift oder Pinsel, mit einem Stück Dachziegel, mit Kreide oder Kohle, sie hinterlassen Spuren, die zum Staunen und Nachdenken anregen können.
Kinderzeichnungen sind seit Beginn einer systematischen Entwicklungspsychologie Gegenstand ernsthafter Analysen, sie werden tiefenpsychologisch gedeutet, sind Ausweis der Intelligenzentwicklung, geben Aufschluss über Traumata – und manchmal dürfen sie einfach auch nur schön sein.
Dieses Buch geht eigene Wege, sucht in Kinderzeichnungen das, was das einzelne Kind in seiner Zeichnung für sich, vielleicht auch für andere zum Ausdruck bringt.
Wie schaut ein Kind auf die Welt, was beschäftigt es, was hat es in dieser oder jener Situation gesehen, was möchte es erinnern, was anderen zeigen? Da kommen schnell andere Fragen auf, als die nach einem bestimmten Entwicklungsalter. «Typische» Darstellungsformen sind weniger interessant als individuelle. Wie nimmt ein Kind seine aktuelle Lebenssituation wahr, wie gestaltet es diese Situation, was also nimmt Gestalt an für das Kind?
Natürlich ist vieles vielen Kindern gemeinsam, die Kopffüßler, die Sonnen, später die Suche nach Details und die Frage ihrer Darstellung.
Sehr schnell kommen wir damit zu eigentlich künstlerischen Fragen: Was drängt zum Ausdruck, welcher Eindruck muss Gestalt annehmen, mit welchen Mitteln gelingt dies?
Und Kinder suchen sehr ernsthaft nach Wegen ihre eigenen Fragen zu beantworten.
Manche tun dies intensiv, immer wieder, noch mal und noch mal. Erwachsenen scheint es oftmals reine Wiederholung zu sein. Ich denke nicht, dass es das ist: Es ist die lange Suche nach einer Perfektion, nach der Stimmigkeit von Eindruck und Ausdruck. Und das macht doch eigentlich künstlerisches Arbeiten aus.
Die meisten Kinder wenden sich dann nach einiger Zeit wieder ganz anderen Fragen zu, spielen anderes, gestalten Szenen mit Puppen oder Figuren, bauen, entdecken den Reiz der Regeln im Spiel mit anderen Kindern.
Die «künstlerische Phase» ist erst einmal beendet, bei manchen Kindern für immer, andere kommen immer wieder darauf zurück, einige wenige widmen sich ihren künstlerischen Fähigkeiten ein ganzes Leben lang.
Die «Suche nach emotionalen Urformen» , wie Eric Kandel, Neurowissenschaftler und Nobelpreisträger, einen Aspekt dieses künstlerischen Bemühens nennt, können wir in Kinderzeichnungen immer wieder entdecken. Das lässt sie auch in eine immer wieder faszinierende Nähe zur «echten» Kunst kommen. Auch wenn es nicht zu einer solchen Nähe kommt, so ist es doch kindliche Suche nach emotionalen Urformen, so wie Singen, Sich-Bewegen, Tanzen und Springen, mit der Sprache Spielen, Grimassen schneiden, sich Verkleiden …
Einen Ausschnitt aus dieser einzigartigen Vielfalt kindlicher Entwicklung zeigt uns dieses Buch.
Es fordert uns auf, Kinder und ihre Spuren nicht nur zu sortieren und einzuordnen, sondern sie als Unikate, als einzigartig, wert zu schätzen.
Prof. Dr. Andreas Fröhlich
Begründer des Konzepts der Basalen Stimulation
Vorwort
Um zu wissen, was man zeichnen will, muss man zu zeichnen anfangen.
Pablo Picasso
Picassos Erfahrung lässt sich auch auf Kinder übertragen, denn Kinder zeichnen nicht abstrakte Ideen und Vorstellungen! Die Zeichnungen sind das Werk ihrer Händchen und Zeichen ihrer Menschwerdung.
Die Zeichnungen sind aufgrund ihrer Singularität und spirituellen Bedeutung ausgewählt worden. Auf Vergleiche mit anderen Untersuchungen wurde weitgehend verzichtet. Zeichnungen sind einmalig und nicht wiederholbar, z. B. durch Nachzeichnen. Sie sind nur mit den eigenen Schöpfungen vergleichbar. Bedeutsames lässt sich deshalb in der realen Begegnung mit dem zeichnenden Kind erfahren, dabei ist die Entstehungsgeschichte, die zur Zeichnung führt, nicht unbedeutend.
Zeichnungen haben eigene Entstehungsgeschichten. Es ist spannend, dem Streben der Kinder nachzuspüren. Was im Erziehungsalltag bedeutungsvoll ist, ist auch für die kleinen Zeichnerinnen und Zeichner angebracht: Wer ihnen nicht «schulmeisterlich» begegnet, wird das Einmalige in ihren Arbeiten entdecken. Es trifft zu, worauf der Basler Heilpädagoge und Professor, Emil E. Kobi Wert legte: «Wer sehen will, muss sich sehen lassen und die Maske der Objektivität abstreifen.» (Kobi)
Als anthroposophisch tätiger Heilpädagoge wurde mir eine offene und respektvolle Beziehung, in der auch Spiritualität ihren Platz hat, ein ernsthaftes Anliegen. In lebhafter Erinnerung bleibt mir Hannes’ spitzbübisches Lächeln. Der langgewachsene autistische Junge ließ mich nachdenklich werden, nachdem er das Ergebnis einer schwierigen Rechenaufgabe bereits gefunden hatte, bevor ich ihm meinen Lösungsweg verständlich machen konnte. Wie er vorging, ist mir heute noch schleierhaft. Da ist auch Markus. Er machte mich in entscheidenden Momenten auf vergessene Texte aufmerksam. Mit seinem perfekten Gedächtnis, dem absoluten Musikgehör und seinen Synästhesien versetzte er mich oft in Staunen: Meine Aufmerksamkeit für unkonventionelle, ja widersprüchliche Anschauungen wurde geweckt. «Wir können von jedem Menschen viel lernen, auch von Kindern, wenn man aufpasst». Dieser Gedanke Rudolf Steiners, dem Begründer der anthroposophischen Geisteswissenschaft, wurde mein Leitspruch.
In meinem Buch «Geheime Botschaften – Was Kinderzeichnungen offenbaren» wurden einige Phänomene betrachtet. Dies führte bei Leserinnen und Lesern zu Rückmeldungen, die mich zu weiterführenden Betrachtungen veranlassten und schließlich zu diesem Buch führten.
Früher behandelte Themen werden aufgegriffen: z. B. der in seiner Bedeutung unterschätzte, erste geschlossene Kreis. Bilder im Zusammenhang mit Komplementarität, Spiegelung und Punktsymmetrie. Neu werden Tagbilder den Nachtbildern gegenübergestellt, Zeichnungen technischer Objekte betrachtet, und es wird nach der Aktualität der verwendeten Zeichnungen gefragt. Besonders wird auf die Bedeutung eines freilassenden Arbeitsklimas hingewiesen, wo Kinder ihr persönliches Potenzial frei entfalten können, ohne von «Fördereinheiten» früh beeinflusst zu werden. Die Schlussfolgerungen entsprechen nicht den alltäglichen Erfahrungen. Sie werden deshalb überraschen.
Es werden Arbeiten von Kindern und Jugendlichen mit heilpädagogischem Förderbedarf betrachtet. Hauptsächlich sind es Zeichnungen der eigenen drei Kinder, deren Entstehungsgeschichten mir am besten bekannt sind. Alle kommentierten Arbeiten mögen dazu anregen, das Irrationale und Transzendente darin wahrzunehmen, es «für-wahrnehmen», um es gleichberechtigt neben dem bekannten Wissen stehen zu lassen. Wir werden den Spuren folgen und uns auf schwer Verständliches und Unerwartetes einlassen. Es möge dann daraus werden, was werden will. Wir richten die Aufmerksamkeit u. a. auf folgende Zusammenhänge:
Kritzel
erste Kreise
Gegensätze, Polaritäten
Komplementarität
Kopffüßler
Pflanzen
Haare
Sonnenstrahlen
Bauchfüßler
Tiere
der menschliche Körper
das Haus
Tag
Nacht
Mandalas
stirb und werde
der Arbeitsplatz
Technik und Maschinen
Obwohl sich die Zeichnungsweise im Laufe der Zeit verändert hat, werden hier mehrheitlich Zeichnungen vom Ende des letzten Jahrhunderts verwendet. Ihre Inhalte lassen Vergleiche mit der Gegenwart zu.
Inhalt
1. Einzigartiges und Allgemeines in Zeichnungen
1.1 Unterschiede bei 12-jährigen Jugendlichen
1.2 Allgemeine Entwicklung bei Mensch, Haus, Tier, Pflanze
2. Kritzeleien, Spirallinien und Kreis
2.1 Kritzeleien und Farbkleckse
2.2 Der Gestaltungswille des Kindes – Bewegung und Form
2.3 Auf dem Weg der Schneckenlinie
2.4 Die Welt mit Kinderaugen sehen
2.5 Das Ende der Linie führt zum Anfang zurück
2.6 Uroboros – die Schlange, die sich in den Schwanz beißt
2.7 Große und kleine Kreise
Fazit
3. Das Chaos wird auf eine Linie verdichtet
3.1 Regula erfasst Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft
3.2 Das Urvertrauen wird neu erworben
3.3 Kernfragen der Philosophie des Bewusstseins
3.4 Roboter haben emotionale Programme
3.5 Die Entwicklung des ICH – ein höchst sensibler Prozess
3.6 Der radikale Kampf um die Bildersprache
3.7 Abwertung der Bildersprache in Erziehung und Bildung
3.8 Das Geschaute ins rechte Licht rücken
Fazit
4. Die ersten Menschen – die Kopffüßler
4.1 Der Kreis wird zum Kopffüßler
4.2 Klosterschüler und Wüstenkinder
4.3 Haare und Sonnenstrahlen
4.4 Zwei unterschiedliche Selbstporträts
Fazit
5. Komplementarität und der Bauch
5.1 Stefan entdeckt Komplementarität im Kreis
5.2 Regula findet die Komplementarität in Kreis und Quadrat
5.3 Christiane findet die Komplementarität bei Riese und Zwerg
5.4 Stefans Kopffüßler hat Eigenschaften der Bauchfüßler
5.5 Joanas Mutter-Kind-Beziehung – eine Generation später
5.6 Komplementarität in Stefans Bauchfüßlern
5.7 Komplementäre Beziehungen und erste Bauchfüßler
5.8 Dualität – Mensch und Welt werden neu entdeckt
Fazit
6. Das Haus
6.1 Erstaunliche Lösungswege führen zum Haus
6.2 Christianes Haus im Sternenmeer
6.3 Jonas konstruiert sein Haus
6.4 Zu Hause bei Aurelia, Regula und Lukas
6.5 Wie Hildegard von Bingen das Haus einschätzte
6.6 Häuser aus Licht und Farbe
6.7 Tag und Nacht – frohes Schaffen und ruhiges Besinnen
6.8 Morgendämmerung – morgen scheint die Sonne wieder
6.9 Mondlicht und Sonnenlicht
6.10 Dualität und Trinität – eine bedeutende Herausforderung
6.1 Der Regenbogen – die Brücke über den Strom
6.12 Das Haus, das Himmel und Erde umspannt
6.13 Punktsymmetrie – ein Haus steht auf dem Kopf
Fazit
7. Gräser, Blumen und Bäume
7.1 Urbilder – Mensch, Blume und Baum
7.2 Bilder die Geschichten erzählen
7.3 Bäume werden fließend gestaltet
7.4 Werden und Vergehen
Fazit
8. Mensch und Tier
8.1 Die Arche Noah und wie Kinder Tiere lieben
8.2 Christiane zeichnet ein Tierbuch
8.3 Diese Kinder widersprechen der Evolutionstheorie
8.4 Der Mensch steht aufrecht
8.5 Christiane zeichnet unermüdlich Pferde
Fazit
9. Wahrnehmen, Verarbeiten und Visualisieren
9.1 Jugendliche mit Behinderung zeichnen Myrons Diskuswerfer
9.2 Zwei Kinder – zwei Hexenbilder
9.3 Zwei blinde Menschen erklären die Welt
Fazit
10. Sonnenräder, Chakren und Heiligenscheine
10.1 Chakren in Menschenzeichnungen
10.2 Christianes Leitermännchen tragen Sonnenräder
Fazit
11. Die Chakren verglimmen
11.1 Auf Spurensuche
11.2 Die beliebte Zipfelmütze
11.3 Die neuen Hüte
11.4 Festtagstracht auf dem Lande
11.5 Adoleszenz – neue Hüte bestimmen
Fazit
12. Stirb und Werde
12.1 Verarbeiten des Todes
13. Mandalas
13.1 Mandalas sind mehr als schöne Kreisgebilde
Fazit
14. Technik und Maschine
14.1 Flugzeug, Eisenbahn, Feuerwehr
14.2 Neue Technik – «Joana schreibt ihre erste SMS»
Fazit
15. Lehm, Wachs und viel Gesammeltes
15.1 Übend gestalten, durchhalten und neu gestalten
Fazit
16. Der Werkplatz – mein Entwicklungsraum
16.1 Mein Arbeitsplatz
16.2 Schaffen und Werken – Ruhen und Besinnen
16.3 Die Bedeutung der Lichtqualität – Forschungsergebnisse
16.4 Nachzeichnungen von Schülern bei Tageslicht und LED-Licht
16.5 Das «Energiebündel» wird flügge – Ein Erziehungsbeispiel
Fazit
17. Suchen nach dem Vernachlässigten
Aus Nachwort zu «Geheime Botschaften», 2015
Literaturverzeichnis
1. Einzigartiges und Allgemeines in Zeichnungen
In den Zeichnungen gleichaltriger Kinder zeigen sich vergleichbare Merkmale. Verallgemeinernd, d. h., unter Weglassung des individuellen Ausdrucks, lässt sich die typische, altersgemäße Entwicklung der Zeichnenden ermessen. Es darf nicht vergessen werden, dass dabei das Individuelle in Zeichnungen unberücksichtigt bleibt. Jede Zeichnung weicht vom allgemeinen Abstraktum mehr oder weniger ab. Die Abweichung ist Gradmesser für die Einzigartigkeit der Zeichnung: eine Hieroglyphe des zeichnenden Kindes. Auf das Einzigartige wollen wir im weiteren Verlauf dieser Arbeit unsere Aufmerksamkeit richten.
Die ersten menschlichen Gestalten (Kopffüßler) zeichnen Kinder etwa im dritten/vierten Lebensjahr. Kopffüßler zeigen Kopf, Beine und Arme und häufig ein Gesicht. Es überrascht, dass ihnen der Bauch fehlt. Kinder in diesem Alter kennen den Bauch gut, sie können ihn benennen und auf ihn zeigen. Wie wir sehen werden, dauert es unterschiedlich lang, bis er in den Kopffüßler integriert wird. Monate später bekommen die Menschen Kleider, Hut, Gehstock, Ohrclips und Handtasche.
Das Wandtafelbild der 12-jährigen Schülerinnen und Schüler einer Förderklasse zeigt, wie früh Unterschiede sichtbar werden. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Aufgabe, Menschen an die Wandtafel zu zeichnen. Sie bestimmten Platz und Größe ihrer eigenen Figur selbst.
1.1 Unterschiede bei 12-jährigen Jugendlichen
Die großen Unterschiede der 12-jährigen Schülerinnen und Schüler sind Ausdruck ihrer körperlichen, seelischen und geistigen Voraussetzungen. Auch Lebenserfahrungen und die aktuelle Befindlichkeit beeinflussen ihre Zeichnungen (Abb. 1).
Den Einfluss der aktuellen Befindlichkeit zeigt Regula in ihrer Zeichnung mit dem braunen Männchen, das sie beim Spielen mit Kameraden zeichnete. Nach Unstimmigkeiten entfernte sie sich verärgert von ihren Freunden. Sie erschien aber schon bald wieder und beteiligte sich völlig beruhigt am weiteren Spiel.
Abb. 1: 12-jährige Jugendliche mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf zeichnen an der Wandtafel
Was war in der Zwischenzeit geschehen? Regula ließ ihrem Ärger freien Lauf. Sie «zeichnete sich frei». Abstrafend stellte sie das eckige, braune Männchen an den unteren, linken Blattrand! Die Zeichnung entspricht bei Weitem nicht ihren farbenfrohen Gestaltungen, wie z. B. der «Sonnenmutter» (Abb. 3).
Männchen und Sonnenmutter zeigen Einzigartigkeiten (Singularitäten) in Regulas Darstellungskunst. Einer Verallgemeinerung bleibt das Einzigartige unberücksichtigt. Im weiteren Verlauf werden wir vorwiegend den Blick auf das Einzigartige richten aber auch die unmittelbare Begegnung mit dem zeichnenden Kind anstreben.
Abb. 2: Regula, 9-jährig, nach einer Auseinandersetzung
Abb. 3: Regula, 6-jährig, Sonnenmutter
Wirkliches Verstehen baut auf der realen Begegnung von Mensch zu Mensch auf. Begegnung ist unmittelbar, nicht ersetzbar! Vorgefertigtes (angelerntes) Wissen mag hilfreich sein, doch wirkt es, oft kaum bemerkt, bestimmend auf die Blickrichtung, und es beeinflusst den Sehhorizont. Das trübt die Unbefangenheit: So lässt sich Birger Selim verstehen, wenn der bekannte Autist feststellt, dass sie [er meint Fachpersonen] nur seinen «Außenpanzer» sähen. Birger Selim sieht sich reduziert auf die allgemeine (studierbare) Symptomatologie des Autismus (sein Außenpanzer). Aber als Mensch fühlt er sich missachtet und abgewertet.
Zur Anschauung der allgemeinen Entwicklung (Abb. 4) werden authentische Zeichnungen verwendet. Die Entwicklung des Menschen wird von Haus-, Tier- und Pflanzenzeichnungen ergänzt. Es soll die Zusammengehörigkeit von Mensch und Kreatur deutlich werden.
1.2 Allgemeine Entwicklung bei Mensch, Haus, Tier, Pflanze
Abb. 4
2. Kritzeleien, Spirallinien und Kreis
Irgendwann im Laufe des zweiten Lebensjahres entdecken Kinder, dass ihr Tun Spuren hinterlässt, und schon schaffen sie chaotisch kreisende, pendelnde und hiebartige Kritzeleien. Mit Pinsel und Farbe entstehen Kleckse und vielfarbige Gebilde. Schon für diese ersten Werke entwickeln die Kinder größte geistige und körperliche Anstrengungen! Ihnen gelingt eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen der rechten und der linken Hand.
Die linke Hand – es ist die «emotional dominante» – hält das Zeichenpapier auf der Unterlage fest, damit die Rechte – es ist die «intentional dominante» – zeichnen kann. Gleichzeitig werden die Handbewegungen mit beiden Augen beobachtet (Auge-Hand-Koordination)! Diese Entwicklung verläuft nicht gradlinig, sie mäandriert dem Ziel entgegen.
Ruhig wird früher Erworbenes wiederholt. Die Kinder nähern sich auf Umwegen dem Ziel, wo sie mit unerwarteten, neuen Fähigkeiten überraschen: So wird das chaotische Liniengewirr auf eine spiralförmige Linie verdichtet und zum geschlossenen Kreisgebilde weitergeführt. Der Kreis entsteht und signalisiert das Ende der, nur scheinbar, ziellosen Kritzelei. Der Kreis ist gleichzeitig Anfang für ein umwälzend Neues. Jetzt werden Zeichnungen des Menschen möglich, die Kopffüßler. Viele sehen in den Kopffüßlern den Anfang des kindlichen Zeichnens. Gleichzeitig mit den Kopffüßlern werden Urformen gezeichnet, aus denen später Baum, Blume und Gräser werden.
Die primitiv anmutenden Zeichnungen verlocken Erwachsene zu Hilfestellungen. Allerdings ist Vorsicht geboten! Der Gestaltungswille der Kinder wird zurückgedrängt. Die vermeintliche Hilfe wirkt kontraproduktiv. Ein Déjà-vu erinnert an vergangene Zeiten, wo Flussläufe aus ökonomischen Gründen und zum alleinigen Nutzen des Menschen begradig wurden. Heute zeigen sich Nebenwirkungen, und mit viel Aufwand und hohen Kosten werden die vergangenen Ingenieurkünste rückgängig gemacht. Flussläufe werden renaturalisiert. Wir hoffen, dass der Erziehung dieses Schicksal erspart bleibt.
2.1 Kritzeleien und Farbkleckse
Die knäuelhaften Zeichnungen in Abb. 5 zeigen die überragende Vitalität der Kinder. Völlig impulsiv bekritzeln sie, was ihnen in den Weg kommt. Nicht zur Freude aller. Wenn beispielsweise die Küchenwand oder das Schulbuch der älteren Geschwister «beschrieben» wird. Um Kinder zu verstehen, müssen wir uns auf ihre Schaffensweise einlassen. Wer vielleicht glaubt, dass diese Zeichnungen bedeutungslos sind, irrt. Allein schon die Tatsache, dass aus eigenem Antrieb (intrinsisch motiviert) Linien und Formen sehr lange geübt werden, bis ein «Werk» gelingt, macht nachdenklich.
In ihrem Leistungsnachweis stellen die beiden Psychologinnen M. Engler und M.-L. Schlapbach treffend fest: «Für das Verständnis von Kinderzeichnungen ist es wichtig zu wissen, dass das Kind in seinen Zeichnungen nicht etwas abbildet, sondern etwas erschafft.» Aber: «Wenn Erwachsene eine Kinderzeichnung betrachten, versuchen sie die Bilder in ihre eigeneVorstellungs- und Begriffswelt einzuordnen.» (Engler & Schlapbach, S. 5) Und das entfernt uns von der Wirklichkeit des Kindes.
Abb. 5: Mädchen, 2,5 Jahre. Schwing- Pendel-, Hiebkritzel (links) und Farbklekse (rechts)
Kinder kritzeln aus reiner Bewegungsfreude. Die Kritzeleien sind eine geniale Formensprache im Entstehungsstadium: Viel ist angelegt, wenig festgelegt! (Abb. 5)
2.2 Der Gestaltungswille des Kindes – Bewegung und Form
Den kraftvollen Bewegungen steht schon früh der Gestaltungswille des Kindes gegenüber: Absichtsvoll unterbricht es die endlosen Linien und setzt sie über- und nebeneinander. Das eigene Wollen zeigt es in kraftvollen Linien, in Gliederung und Raumaufteilung, wie auch in der Farbwahl.
In der Dualität – Bewegung und Form – offenbart sich ein persönlicher Wesenszug, die eigene Handschrift.
Abb. 6: Joana, 2½-jährig, erschafft Kritzeleien
Kritzeleien werden unterschiedlich gedeutet: Als ein begnadeter Forscher sieht Wolfgang Grözinger darin Erinnerungen an die Zeit vor der Geburt, zu denen kleine Kinder noch Zugang haben. Wolfgang Schad, Pädagoge und Naturwissenschaftler, sieht die Quelle in den unbewussten Lebensvorgängen, in der Physiologie. Die Erziehungswissenschaftlerin Angelika-Martina Lebéus sagt es so: «Die Kraft, mit der ein Kind wird und wächst, ist es auch, die ihm die Hand führt bei seinem Kritzeln und Malen.» (Lebéus, S. 14)