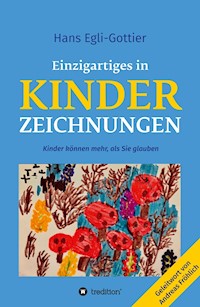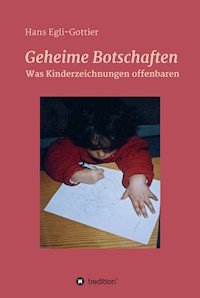
4,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kinder können viel mehr als wir glauben! In ihren ersten Zeichnungen ist sehr viel angelegt und noch wenig festgelegt. Schon bald schaffen sie archetypische Menschenbilder - die Kopffüßler. Diese stehen auf den eigenen Beinen und zeigen der Welt ihr Gesicht. Zur Welt der Kinder gehört der ganze Kosmos - Sonne, Mond und Sterne. Manche Kinderzeichnungen überraschen mit rätselhaften Gestaltungen, die an die Spiritualität vergangener Hochkulturen erinnern. Nur allmählich übernehmen die Kinder Konventionen und Lehrmeinungen der Erwachsenenwelt. Doch: Erwachsene glauben, dass die Welt so ist, wie sie ihnen beigebracht wurde, und sie wollen schon früh zeigen, wie Kinder die Welt zu sehen haben... Der eigenständigen und geheimnisvollen Bildersprache der Kinder gilt es, die nötige Aufmerksamkeit zu schenken und ihrer Tiefsinnigkeit nachzuspüren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 89
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
www.tredition.de
Hans Egli-Gottier
Geheime Botschaften
Was Kinderzeichnungen offenbaren
www.tredition.de
© 2015 Hans Egli-Gottier
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7323-2428-6
Hardcover:
978-3-7323-2429-3
e-Book:
978-3-7323-2430-9
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
Einleitung
1. Die ersten Kreisgebilde
Das geniale Knäuel
Bewegung und Form
Auf dem Weg vom Makrokosmos zum Mikrokosmos
Die Welt mit Kinderaugen sehen
Dianes erster geschlossener Kreis
Große und kleine Kreise
Uroboros – Die Schlange, die sich in den Schwanz beißt
ICH und WELT stehen sich gegenüber
Fazit
2. Die Erkenntnis des ICH - Ein Exkurs
Wer bin ICH
Haben Roboter Gefühle?
Es geht um viel!
Fazit
3. Es geht um Bilder
Ein Bildersturm im wissenschaftlichen Diskurs
Der Einfluss auf Bildungs- und Erziehungsziele
Das Geschaute ins rechte Licht rücken
Fazit
4. Auftritt der Kopffüßler
Kinder schaffen erste Menschen – Kopffüßler
Klosterschüler und Wüstenkinder
Die Sonne geht auf
Zwei Selbstporträts
Fazit
5. Die ersten Bauchfüßler
Komplementäre Kreise – Eine Entdeckung
Regula zeichnet Bauchfüßler
Diane zeichnet Bauchfüßler
Stefan zeichnet Bauchfüßler
Fazit
6. Das Haus
Der Höhlenbau
Diane und Jonas zeichnen ihr erstes Haus
Zuhause in der Welt bei Aurelia, Regina und Lukas
Fazit
7. Häuser – eingehüllt in Licht und Farbe
Regulas Lichthaus
Ein eigenartiges Zahlenrätsel
Der Regenbogen – Brücke und Vermittler
Das Haus zwischen Tag und Nacht, Himmel und Erde
Das gespiegelte Dach und fünf Sonnen
Punktsymmetrie – Ein Haus steht Kopf
Maslows Bedürfniskategorien
Die fünf Kategorien
Transzendenz
Die acht Kategorien
Fazit
8. Grenzen überschreiten
Schüler zeichnen Myrons Diskuswerfer
Zwei Kinder – zwei Hexenbilder
Alles ist Aufmerksamkeit – Zwei Blinde sehen die Welt
Fazit
9. Sonnenräder, Chakren, Heiligenscheine
„Ich weiß nicht, was ich bin…“
Fazit
10. Die Chakren verglimmen
Auf Spurensuche
Die beliebte Zipfelmütze
Die neuen Hüte
Die Melone
Der Zylinderhut
Festtagstracht auf dem Lande
Volkstracht aus dem Montafon
Fazit
11. Stirb und Werde
Verarbeiten des Todes
Schlussgedanken
Dank
Literaturverzeichnis
Einleitung
Schon die allerersten „Kritzeleien“ schaffen Kinder ohne fremde Hilfe, aus reiner Lust am Gestalten und Markieren ihres Daseins. Jede Zeichnung hat eine individuelle Entstehungsgeschichte, und sie trägt den geistigen Fingerabdruck der Zeichnerinnen und Zeichner.1 Auffassungen, dass die Spur dieser frühen motorischen Tätigkeit noch bedeutungslos sei und unkontrolliert ausgeführt werde, müssen ergänzt werden, denn bereits diese frühen knäuelhaften Spuren lassen ein absichtsvolles und zielgerichtetes Gestalten erkennen. Schon früh zeigen die Kinder Momente höchster Konzentration, und mit großer Aufmerksamkeit und Hingabe begleiten sie ihre schwungvollen Bewegungen (Auge-Hand-Koordination). (vgl. Foto S. 13)
Mit dem zunehmenden Gestaltungsreichtum schaffen die Kinder schon bald Zeichnungen, die sich nur unzureichend mit ihrer kurzen Lebenserfahrung erklären lassen. Die Hieroglyphen, die sie irgendwann im Alter zwischen dem zweiten Lebensjahr und dem Schuleintritt machen, werfen Fragen auf nach den Triebfedern. Wollen Kinder wiedergeben, was sie mit Augen sehen, aber noch nicht besser zeichnen können? Setzen sie mit Linie und Farbe um, was sich in ihrem Organismus regt und bewegt? Sind es Nachwirkung ihres pränatalen Werdens im mütterlichen Leib, oder ist es eine im Menschen innewohnende geistige Kraft, der Entelechie vergleichbar, die Aristoteles in seiner Metaphysik beschrieb? Manche dieser Zeichnungen erinnern an die Spiritualität vergangener Kulturen.
Um diesen Fragen nachzuspüren, werden wir die subjektive Begegnung suchen und einer distanzierenden „objektiven“ Betrachtung vorziehen. Wir wollen das Einzigartige und Tiefgründige der Zeichnerinnen und Zeichner ins Blickfeld rücken.
Für Emil E. Kobi (1935 - 2011), Prof. für Heil- und Sonderpädagogik an der Universität Basel, war die subjektive Begegnung für den pädagogischen Bezug entscheidend: „Gegenstand pädagogischen Bemühens und Forschens ist nicht das außerhalb der Subjektivität Liegende, sondern das, was Subjekte im geschichtlichen Kontext und unter einer bestimmten Perspektive konstituieren. Subjekte erschließen sich in subjektiver Begegnung. Wer sehen will, muss sich sehen lassen und die Maske der Objektivität abstreifen.“ (Kobi, S. 55)
Als Individuen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten sind wir nicht nur unterschiedlich gebildet und ausgebildet, wir tragen auch unterschiedliche Prägungen und Neigungen. Diese sind Teil unserer Persönlichkeit. Unsere Absichten und Ziele sind immer wertgeleitet! Der Gefahr von Unsachlichkeit ist, wie Kobi festhält, durch Selbsterziehung zu begegnen. (vgl. Mürner, S. 15)
1In der Regel wird für beide Geschlechter eine Schreibform verwendet.
1. Die ersten Kreisgebilde
Irgendwann im Laufe des zweiten Lebensjahres entdecken Kinder, dass ihre Bewegungen Spuren hinterlassen. Mit ihren eigenwillig kreisenden, pendelnden und hiebartigen Strichen schaffen sie die schwungvollen Kritzelzeichnungen, gelegentlich werden sie auch Knäuel genannt. Schon bald entwickeln die Kinder einfachste Bildelemente, die an geometrische Formen wie Spirale, Gerade und Kreuz erinnern. Und dann erscheint der Kreis, der das kraftvoll geballte Knäuel ersetzt.
Das geniale Knäuel
Knäuel sind ein Ausdruck geballter kreisender, pendelnder und hiebartiger Bewegungen. Völlig impulsiv bekritzeln Kinder alles, was ihnen in den Weg kommt. Nicht immer zur Freude aller, wenn sie die Küchenwand oder das Schulbuch der älteren Schwester „beschreiben“. Um die Kinder zu verstehen, müssen wir uns auf ihre besondere Schaffensweise einlassen. Wer glaubt, dass diese Zeichnungen bedeutungslos sind, irrt. Allein schon die Tatsache, dass sie aus eigenem Antrieb (intrinsisch motiviert) Linien und Formen oft lange üben, bis das „Werk“ gelingt, spricht dagegen.
In ihrem Leistungsnachweis stellen die beiden Psychologinnen M. Engler und M.-L. Schlapbach treffend fest: „Für das Verständnis von Kinderzeichnungen ist es wichtig zu wissen, dass das Kind in seinen Zeichnungen nicht etwas abbildet, sondern etwas erschafft.“ Aber: „Wenn Erwachsene eine Kinderzeichnung betrachten, versuchen sie die Bilder in ihre eigene Vorstellungs- und Begriffswelt einzuordnen.“ (Engler & Schlapbach, S. 5) Und das führt in eine Sackgasse.
Abb. 1: Mädchen, 2.5 Jahre. Schwing-, Pendel-, Hiebkritzel
Kritzeleien (Abb.1) entstehen aus reiner Bewegungsfreude. Sie sind eine geniale Formensprache im Entstehungsstadium: Unendlich viel ist angelegt, kaum etwas festgelegt!
Bewegung und Form
Dem Bewegungsdrang steht schon früh ein Formprinzip gegenüber: Absichtsvoll unterbrechen die Kinder die endlosen Linien und setzen sie über- und nebeneinander. Die Form zeigt sich auch in Gliederung, Raumaufteilung und nicht zuletzt in der Farbwahl.
Mädchen, 3. Lebensjahr. Erschafft Formen
In dieser Dualität – Bewegung und Form – offenbart das Kind bereits persönliche Wesenszüge, seine eigene Handschrift. Diese Zeichnungen werden unterschiedlich gedeutet: Der Pädagoge Wolfgang Grözinger sieht Erinnerungen an eine Zeit vor der Geburt, zu denen kleine Kinder noch Zugang haben. (Grözinger S. 20) Wolfgang Schad, Pädagoge und Naturwissenschaftler, sieht die Quelle in den unbewussten Lebensvorgängen, in der Physiologie. (Schad, S. 29) Die Erziehungswissenschaftlerin Angelika-martina Lebéus sagt es so: „Die Kraft, mit der ein Kind wird und wächst, ist es auch, die ihm die Hand führt bei seinem Kritzeln und Malen.“ (Lebéus, S. 14)
Tatsache ist, dass schon die ersten Zeichnungen das Werk eines grossartigen Gestaltungswillens sind, dem sich Kinder lustvoll und konzentriert hingeben. (Foto: Mädchen, 3. Lebensjahr)
Auf dem Weg vom Makrokosmos zum Mikrokosmos
Stefan zeichnet unermüdlich kreisende Formen, die sich einem Zentrum nähern. Aus den kreisenden Linien werden Spiralen. (Abb. 2) Spiralen verbinden das unendlich Große mit dem Kleinen, das Makrokosmische mit dem Mikrokosmos. Der Basler Physiker und Mathematiker, Jakob Bernoulli (1654 bis 1705) befasste sich zeitlebens mit diesem Phänomen. Die nach ihm benannte logarithmische Spirale windet sich von der Unendlichkeit, dem alles umfassenden Makrokosmos, zum Kleinsten, dem Mikrokosmos. Nicht zufällig nannte er die von ihm erforschte Spirale „spira mirabilis“.
Abb. 2: Stefan, 2.9 Jahre. Spiralen mit Zentrum
Sind Stefans Zeichnungen auch als spira mirabilis zu verstehen? Zeigen die Spiralen seinen Weg von der Unendlichkeit zum eigenen Bezugspunkt? Noch betrachtet er sich wie ein Außenstehender und ruft sich – genauso wie seine Eltern – als Stefan. Aber schon bald wird er sich als ein eigenständiges ICH erleben.
Völlig anders sehen Dianes Spiralen aus. (Abb. 3) Sie bricht die Formen jeweils auf halbem Weg ab, um es erneut zu versuchen. Offensichtlich hat sie eine andere Absicht. Erst einige Wochen später wird sie uns zeigen können, was sie will.
Abb. 3: Diane, 2.8 Jahre. Spiralen ohne Zentrum
Die Welt mit Kinderaugen sehen
Wir können uns in der Regel nicht an unsere ersten Zeichnungen erinnern. Und als zuverlässige Interpretationsquelle lassen sich die eigenen Erfahrungen und Entdeckungen aus jener Zeit kaum heranziehen. Außerdem haben wir diese frühe produktive Schaffensweise längst aufgegeben.
Doch es gibt Ausnahmen! Goethe scheint mit seiner, die Wissenschaft beunruhigenden Arbeits- und Denkweise, genau diese Produktivität beibehalten zu haben. In einem Brief an Karl Ludwig von Knebel schreibt er am 15. 3. 1791: „Da ich nur denken kann, insofern ich produziere, mag daraus entstehen, was will.“ (Goethe) Nicht ER bestimmt – ES bestimmt, was werden will! Und der geniale Emil Nolde soll gesagt haben, dass er es liebe, wenn Bilder aussehen, als ob sie sich selbst gemalt hätten! Offenbar rang auch der französische Maler und Bildhauer Henri Matisse mit dieser Herausforderung. Auf die Frage eines Kunstkritikers soll er geantwortet haben, dass ein Künstler, der etwas Besonderes geschaffen habe, ganz ohne Absicht über sich hinaus gewachsen sei und sich selbst nicht mehr verstehe. Matisse wird zugeschrieben, dass man nicht verlernen dürfe, die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen.
Nicht jeder erfolgreiche Künstler arbeitet wie Goethe oder gestaltet seine Werke wie Nolde oder Matisse. Der Amerikaner Andy Warhol beispielsweise kreierte seine Werke sehr pragmatisch. 1961 hat er einem Journalisten gesagt: „Malerei ist zu anstrengend. Ich will Maschinelles zeigen. Maschinen haben weniger Probleme. Ich wäre gerne eine Maschine.“ (Warhol) Ob Künstler oder Kind, keiner lässt sich mit dem anderen gleichstellen. Und Kinder sind keine Maschinen. Ihre rätselhaften Bilder wollen uns etwas sagen.
Viele Künstler erklären Bilder nur ungern, denn Bilder sprechen für sich selbst, sagen sie! Auch Kinderbilder sprechen für sich. Es liegt an uns, ihre Bildersprache zu verstehen. Dann wird sich zeigen, dass Kinder mehr können, als wir glauben! In dieser Hinsicht ist es sehr bedauerlich, dass Kunst in Erziehung und Bildung kaum noch gefördert wird. Entsprechende Fächer sind sogar weitgehend aus den Bildungsplänen verschwunden und der privaten Initiative überlassen. So klagte der bekannte Dirigent Nikolaus Harnoncourt: „Es ist symptomatisch für unsere Bildungsziele, dass bei den Kontrollmethoden – etwa der PISA-Studie2 – die Musik praktisch keine Rolle spielt.“ (Harnoncourt) Schon Grözinger bemerkte: „Der Forscher steht am Fernrohr und schaut in den Weltenraum; er steht am Mikroskop und betrachtet die Mutationen einer Fliege. Neben ihm steht ein Kind und kritzelt etwas an die Wand. Der Forscher ahnt nicht, dass auch hier Welten verborgen sind wie in dem Spiralnebel, dessen Entstehung er eben verfolgt; er denkt nicht daran, dem Kinde die Würde zuzusprechen, die er der Fliege nicht versagt, die Würde des Geheimnisses.“ (Grözinger, S. 1 6)
Dianes erster geschlossener Kreis
Was Diane vor kurzer Zeit mit ihren Spiralen zeichnen wollte, zeigt sie jetzt mit aller Deutlichkeit. (Abb. 4)
1) Diane zeichnet eine gebogene Linie. Weil sich der Bogen am Ende spiralig nach innen biegen will, korrigiert sie mit einer Gegenbewegung und stoppt dann unbefriedigt. (Pfeil)