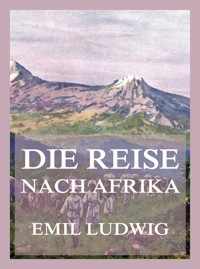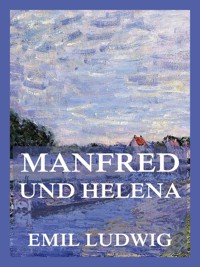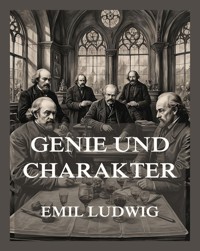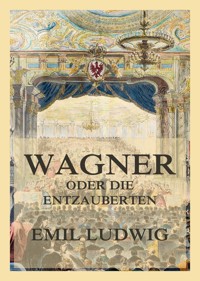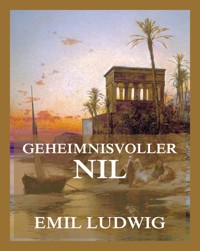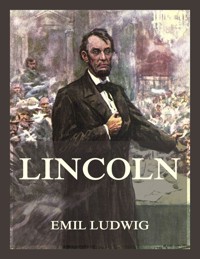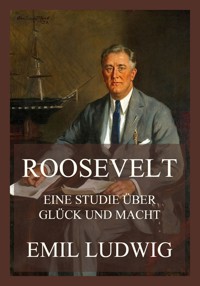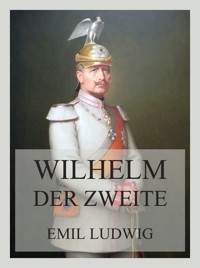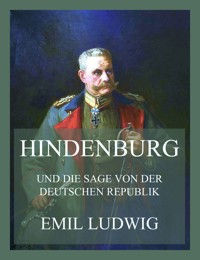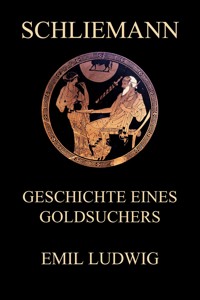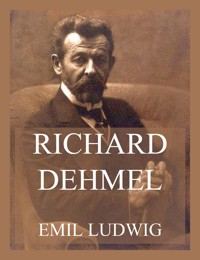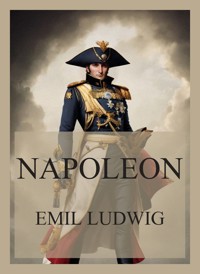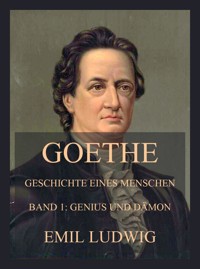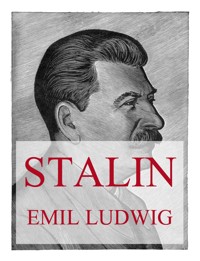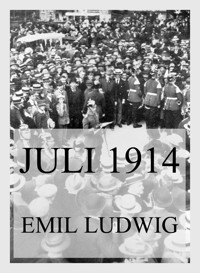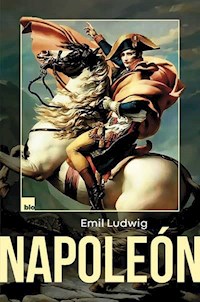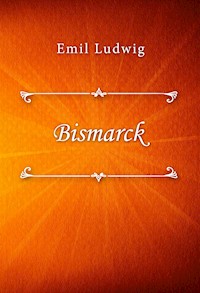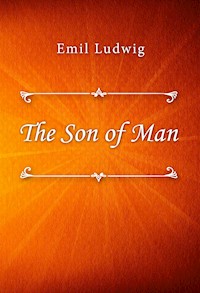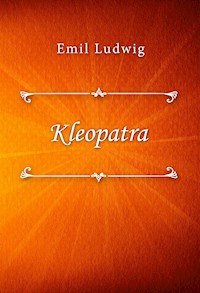Emil Ludwig: Genie und Charakter – Band 207 in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski E-Book
Emil Ludwig
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: gelbe Buchreihe
- Sprache: Deutsch
Emil Ludwig stellt uns in diesem Buch zwanzig historische Persönlichkeiten aus mehreren Jahrhunderten vor und spekuliert über ihren Charakter, etwa König Friedrich II., Freiherr vom Stein, Otto von Bismarck, Henry Morton Stanley, Lenin, Präsident Thomas Woodrow Wilson, Leonardo da Vinci, Walther Rathenau, Goethe und Schiller. Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Emil Ludwig
Emil Ludwig: Genie und Charakter – Band 207 in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski
Band 207 in der gelben Buchreihe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Emil Ludwig: Genie und Charakter
Teil eins
Stein
Bismarck
Stanley
Peters
Lenin
Wilson
Rathenau
Teil zwei – Leonardo
Shakespeare als Liebender
Rembrandts Selbstbildnis
Voltaire
Lord Byron und Lassalle
Goethe und Schiller
Dehmel
Herman Bang
Bildnis eines Offiziers
Die maritime gelbe Buchreihe
Weitere Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.
Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere.
* * *
2022 Jürgen Ruszkowski
Ruhestands-Arbeitsplatz
Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers
* * *
Der Autor Emil Ludwig
Der Autor Emil Ludwig
https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/ludwige.html
Emil Ludwig wurde am 25. Januar 1881 in Breslau geboren und starb am 17. September 1948 in Ascona. Er war ein deutscher und später Schweizer Schriftsteller jüdischer Abstammung, der sich auf psychologisch deutende Biografien weltgeschichtlich hervorragender Persönlichkeiten spezialisierte und damit Welterfolge erzielte.
* * *
Emil Ludwigs (1881-1948) Lebensgeschichte ist spannend wie ein Roman: Sie handelt vom Aufstieg eines mittellosen Bohemien zum Bestsellerautor der 1920er Jahre, dessen Biographien über historische Persönlichkeiten in mehr als 20 Sprachen übersetzt werden. So gerät Ludwigs Buch über den Exkaiser Wilhelm II. zur Abrechnung mit der Monarchie und zum politischen Skandal der Weimarer Republik.
Ludwig selbst wird weltweit zum Vertreter des „anderen“, des demokratischen Deutschland. Aufsehen erregt der rastlose Publizist u. a. durch seine Interviews mit Josef Stalin, Benito Mussolini sowie US-Präsident Franklin D. Roosevelt.
Wilhelm II.
Josef Stalin
Benito Amilcare Andrea Mussolini (* 29. Juli 1883 in Dovia di Predappio, Provinz Forlì; † 28. April 1945 in Giulino di Mezzegra, Provinz Como) war ein italienischer Politiker. Er war von 1922 bis 1943 Ministerpräsident des Königreiches Italien.
Franklin Delano Roosevelt (* 30. Januar 1882 in Hyde Park, New York; † 12. April 1945 in Warm Springs, Georgia).
1933 gehört Ludwig zu den Autoren, deren Bücher die Nazis verbieten und verbrennen. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wird er zu einer zentralen Figur des deutschen Exils in den USA. Als deutschlandpolitischer Berater der US-Regierung tritt er für eine radikale Umerziehung der Deutschen ein.
Bei alldem spielt der Mensch Emil Ludwig eine wichtige Rolle: der Künstler und Goethe-Enthusiast, der Lebenskünstler, der kein Verhältnis zum Geld hat und dessen Ehe ähnlich turbulent verläuft wie seine Liebesbeziehung zu der Schauspielerin Lilly Kardorff.
Eine wahre Geschichte!
https://www.velbrueck.de/Programm-oxid/Emil-Ludwig.html
* * *
Gibt es das eigentlich? Dass der meistgelesene deutschsprachige Autor der 1920er Jahre einfach verschwindet – aus dem Gedächtnis, aus den Bibliotheken, aus den Programmen der Buchverlage? Nicht mal Rowohlt hat ihn noch im Programm, sein einstiger Hausverlag. Dabei war Emil Ludwig einst ein Star wie Thomas Mann oder Erich Maria Remarque.
Seinen Durchbruch hatte der 1881 in Breslau Geborene 1920 mit „Goethe. Geschichte eines Menschen“. Immerhin gibt es dieses Buch als dicken, dreibändigen Nachdruck im Vero Verlag. Man kann also – wenn man Ludwig nicht antiquarisch kauft – zumindest lesen, wie dieser studierte Jurist und Sohn des bekannten Augenarztes Hermann Cohn die großen Gestalten der Geschichte auf damals völlig neue Weise anpackte.
Hermann Cohn, * 4. Juni 1838 in Breslau † 11. November 1906 in Breslau.
Denn mit seinem Stil war Ludwig einzigartig, ein Pionier, der seine Figuren aus ihren eigenen Lebenserfahrungen und persönlichen Stärken und Schwächen heraus handeln und begreifbar werden lässt. Darin durchaus seinem Zeitgenossen und Freund Stefan Zweig verwandt, dessen Bücher heute noch sorgfältig bei Fischer betreut werden.
Stefan Zweig (* 28. November 1881 in Wien; † 23. Februar 1942 in Petrópolis, Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien) war ein britisch-österreichischer Schriftsteller, Übersetzer und Pazifist. Zweig gehörte zu den populärsten deutschsprachigen Schriftstellern seiner Zeit.
Was der Historiker Armin Fuhrer (Armin Fuhrer (* 1963 in Düsseldorf) ist ein deutscher Journalist und Publizist.) hier macht, ist eine regelrechte Wiederentdeckung eines Verfemten, eines Mannes, der zwischen allen Stühlen saß und am Ende eigentlich Opfer der deutschen Cancel Culture wurde, ein Begriff, den ich hier eigentlich in Gänsefüßchen setzen müsste, weil er heute (wieder) von den falschen Leuten für das falsche Phänomen benutzt wird.
Denn genau die Leute, die sich heute so peinlich echauffieren über Gendern und Cancel Culture, haben Cancel Culture immer praktiziert. Mit dem peinlichsten aller Höhepunkte, der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933. Da warfen die uniformtragenden Studenten auch Bücher von Emil Ludwig ins Feuer. Denn wie kein anderer Schriftsteller aus Deutschland hatte er die Feinde der jungen Republik verärgert, regelrecht auf die Palme gebracht. Die konservativen deutschen Historiker hatten geradezu einen Feldzug gegen den ungeliebten Autor angezettelt, der mit seinen Büchern über Bismarck und Wilhelm II. die alten Märchen von ihren Nationalhelden regelrecht demontiert hatte.
Es war Emil Ludwig, der als Erster gezeigt hatte, dass auch hinter dem Leben und Handeln dieser beiden Nationalhelden nur Menschen steckten, richtige Menschen mit Schwächen, Abneigungen, Abhängigkeiten und Ängsten. Was er bei der Arbeit an seinem „Goethe“ gelernt hatte, wendete Ludwig fortan in immer neuen Büchern über berühmte Männer (und manchmal auch Frauen) an – und erreichte damit ein Millionenpublikum nicht nur in Deutschland (das er schon 1906 verlassen hatte, auch weil ihm das Kriegsgetöse wirklich Angst machte), sondern auch in Frankreich, England, den USA …
Als in der NS-Zeit tausende deutsche Künstler und Schriftsteller in die USA emigrierten, waren zwar Thomas Mann und Remarque die berühmtesten.
Paul Thomas Mann (* 6. Juni 1875 in Lübeck; † 12. August 1955 in Zürich, Schweiz) war ein deutscher Schriftsteller und einer der bedeutendsten Erzähler des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1929 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.
Erich Maria Remarque (eigentlich „Erich Paul Remark“; * 22. Juni 1898 in Osnabrück; † 25. September 1970 in Locarno, Schweiz) war ein deutscher Schriftsteller. Seine überwiegend als pazifistisch eingestuften Romane, in denen er die Grausamkeit des Krieges thematisiert, finden bis heute große Verbreitung.
Aber in den USA noch berühmter war Emil Ludwig, der sogar ein Buch über Franklin D. Roosevelt, den Präsidenten, geschrieben hatte.
Er war so berühmt, dass ihn die Staatsmänner seiner Zeit einluden und ihn tatsächlich baten, auch über sie ein Buch zu schreiben.
Darunter auch Stalin und Mussolini, über die er tatsächlich Bücher veröffentlichte. Genauso wie über Napoleon, Lincoln und Schliemann.
Abraham Lincoln (* 12. Februar 1809 bei Hodgenville, Hardin County, heute: LaRue County, Kentucky; † 15. April 1865 in Washington, D.C.) amtierte von 1861 bis 1865 als 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann (* 6. Januar 1822 in Neubukow; † 26. Dezember 1890 in Neapel) war ein deutscher Kaufmann, Archäologe sowie Pionier der Feldarchäologie. Als erster Forscher führte er Ausgrabungen im kleinasiatischen Hisarlık durch und fand die von ihm und zuvor schon anderen Forschern, vor allem Frank Calvert, hier vermuteten Ruinen des bronzezeitlichen Trojas.
Napoleon Bonaparte, als Kaiser Napoleon I., bzw. „Napoléon I“; * 15. August 1769 in Ajaccio auf Korsika als Napoleone Buonaparte; † 5. Mai 1821 in Longwood House auf St. Helena im Südatlantik).
Er war ein regelrecht entfesselter Autor, vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum sich Verlage heute so schwertun mit ihm. 300 Seiten waren für ihn eher mal eine Zwischendurchbeschäftigung. Denn er schrieb in einem Wahnsinnstempo, unterstützt von seiner Frau Elga, deren Rolle man nicht unterschätzen darf, wie Fuhrer betont.
Elga Ludwig (1884 – 1971)
Der eigentlich mit seiner Biografie über Ludwig auch davon zehren kann, dass Emil Ludwig nicht nur einige Erinnerungsbücher über sein Leben schrieb, sondern auch akribisch Tagebuch führte, sodass heute noch immer auf den Tag genau nachzulesen ist, wann er mit welcher heute immer noch berühmten Person der Zeitgeschichte sprach – darunter nicht nur seine berühmten Schriftstellerkollegen und -freunde von Ernst Toller bis Gerhart Hauptmann. Sondern auch viele Persönlichkeiten aus der Politik von Walther Rathenau über Gustav Stresemann bis zu Heinrich Brüning oder Otto Braun.
Walther Rathenau (* 29. September 1867 in Berlin; † 24. Juni 1922 ebenda) war ein deutscher Industrieller, Schriftsteller und liberaler Politiker (DDP). Während des Ersten Weltkrieges beteiligte er sich an der Organisation der Kriegswirtschaft und setzte sich für einen „Siegfrieden“ ein.
Gustav Ernst Stresemann (* 10. Mai 1878 in Berlin; † 3. Oktober 1929 ebenda) war ein deutscher Politiker und Staatsmann der Weimarer Republik, der 1923 Reichskanzler und danach bis zu seinem Tod Reichsminister des Auswärtigen war.
Heinrich Aloysius Maria Elisabeth Brüning (* 26. November 1885 in Münster; † 30. März 1970 in Norwich, Vermont, USA) war ein deutscher Politiker der Zentrumspartei und vom 30. März 1930 bis zum 30. Mai 1932 Reichskanzler.
Im Grunde dachte Ludwig auch wie ein Journalist. Ihm lag gar nichts daran, die Geschichte in Romane zu verwandeln, also künstlerisch zu verfremden. Im Gegenteil: Er nutzte die Romanform, um den Lesern auf spannende und – so Fuhrer – stilistisch brillante Weise die Menschen nahezubringen, die er hinter der Maske der historischen Persönlichkeit fand. Und das einfach nur, weil er – wie bei Goethe – die persönlichen Zeugnisse dieser Menschen ernst nahm, ihnen zubilligte, auch echte Gefühle zu haben und ein Leben abseits der offiziellen Ämter gelebt und auch durchlitten zu haben.
Erst so, so sein Ansatz, wird begreiflich, warum diese Menschen so handelten, wie sie handelten. Und wird auch deutlich, warum es zum Beispiel zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam, den ja heutige Historiker auch gern unter dem Motto „Traumwandler“ interpretieren. Man geriet – so liest sich das meist – eher ungewollt in diesen Krieg, keiner sei schuld.
Was den Punkt berührt, warum Ludwig bei den Nationalisten seiner Zeit (und das waren eben nicht nur die Nazis) so verhasst war. Denn die hatten mit der „Dolchstoßlegende“ auch ihre Interpretation von der Kriegsschuld zum Dogma gemacht. Wer auch nur andeutete, dass Deutschland bzw. die entscheidenden Personen rund um Wilhelm II. Mitschuld trugen am Kriegsausbruch, wurde – wie eben Ludwig – zur Zielscheibe bösartigster Angriffe.
In seinem Fall auch durch die komplette konservative Historikerzunft, die ihm in öffentlichen Kampagnen regelrecht Unwissenschaftlichkeit vorwarfen. Eigentlich ein Argument, das auf sie zurückfiel. Das diskutiert Fuhrer sehr ausführlich. Denn tatsächlich arbeitete Emil Ludwig auch in seinen Büchern zu Bismarck, Wilhelm II. und zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges („Juli 1914. Den Söhnen zur Warnung“) mit historischen Dokumenten und sprach mit vielen Zeitzeugen, die direkt dabei waren. Was ihm eben auch deshalb möglich war, weil Parteifarben ihn überhaupt nicht interessierten.
Ihn interessierten tatsächlich die Menschen, mit denen er sprach. Und dieser Ansatz sollte eigentlich Journalisten auch heute noch Ansporn sein: Er wollte wissen, warum sie so handelten, was sie antrieb. Wohl wissend, dass Geschichte das Ergebnis menschlicher Schwächen und Stärken ist.
Und dass nicht mal der scheinbar mächtige Mann an der Spitze gefeit ist vor Fehlern, Blindheiten, undurchdachten Entscheidungen oder – wie 1914 – absoluten Fehleinschätzungen, die auf Angst und Ignoranz beruhen. Und auf Dünkel und Stolz und – wie bei Wilhelm II. – dem Versuch, persönliche Schwächen durch besonders „mannhaftes“ Agieren zu kompensieren. Es sind meist die schwächsten Persönlichkeiten, die die schlimmsten Hunnenreden halten.
Und wenn man die 2018 erschienenen Bücher zum Jahr 1918 gelesen hat, weiß man, wie schwer sich Historiker bis heute tun, diese psychologische Dimension überhaupt wahrzunehmen und als historischen Zunder zu begreifen.
Fast bedauert man, dass Emil Ludwig nicht auch eine Hitler-Biografie geschrieben hat.
Begegnet ist er ihm nur einmal in einem Berliner Hotel, wo er aber – weil er auf solche Details achtete – sah, dass der noch nicht zum Reichskanzler ernannte Hitler vor allem eins war: Ein Schauspieler, der überall penibelst darauf achtete, seine Rolle des „Führers“ zu spielen. Und nur in Momenten, in denen er sich unbeobachtet glaubte, fiel er aus dieser Rolle.
Wie viel Schauspiel steckt eigentlich in Politik und Geschichte?
Und wie frei ist ein Autor davon, selbst aus der Rolle zu fallen? Oder in die Rolle? Denn es stimmt ja: Mit dem beginnenden Kesseltreiben das rechtsradikalen Deutschland gegen Ludwig begann sein Erfolg zu schwinden. Denn hier wurde massiv seine Integrität infrage gestellt, öffentlich und immer heftiger. Sodass Ludwig am Ende der Weimarer Republik wohl auch zu Recht das Gefühl haben durfte, ziemlich allein dazustehen.
Man möchte das gern einschränken.
Ludwig Marcuse (* 8. Februar 1894 in Berlin; † 2. August 1971 in Bad Wiessee) war ein deutscher Philosoph und Schriftsteller. Ab 1944 hatte er die amerikanische Staatsbürgerschaft. Dem jüdischen Großbürgertum entstammend, nahm Marcuse nach Beendigung der Schulzeit im Jahr 1913 ein Studium der Philosophie in seiner Heimatstadt auf.
Denn etwa von Ludwig Marcuse gibt es ja einen sehr präzisen und klugen Aufsatz, in dem der Ludwig gegen die schäumenden Professoren verteidigt. Doch allzu viel gab es da nicht. Und Ludwig war nicht der einzige, der Ende der 1930er Jahre schon das Gefühl hatte, dass der Republik schlicht die Republikaner fehlten, die bereit gewesen wären, sie zu verteidigen. Insbesondere das Lager der liberalen Parteien zerbröselte vor aller Augen. Es war zuallererst das Bürgertum, das die junge Republik im Stich ließ und sich zunehmend radikalisierte, sodass die SPD als Verteidigerin der Republik am Ende ziemlich allein da stand.
Fuhrers Buch ist ja nicht ohne Grund 600 Seiten dick geworden. Nicht weil er nun seinerseits versucht, Ludwig in seinem Handeln psychologisch zu erklären, sondern weil er Ludwigs Entwicklung sehr akribisch nachzuvollziehen versucht. Und es trifft eben auch auf Emil Ludwig zu, dass sein späteres Handeln auch (nur) aus seinen früheren Erfahrungen erklärlich ist.
Denn dadurch, dass er sich nicht auf die Position des Schriftstellers zurückzog, der sich nicht in die politische Debatte einmischte, wurde er schon in den 1920er Jahren selbst Teil der Debatte. Und wenn sich Medienforscher irgendwann einmal, wenn sie ihr strenges Korsett mal vergessen, auch mit der Debattenkultur der späten Weimarer Republik eingehender beschäftigen, werden sie merken, wie bekannt einem das alles ist.
Es ist dieselbe „Lust“ an der Verächtlichmachung, Aburteilung, Ausgrenzung, der rigiden Parteilichmachung auch in den großen Zeitungen, wie sie heute digital ausgelebt wird. Und eine unübersehbare Unlust an einer echten Debatte. Die deutschen Zeitungen haben einen gehörigen Anteil an dem, was da 1933 kippte.
Und bei Ludwig hinterließ das natürlich Spuren. Denn da er seinen Wohnsitz schon lange in die Schweiz verlegt hatte, war sein Blick auch ungetrübter, sah er deutlicher, was da im Norden vor sich ging, veröffentlichte er seine Warnung in Schweizer Zeitungen. Aber es nutzte ja bekanntlich nichts. Stattdessen musste er erleben, wie sich gute Freunde sogar dem neuen Regime andienten und noch lange glaubten, dieser Hitler würde schon bald gezähmt sein.
Ludwigs Appelle verhallen
Etwas, woran man ja sogar in Paris, London und New York glaubte, bis 1939 glauben wollte. Auch hier verhallten Ludwigs Appelle, der zwar diesen Hitler bis 1932 nicht wirklich ernst nahm, aber dann umso entschiedener davor warnte, den Mann und seine Drohungen nicht ernst zu nehmen.
Dass Ludwig auch deshalb vieles klarer sah, hat natürlich auch mit seiner Lebensgeschichte zu tun. Denn nicht ohne Grund war er so fasziniert von „starken“ Männern, eine Faszination, die ihn sogar Mussolini bewundern ließ. Als sich Ludwig ab 1940 im Exil in den USA (wo er zeitweilig in nächster Nachbarschaft zu Thomas Mann wohnte) heftigst mit fast der kompletten Emigrantenszene zerstritt, waren einige seiner früheren Bücher durchaus auch Munition gegen ihn selbst, stellten ihn selbst eine kluge Kritikerin wie Hannah Arendt in eine Ecke, wo er beileibe nicht hingehörte.
Aber da hatte er dann auch schon den ganz großen Holzhammer herausgeholt und in mehreren Büchern den Amerikanern erklärt, dass ihr Feind eben nicht nur Hitler hieß, sondern Deutschland. Und dass „die Deutschen“ sehr wohl Schuld trugen am Aufkommen des Nazireiches und an der Entfesselung des Krieges. Und dass sie dafür nach dem Krieg auch bestraft werden müssten. Eine Position, mit der er unter den deutschsprachigen Exilanten ziemlich einsam dastand. Und die uns natürlich heute auch sehr rigide vorkommt. Was wäre aus uns geworden, wenn die Alliierten damals tatsächlich so mit Deutschland umgegangen wären?
Wahrscheinlich haben all jene recht, die – nach anfänglicher Begeisterung über Ludwigs Vorschläge – dann doch lieber eine andere Strategie wählten, nicht den Morgenthau-Plan umsetzten, sondern lieber den Marshall-Plan.
Warum aber ist er so geworden, fragt man sich beim Lesen dieses fast letzten Kapitels in Ludwigs Leben, denn er starb ja schon 1948 kurz nach seiner Rückkehr in die Schweiz? War es wirklich nur Eitelkeit, verletzter Stolz und der Wunsch, als „wichtig“ wahrgenommen zu werden und gar den Präsidenten beraten zu dürfen?
Das fragt man sich auch als Journalist, denn eigentlich hat man doch 20 Jahre zuvor einen Autor gesehen, der keine Scheu hatte, mit den Männern der Zeitgeschichte einfach freundlich und ohne Scheuklappen zu reden, weil er wissen wollte, wie sie dachten und fühlten. Da war von „den Deutschen“ keine Rede, wäre auch Ludwig nie auf die Idee gekommen, die Bewohner Deutschlands alle in einen Sack zu stecken.
All seine Bücher über berühmte Persönlichkeiten erzählen ja eigentlich davon, dass es „die Völker“ gar nicht gibt, sondern stets nur von Emotionen getriebene Individuen, die ihren eigenen Vorstellungen folgen. Warum sollte das unterhalb der Ebene der Berühmtheiten anders sein?
„Land der Dichter und Denker“
Aber Ludwig war ja nicht der Einzige, der sich da im Exil ein eigenes Interpretationsmuster von „den Deutschen“ schuf, das einem eigentlich auch von anderen Autoren vertraut ist, die durchaus ähnlich kritisch auf die Rolle Preußens und des Militärs in Deutschland schauen und die zelebrierte Begeisterung für Uniformen und Kriege. Und dann quasi als Gegensatz die Welt der Musik und Dichtung, die dann in dem immer peinlicheren Spruch vom „Land der Dichter und Denker“ mündete.
Diese Stereotype gibt es ja heute noch, gern gepflegt von überzeugten Chauvinisten, die selten bis nie ein Buch in die Hand nehmen, aber ergriffen jede Wagner-Inszenierung verfolgen. Wobei Ludwig ja dafür plädierte, jede Wagner-Aufführung in Deutschland erst mal 50 Jahre lang zu verbieten. Denn dass Hitlers Inszenierung vor allem Wagner-Inszenierung war, das war ihm unübersehbar. Heute eiern die Historiker ja gern herum, wenn sie über Hitlers Wagner-Anhimmelung schreiben und versuchen, Wagner irgendwie von Hitler reinzuwaschen.
Aber man ahnt bei diesem Ludwig, dass es sich lohnt, die Dinge eben nicht nur Schwarz und Weiß zu sehen, in diesem gnadenlosen deutschen Entgegensetzen und Ausgrenzen, als gäbe es immer nur eine Wahrheit. Womit man wieder bei der Cancel Culture wäre, die Ludwig in den USA dann gerade aus der Emigranten-Szene mit aller Heftigkeit erlebte. Die sich logischerweise auch angegriffen fühlte, denn stand sie nicht für „das andere Deutschland“?
Brach Ludwig da nicht auch den Stab über die Menschen, die unter Hitler litten und geflohen waren? Freilich war das aber auch nicht der Moment, in dem Ludwig noch fähig gewesen wäre, den Dialog zu suchen. Und irgendwie fehlten ihm in dem Moment wohl die Menschen, die ihn gebremst hätten. Denn dass er hier von Emotionen getrieben war und sich völlig im Recht fühlte (und im Besitz der Wahrheit) ist ja unübersehbar.
War vielleicht schon früher sichtbar, wie Fuhrer feststellt, in Ludwigs seltsamen Ringen um den Alleinbesitz Goethes, das ihn letztlich sogar in einen ganz und gar nicht klugen Angriff auf Thomas Mann und dessen Goethe-Verehrung stürzen ließ. Als wäre sein Selbstwertgefühl angegriffen, als wäre sein eigenes Werk völlig infrage gestellt dadurch, dass ein hochbegabter Konkurrent ihm das Feld auf einmal streitig machte.
„Verehrt, verfemt, verbrannt“
Armin Fuhrer hat die Biografie mit dem Dreiklang „Verehrt, verfemt, verbrannt“ untertitelt. Dabei hätte das „verfemt“ durchaus an die letzte Stelle gehört, denn augenscheinlich waren es genau diese letzten Jahre, in denen sich Emil Ludwig mit fast allen Emigranten heftig zerstritt und so auf einmal auch nicht Teil der Wiederentdeckungen nach dem Krieg wurde, auch wenn einige seiner Buchtitel nach 1945 endlich auch auf Deutsch erscheinen konnten. Er wird zwar erwähnt, wenn es um Emigrationsliteratur geht, aber präsent ist er nicht.
Ob es nur die gewaltige Dicke seiner Bücher ist, darf man wohl bezweifeln. Und ob seine psychologische Herangehensweise heute nicht mehr lesbar ist, kann man ja auch nicht einschätzen, wenn die Bücher nicht präsent sind und diskutiert werden. Hatte er die falschen Thesen? Wohl eher nicht. Eher ging es ihm wohl so, wie es den unpassenden Wortmeldungen in Diskussionen oft geht: Da sie weder ins Schwarze noch ins Weiße Lager gehören, ignoriert man sie, nimmt ihre Positionen auch nicht ernst.
Und natürlich kam ihm sein Schweizer Pass da in die Quere: Er konnte „die Deutschen“ und Deutschland von außen her denken, denn er kehrte ja in die Schweiz zurück, während sich die meisten Emigranten sehr wohl Gedanken darüber machten, was aus diesem Deutschland jetzt werden sollte. Ein Paria unter den Staaten? Eigentlich ein Unding.
Und so schaut man in gewisser Weise auch einem Trauerspiel zu, wenn man Ludwig am Ende so kämpfen sieht, als müsste er noch irgendetwas abrechnen und ausfechten, man weiß nur nicht, gegen wen eigentlich. Warum hat ihn niemand beruhigt und ihm erklärt, dass es niemals gut ist, sich völlig enthemmt in öffentliche Schlachten zu werfen? Mit entfesselten Emotionen schreibt es sich nicht gut. Gar nicht.
Das schafft selbst nur wieder Verbitterung und noch schärfere Angriffe. Aber Emil Ludwig hatte wohl auch nicht das Talent, die Dinge sich erst einmal setzen zu lassen. Oder sich selbst zurückzunehmen, wenn er merken musste, dass er selbst verletzend wurde. Was ja auch mit seinem Schreiben zu tun hatte. Denn war er erst einmal im Stoff, arbeitete er ihn in einem furiosen Tempo herunter. Dann will das gesagt und geschrieben sein.
Wie funktioniert eigentlich Politik?
Was in der Literatur oft genug grandiose Texte ergibt – in der öffentlichen Debatte aber meist zu einer Radikalisierung des Ganzen führt. Am Ende mehren sich die persönlichen Angriffe, will man gar verletzen, vielleicht auch nur, weil einem irgendetwas sagt, dass der andere endlich aufhören soll. Aber das passiert ja nicht, wie heute eine Menge Leute aus den enthemmten Diskussionen im Internet wissen.
Die einzige Bremse ist genau die, die auch eine Demokratie am Leben erhält: der Wille zur Rücksicht, zum Zuhören und zur Bereitschaft, den anderen zumindest zuzubiligen, dass in ihrer Position auch eine Sichtweise steckt, über die man reden kann. Was unter Demokraten ja die Regel sein sollte – von den anderen reden wir hier mal nicht.
Aber diese Tugenden scheint Emil Ludwig am Ende nicht mehr für wichtig gehalten zu haben. Mit langanhaltenden Folgen, die wohl auch dazu geführt haben, dass nach seinem Tod niemand da war, der sein Werk lebendig erhalten hätte und wenigstens die Bücher immer wieder aufgelegt hätte, die für uns heute noch wichtige historische Fragen aufwerfen – wie seinen „Bismarck“ oder „Wilhelm der Zweite“ oder den 1935 bei Querido erschienenen „Hindenburg“, ein Buch, das auch ein wenig erklärt, warum Ludwig den Deutschen eine Vergötterung vom Militär und Führerkult attestierte.
Und das damit auch Fragen aufwirft wie die: Wie funktioniert eigentlich Politik? Und warum ist dieser trübe Glanz der selbst ernannten Führerfiguren auch heute wieder (oder noch) für einige Menschen so anziehend? Warum wählen so viele Menschen nicht wie kluge und informierte Demokraten, sondern nur zu gern autoritäre Bühnenredner?
Eine höchst aktuelle Frage. Und Armin Fuhrer macht mit seiner akribisch erarbeiten Lebensgeschichte Emil Ludwigs eben auch deutlich, dass dieser Autor zu Unrecht vergessen ist und viele Fragen auch kontrovers anreisst, die uns eigentlich heute genauso nahegehen, wie sie den Leser/-innen in der Weimarer Republik hätten nahegehen müssen. Vielleicht auch gingen, denn seine Bücher erreichten ja gewaltige Auflagen.
Nur half das nicht, den Rechtsrutsch zum Ende der Weimarer Republik zu verhindern. Und Fuhrer merkt durchaus kritisch an, dass Emil Ludwig wohl auch übersah, wie machtlos eine Bevölkerung gemacht werden kann, wenn die etablierten Eliten die Macht sogar freiwillig in die Hände eines Extremisten legen.
Nur so als Gedanke zum Schluss, denn bei Ludwig findet man die Antworten dazu wohl eher nicht. Auch wenn sein Leben eben auch davon erzählt, dass selbst ein friedliebender Mensch wie er am Ende meinte, Einfluss auf die Geschichte nehmen zu müssen. Obwohl er um alle Tücken und Fallstricke wusste aus seiner Beschäftigung mit den Großen der Vergangenheit.
Ein am Ende tragisches Schicksal, bei dem die Frage tatsächlich offenbleibt: Ist er tatsächlich durch alle Raster gefallen nach dem Krieg und damit auf gewisse Weise nachträglich verfemt? Oder tun sich deutsche Verleger tatsächlich schwer mit seinen Büchern und zögern deshalb, die oft viele Seiten starken Romanbiografien wieder aufzulegen?
Denn auch das erfahren wir ja, dass der Erfolg Ludwigs in den 1920er Jahren auch eng mit dem guten Riecher Ernst Rowohlts für zugkräftige Titel und Autoren zusammenhängt. Und für ihr Gefühl für das, was die Leser/-innen dazu bringt, sich das neueste Buch aus dem Buchladen zu holen. Das funktionierte erstaunlich gut, bis auch Rowohlt in den Strudel der Finanzkrise von 1929 geriet.
Jedenfalls würdigt Fuhrer mit diesem Buch einen Mann, der zwingend in alle Literaturgeschichten zur deutschen Literatur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehört, der aber aus unerfindlichen Gründen fast daraus verschwunden ist. Was Emil Ludwig auf keinen Fall verdient hat, erst recht, wenn man weiß, wie eng befreundet er mit etlichen der besten Autoren seiner Generation war, die heute alle wie selbstverständlich im Buchregal stehen. Nur bei L ist eine Lücke. Eine ziemlich große. https://www.l-iz.de/bildung/buecher/2021/09/emil-ludwig-die-eindrucksvolle-biografie-eines-fast-vergessenen-erfolgsautors-408533
* * *
Emil Ludwig: Genie und Charakter
Emil Ludwig: Genie und Charakter
* * *
Über historische Gestaltung
https://www.projekt-gutenberg.org/ludwige/geniecha/geniecha.html
Amor fati
Der modernste unter allen Porträtisten ist jetzt grade achtzehnhundert Jahre tot, er hieß Plutarch (Plutarch („Ploútarchos“, latinisiert „Plutarchus“; * um 45 in Chaironeia; † um 125) war ein antiker griechischer Schriftsteller. Er verfasste zahlreiche biographische und philosophische Schriften, die seine umfassende Bildung und Gelehrsamkeit zeigen.) und war, paradox genug, ein Böotier. Aber in Wahrheit war er Athener an Kultur, Franzose an psychologischer Verve, Engländer an Puritanismus, an Gründlichkeit ein Deutscher. Zur Zeit Trajans hat er die Grundsätze ausgesprochen und selbst erfüllt, denen wir heut wieder zu genügen trachten:
„Nicht Geschichte schreibe ich nieder, sondern Lebensschicksale; nicht in berühmten Taten liegt allein der Beweis von Tugend oder Schlechtigkeit; oft zeigt vielmehr ein kleiner Umstand, ein Wort, ein Scherz den Charakter besser als große Schlachten und Belagerungen. Wie der Maler vor allem nach Gesicht und Zügen die Ähnlichkeit bestimmt, worin sich der Charakter kundgibt, so gestatte man auch mir, mich an die Anzeichen des Geistes zu halten und durch sie dem Porträt seine Form zu geben, Großtaten aber und Kämpfe anderen zu überlassen.“
Zu allen Zeiten haben große Männer den Plutarch geliebt, hier fand der Kenner des Menschen seine eigenen Motive, Fähigkeiten, Dunkelheiten wieder. Napoleon führte ihn durch 20 Jahre mit sich, er las am Abend mancher Schlacht in seinem Zelt das Leben Cäsars, und zugleich schrieb sein Todfeind, der Freiherr vom Stein, wie häufig „große Männer in der Jugend durch Lesen der Geschichte sich zu edlen Taten angefeuert, in reiferen Jahren deren Lehren benutzt, im Alter durch Rückblick auf ihr eigenes Schauspiel sich über das Erlittene beruhigt und gestärkt haben.“
Charles Robert Darwin (* 12. Februar 1809 in Shrewsbury; † 19. April 1882 in Down House/Grafschaft Kent) war ein britischer Naturforscher. Er gilt wegen seiner wesentlichen Beiträge zur Evolutionstheorie als einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler.
(Siehe Band 171e in dieser gelben Buchreihe)
Nach einer Zeit, die den Menschen aus Abstammung und Erziehung zu bestimmen suchte, ist uns, der darwinistischen Welt Entfremdeten, die Persönlichkeit als solche, zeitlos beinahe, wieder Studium geworden: Maße, Spannung und Lähmung ihrer Lebenskräfte, Trieb zur Tat und Hemmung durch Gedanken, das wechselnde Fluidum ihrer Stimmungen. Während unsere Väter fragten, wie der einzelne mit der Welt harmonierte, fragen wir zuerst: harmoniert er in sich selber? Siege und Verantwortungen sind aus dem Milieu in die Seele des einzelnen zurückverlegt worden, so dass die Darstellung ins Innere zu dringen sucht, die früher der Sphäre gewidmet war. Auch das erneute Interesse an Memoiren ist ein biologisches, der Porträtist von heute, vor allem Psychologe, steht vielleicht dem Biologen näher als dem Geschichtsschreiber.
Umso freier ist er in seinen Formen. Er kann die dramatische Form benötigen oder den kurzen Essay, die mehrbändige Lebensbeschreibung oder den Leitartikel; alle diese Formen sollten ihm vertraut sein und je nach Objekt und Zweck der Darstellung von ihm ausgewählt werden; wie sein Bruder, der stumme Porträtist, Öl, Stift oder Kohle, Radiernadel oder Wasserfarben wechselweise benutzt.
In allen Fällen ist seine Aufgabe die gleiche, es ist die Entdeckung einer Menschenseele. Freilich baut der Porträtist auf dem rein wissenschaftlichen Biographen auf und bleibt immer sein Schuldner. Mit einer gewissen zynischen Naivität reisst er ihm mühsam erforschte Wahrheiten weg, um sie auf seine Art zu benutzen; ein Künstler, der die Beete einer Gärtnerei durchstöbert und, ist er fort, einen beraubten Garten dem grollenden Gärtner zurücklässt, doch in den Händen glüht ihm der schönste Strauß.
Denn wenn der Philolog mit seinem Studium beginnt, aus dem sich ihm allmählich das Bild des Menschen enthüllt, so hat der Porträtist mit der Vision seiner Gestalt begonnen und sucht aus den Akten im Grunde nur Bestätigungen seines inneren Vorgefühls. Wehe ihm aber, wenn er dabei zu phantasieren anfängt, wenn er Daten auch nur um Nuancen verschiebt, sich also dem Romancier annähert!
Denn der historische Roman ist immer ein unhistorischer Roman und darum das Schreckbild des echten Porträtisten. Wer schweift und erfindet, während er seine Gestalten mit historischen Namen schmückt, versündigt sich nicht bloß an der Gestalt, er verliert obendrein auch die Partie; denn Gott ist immer weise und überdies phantastischer als der Dichter und hat dem Lebenslauf seiner Wesen stets eine tiefere Logik mitgegeben, als sie der feinste Konstrukteur erdichten kann. Wer nicht mit Anbetung vor der Notwendigkeit aller Lebensdaten des Menschen steht, sollte nie wagen, einen historischen Menschen nachzubilden; er mag nur immer in seinen Träumen schweifen!
Darum tut der Porträtist vor allem gut, nur den Menschen darzustellen, der tot und also, wie die Sprache sagt, vollendet ist, denn Zeitpunkt, Art und Umstände des Todes geben oft erst den Schlüssel zu allem Vorangegangenen; das Porträt eines Lebenden bleibt immer nur unter Vorbehalten richtig, wie ja auch unter den gemalten Bildnissen eines Menschen das letzte – die Maske des Toten – immer das wahrste bleiben wird, wenn auch keineswegs immer das schönste.
Überhaupt geht vom Bildnis des Menschen meist die Vision seines Wesens aus, und die großen Porträtisten mit Pinsel oder Feder sind sämtlich große Physiognomen gewesen. Bildnisse, diese stummen Verräter, sind darum für den Biographen Materialien von demselben Werte wie Briefe, Memoiren, Reden, Gespräche, soweit sie der wissenschaftliche Vorgänger für echt erkannt hat, oder wie die Handschrift. Darum ist eine Biographie ohne voranstehendes Bildnis unmöglich.
So geht es auch mit den Gewohnheiten des Menschen: sie wurden früher wie Kuriosa eingefügt, kleine Bonbons für den Gaumen des Lesers; vollends die Anekdote wurde nur mit Fragezeichen, verschämt und gleichsam bei verdunkelter Forscherwürde überliefert. Uns anderen weist die kleinste Gewohnheit zuweilen die Richtung, um auf bestimmte Züge des Charakters zu stoßen, und die verbürgte Anekdote wird zum Epigramm.
Noch heute schließen wissenschaftliche Biographien zuweilen mit einem Kapitel, das den Helden „als Menschen“ schildern soll; ein Anhang, wie die Tafel einer Schlacht oder das Faksimile eines Notenblattes. Was aber soll denn der Porträtist darstellen als eben sein Objekt als Menschen? Und welche andere Aufgabe ist ihm gestellt, als alle Taten und Gedanken, Wünsche und Motive dieses Menschen zurückzuführen auf nicht mehr teilbare Elemente der Seele?
Dies zu erfüllen, muss er freilich mehr als ein Kenner der Epoche, Kenner des Menschen muss er sein, Psycholog und Analytiker. Die Deutung einer Seele aus den Symptomen des Handelnden muss ihm geläufig sein, aus Intuition wie aus Erfahrung. Sicher sind in großen Diplomaten große Biographen versteckt; sicher könnten diese im Kreise der Diplomatie fruchtbar werden.
Doch auch Kenner des Genius muss der Darsteller sein, und eben hierin liegt die größte Schwierigkeit begründet. Dichterische Kraft ist Bedingung zur Erkenntnis und Darstellung eines Dichters, weltliches Leben zur Darstellung eines Weltmannes, politische Einsicht zur Darstellung des politischen, Kenntnis der Frauen zur Darstellung des erotischen Menschen; ein verwandtes Fühlen, mit einem Worte, ist Bedingung zur Darstellung genialischer Naturen.
Luc de Clapiers, Marquis de Vauvenargues (* 6. August 1715 in Aix-en-Provence ; † 28. Mai 1747 in Paris ) war ein französischer Philosoph , Moralist und Schriftsteller.
„Ich finde Gefallen in dem Gedanken – schrieb Vauvenargues – dass, wer so große Taten versteht, nicht außerstande gewesen wäre, sie auszuführen, und mir erscheint das Schicksal ungerecht, das ihn darauf beschränkt hat, sie niederzuschreiben.“
Wer seine Aufgabe in so großem Sinn fasst und entschlossen ist, in der Erzählung eines Lebenslaufes zugleich ein Exempel für das Wesen des Genies zu geben, wem sein Held nur immer eine Art von Beispiel bedeutet, um die Grenzen der Menschheit zu bezeichnen, der ist im Vorhinein jeder Gefahr der Parteinahme überhoben; er kann weder national noch sonst verblendet sein, parteilos steht er vor seinen Helden und ist, wie Shakespeare und Balzac, die Menschenschöpfer, durch keine sogenannte Weltanschauung begrenzt.
Hier liegt ein neues Problem: muss der Biograph kalt sein wie der Richter oder leidenschaftlich Stellung nehmen wie der Advokat? Uns scheint die rein platonische Darstellung salzlos und langweilig; doch auch die Forderung ist einseitig, man müsse seinen Helden von Grund aus lieben.
Auch hierin ist Plutarch Vorbild und Meister. Indem er immer einen Griechen in Parallele mit einem Römer stellt, kann er die Kunst des Wägens und jede Freiheit von Vorurteilen erweisen. Immer erkennt er den Genius und bleibt vor ihm unbestechlich. Mit der Intuition des Dichters durchdringt er die Motive seines Helden, erspürt die Leidenschaft und wiederum die Freiheit als Motiv. Durch beinah unsichtbare Anzeichen, wenn sie nur schlagend sind, lässt er sich leiten, durch die sichtbarsten Daten lässt er sich nicht blenden. Den Charakter entwickelt er ohne Rücksicht auf das Genie, doch unversehens entfaltet sich dieses mühelos aus dem Charakter.
In dieser Kunst sind die Franzosen groß; unter den Deutschen ist sie vielleicht nur Goethe in seiner Psychographie Winckelmanns gelungen, die sich der Skizze eines Dramatikers nähert.
Johann Joachim Winckelmann; * 9. Dezember 1717 in Stendal; † 8. Juni 1768 in Triest) war ein deutscher Archäologe, Bibliothekar, Antiquar und Kunstschriftsteller der Aufklärung. Er gilt, neben Flavio Biondo, als der Begründer der wissenschaftlichen Archäologie und Kunstgeschichte und als geistiger Begründer des Klassizismus im deutschsprachigen Raum.
Dies sind die Vorbilder der folgenden Versuche. Man wird darin tätige und betrachtende, handelnde und bildende Menschen finden, alle genialisch, alle problematisch. Auf den Schnittpunkt dieser Eigenschaften kommt es an. Auch dort, wo sie im Politischen wirken und noch aus unseren Tagen stammen, wird der Versuch gemacht, sie von oben zu sehen, wie denn diese zwanzig Bildnisse, die sechs Jahrhunderten und neun Nationen angehören, nur durch ihre Seelenzustände, doch eben durch diese stark verbunden sind.
Aus Skizzen solcher Art können sich Vorbilder des Menschlichen entwickeln. Und eben dies ist hier der Sinn und Zweck. Dem Leser jeder Sphäre, besonders aber der Jugend darzustellen, wie große Männer keine Götter sind, wie sie von denselben allzu menschlichen Passionen, Hemmungen und Lastern geschüttelt wurden, die jeden andern Sterblichen beunruhigen, und wie sie dennoch sich zu ihren Zielen durchkämpfen: das ist unsere erzieherische Absicht. Auf diese Art spornt man den Menschen an, sich selbst, trotz allem, das Höchste abzufordern.
Eine andere Schule der Darstellung, mit der man auf Universitäten das Genie in seinem Werke aufzulösen strebt, während wir das Werk in der Persönlichkeit aufgehen lassen, bringt dem Leser den Vorteil eines Systems, das uns durchaus fehlt; sie hat dafür den Nachteil, nie als lebendiges Vorbild zu wirken. Was sich daneben in psychiatrischem Hochmut tummelt, wird nie einen vollen Menschen, stets nur seine verdunkelte Provinz beschreiben.
Wozu aber überhaupt Geschöpfe nachbilden, wenn nicht ein Vorbild, vielleicht auch eine Warnung daraus entsteht! Dies war zu allen Zeiten Sinn des Dramas; es sollte dem Porträtisten auch dann das hohe Ziel bedeuten, wenn er sich biographischer Formen bedient.
Doch dazu ist berufen nur, wer die Rhapsodie seines eigenen Lebens immer wie eine fremde vernimmt, wer in seinem Schicksal, auch wenn es unbewegt erscheint, ein Gleichnis noch des bewegtesten erfühlt: nur wer sich immer in der Menschheit spiegelt, ist geschaffen, Menschen nachzuschaffen. Er allein, der sein Leben als ein Gleichnis erlebt, ist reif, das Gleichnis anderer Menschen zu erfassen.
Denn wie er selbst Notwendigkeit in seinen Tagen spürt, so wird er mit Ehrfurcht in fremden Geschicken nichts anderes als Notwendigkeit erkennen und mit behutsamer Hand das, was geschah, aus dem verschlungenen Gewebe der Charaktere deuten, in denen Gottes Finger winkt.
* * *
Teil eins
Teil eins
Friedrich II. oder Friedrich der Große (* 24. Januar 1712 in Berlin; † 17. August 1786 in Potsdam), volkstümlich der „Alte Fritz“ genannt, war ab 1740 König in, ab 1772 König von Preußen.
Friedrich II.
„Die Kugel die mich treffen soll, kommt von oben.“
Im Gleichgewicht beginnen manche Naturen ihre Bahn, dann werden sie von den Ereignissen beunruhigt und enden ohne Harmonie. Manche tragen von Anbeginn den Geist des Widerspruchs in sich, so tief, dass auch die glücklichste Entwicklung sie nicht heilen kann. Wenige sind es, die treten ein voll Unruh, Dunkelheit und innerer Spaltung, dann aber werden sie in ihrem Lauf von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gewisser, werden klarer, bis sie am Ende ihrer Bahn zu jener Harmonie gelangen, für die sie die Natur vorausbestimmt.
Zu diesen zählt Friedrich.
Zwei Neigungen gefährdeten ihn: sein Hang zur Philosophie und zur Lebensform des Weltmannes.
Zwei Ereignisse reiften ihn: der Zorn des Vaters und die Folgen seiner Ruhmsucht.
* * *
Mit 16 Jahren war Friedrich nur ein zarter, hübscher Junge, die langen Locken wohlgekräuselt, mit einem Hang zu den Künsten der Frauen. Mit Recht schilt ihn der Vater effeminiert, denn auf preußische Throne gehört kein van Dyckischer Prinz. Nun kommt er an den Dresdener Hof, der Rausch, die Feste überfluten ihn. Früh sinnlich, schmachtend, weiblich, wie er ist, beginnt er mit einem Raffinement: sterblich verliebt er sich in ein älteres rassiges, heiteres Mädchen, die schöne Gräfin Orzelska, die man in Männerkleidern kaum erkannte. Doch als ihm dann auf einem Maskenfest eine andere Schöne, wenig verhüllt, hinter einem Vorhang gezeigt und angeboten wird, verlässt er die Gräfin. Von nun ab tanzt er leidenschaftlich.
Wieder in Berlin, wird er schwermütig und dichtet die ersten Liebesoden. Dies ist der Auftakt einer höchst unpreußischen Prinzenbahn. Mutig von Natur ist er keineswegs. Sein Vater schilt ihn, dass er sich so schmählich behandeln lasse, doch als er ihm anträgt, auf die Krone zu verzichten, um dafür seinen Neigungen zu leben, lehnt Friedrich entschieden ab. Es folgen zwei Versuche zur Flucht. Beide scheitern. War ihm zu wünschen, dass sie glückten? Was wäre aus ihm in England geworden, aus diesem haltlosen jungen Herrn? Sofern er zur Harmonie in reiferen Zeiten ausersehen war: hier musste der Unruhige straucheln und Strafe leiden.
Er schwört, nie werde er nachgeben. Zwei Monate später, in der Küstriner Zelle, schwört er: alles zu tun, was der Vater verlange, dem König wie ein Knecht zu gehorchen. Vor seinem Fenster wird der geliebte Freund, wird Katte hingerichtet.
Er sieht's und zittert nur für sein eigenes Leben, misstraut dem Prediger, der ihm beruhigendes Wasser reicht, misstraut noch seinem Zuspruch, den er für letzte Tröstung vor dem Tod nimmt.
Männlicher in jedem Betracht, kehrt er in Freiheit und Stellung zurück. Hier beginnt Friedrichs Verschlossenheit, sein Rationalismus. Auch Verlöbnis und Ehe nimmt er, bei allem Abscheu vor der Ausgewählten, gern an als Mittel zu größerer Freiheit. Da diesen geistigen, anomalen, den eigenen Vätern fremden Mann nie der Gedanke der Generationen erfasste, blieb er recht froh ohne Kinder und hat den Wunsch nach solchen, auch nach illegitimen, nie geäußert oder verwirklicht. Seine Unruhe hat andere Quellen.
Kredo des 20jährigen: „Ich bin all mein Lebtag unglücklich gewesen; vielleicht dass ein plötzliches Glück auf all den Verdruss mich zu stolz gemacht hätte. Es steht mir noch immer eine Zuflucht offen: ein Pistolenschuss kann mich von diesem Leben und Leiden befreien. Ich fühle, wenn man jeden Zwang so hasst wie ich, dann treibt einen das heiße Blut immer zum Extreme hin.“
* * *
Die Jahre von Rheinsberg gelten für Friedrichs glücklichste Zeit.
Schloss Rheinsberg
Es war nur seine ruhigste: ein 25jähriger nahm vorweg, was zwei Jahrzehnte später in Sanssouci dieselbe Lebensform zur Reife brachte. Ein junger Mensch, ganz unerprobt, sehr tatenlustig, nicht in der Lage abzusehn, wann er zum Handeln berufen würde, lässt sich von Knobelsdorff auf das Portal seines Landhauses meißeln: Federico tranquillitatem colenti. Lustschiffe auf dem See, er selbst als Liebhaber den Philoktet, den Mithridates spielend, spielerische Gründungen von Ritterorden, die den altfranzösischen Ritterstil erweckten, frühreife Aperçus bei Tisch, Prachtausgabe der Henriade, Herbeiholung der neusten Schriften des Herrn von Voltaire aus Paris, von Friedrich „mein Goldenes Vließ“ genannt, Abfassung schlechter Verse im Geschmack der Zeit: das ist alles.
Doch es sind Züge der Entsagung: aus Glücksbestreben sich zum Platoniker zu stempeln, da man vom Handeln ausgeschlossen ist. „Ich gehöre zur Klasse der betrachtenden Menschen, was sicher das Angenehmste ist.“ Man spürt die herrische Verschlossenheit. Das Angenehmste? Warum dann nennt er Verse und Weltweisheit nur „Trost“ in schlimmen Tagen, nur „Berauschung im Glück“? Gehört zur Klasse der Betrachtenden, wer aus der gesamten Philosophie sich immer nur für praktische Ethik interessierte, die der Lebendige sich noch am meisten fruchtbar machen kann? Die Metaphysiker verachtet er und setzt sie mit gewissen chinesischen Geheimniskrämern in Vergleich, und als man ihm Wolfs Metaphysik übertragen hatte, nahm ihm einer jener exotischen Sonderlinge, die er in den Zimmern hielt, nahm ihm ein Affe die Arbeit ab und steckte das Werk unaufgefordert in den brennenden Kamin.
Nicolò di Macchiavelli
Macchiavellis Buch vom Fürsten hat er ganz falsch verstanden, es war allein für jene Zeit geschrieben: ein italisches Vademecum um 1500, das niemand nach 200 Jahren im kalten Preußen widerlegen musste. Doch nicht zuerst aus ethischer Leidenschaft: aus Tatenlosigkeit, kronprinzlicher Langeweile ist der „Anti-Macchiavell“ geschrieben, wie sein Verfasser später Voltaire gesteht. Man ist geneigt, seine Leidenschaft für dies pathetisch-zynische Genie als Signum seines Inneren zu überschätzen. Voltaire war für Friedrich nur die Blüte eines Geistes, einer Sprache, in die sich notwendig versenken musste, wer um 1740 Geist besaß.
Den Prinzen schützte vor Überwucherung des Literarischen sein Temperament, auf der Lauer.
Kredo des 27jährigen: „Ich fange endlich an, die Morgenröte eines Tages aufdämmern zu sehen, der meinem Auge noch nicht voll leuchtet.“ Ein andermal: „Es soll doch eine Lust sein, ganz allein in Preußen König zu sein!“
Mit 17 ein durch Zwang dämonischer, mit 27 ein durch Zwang platonischer Mensch. Die Synthese war ein König.
König Friedrich II.
Nun endlich, frei von jeder Nötigung, brach Leidenschaft sich Bahn. Ins Erotische konnte sie sich nicht wenden: „Ich liebe das weibliche Geschlecht, aber meine Liebe zu ihm ist eine sehr flüchtige. Ich suche nur den Genuss, und hernach veracht' ich es.“ Sie wurde Ehrgeiz, wurde Ruhmsucht. Dieser Mann wird von der Gloire erfasst und hingerissen.
Karl VI.
Wenige Monate ist er König: und schon benutzt er den ersten Anlass, Karls VI. Tod, um alte Forderungen auf Schlesien zu erheben.
Kaum ahnt er, was er tut, – was ganz Europa toll nennt: „Ich denke meinen Schlag am 8. Dezember auszuführen und damit die kühnste, durchschlagendste und größte Unternehmung zu beginnen, deren sich jemals ein Fürst meines Hauses unterfing.“ An den Freund Jordan: „Mein Alter, das Feuer meiner Leidenschaft, die Sucht nach Ruhm, ja Neugier selbst, um dir nichts zu verschweigen, kurz, ein geheimer Instinkt hat mich aus der süßen Ruhe gerissen, und die Genugtuung, meinen Namen in den Zeitungen und dann im Buch der Geschichte zu sehen, hat mich verführt.“ Dies ist Friedrich, der von sich sagte, er könne sich einer Sache nicht halb ergeben, „ich muss immer kopfüber hinein“.
Auf dem Kampfplatz erschrickt er vor dem, was er gewagt. Vor seiner ersten Schlacht, bei Mollwitz, ist er geflohn und erst nach 16 Stunden wieder erschienen, als alles vorbei und gewonnen war, er war noch kein Feldherr.
Schlacht bei Mollwitz
Ein Schlachtenheld, einer, der die Schlacht als Steigerung liebte wie Napoleon, ist Friedrich nie geworden. Er hasste die Jagd und liebte den Tanz. Zu jener Zeit war er so wild, wie ein Kalender ihn darstellt, der ihn dem Rasenden Roland verglich. Alles sprengte durch. Die Macht, die endlich seine Faust umspannte, war er gesonnen, gründlich zu genießen.
Am Tag, in der Stunde der Thronbesteigung hatte er sich bereits als Autokrat erwiesen; der alte Dessauer fuhr zusammen.
Leopold von Anhalt-Dessau
Friedrich war tolerant, doch hasste er die Menge. Kanaille, das war das Wort, das der aufgeklärte König gern gebrauchte. Eine burleske Leutseligkeit machte ihn spät populär. Er liebte nur seine Soldaten und seine Hunde.
Zwei überstürzten Kriegen folgte ein Jahrzehnt der Ruhe. In Sanssouci wurde Friedrich zum Fürsten.
Schloss Sanssouci
„Wenn Sie hierherkommen,“ schrieb er Voltaire, „so sollen Sie an der Spitze meiner Titel stehen: Friedrich, König von Preußen, Kurfürst von Brandenburg, Besitzer von Voltaire.“ Besitzer? Dies ist symbolisch, doch sicher nicht schön. Er sammelte Philosophen um sich, wie einst sein Vater lange Kerle gesammelt hatte: als Liebhaber, doch nicht als Philosoph. Das war so auffallend nicht. Gab es damals nicht Philosophen, die Gesandte waren, und Fürsten, die über die Freiheit des Willens schrieben? „Ein Mensch, der die Wissenschaften pflegt und ohne Freundschaften lebt, ist ein gelehrter Werwolf. Nach meiner Ansicht ist die Freundschaft zu unserem Glück unerlässlich.“ Niemand lebte geselliger als er, – als „Philosoph von Sanssouci“ hätte er einsam leben müssen.
Freilich glich dieser Hof durchaus nicht dem in Rheinsberg. Nun war Friedrich der König, nun hatte er Macht vor sich, Ruhm hinter sich, nun hatte er Freiheit und Geld, nun war er – Herr, hochgebildet, genial – gerüstet, einen Fürsten großen Stils darzustellen. Alles, was nicht den Staat betraf, betrieb er als Liebhaber mit den anderen im geselligen Stil des Rokoko: Briefe, Memoiren, Essays, das Flötenblasen selbst, das ihn zuweilen, wie er berichtet, zu neuen Gedanken angeregt, indem er es promenierend übte.
Dieser Autor lief sich selber nach: schon 1746 schrieb er die Geschichte seines zweiten Krieges, der 45 geendet hatte. Doch da er allmählich ein größerer Feldherr wurde als ein Skribent, kam seine Feder nicht mit. Als Weltmann schrieb er Französisch, jedoch so unorthographisch wie Deutsch, und nicht nur die Rechtschreibung mussten Sekretäre ihm verbessern. Seine berühmten Worte sind fast durchweg deutsch gesprochen worden. Die deutschen Marginalien enthalten eine sehr ungewollt preußische Philosophie.
Doch Zeichen wunderbarer Reife sammeln sich allenthalben. Er errichtet eine Gruft für sich, überbaut sie mit einem schlanken Sockel, auf dem eine marmorne Flora ruht. Zu diesem Wahrzeichen von Tod und Leben blickt er täglich vom Fenster hinüber.
Kredo des 35jährigen Märkers: „Ich liebe den Krieg um des Ruhmes willen, aber wenn ich nicht Fürst wäre, würde ich nur Philosoph sein. Schließlich muss in dieser Welt jeder sein Handwerk treiben.“
Erst die schweren Folgen seiner ersten leichtsinnigen Unternehmung reiften den König. Nun erst, in dem Krieg von sieben Jahren, gewannen seine Gaben ihre höchste Form. Die großen Gefahren steigen auf, die tiefen Depressionen, die ihn klärten. Gleich im ersten Kriegsjahr hat er mehr Verse in 3 Monaten geschrieben als je im ganzen Jahr; so viel Entlastung brauchte seine Seele. Er gab sich auf (nach Kunersdorf), Thron und Leben gab er verloren und redete schon den Neffen als König an. Im Getümmel der Schlacht hatte er gerufen: „Gibt es keine verwünschte Kugel für mich!“ Und nach Kolin, der einzigen Schlacht, in der Friedrich den Degen gezogen, sagte er zum jungen Grafen von Anhalt: „Wissen Sie nicht, dass jeder Mensch seine Schicksalsschläge haben muss?“
Berlin, Potsdam, Sanssouci fällt in die Hand der Feinde, der König konnte nicht wissen, wie klug sich diese dort verhalten würden. Dies waren, trotz aller Strenge der Jugend, zum ersten Mal Schläge eines Geschickes, das der eigene Dämon herbeigerufen. Da sich lawinenartig nun vergrößert, was er einst selber ins Rollen gebracht, wird Friedrich immer strenger, pflichtbewusster. Seines Vaters einst gehasste Züge werden in seiner Seele sichtbar. Sollte er gefangen werden, so verbietet er, irgendwelche Entschädigung für ihn zu zahlen. Er fürchtet nicht den Tod, nur den Schmerz: „Der Schmerz ein Säkulum, der Tod ein Augenblick.“ Nun wird es ihm mit einem Mal klar, dass er nicht zur „Klasse der Betrachtenden“ gehöre: „Es scheint“, schreibt er 50jährig an d'Argens, „dass wir viel mehr zum Handeln als zum Denken geschaffen sind.“ Es scheint.
Ermüdet kehrt der Siegreiche heim.
Kredo des 55jährigen: „Ruhm ist eitel. Verdienten Menschen je eine Lobrede? Man hat sie nur gerühmt, weil sie Lärm gemacht haben.“
* * *